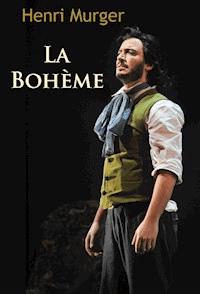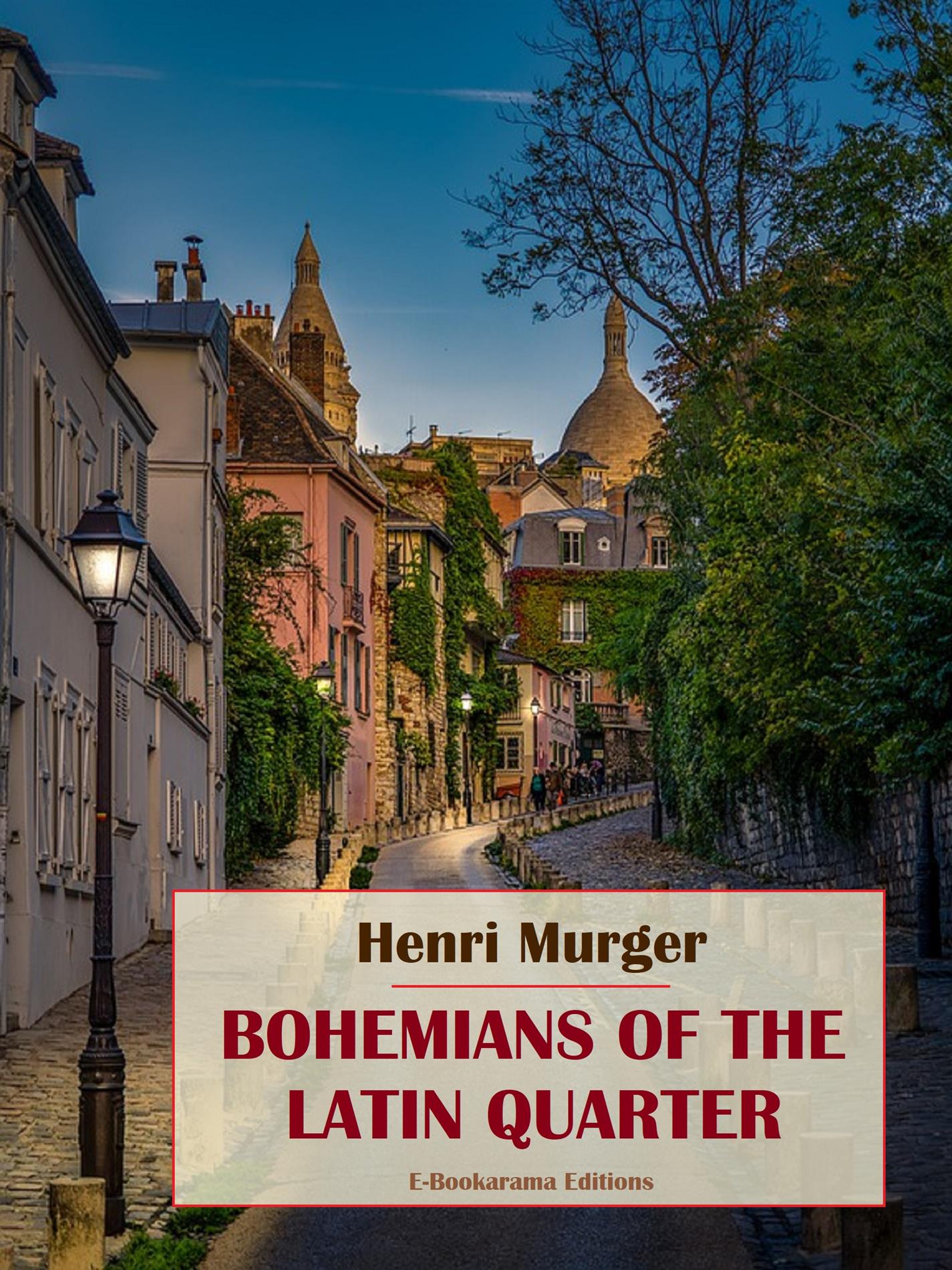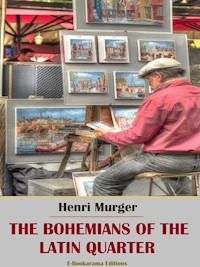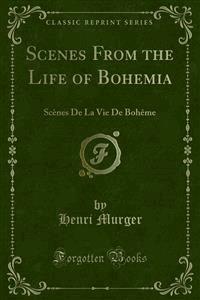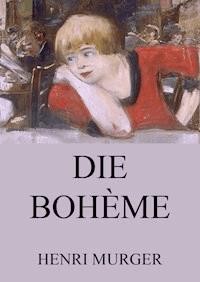
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman "Die Bohème" bildete die Grundlage zu Puccinis gleichnamiger Oper und spielt im bürgerlichen Frankreich des 19. Jahrhunderts.
Das E-Book Die Bohème wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Bohème
Henri Murger
Inhalt:
Henri Murger – Biografie und Bibliografie
Die Bohème
Vorwort des Verfassers.
Zur Einführung
I. Wie der Zigeunerbund begründet wurde
II. Ein Engel der Vorsehung
III. Die Liebe in der Fastenzeit
IV. Ali Rudolf oder der Türke wider Willen
V. Die Karolingermünze
VI. Fräulein Dudelsack
VII. Der Goldstrom
VIII. Was ein Fünffrankstück kostet.
IX. Das Kap der Stürme
X. Ein Zigeunercafé
XI. Eine Aufnahme in den Zigeunerbund
XII. Das Hochzeitsessen
XIII. Fräulein Mimi
XIV. Geschiedene Ehen
XV. Der Durchzug durch das rote Meer
XVI. Die Kleider der Grazien
XVII. Franziskas Muff
XVIII. Fräulein Dudelsacks Liebeslaunen
XIX. Mimi in Glanz und Seide
XX. Romeo und Julia
XXI. Mimis Ende
XXII. Nur einmal ist man jung
Die Bohème, H. Murger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849632410
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Henri Murger – Biografie und Bibliografie
Franz. Schriftsteller, geb. 24. März 1822 in Paris, hatte mit Not und Entbehrungen zu kämpfen und starb daselbst 28. Jan. 1861 im Hospital, als die öffentliche Aufmerksamkeit sich seinen realistischen Schilderungen des Lebens zuzuwenden begann. Diese erschienen unter dem Titel: »Scènes de la vie de Bohême« (1851; deutsch in Reclams Universal-Bibliothek, 1882), eine durch ihn typisch gewordene Bezeichnung (s. Bohême). Er schilderte darin sich selbst als Rodolphe, den Philosophen Jean Wallon als Colline, Alex. Schanne (der noch lebt) als Schaunard. Ferner: »Le pays latin« (1851), »Scènes de campagne«, »Adeline Protat« (1854), »Le sabot rouge« (1860) u.a. Die beiden ersten, die er mit Barrière und Mousseux dramatisierte, errangen auch auf der Bühne Beifall. Seine Gedichte »Les nuits d'hiver« (1861) sind in schwermütigem und nervösem Tone gehalten und klingen stark an A. de Musset an. Vgl. Delvau, Henri M. et la Bohême (Par. 1866); Maillard, Les derniers Bohêmes. Henri M. et son temps (das. 1874); Ricault d'Héricault, M. et son coin, souvenirs (das. 1896).
Die Bohème
Vorwort des Verfassers.
Die Zigeuner, von denen in diesem Buche die Rede ist, haben gar nichts mit jenem Großstadtgesindel zu tun, aus dem sich unsere Boulevarddramatiker ihre Gauner- und Meuchelmördertypen heraussuchen. Sie gehören auch nicht zu jenen Vagabunden, die auf öffentlichen Plätzen als Bärenführer, Säbelschlucker, Verkäufer von diebessicheren Türverschlüssen, Glücksbudenbesitzer und dergleichen ein ebenso interessantes wie für sie selbst einträgliches Gewerbe betreiben.
Das Zigeunertum, das hier beschrieben wird, ist überhaupt nicht der Gegenwart entsprungen, es hat zu allen Zeiten und an allen Orten bestanden und kann sich einer erlauchten Herkunft rühmen. Schon im alten Griechenland – um nicht weiter in die Vergangenheit hinabzusteigen – gab es einen berühmten Zigeuner, der auf gutes Glück die blühende jonische Landschaft durchstreifte, von Almosen lebte und des Abends die Leier, zu deren Klang er die Liebesabenteuer der Helena und den Fall Trojas besungen hatte, an irgendeinem gastlichen Herde aufhing. Auch später finden wir die Vorgänger der modernen Zigeuner in allen Epochen der Kunst und Literatur. Im Mittelalter sind es die fahrenden Schüler, die Troubadoure und Minnesänger, die mit Felleisen und Harfe durch das Land zogen, die die blühende Tourraine mit ihrem heiteren Gesang erfüllten und um die goldene Rose in den Blumenspielen der Clemence Isaure kämpften.
Auch in der Zeit des Übergangs zur Renaissance fährt das Zigeunertum fort, die Straßen Frankreichs und sogar schon etwas die der Stadt Paris zu durchschweifen, da ist vor allen Meister Pierre Gringoire, der Freund der fahrenden Bettler und Feind der Enthaltsamkeit. Mager und ausgehungert, wie es nur ein Mensch sein kann, dessen ganzes Leben nichts als eine ewige Fastenzeit ist, schlendert er durch die Straßen der Stadt, die Nase in der Luft wie ein Jagdhund, und schnüffelt nach den Gerüchen der Speisehäuser und Garküchen. Vor seinem gierig brennenden Blick scheinen die Schinken, die an den Haken der Schlächter hängen, zusammenzuschrumpfen, während er im Geiste – aber leider nicht in den Taschen – die zehn Taler klimpern läßt, die ihm die Herrn Schöffen für den ›sehr andächtigen und sehr erbaulichen Schwank‹ versprochen haben, den er für das Theater im Saale des Gerichtshauses dichtete. Neben diesem schmerzerfüllten und melancholischen Antlitz des Geliebten der Esmeralda kann die Chronik des Zigeunertums ein weniger abgezehrtes und lebensfroheres Gesicht heraufbeschwören, das des Meisters François Villon, des Geliebten jener Schönen, ›die eine Dirne war‹. Poet und Vagabund im echtesten Sinne der Worte war dieser Mann, dessen Verse, wohl infolge eines inneren Vorgefühls, eine merkwürdige Angst vor dem Galgen widerspiegeln. Und er entging ja auch dem Schicksal, eines Tages wegen eines Münzverbrechens daran aufgeknüpft zu werden, nur mit genauer Not. Dabei hat dieser selbe Villon, der mehr als einmal die ihm auf den Fersen befindliche Polizei außer Atem zu setzen wußte, dieser lärmende Gast in den Absteigequartieren der Rue Pierre-Lescot, dieser Schmarotzer am Hofe des Zigeunerherzogs, dieser Salvator Rosa der Poesie, Elegien von so mitreißender und echter Empfindung gedichtet, daß selbst die Hartherzigsten davon erschüttert werden und den Straßenräuber, den Vagabunden und Wüstling vergessen vor den göttlichen Tränen dieser Muse.
Übrigens hat von allen, deren Werke eine Zeit nicht mehr liest, die die französische Literatur erst mit Malherbe beginnen läßt, François Villon wohl die Ehre gehabt, am meisten durch bekannte Literaten, besonders auch durch die großen Bonzen des modernen Parnasses, ausgeplündert zu werden. Sie haben sich alle auf den Garten dieses Armen gestürzt und Münzen des Ruhms aus seinem verborgenen Schatz geschlagen. Manche Ballade, die der heimatlose Rhapsode an einem frostigen Tage neben einem Meilenstein auf der Landstraße oder unter der Dachtraufe schrieb, manches Liebeslied, das er in der Spelunke improvisierte, in der die Schöne, ›die eine Dirne war‹, jedem, der vorbeikam, ihren goldenen Gürtel löste, sie zieren heute, zu einem von Moschus und Ambra duftenden Liebesgetändel umgeformt, das wappengeschmückte Poesiealbum einer aristokratischen Chloris.
Aber nun taucht das große Jahrhundert der Renaissance auf. Michel Angelo ersteigt das Gerüst der Sixtinischen Kapelle und betrachtet nachdenklich den jungen Raffael, der auf der Treppe zum Vatikan erscheint mit den Kartons der Loggien unter dem Arm. Benvenuto ersinnt seinen Perseus, Ghiberti ziseliert die Türen des Baptisteriums zu der gleichen Zeit, in der Donatello seine Mamorstatuen auf der Arnobrücke aufstellt, und während die Stadt der Medizäer an Meisterwerken mit der Stadt Leos X. und Julius II. wetteifert, schmücken Tizian und Paolo Veronese die Stadt der Dogen, kämpft St. Markus mit St. Peter. Diese fieberhafte Genialität, die mit der Heftigkeit einer Epidemie plötzlich auf der italienischen Halbinsel ausbricht, breitet seine ansteckende Glorie über ganz Europa aus. Die Kunst, diese Nebenbuhlerin Gottes, erlangt königliche Würde. Karl V. bückt sich, um Tizian den Pinsel aufzuheben, und Franz I. wartet im Vorzimmer der Druckerei, in der Etienne Dolet vielleicht gerade die Korrekturbogen des ›Pantagruel‹ las.
Inmitten dieser Wiedergeburt des Geistes fährt das Zigeunertum in alter Weise fort, um einen Ausdruck Balzacs zu gebrauchen, sich Brot und Obdach zu suchen. Clement Marot setzt sich in den Vorzimmern des Louvre fest und wird, bevor die schöne Diane selbst die Favoritin eines Königs wurde, der Favorit jener Dame, die mit ihrem Lächeln drei Regierungen erhellte. Von dem Boudoir der Diane von Poitiers fliegt die ungetreue Muse des Poeten nach dem der Marguerite von Valois, welche gefährliche Gunst Marot mit dem Gefängnis büßen mußte. Fast Zu derselben Zeit kam ein anderer Zigeuner, dessen Jugend am Gestade von Sorrento den Kuß der epischen Muse empfing, Tasso, an den Hof des Herzogs von Ferrara, so wie Marot an den Franz' I. kam. Aber weniger glücklich als der Geliebte der Diane und der Marguerite büßte der Dichter des ›Befreiten Jerusalem‹ die Kühnheit seiner Liebe zu einer Tochter des Hauses Este mit dem Verlust seiner Vernunft und seines Genies.
Die religiösen und politischen Kämpfe, die die Ankunft der Medici in Frankreich begleiten, halten den Höhenflug der Kunst in keiner Weise auf. Zu der Zeit, da Jean Goujon, der die heidnische Kunst des Phidias wieder aufnahm, auf der Place des Innocents von einer Kugel getroffen wurde, fand Ronsard die Dichtung des Pindar wieder und gründete, unterstützt von seiner Plejade, die große Schule der französischen Lyrik. Dieser Schule des Erwachens folgte die Reaktion Malherbes und seiner Anhänger, die aus der Sprache alle fremden Grazien verbannten, welche ihre Vorgänger auf dem Parnaß heimisch zu machen versucht hatten. Und es war ein Zigeuner, Mathurin Régnier, der als einer der letzten die Bollwerke der lyrischen Poesie verteidigte gegen die Phalanx jener Rhetoren und Grammatiker, die Rabelais für barbarisch und Montaigne für dunkel erklärten. Es war dieser selbe Mathurin Régnier, der Zyniker, der neue Knoten in die satirische Geißel des Horaz knüpfte und beim Anblick des Sittenverfalls seiner Zeit ausrief:
›Die Ehre ist ein Gott, dem niemand Opfer bringt.‹
Aus dem siebzehnten Jahrhundert gehört eine Reihe von Namen aus dem Literaturkreis der Epochen Ludwigs XIII. und Ludwigs XIV. zum Zigeunertum. Es hat seine Mitglieder unter den Schöngeistern des Hotel Rambouillet, wo es Beiträge zu ›Juliens Blumenstrauß‹ liefert. Es findet Zutritt zum Palais Cardinal, wo es mit dem Ministerdichter, dem Robespierre der Monarchie, an seiner Tragödie ›Marianne‹ arbeitet. Es bestreut das Schlafzimmer der Marion Delorme mit Madrigalen und huldigt Ninon unter den Bäumen der Place Royale. Das Zigeunertum frühstückt des Morgens in der Schenke der ›Schlemmer‹ oder in der des ›Königsschwerts‹ und speist des Abends am Tische des Herzogs de Joyeuse. Es schlägt sich sogar beim Licht der Straßenlaternen für das Sonett der Urania gegen das Sonett des Hiob. Das Zigeunertum befaßt sich mit Liebe, mit Krieg und selbst mit Diplomatie, und, da es alt geworden, bringt es, müde der Abenteuer, das Alte und das Neue Testament in Verse, bewirbt sich um alle frommen Stiftungen und besteigt endlich, wohlgenährt durch fette Pfründe, einen Bischofssitz oder einen Sessel jener Akademie, die ja auch von einem Zigeuner begründet ist.
Es war beim Übergang vom sechzehnten zum siebzehnten Jahrhundert, als die beiden stolzen Genies aufstanden, die die beiden Länder, in denen sie lebten, wenn sie um ihren literarischen Vorrang kämpfen, immer wieder eins dem andern gegenüberstellen: Molière und Shakespeare, diese berühmten Zigeuner, deren Schicksale nur allzu viele Vergleichspunkte bieten.
Ebenso finden sich die berühmtesten Namen der Literatur des achtzehnten Jahrhunderts in den Archiven des Zigeunertums, darunter die Unsterblichen dieser Epoche, Jean Jaques Rousseau und d'Alembert, der Findling vom Vorplatz der Notre-Dame-Kirche. Ferner unter den weniger bekannten Malfilâtre und Gilbert, die überschätzt worden sind, denn das Feuer des einen war nur ein matter Abglanz des bleichen Lyrismus Jean Baptiste Rousseaus, und das Feuer des andern nur eine Mischung ohnmächtigen Stolzes mit einem Hasse, der nicht einmal die Entschuldigung der Echtheit und Aufrichtigkeit aufweisen kann, da er nur die bezahlte Masse der Ränke und Feindschaften einer Partei war.
Mit dieser Epoche wollen wir die flüchtige Übersicht über das Zigeunertum in den verschiedenen Zeiten schließen. Wir haben diese mit berühmten Namen durchsetzte Vorrede absichtlich an die Spitze dieses Buches gesetzt, um den Leser vor jeder falschen Vorstellung bei dem Wort Zigeunertum zu bewahren, weil man diesen Namen seit langem auch Bevölkerungsklassen zulegt, mit denen diejenigen, deren Sitten und Sprache in diesem Buche geschildert werden, nichts zu tun haben wollen.
Heute wie früher wird jeder Mann, der sich der Kunst widmen will, wenn er sonst keine Existenzmittel hat, als die ihm aus der Kunst zufließenden, gezwungen sein, die Wege des Zigeunertums zu gehen. Die meisten der jetzt lebenden berühmten Künstler sind Zigeuner gewesen, und in ihrem sicheren und glänzenden Ruhm erinnern sie sich oft, vielleicht sogar mit Bedauern, jener Zeit, da sie in der blühenden Jugend ihrer zwanzig Jahre kein anderes Vermögen hatten als ihren Mut, diese Tugend der Jungen, und die Hoffnung, diesen unerschöpflichen Schatz der Armen.
Wir wiederholen also noch einmal zur Beruhigung des besorgten Lesers, des ängstlichen braven Bürgers und überhaupt aller, die alles genau definiert haben wollen, in Form eines Axioms:
»Das Zigeunertum ist die Lehrzeit des Künstlers. Es ist die Vorstufe zu den akademischen Würden oder auch zum Hospital und zur Morgue.«
Und wir fügen hinzu, daß es nur in Paris ein Zigeunertum gibt, und daß es nur dort möglich ist.
Wie jede Gesellschaftsklasse zeigt auch das Zigeunertum verschiedene Abstufungen, die sich noch in einzelne Spielarten zerteilen, so daß es gut ist, ihre unterscheidenden Merkmale festzustellen.
Wir beginnen mit der zahlreichsten Klasse, der der Unbekannten. Sie umfaßt die große Familie der armen Künstler, die ein verhängnisvolles Schicksal dazu verdammt hat, inkognito dahinzuleben, die vergebens nach einem Fleckchen in der Öffentlichkeit suchen, wo sie sich und ihr künstlerisches Vermögen zeigen könnten. Sie sind das Geschlecht der ewigen Träumer, denen die Kunst kein Handwerk, sondern eine Religion ist. Sie sind die Enthusiasten, die wahrhaft Gläubigen, die beim Anblick eines großen Kunstwerks erglühen und mit klopfendem Herzen vor allem Schönen stehen, ohne nach dem Namen des Künstlers und seiner Schule zu fragen. Diese Art Zigeunertum ergänzt sich aus jungen Leuten, die, wie man sagt, zu Hoffnungen berechtigen, und aus solchen, die diese Hoffnungen schon erfüllt haben, dann aber aus Gleichgültigkeit, Scheu oder Unkenntnis des praktischen Lebens glauben, mit dem Schaffen des Kunstwerks sei alles getan und die Anerkennung des Publikums sowie der Reichtum würden jetzt von selbst über sie herabströmen. So leben sie am Rande des öffentlichen Lebens, vereinsamt und untätig. Wie versteinert in ihrer Kunst nehmen sie die Symbole der akademischen Dithyrambe, die eine Aureole um die Stirn der Dichter legen, wörtlich und, überzeugt, daß sie einst auch das Dunkel ihres Lebens erhellen werde, warten sie ruhig, daß man zu ihnen komme. Wir haben seinerzeit eine kleine Schule solcher Typen gekannt, die so seltsam waren, daß man kaum an ihr Dasein glauben wollte. Sie nannten sich die Schüler des › l'art pour l'art‹. Diese ›Kunst um ihrer selbst willen‹ bestand nach der Ansicht dieser Naiven darin, daß man sich gegenseitig in den Himmel erhob, daß man dem Zufall, der nicht einmal ihre Namen kannte, in keiner Weise zu Hilfe kam und abwartete, bis sich das Piedestal ihres Ruhms ihnen von selbst unter die Füße schob.
Man sieht, dieser Stoizismus grenzt an das Lächerliche, aber wir versichern noch einmal, um keinen Zweifel daran zu lassen, daß es im Schoße des verkannten Zigeunertums wirklich solche Typen gibt, deren Elend entschieden unser Mitgefühl erregen würde, wenn uns nicht der gesunde Menschenverstand veranlaßte, wieder davon abzustehen. Denn wenn wir sie ruhig darauf aufmerksam machen, daß wir nun einmal im neunzehnten Jahrhundert leben, wo das Geld regiert und keine blank gewichsten Stiefel vom Himmel fallen, dann drehen sie uns den Rücken und nennen uns Spießbürger.
Im übrigen sind sie in ihrem sinnlosen Heldentum sich selber treu: sie klagen nicht und jammern nicht und ergeben sich widerstandslos dem dunkeln und herben Geschick, das sie sich selbst geschaffen haben. Die meisten sterben an jener Krankheit, die die Wissenschaft nicht beim richtigen Namen zu nennen wagt – am Elend. Und doch könnten viele diesem traurigen Schicksal entgehen, das ihrem Leben zu einer Zeit ein Ende macht, wo im allgemeinen sonst das Leben erst richtig aufblüht. Sie brauchten nur den harten Gesetzen der Notwendigkeit ein paar Zugeständnisse zu machen, indem sie ein Doppelleben begännen und zwei Naturen in sich vereinten: den Dichter, der stets über den Höhen der Menschheit schwebt und dort dem Gesang aus schöneren Welten lauscht, und dem Mann, der in harter Arbeit sich sein tägliches Brot erkämpft. Aber diese Zweiheit, die man immer bei ausgeglichenen Naturen findet und die sogar deren hervorragendes Merkmal sind, sie fehlt den meisten dieser jungen Leute, die ihr Stolz, ihr falscher Stolz, für alle Ratschläge der Vernunft unzugänglich gemacht hat. So sterben sie, vielleicht jung, und hinterlassen manchmal ein Werk, das die Welt zu spät bewundert und das sie vielleicht schon früher gewürdigt hätte, wenn es ihr nur bekanntgeworden.
Es gibt in dem unbekannten Zigeunertum noch eine Unterklasse. Sie besteht aus jungen Leuten, die man getäuscht hat, oder die sich selbst getäuscht haben. Sie halten eine Schwärmerei für ein Berufensein, und getrieben von einem selbstmörderischen Schicksal sterben sie als Opfer ihres Stolzes oder als Sklaven einer Schimäre.
Zu ihnen gehört auch die lächerliche Klasse der Unverstandenen, jener weinerlichen Dichter, deren Muse immer mit rotgeweinten Augen und schlecht gekämmtem Haar herumläuft, und alle die unfähigen Mittelmäßigkeiten, die, weil sie nicht dazu kommen, sich gedruckt zu sehen, die Muse eine Rabenmutter und die Kunst ein Schafott nennen.
Alle wahrhaft starken Geister wissen, daß sie etwas zu sagen haben, und sie sagen es früher oder später. Das Genie und das Talent sind keine Zufälligkeiten im Reiche der Menschheit. Sie erscheinen mit Notwendigkeit und können schon deshalb nicht ewig im Dunkel bleiben. Wenn die Menge ihnen nicht vorangehen will, dann verstehen sie es, der Menge voranzugehen. Das Genie ist wie die Sonne – die ganze Welt sieht es. Das Talent ist wie ein Diamant, der lange im Dunkeln liegen kann, aber immer findet sich einer, der ihn bemerkt. Man tut daher unrecht, wenn man sich von dem Jammern und dem leeren Gerede dieser Klasse von Eindringlingen und Überflüssigen beeinflussen läßt. Sie haben in der Kunst nichts verloren, und sie sind es auch, deren eigentliches Wesen nur aus Faulheit, Ausschweifung und Schmarotzertum besteht.
Schlußfolgerung: »Das Zigeunertum der Verkannten ist kein Weg nach oben, sondern eine Sackgasse.«
In der Tat führt ein solches Leben durchaus zu nichts. Es ist ein verdummendes Elend, in dem der Geist erlischt wie eine Lampe in einem luftleeren Raum und das Herz in wildem Menschenhaß versteint, so daß gerade die besten Naturen am tiefsten sinken. Wer das Unglück hat, zu lange darin zu weilen oder sich zu tief in seine Höhlen zu verirren, der findet nie wieder den Ausweg, denn es gibt hier gefährliche Abwege, die in ein anderes Zigeunertum führen, mit Sitten, die auch vor ein anderes Forum gehören als das der Literaturgeschichte.
Wir haben dann noch eine merkwürdige Abart der Zigeuner zu erwähnen, die man die Liebhaber nennen könnte. Sie sind durchaus nicht uninteressant, für sie hat das Leben der Zigeuner einen verführerischen Reiz. Nicht immer jeden Tag sein Mittagessen zu haben, im Freien zu schlafen, während es in Strömen regnet, im Dezember in einem gelben Nankinanzug herumzulaufen, das scheint ihnen der Gipfel menschlicher Glückseligkeit zu sein, und um es zu genießen, verläßt der eine das wohlgeschützte Vaterhaus, der andere sein Studium, das vor dem glücklichsten Abschluß steht. Sie wenden plötzlich einer ehrenvollen Zukunft den Rücken, um den Abenteuern eines vom Zufall abhängigen Lebens nachzulaufen. Da aber selbst die Kräftigsten eine Lebensweise nicht lange aushalten, bei der eine Herkulesnatur zusammenbrechen würde, so geben sie das Spiel bald wieder auf und kehren reumütig zu den väterlichen Fleischtöpfen zurück. Dann heiraten sie eine Verwandte, lassen sich als Notar in einer Stadt von dreißigtausend Einwohnern nieder, und des Abends am Kamin erzählen sie mit der Genugtuung eines Reisenden, der über eine Tigerjagd plaudert, von ihrem ›Künstlerelend‹. Andere sind hartnäckiger und auch wohl zu stolz, um nachzugeben. Aber sobald sie einmal den Kredit erschöpft haben, den sie als Söhne guter Familien leicht finden, geht es ihnen schlechter als den echten Zigeunern, die außer ihrer Intelligenz niemals andere Hilfsquellen besessen haben. Wir haben selbst einen dieser Zigeuner aus Liebhaberei gekannt, der sich mit seiner Familie überwarf und drei Jahre im Zigeunertum lebte, bis er eines schönen Tages starb und in einem Armenleichenwagen nach dem Armenfriedhof gefahren wurde. Dabei besaß er zehntausend Franken Rente!
Es braucht natürlich nicht erwähnt zu werden, daß diese Art von Zigeunern absolut nichts mit der Kunst zu tun hat und in diesem Milieu das allerunbeachtetste Dasein führt.
Aber jetzt kommen wir zum echten Zigeunertum, zu demjenigen, das in diesem Buche ja zum Teil geschildert wird. Zu ihm gehören die wahrhaft Berufenen der Kunst und mitunter auch die Auserwählten. Auch dieses Zigeunertum starrt von Gefahren, und zwei Abgründe umgeben es rechts und links: das Elend und der Zweifel. Aber es gibt wenigstens zwischen diesen beiden Schlünden einen Weg zum Ziel, das die Zigeuner mit ihren Blicken erreichen können, ehe sie es mit den Händen erfassen.
Man nennt es das offizielle Zigeunertum, weil die dazu Gehörenden mit ihrem Namen schon irgendwie in die Öffentlichkeit gedrungen und so in dem offiziellen Register der Kunst eingetragen sind. Ihre literarischen und künstlerischen Erzeugnisse kommen auf den Markt und finden dort, allerdings zu sehr mäßigen Preisen, ihre Abnehmer. Um das Ziel zu erreichen, das sie sich gesetzt haben, sind ihnen alle Wege recht, und sie wissen aus allen Zufälligkeiten ihres Lebens Nutzen zu ziehen. Regen oder Trockenheit, Dunkel oder Sonnenschein, nichts hält diese verwegenen Abenteurer auf, die bei allen Fehlern eine große Tugend haben. Ihr Geist wird nämlich immer durch ihren Ehrgeiz wachgehalten, und dieser Geist geht ihnen wie ein Trommler voraus und treibt sie an, die Zukunft im Sturm zu erobern. Immer im Kampf mit der harten Not des Tages, sprengen sie mit stets bereiter Lunte jedes Hindernis, kaum daß es vor ihnen aufgetaucht ist. Wie sie sich jeden Tag ihr Brot verschaffen, das ist eine Arbeit des Genies, ein immer neues Problem, das sie mit tollkühner Strategie lösen. Diese Leute verstehen es, sich von dem geizigsten Harpagon Geld zu leihen, und sie würden als Schiffbrüchige auf einem Floß Trüffeln entdecken. Im Notfall wissen sie zu fasten wie der tugendhafteste Anachoret, fällt ihnen aber eine größere Geldsumme in die Finger, dann ergeben sie sich den ausschweifendsten Phantasien, holen sich die schönsten und jüngsten Mädchen, trinken den besten und ältesten Wein und finden überhaupt nicht genügend Fenster, um ihr Geld hinauszuwerfen. Ist dann schließlich das letzte Silberstück tot und begraben, dann kehren sie wieder zu der Tafel des Zufalls zurück, die für alle gedeckt ist, und mit einer ganzen Meute von listigen Einfällen durchjagen sie vom Morgen bis zum Abend alle Gewerbe, die irgend etwas mit der Kunst zu tun haben, um jenes edle Wild zu erlegen, das man ein Fünffrankstück nennt.
Diese Zigeuner kennen alles und gehen überall hin, je nachdem sie gerade Lackschuhe oder zerrissene Stiefel haben. Man findet sie heute vor den eleganten Kaminen eines mondänen Salons und morgen unter den Gewölben einer verrufenen Tanzschenke. Sie können keine zehn Schritte über den Boulevard gehen, ohne einen Freund zu treffen, und keine dreißig, ohne einem Gläubiger zu begegnen.
Die Zigeuner haben ihre eigene Sprache, die aus dem Ateliergeplauder, dem Bühnenjargon und den Debatten auf den Redaktionen entstanden ist. Alle Stilblüten geben sich in diesem unerhörten Idiom ihr Rendezvous, apokalyptische Wendungen neben geschmackloser Komik, Alltagsausdrücke neben gewagten, dichterischen Perioden. Es ist ein geistvolles Rotwelsch, das allen denen unverständlich ist, die nicht den Schlüssel dazu haben, und das an gewagten Redewendungen auch die freieste Sprache übertrifft. Das Wörterbuch des Zigeunertums ist die Hölle der akademischen Redekunst und ein Paradies für die Freunde neuer Wortbildungen. Dieses ist, in kurzen Worten gesagt, das Zigeunerleben. Es ist wenig gekannt von den Puritanern der Gesellschaft, verschrien bei den Puritanern der Kunst, und es wird beschimpft von all den ängstlichen und neidischen Mittelmäßigkeiten, die doch nicht genug Lungenkraft, Lügen und Verleumdungen haben, um die Stimmen und Namen derjenigen zu ersticken, die aus diesem Vorsaal des Ruhms heraustreten, indem sie vor ihr Talent ihren Mut spannen. Es ist ein Leben der Geduld und der Kühnheit, wo man sich auch im Kampf mit der Dummheit und dem Neid in den festen Panzer der Gleichgültigkeit stecken muß. Wo man, um nicht auf dem Wege zu straucheln, keinen Augenblick den Stolz auf sich selbst verlieren darf, diesen ausgezeichneten Wanderstab. Ein wundervolles Leben und ein schreckliches Leben, das seine Sieger und seine Märtyrer hat, und in das nur der eintreten darf, der sich von vornherein dem unerbittlichen Gesetz des vae victis unterwirft.
1851.
H. M.
Zur Einführung
Wie ein Stück Frühling über Paris ist dieser Roman jung geblieben, wie ein Zipfel eines blauen Maimorgens über der allen Künsten zugeneigten Stadt an der Seine, wenn die Kastanienbäume auf den Boulevards im ersten zarten, goldenen Grün stehen, wenn die frisch geweißten Dampfer auf dem Fluß zu Ausflügen nach Sèvres, Auteuil und Charenton locken, wenn draußen in Versailles die Brunnen springen, und wenn aus den vielen buschigen Plätzen und Gärten mitten in der Stadt in die Hupen der Kraftwagen die Nachtigallen ihren ewigen Aufruf für die Menschen flöten: »Liebt euch! Liebt euch!«
Besonders der köstliche Anfang dieser Folge von Szenen, die zu einem Roman zusammengewachsen sind wie eine Reihe von Blumen zu einem Strauß, duftet frisch wie erste Rosen noch in die Gegenwart hinein. Untermischt freilich, wie fast alles, was Murger geschrieben hat, mit einem Hauch, der nach Vergänglichkeit riecht. »Sie ist vorbei, die Blütezeit der Bohème!« stellt ein jedes Geschlecht mehr oder weniger klagevoll fest, wenn es altert und die lockern Zügel der Jugend den Neuen reicht, die natürlich in ihren Augen viel zu ernst sind, um sich noch wie sie freuen zu können. »Wir haben als junge Burschen bei Kahnfahrten auf der Seine gelacht, wie heutzutage nicht mehr gelacht wird«, schrieb Maupassant, der Dichter des Romans vom »Schönen Freund«, diesem gewissenlosen Weiberhelden, an einen seiner Schulfreunde. Ach, schreibt nicht das Alter stets so frohlockend über die Tage der eigenen Jugendzeit und stets so wehmütig krittlig über das neue Geschlecht, das heraufrückt und sich an die Ruderbänke setzt? Der Alternde vergißt in seinem berechtigten Groll über seine dahingeschwundene Schönheit und Kraft, daß die Jugend unsterblich ist wie die Bohème, das Zigeunerleben der jungen Männer und Künstler in den großen Städten. Gewiß! Es mag im lateinischen Viertel von Paris und oben auf dem Montmartre nicht ganz mehr so behaglich und verbrüdert zugehen, wie es Murger beschrieben hat. Beklagt er doch selber schon in seiner »Bohème« gegen Ende den Rückgang der alten Fröhlichkeit und Vertraulichkeit in einer Zeit, wo aus der munteren anspruchslosen Grisette, wie er sie in »Mimi« und »Musette« geschildert hat, die Lorette geworden ist, »ein Zwittergeschlecht von frechen Geschöpfen«, wie er selber sagt, »halb aus Fleisch und halb aus Schönheitsmitteln, ein Geschlecht, deren Wohnung ein Zahlzimmer ist, in dem sie Stücke von ihrem Herzen feilhalten, wie man Rostbeefschnitten feilhält«. Was würde der Dichter der »Musette« erst über die »Cocotte« geschrieben haben, die auf die Lorette des französischen Kaisertums gefolgt ist, über jenes kalte, nur mehr berechnende Geschlecht käuflicher Weiber, die heute die Boulevards des veramerikanisierten Paris bevölkern!
Und doch gibt es wahrscheinlich dort, in dieser Stadt des Leichtsinns und der »joie de vivre«, die noch ein so ernster Künstler wie Zola gefeiert hat, auch heute noch »Mimis« und »Musettes«, die einen Vicomte um eines jungen Dichters oder Malers willen verlassen und einen kalten Winter lang oder zwei, nur von Liebe durchwärmt, bei ihrem Liebsten aushalten? Die Bohemiens, deren Name Murger für das Künstlervölkchen, wie wir im Deutschen es nennen, erfunden hat, haben ja eine Mitgift, um die man jede Not und Entbehrung erträgt: eine unverwüstliche, unbezahlbare Heiterkeit. Die Bohème, das Kunstzigeunertum, ist darum recht eigentlich eine Sache der Jugend und wird es ewig bleiben. Ein alter Bohemien ist ein Unding, ein Wesen, das sich selbst überlebt hat und eigentlich nicht mehr Daseinsberechtigung besitzt. Das erkannte schon Murger, der den Namen für sie, nicht etwa den Begriff erfunden hat – denn »Bohemiens« sind schon Homer und Li-Tai-Pe gewesen – und läßt darum gegen den Schluß seiner Szenen seine früheren Kunstzigeuner sich mit ihrer Jugend oratorisch selber zu Grabe tragen. »Wir können nicht länger mehr dies uns einförmig und nutzlos gewordene Landstreicherleben neben der Gesellschaft, beinahe neben dem Leben fortführen«, stellt der Maler als Stimmrohr seines Schöpfers fest. »Du hast recht«, muß ihm der Dichter seufzend erwidern. Und dieser Seufzer lautet ausgeschrieben: »Wir würden sonst sentimental werden.«
Ein wenig ins Sentimentale, ins Gefühlsselige, das kraftlos alte vergangene schönere Zeiten bejammert, rückt bereits auch dieser Roman von der »Bohème« gegen sein Ende, das uns etwas rührsam den Abschied und den Tod Mimis ausmalt, die, eine Vorläuferin der empfindsamen »Cameliendame«, im Spital an der Schwindsucht erlischt. »Ihre letzten Seiten erinnern an den Blätterfall im Herbst, dies regelmäßige erschütternde Sterbeereignis, das ich gestern im Luxembourggarten mit Ihrem Roman auf einer Bank in einem Seitengang genossen habe«, schrieb der Dichter Musset an Murger, nachdem er das Buch von der Bohème ganz dicht bei der Stelle gelesen hatte, wo heute ein Denkmal Murgers unfern der Fontaine de Médicis emporragt. Und in der Tat muten diese letzten Blätter der Szenen uns auch heute noch vergilbter und welker an als die immergrünen, mit denen er mit der Begründung des Bohèmebundes anhebt. Wenn Ausgelassenheit und Jugendübermut die eine Seite des Künstlerzigeunertums ausmachen, so steht auf der andern Seite diesen Tugenden mit Recht ein ebenso kecker Stolz entgegen. Ein rechter Bohemien kann wohl die Reichen, die Seßhaften, die Bürger, auf denen er lebt und die er, nicht zu vergessen, mit seinen Scherzen unterhält und mitergötzt, gelegentlich anpumpen. Aber er wird darum nie ein berufsmäßiger Schnorrer sein. Im Gegenteil, zu einem wahren Bohèmetum gehört die stolze Verschwendung als notwendige Begleitung. Der junge Bohemienmaler, der ein Bild »verkloppt«, der angehende Dichter, der einen Zeitungsaufsatz an irgendein Modeblatt wie »Die Schärpe der Iris« im Künstlerkauderwelsch »verklitscht«, sie denken nicht daran, das Geld auf Zinsen zu legen oder Staatsanleihen davon zu kaufen. Sie schmeißen das mühsam Erworbene sofort wieder aufs freigebigste hinaus. Ja, noch mehr, sie laden sich sofort ihre Genossen und Kumpane, ja oft sogar noch ein paar Spießer als Füllsel ein, um ihren Verdienst schleunigst wieder zu verhauen. Ganz mit Recht verweilt Murger ausführlicher bei diesem Künstlerstolz, als er die umständliche und schwierige Aufnahme des braven Hauslehrers Carolus Barbemuche in das Reich der Bohème schildert, in das nur derjenige auf die Dauer eingelassen wird, der von seiner Natur aus einen Paß für diese Zigeunerwelt bekommen hat, für dies »Böhmen«, das zwischen den Kasten und Klassen und außerhalb der Gesellschaft liegt. Man kann nicht so ohne weiteres ein Bohemien werden. Es gehört eine ganz bestimmte Begabung dazu. Und wer sie, diese göttliche Leichtigkeit, nicht besitzt, der kann sich wohl in den unförmlichen unfeierlichen Orden der Bohème aufnehmen lassen, aber er wird dort nie Heimatsrecht erwerben. Folgerichtig scheidet drum der Außenseiter Barbemuche am frühesten und wie von selbst aus der unsichtbaren Gemeinde der Bohemiens aus, in die er eigentlich nur als Gast eingetreten war. Die andern, die echten Bohemiens, schleichen erst viel später ins Spießbürgertum, ins Philistertum, um sich, so gut es gehen mag, den seriösen Leuten anzupassen. Aber die Bohème selber stirbt niemals aus, trotzdem ihr Schöpfer Murger es, zum Schluß grämlich werdend, verkündet hat. Sie wird blühen, solange es eine Kunst und Künstler gibt. Wir in Deutschland kennen sie, wenigstens im Norden, selten, und haben darum noch immer kein rechtes eigenes Wort dafür gebildet. Nur das Studentenleben auf unseren Universitäten und Hochschulen hat manches mit der Bohème gemeinsam, die nach Murgers eigenen Worten nur in Paris besteht und möglich ist. Aber dies unser Studententreiben ist immerhin noch geregelt, lebt auf einem festen Wechsel und hat eine Verfassung wie seinen Komment, eine strenge Verkehrsform, vor der jeder Bohemien, der nicht einmal sich selber Satisfaktion gibt, schaudern würde. Es gibt ja überhaupt zu denken, daß unser Studententum vielfach noch eine Rauf- und Streitlust züchtet, während die Gemeinschaft der Bohemiens – und das ist ihr schönster Zug – vor allem auf die Kameradschaft gegründet ist. Allenfalls in München und seinem Schwabinger Viertel ist etwas der Bohème Verwandtes bei uns erwachsen, wie man auch dort allein in Deutschland einen Kreis oder gar Kreise von Bohemiens finden kann. Auf der Leopoldstraße und zwischen den Häusern ringsum in der Isarstadt können einem wohl auch gegenwärtig noch ähnliche Wesen wie die von Murger hier beschriebenen begegnen. Kerle wie Schaunard, Marcel, Rudolf und Colline, der unserm toten Dichter Peter Hille zum Verwechseln gleicht, Kerle, die ihre Pfeife, ihren Nasenwärmer, kaum zwischen den Lippen hervorziehen, und deren Möbel aus einer Staffelei und ein paar Rahmen oder einem geborgten Flügel bestehen. Und auch Mädchen wie Louise, wie Mimi und Musette können noch an der Isar wie an der Seine und in Wien an der Donau wachsen, Mädchen, die in Musselin und Druckkattun lustiger als die vornehmen Damen herumspazieren und ihre Jugend wie einen Tag im Lenz genießen, und wenn sie sich von ihrem Geliebten trennen, um solide zu werden, scherzend einen Trauerflor um die Abschiedsflasche binden, die man gemeinsam mit dem nunmehrigen »Freund« auf die herrliche Vergangenheit trinkt.
Von dem Dichter der Szenen aus dem Leben der Bohème, von Henri Murger, steht im Konversationslexikon zu lesen, daß er in Paris geboren, in kümmerlichen Verhältnissen dort gelebt habe und am 28. Januar 1861, erst neununddreißig Jahre alt, daselbst gestorben sei. Sie passen gut zu ihm, der die dürftige Glücklichkeit der Bohème besungen hat, diese wenigen Worte, die uns sein ganzes flüchtiges Dasein aufs kürzeste enthüllen. Gerade daß er, der auch die bittere Seite des Bohèmelebens erfahren hat, nicht unter allen Umständen heiter wirken mag, ist noch ein besonderer Vorzug von ihm. Seine Munterkeit hat darum nichts Erquältes und Gezwungenes bekommen. »Ich habe keineswegs geschworen,« sagt er an irgendeiner Stelle, »um jeden Preis Lachen zu erwecken. Die Bohème ist auch nicht alle Tage lustig.«
Aber seine Frohnatur und sein goldenes Herz, wie es die Wiener nennen, die alle halbe Bohemiens sind, haben ihm sicherlich zeitlebens auch die Entbehrungen und Enttäuschungen seiner Laufbahn versüßt. Als er begraben wurde, konnten leider um seine Gruft noch nicht die Lieder und Chöre erklingen, die spätere Opernschöpfer wie Massenet, Puccini und andere zu dem Text gemacht haben, den seine heiteren Szenen, ein Fries von fröhlichen Einfällen, ihnen darboten. Musset, in dessen starken Bann Murger nach seinem prächtigen Erstlingswurf der Bohème später geriet, war ihm auch im Sterben bereits vorangegangen und fünf Jahre vor ihm geschieden. Und darum konnte auch der Dichter, der dazu berufen gewesen wäre, an seiner Gruft zu sprechen, ihm nicht die schöne Nachrede halten. Aber Paris, dessen Frühling er so köstlich, und nicht zuletzt in seinen jungen Menschen, hingezeichnet hat, vergalt späterhin dem Toten, was es dem lebenden Murger zu verdanken hatte und was es ihm leider schuldig geblieben war. Man bestellte bei dem zu seiner Zeit berühmtesten Bildhauer Millet ein weibliches Standbild für das noch ungeschmückte Grab Murgers. Und als der Bildner fragte, was dies Grabmal, das man von ihm forderte, darstellen sollte, gab man ihm zur Antwort: »Nichts anderes als Murgers Bohème selber: Die Jugend.« Herbert Eulenberg.
I. Wie der Zigeunerbund begründet wurde
Eines Morgens, es war am 8. April, wurde Alexander Schaunard, der die beiden freien Künste der Malerei und der Musik pflegte, plötzlich durch das Krähen eines Hahns geweckt, der sich irgendwo in der Nachbarschaft befand und ihm als Uhr diente.
»Verflucht!« schrie Schaunard. »Meine gefiederte Uhr geht vor. Es ist doch noch gar nicht möglich, daß es schon heute ist.«
Mit diesen Worten sprang er schnell aus einem Möbelstück seiner eigenen Erfindung heraus, das ihm des Nachts als Bett diente (allerdings leider herzlich schlecht) und am Tage die Rolle aller andern Möbel spielte, da diese im letzten Winter infolge der strengen Kälte nach und nach abhanden gekommen waren.
Um sich vor der scharfen Morgenluft zu schützen, bekleidete sich Schaunard eiligst mit einem rosaseidenen Unterrock, der mit Flittersternen besät war und ihm als Schlafrock diente. Dieses Prachtstück war eines Nachts nach einem Maskenball von einer Dame bei ihm zurückgelassen worden, die töricht genug gewesen, sich von trügerischen Versprechungen des Künstlers täuschen zu lassen. Im Kostüm des Marquis de Mondor, des berühmten Scharlatans des 17. Jahrhunderts, hatte er in seiner Tasche das verführerische Klingeln von einem Dutzend Silbermünzen hören lassen, aber es war nur aus Blech ausgestanztes Phantasiegeld gewesen und den Requisiten eines Theaters entlehnt.
Als der Künstler seine Haustoilette beendet hatte, ging er daran, das Fenster und die Läden zu öffnen. Ein helles Sonnenlicht drang plötzlich ins Zimmer und zwang ihn, die noch vom Schlaf verschleierten Augen weit aufzureißen. In demselben Augenblick schlug es von einem benachbarten Kirchturm fünf Uhr.
»Wahrhaftig, die Sonne geht auf«, murmelte Schaunard. »Es ist erstaunlich. Aber trotzdem«, fügte er hinzu, indem er einen an die Wand genagelten Kalender zu Rate zog, »muß hier ein Irrtum vorliegen. Nach den bestimmten Angaben der Wissenschaft darf die Sonne um diese Jahreszeit erst um fünfeinhalb aufgehen. Es ist erst fünf, und schon ist sie da. Ein strafwürdiger Diensteifer! Dieses Gestirn ist im Unrecht, ich werde mich auf dem Bureau der Längengrade beschweren. Trotzdem wäre es Zeit, wenn ich anfinge, mich etwas zu beunruhigen. Es ist heute das Morgen von gestern, und da wir gestern den 7. hatten, so muß es heute, falls nicht Saturn den Krebsgang geht, der 8. April sein. Wenn ich aber dem Inhalt dieses Papieres glauben darf,« fuhr Schaunard fort, indem er einen Räumungsbefehl, den der Gerichtsvollzieher an die Wand geklebt hatte, noch einmal las, »so muß ich bis heute mittag Punkt zwölf Uhr diese Wohnung geräumt und meinem Hauswirt, dem Herrn Bernard, für die rückständige Miete von drei Monaten die Summe von fünfundsiebzig Franken gezahlt haben. Ich habe, wie immer, gehofft, der Zufall würde diese Sache schon irgendwie in Ordnung bringen, aber es scheint mir, der Zufall hat noch nicht die nötige Zeit dazu gehabt. Jedenfalls habe ich noch sechs Stunden vor mir, und wenn ich sie richtig anwende, dann finde ich vielleicht ... Los, los! Auf die Suche!«
Er war gerade im Begriff, einen Überzieher anzulegen, dessen Stoff früher einmal langbehaart gewesen, jetzt aber zu einer bejammernswerten Kahlheit angelangt war, als er plötzlich, wie von einer Tarantel gestochen, einen Tanz eigener Komposition auszuführen begann, der ihm schon oft auf öffentlichen Bällen die Ehre eines Hinauswurfs durch die Polizei eingetragen hatte.
»Wundervoll!« schrie er. »Es ist doch eigenartig, was für Ideen man des Morgens hat. Ich glaube, mir fällt da etwas Neues für meine Arie ein. Wir wollen sehen!«
Und Schaunard setzte sich halbnackt an sein Piano, weckte das schlummernde Instrument durch einen wahren Sturm von Akkorden und begann, laut dabei redend, auf dem Klavier die Melodie zu verfolgen, die er schon lange suchte.
»C, g, e, c, a, h, c, d, bumm, bumm. F, d, e, d. O weh, dieses d ist falsch wie Judas,« rief Schaunard und schlug wütend auf die schlecht klingende Taste. »Versuchen wir es in Moll... Es soll den Kummer eines jungen Mädchens wiedergeben, das an einem blauen See ein Gänseblümchen zerrupft. Die Idee ist ja gerade nicht neu. Aber da es jetzt Mode ist und man schwerlich einen Verleger fände, der es wagt, eine Romanze ohne einen blauen See herauszubringen, so muß man schon mitmachen. D, g, e, c, a, h, d. Das klingt schon besser, man kann sich dabei schon ein Gänseblümchen vorstellen, besonders, wenn man in der Botanik sehr bewandert ist. Jetzt aber brauche ich, um den blauen See verständlich zu machen, noch etwas Fließendes, Himmelblaues, etwas wie Mondschein (denn der Mond kommt ja auch in dem Gedicht vor). Halt, so geht's – aber ich darf auch den Schwan nicht vergessen...« Schaunard ließ dabei die kristallklaren Noten der hohen Oktaven ertönen.
»Nun folgen die Abschiedsworte des jungen Mädchens,« fuhr er fort, »bevor sie sich in den blauen See stürzt, um sich mit dem Geliebten zu vereinigen, der unter dem Schnee begraben liegt. Die Geschichte ist etwas unklar, aber ganz interessant. Hier müßte man etwas Zartes, Melancholisches anbringen. Halt, so geht es; diese letzten Takte weinen ja wie die Magdalenen, das zerspaltet das Herz, Brr!« unterbrach er sich fröstelnd in seinem mit Sternenflitter besäten Unterrock. »Lieber wäre es mir, es zerspaltete mir etwas Holz! Übrigens in meinem Alkoven befindet sich ein Deckenbalken, der mir sehr lästig ist, wenn ich Gesellschaft darin habe ... ich werde etwas Feuer damit machen, denn ich fühle, daß meine Inspiration zugleich mit einem Schnupfen kommt. Aber was macht das! Fahren wir fort, das junge Mädchen zu ertränken.«
Und während Schaunards Finger das bebende Klavier folterten, verfolgte er mit leuchtendem Auge und gespanntem Ohr seine Melodie, die wie eine flüchtige Sylphe inmitten der das Zimmer erfüllenden Klangwolken dahinschwebte.
»Jetzt müssen wir aber sehen,« begann Schaunard von neuem, »wie meine Musik zu dem Text meines Dichters paßt.«
Und mit einer krächzenden Stimme trällerte er das Bruchstück eines jener Lieder, die eigens für die Operetten und Tanzlokale geschaffen scheinen:
Die blonde, junge Schöne Wirft ihren Mantel hin, Zum sternenhellen Himmel Blickt sie mit trübem Sinn. Und in die blauen Fluten Des silberweißen Sees
»Wie? Was?« schrie Schaunard plötzlich in wohlberechtigter Entrüstung. »Die blauen Fluten eines silberweißen Sees? So was habe ich wirklich noch nicht gesehn. Die Romantik geht mir denn doch zu weit! Dieser Dichter ist ein richtiger Idiot, der weder Silber noch einen See kennt. Überhaupt ist die ganze Ballade blödsinnig. Das Versmaß geniert mich bei der Musik, und in Zukunft werde ich mir meine Gedichte selbst dichten.«
Mit der entsetzlichen Nasalstimme, die ihm eigen war, begann er jetzt von neuem, sein Kunstwerk vorzunehmen, bis er endlich mit dem Ergebnis zufrieden war und sich mit einer Grimasse des Jubels beglückwünschte. Aber diese stolze Glückseligkeit dauerte nicht lange.
Elf Uhr schlug es auf dem nahen Kirchturm, und jeder einzelne Schlag verlor sich im Zimmer in spöttischen Tönen, die dem armen Schaunard zuzurufen schienen: Bist du bereit?
Der Künstler flog von seinem Stuhl empor.
»Die Zeit läuft wie ein gejagter Hirsch«, sagte er. »Es bleiben mir nur noch dreiviertel Stunden, um fünfundsiebzig Franken und eine neue Wohnung zu finden. Ich werde es aber wohl kaum fertig bekommen, dazu gehören Zauberkräfte. Immerhin, ich gebe mir fünf Minuten Zeit zum Suchen!« Damit steckte er den Kopf zwischen seine beiden Knie und versank in die Abgründe des Nachdenkens.
Die fünf Minuten vergingen, und Schaunard erhob seinen Kopf, ohne daß er etwas gefunden hatte, was nach fünfundsiebzig Franken aussah. »Es gibt wohl nur eine einzige Möglichkeit, von hier fortzukommen, und die ist, einfach hinauszugehen. Draußen ist schönes Wetter, vielleicht macht mein Freund, der Zufall, gerade einen Spaziergang im Sonnenschein. Er muß mich wirklich irgendwo unterbringen, bis ich Mittel gefunden habe, Herrn Bernard zu befriedigen.«
Schaunard stopfte jetzt die kellertiefen Taschen seines Überziehers mit allen möglichen Gegenständen voll, knotete etwas Wäsche in ein seidenes Halstuch und verließ sein Zimmer, nachdem er sich mit einigen Worten von seiner Wohnung verabschiedet hatte.
Als er den Hof durchschritt, hielt ihn plötzlich der Portier des Hauses an, der ihn zu erwarten schien.
»Sie, Herr Schaunard!« schrie er, indem er dem Künstler den Weg vertrat. »Bedenken Sie denn nicht, daß wir heute den achten haben?«
»Acht mal fünf sind vierzig, Wer anders sagt, der irrt sich!«
trällerte Schaunard. »Ich denke überhaupt an nichts anderes!«
»Sie sind nämlich mit ihrem Ausziehen noch weit zurück«, sagte der Portier. »Es ist halb zwölf, und der neue Mieter, der in Ihre Wohnung einzieht, kann jeden Augenblick eintreffen. Sie müßten sich jetzt wirklich etwas beeilen.«
»Dann lassen Sie mich bitte vorbei«, antwortete Schaunard. »Ich werde einen Möbelwagen holen.«
»Natürlich, aber bevor Sie ausziehen, ist noch eine kleine Formalität zu erledigen. Ich habe Befehl, Sie kein Haar hinaustragen zu lassen, bevor Sie nicht die drei verfallenen Monatsraten bezahlt haben. Sie haben sich doch darauf eingerichtet?«
»Selbstverständlich«, meinte Schaunard und wollte weitergehen.
»Wenn Sie dann in meine Loge kommen wollen,« fuhr der Portier fort, »dann kann ich Ihnen Ihre Quittungen geben.« »Ich werde sie mitnehmen, wenn ich zurückkomme.«
»Aber warum denn nicht jetzt?« fragte der Portier in dringendem Ton.
»Ich gehe in eine Wechselstube ... ich habe kein kleines Geld.«
»Ach so«, erwiderte der andere beunruhigt. »Sie holen Wechselgeld? Dann werde ich so lange, um Ihnen gefällig zu sein, das kleine Paket aufbewahren, das Sie unter dem Arm tragen und das Ihnen sicher lästig ist.«
»Herr Portier,« sagte Schaunard mit Würde, »sollten Sie vielleicht Mißtrauen gegen mich hegen? Glauben Sie denn, ich schleppe Möbelstücke in einem Halstuch davon?«
»Verzeihen Sie, mein Herr«, antwortete der Portier, indem er seine Stimme etwas dämpfte. »Herr Bernard hat mir ausdrücklich befohlen, ich dürfte Sie kein Haar davontragen lassen, bevor Sie nicht bezahlt hätten.«
»Aber sehen Sie doch«, sagte Schaunard, indem er sein Bündel öffnete. »Das sind doch keine Haare, das sind meine Hemden. Und ich trage sie zur Wäscherin, die neben dem Wechsler wohnt, keine zwanzig Schritte von hier.«
»Das ist etwas anderes«, meinte der Portier, nachdem er sich den Inhalt des Bündels angesehen hatte. »Übrigens, ohne neugierig zu sein, Herr Schaunard, dürfte ich Sie wohl nach Ihrer neuen Adresse fragen?«
»Ich wohne Rue de Rivoli«, antwortete kaltblütig der Künstler und ging auf die Straße hinaus, wo er sofort schnellere Schritte einschlug.
»Rue de Rivoli«, murmelte der Portier, indem er sich die Nase rieb. »Merkwürdig, daß man ihm auf der vornehmen Rue de Rivoli eine Wohnung vermietet hat, ohne sich vorher hier zu erkundigen. Das ist sehr merkwürdig. Hoffentlich kommt der neue Mieter nicht gerade in dem Augenblick, wenn Herr Schaunard auszieht, das würde einen schönen Spektakel auf meinen Treppen geben. Hallo!« fuhr er fort, indem er durch sein Fensterchen auf die Straße blickte. »Da kommt er ja gerade, mein neuer Mieter.« Tatsächlich betrat ein junger Mann mit einem weißen Hut im Stile Ludwigs XIII. auf dem Kopf den Hausflur. Ihm folgte ein Dienstmann, der nicht gerade unter der Last, die er trug, zusammenbrach.
»Mein Herr,« fragte er den Portier, der herausgetreten war, »ist meine Wohnung frei?«
»Noch nicht, mein Herr, aber sie wird gleich so weit sein. Der bisherige Mieter holt nur einen Wagen, um auszuziehen. Inzwischen könnte ja der Herr seine Möbel auf den Hof stellen lassen.«
»Ich fürchte, es könnte regnen«, antwortete der junge Mann, indem er ruhig an einem Veilchensträußchen kaute, das er zwischen den Zähnen hielt. »Meine Möbel würden dann leiden. Dienstmann,« fügte er hinzu und wandte sich an den Mann, der hinter ihm geblieben war und allerlei Gegenstände trug, deren Natur sich der Portier nicht enträtseln konnte, »stellen Sie das in den Hausflur und holen Sie aus meiner Wohnung, was noch an kostbaren Möbelstücken und Kunstwerken da ist.«
Der Dienstmann lehnte mehrere, sechs bis sieben Fuß hohe Rahmengestelle an die Wand, die zusammengeklappt waren, sich aber anscheinend leicht entfalten ließen.
»Halt!« sagte der junge Mann zu dem Dienstmann, indem er einen Flügel halb aufschlug und auf einen Riß wies, der sich in der Leinwand befand. »Sehen Sie, was Sie angerichtet haben? Sie haben mir meinen großen venezianischen Spiegel zerschlagen. Auf Ihrem zweiten Gang nehmen Sie sich mehr in acht, besonders mit meiner Bibliothek.«
»Was redet er denn von seinem venezianischen Spiegel?« murmelte der Portier, indem er einen unruhigen Blick auf die Rahmengestelle warf, die an der Wand lehnten. »Ich sehe keinen Spiegel. Aber vielleicht scherzt er, es ist ja nur ein Ofenschirm. Nun, wir werden ja sehen, was der Dienstmann beim zweitenmal bringt.«
Der junge Mann wollte sich gerade von neuem erkundigen, wann die Wohnung endlich frei würde (denn es war halb eins geworden), als ein Dragoner im Ordonnanzanzug erschien und einen Brief für Herrn Bernard brachte.
»Entschuldigen Sie, wenn ich Sie allein lasse«, sagte der Portier zu dem jungen Mann, der ungeduldig auf dem Hof auf und ab ging. »Aber hier ist ein Brief aus dem Ministerium für Herrn Bernard, den Hausbesitzer, und ich muß ihn hinaufbringen.«
Herr Bernard war, als der Portier bei ihm eintrat, gerade dabei, sich zu rasieren. »Was wollen Sie, Durant?«
»Herr Bernard, eine Ordonnanz hat diesen Brief für Sie gebracht. Er kommt aus dem Ministerium.«
Und er hielt dem Hausherrn den mit Siegel des Kriegsministeriums verschlossenen Brief hin.
»O mein Gott!« hauchte Herr Bernard so bewegt, daß er sich beinahe geschnitten hätte. »Aus dem Kriegsministerium! Sicherlich ist das meine Ernennung zum Ritter der Ehrenlegion, nach der ich schon so lange strebe. Endlich wird meine gute Gesinnung anerkannt. Hier, Durand,« fuhr er fort, indem er in seiner Westentasche herumwühlte, »hier sind fünf Franken, die Sie auf meine Gesundheit vertrinken können. Doch, halt, ich habe gerade kein Geld in der Tasche, ich werde sie Ihnen sogleich geben. Warten Sie!«
Der Portier war so verblüfft über diesen unheimlichen Anfall von Großmut, den er bei seinem Hauseigentümer nicht gewohnt war, daß er sich verwirrt seine Mütze über den Kopf stülpte.
Aber Herr Bernard, der sonst einen solchen Verstoß gegen die Gesetze der sozialen Ordnung streng gerügt hätte, schien es gar nicht zu bemerken. Er setzte sich die Brille auf, und mit der ehrfurchtsvollen Ergriffenheit eines Veziers, der einen Firman des Sultans empfängt, begann er das Schreiben durchzulesen. Aber schon bei den ersten Zeilen grub eine fürchterliche Grimasse dunkelrote Falten in sein fettes Mönchsgesicht, und seine kleinen Augen schleuderten Blitze, die fast die Locken seiner struppigen Perücke in Brand gesetzt hätten.
Schließlich zeigten alle seine Züge eine solche Verwirrung, als sei ein Erdbeben über sein Gesicht gegangen. Der Inhalt des Schreibens aber, das auf einem Briefbogen mit dem Vordruck des Kriegsministeriums stand und von einem Dragoner als Eilboten gebracht worden war, lautete folgendermaßen:
»Geehrter Herr und Hausbesitzer!
Die Höflichkeit, die, wenn man der Mythologie glauben darf, die Mutter der guten Sitten ist, zwingt mich, Ihnen mitzuteilen, daß