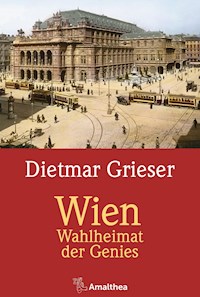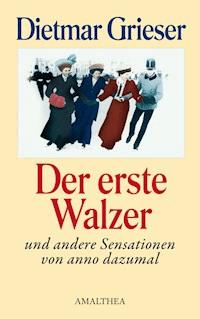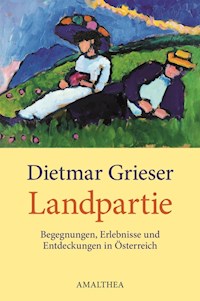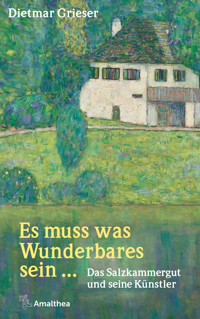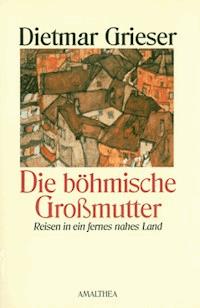
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Franz Schuberts Eltern stammten aus Mähren, Egon Schieles Mutter aus dem südböhmischen Krumau, beide Großväter Bruno Kreiskys waren Deutsch-Böhmen. Gustav Mahler ist in Iglau aufgewachsen, Sigmund Freud ist in Freiberg, Alfred Kubin in Leitmeritz zur Welt gekommen, Adalbert Stifter im Böhmerwald. Die Verbindungen des heutigen Österreich zum alten Böhmen, Mähren und Mährisch-Schlesien sind derart umfassend, dass sie ein eigenes Lexikon füllen könnten. Und doch ist dieses gewaltige Reservoir großer Geister, deren sich Österreich (mit Recht) rühmt, für viele von uns eine Terra incognita. Dietmar Grieser hat es unternommen, dieses "ferne nahe Land" dem Leser auf seine unverwechselbare Art zu erschließen. Entstanden ist ein Lese- und Reisebuch der besonderen Art: voll von bewegenden Schicksalen, voll von Überraschungen, voll von grenzüberschreitender Nostalgie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
Die böhmischeGroßmutter
Reisen in ein fernes nahes Land
Besuchen Sie uns im Internet unter amalthea.at
6. Auflage 2015
© 2005 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: »Krumauer Häuserbogen« von Egon Schiele, 1915
Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger
& Karl Schaumann GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11/14 Punkt New Caledonia
Druck und Bindung: Ueberreuter Buchproduktion, Korneuburg
Printed in Austria
ISBN 978-3-85002-536-2
eISBN 978-3-903083-90-5
Für Dascha
Inhalt
Vorwort
Südböhmen
Hinaus mit dem Schuft!
Stifter allerwege
Mittelböhmen
»Wie glänzt mir deine Pracht!«
Die sanften Riesen
Prag
»Dein Lachen endet vor der Morgenröte …«
Freudenhaus, Trauerhaus
Eine makabre Adresse
Engel in Wort und Bild
Nordböhmen
Die Hochzeit von Reichstadt
Nichts wie Ärger
»Keine Liebschaft war es nicht …«
Die andere Seite
Ostböhmen
Im »Tal der Großmutter«
Nordmähren
»Es ist gern geschehn …«
Der Ölberg von Hohenseibersdorf
Der Ahnfrau dunkle Klause
Kein Gärtchen wie jedes andere
Das »glückliche Freiberger Kind«
Der Weltstar aus der Getreidemühle
Schlesien
Kaltes Wasser, altes Brot
Lokalaugenschein in Hotzenplotz
Südmähren
Der pflügende Kaiser
Franz heißt die Kanaille
Taßwitzer Brotfest oder: Der Schutzpatron von Wien
Wie aus Matej Šindelář Matthias Sindelar wurde
»Aufhören, das ist ja furchtbar!«
Konkordanz der Ortsnamen
Vorwort
Eigentlich ist sie ja eine mährische oder noch genauer eine schlesische Großmutter. Anna Ondrusch, die mich zwischen meinem dritten und elften Lebensjahr aufgezogen hat, stammt aus dem sogenannten Hultschiner Ländchen, jener rund 11000 Einwohner zählenden deutschen Sprachinsel im Kreis Ratibor, die im Zuge der Neuordnung der Staatengemeinschaft nach dem Ersten Weltkrieg an die frischgegründete Tschechoslowakei abgetreten worden ist.
Großmutter Anna nahm sich meiner an, weil wir drei Buben waren und meine Mutter, auch durch das schwere Nervenleiden des Vaters übermäßig in Anspruch genommen, über jede noch so geringe Entlastung froh war. Auch war im Haushalt der Großmutter, die kurz zuvor Witwe geworden war, reichlich Platz für einen Kostgänger, und da ihre Speisekammer bis in die Kriegstage hinein mit nahrhaften Vorräten gefüllt war, ging es mir, dem Jüngsten von uns dreien, um vieles besser als meinen Brüdern, die mir denn auch meinen Sonderstatus unverhohlen neideten und mich als »Nanna-Kindl« verspotteten. Sie taten dies umso mehr, als Großmutter Anna sich im Umgang mit uns Buben einer Art Zweiklassenjustiz befleißigte: Die anderen zwei, zugegebenermaßen »schlimmer« als ich, waren in ihren Augen die Bösen, ich, von Natur unterwürfiger, der Gute.
Ich kann also über die gewiß überstrenge, in ihrer Gottesfürchtigkeit auch vor Bigotterie nicht gefeite Frau kaum etwas Schlechtes sagen; außerdem verbarg sich hinter ihrer stattlichen Erscheinung mit dem stets adretten Outfit ein im Grunde gutmutiges Naturell, das freilich nur demjenigen zugute kam, der Bereitschaft zeigte, sich ihr widerspruchslos unterzuordnen. Ihr trauriges Ende tat ein übriges, eventuelle Vorbehalte gegen Großmutter Anna zum Verstummen zu bringen: Auf einem der Aussiedlertransporte im Herbst 1945 starb die Zweiundsiebzigjährige auf einem Acker vor den Toren der sächsischen Kreisstadt Löbau (wo der Vertriebenenzug angehalten hatte, um den ausgemergelten Greisen eine letzte Möglichkeit zu geben, ein paar Feldfrüchte aufzulesen) am Hungertod.
Es war also die eigene Familiengeschichte, die mich auf einer meiner Reisen durch Nordostmähren auf die Idee brachte, mich für einige Zeit im Land unserer neuen EU-Nachbarn umzusehen, wenn auch weniger auf den Spuren der »böhmischen Großmutter«, sondern um jene nicht minder schicksalsträchtigen »Verwandtschaften« aufzuhellen, die das heutige Österreich nach wie vor mit dem »heimlichen böhmischen Reich« verbinden (wie der Publizist Willy Lorenz – in nostalgischer Anspielung auf das »Heilige Römische Reich« – die Heimat seiner Ahnen apostrophiert hat).
Ich hielt mich dabei an die auch von Lorenz übernommene Sprachregelung, entgegen aller Geographie das gesamte heutige Tschechien unter dem Begriff »Böhmen« zu subsumieren, also dem eigentlichen Kernland dieses Namens auch die Landesteile Mähren und Österreichisch-Schlesien zuzuschlagen. Es macht die Sache nicht nur einfacher und vollständiger, sondern ist auch durch historische Verwurzelung begründet: Erst Friedrich der Große hat die »Länder der böhmischen Krone« zerrissen – mit der Lostrennung Schlesiens im Siebenjährigen Krieg.
Ich wollte das Land kennenlernen, aus dem Franz Schuberts Vater und Egon Schieles Mutter stammen, in dem Gustav Mahler, Karl Kraus und Sigmund Freud geboren sind, das Adalbert Stifter, Marie von Ebner-Eschenbach und Carl Postl alias Charles Sealsfield, Franz Werfel, Franz Kafka und Egon Erwin Kisch, Alfred Kubin und Adolf Loos, Leo Slezak und Maria Jeritza, den Starfußballer Matthias Sindelar und die »Wunderärzte« Johann Schroth und Vinzenz Prießnitz hervorgebracht hat, das Land, in dem sich Mozart wohlgefühlt, Casanova seinen Lebensabend verbracht, Kanzler Metternich seine Güter bewirtschaftet und Kaiser Franz Joseph den Thron bestiegen hat, wo Goethe seiner letzten Liebe, Ulrike von Levetzow, und Grillparzer seiner »Ahnfrau« begegnet ist. Hier sind Rainer Maria Rilke und Robert Musil zur Schule gegangen, hier hat der Augustinermönch Gregor Mendel die folgenreichen Experimente für seine Vererbungslehre durchgeführt, hier hat Albert Einstein seine ersten Überlegungen zur Relativitätstheorie angestellt, hier liegt der legendenumwobene Pandurengeneral Freiherr von der Trenck begraben.
Ein besonders markantes Beispiel für deutsch-böhmische Wurzeln bietet der frühere österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky. Großvater Benedikt, Oberlehrer in dem kleinen zwischen Tabor und Budweis gelegenen südböhmischen Dorf Kaladei und später Vizedirektor der Lehrerbildungsanstalt Budweis, erhielt noch lange nach seiner Pensionierung und Übersiedlung nach Wien alljährlich Besuch von der Bauernschaft seiner Heimatgemeinde, die ihn zum Geburtstag mit Schinken, Würsten und selbstgebackenem Brot erfreuten. Und Moritz Felix, der Großvater mütterlicherseits, hat als Konservenfabrikant halb Europa mit seinen Znaimer Gurken versorgt. Im Stammhaus in Trebitsch hat der junge Bruno Kreisky so manchen Sommer die Ferien zugebracht.
Böhmen und Wien: eine endlose Geschichte. Nicht einmal Clemens Maria Hofbauer, der Schutzpatron der Reichshaupt- und Residenzstadt, und Anton Pilgram, der Dombaumeister von St. Stephan, sind gebürtige Wiener, sondern stammen aus der Gegend um Znaim bzw. Bränn – ganz zu schweigen von den tausenden und abertausenden Pospischils, Swobodas und Vlks, die das heutige Wien bevölkern, und selbst der Räuber Hotzenplotz, den der Kinderbuchautor Otfried Preußler in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts zur Berühmtheit gemacht hat, hat mährische Wurzeln, denen der Literaturtourist in der kleinen Ortschaft Osoblaha nachgehen kann …
Umgekehrt ist die von den Tschechen wie ein Nationaldenkmal verehrte Dichterin Božena Němcová, deren autobiographischer Roman »Babička« nach wie vor in keinem Bücherschrank zwischen Pilsen und Brünn fehlt, nicht in dem nach ihr benannten »Tal der Großmutter« am Fuß des Riesengebirges zur Welt gekommen, wo ihre »Bilder aus dem Landleben« angesiedelt sind, sondern – in Wien. Das Thema hat also viele, sehr viele Seiten, und einige dieser Seiten sollen in dem Buch, das ich hiermit vorlege, aufgeschlagen werden.
Zum Schluß noch ein Wort mehr technischer Natur. Welche Schreibweise, so war die Frage, sollte ich für die in den einzelnen Kapiteln vorkommenden Ortsnamen wählen: die heutige tschechische oder die frühere deutsche bzw. eingedeutschte? Bei Städten wie Olmütz, Brünn oder Prag war die Sache klar: Kein Autor eines deutschsprachigen Buches wird sie Olomouc, Brno oder Praha nennen. Aber was ist mit den anderen, den weniger geläufigen – mit Litoměřice, Šumperk, Příbor? Die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Ich habe sie schließlich – ohne den geringsten Gedanken an Deutschtümelei – rein sachlich getroffen: Als Sigmund Freud zur Welt kam, hieß das heutige Příbor mehrheitlich Freiberg, und ebenso verhält es sich mit Leo Slezaks Mährisch Schönberg und mit Alfred Kubins Leitmeritz. Bleiben wir also bei den früheren Ortsnamen. Wer ihre heutige Schreibweise klären und sich auf den heutigen Landkarten zurechtfinden will, bediene sich der Konkordanz im Schlußteil des Buches.
Südböhmen
Hinaus mit dem Schuft!
In ein paar Wochen wird er zwanzig, schon im Vorjahr hat er sein Studium an der Akademie abgeschlossen, auch die ersten Ausstellungen liegen hinter ihm. Woran es Egon Schiele mangelt, ist das liebe Geld: Oft reicht es nicht einmal, um das Nötigste an Malutensilien zu kaufen. Ob er da auf Dauer das Atelier in der Alserbachstraße 39 wird »halten« können, das er vor kurzem bezogen hat? Das Leben in der Großstadt ist verdammt teuer; auch die Rivalität und der Neid mancher Kollegen verleiden ihm Wien.
Im Mai 1910 steht sein Entschluß fest: Er will versuchen, in Kru-mau ein neues Leben zu beginnen. Die kleine Stadt an der Moldau ist ihm schon seit Kindertagen vertraut: Es ist der Geburtsort seiner Mutter; mehrmals war man bei den drei Tanten, die nach wie vor in Krumau leben, zu Besuch, und schon mit sechzehn hat er Budweiser Tor und Schloßturm mit Farbkreide festgehalten – es ist das früheste seiner Landschaftsbilder, von denen man weiß.
Krumau – das hieße zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einerseits steht er durch seine Mutter – Marie Soukup ist die älteste Tochter eines durch die großen Eisenbahnbauten vor der Jahrhundertwende zu Wohlstand gelangten Baumeisters – ohnedies mit einem Fuß in der wunderschönen südböhmischen Kreisstadt, andererseits bedeutet der Weggang aus Wien Befreiung von ebendieser Mutter, mit der er sich nur schlecht verträgt. Und das vielleicht Allerwichtigste: Krumau mit seinen herrlichen alten Häusern und verwinkelten Gassen, den phantastischen Ausblicken auf Fluß und Schloß bietet dem Maler in seinem unbändigen Schaffensdrang wie kein zweiter Ort eine Überfülle reizvollster Motive.
Noch im Sommer 1910 trifft Schiele am Zielort ein. In seiner Begleitung befindet sich der Malerkollege Erwin Osen – ein besonders origineller Altersgenosse, der auch als Gelegenheitsschauspieler Furore macht. Freund Anton Peschka (der später Schieles Lieblingsschwester Gerti heiraten wird) folgt kurz darauf nach. In der Fleischgasse 133 beziehen sie möblierte Zimmer; im Café Fink (der heutigen Pizzeria Latrán) können sie, wenn ihnen das Geld ausgeht, »anschreiben« lassen.
Schon dort fallen die drei durch ihr extravagantes Verhalten auf – etwa, wenn sie unbekümmert ihre Füße auf die Sessel und Tische des Lokals legen, und beim frühabendlichen Korso auf dem Ringplatz nimmt so mancher ältere Passant Anstoß am ungewohnt-unbürgerlichen »Outfit« der Wiener, die mit knallweißem Anzug, schwarzer Melone und Spazierstock die biedere Provinzstadt unsicher machen. Besonders Freund Osen, der bei jeder Gelegenheit mit seinen Englischkenntnissen prahlt und sich vor den Statuen des Schloßgartens als Pantomime produziert, erregt heftiges Kopfschütteln, und als Schiele dann auch noch bei einem spektakulären Experiment mit einem eilends konstruierten Flugapparat mittut, der vom Kreuzberg aus in Richtung Stadt segeln und auf einem der nahen Wiesengründe niedergehen soll, schlägt die anfängliche Neugier der Krumauer in unverhohlene Schadenfreude um: Das Abenteuer ist kläglich gescheitert.
Umso ansehnlicher ist der künstlerische Ertrag von Schieles Krumau-Aufenthalt: In einer Vielzahl von Bleistift-, Kreide- und Kohlezeichnungen, Aquarellen und Ölbildern hält der Zwanzigjährige die pittoreske Stadtlandschaft fest; Zug um Zug entstehen Meisterwerke wie »Häuser an der Moldau« und »Stadt am blauen Fluß«, »Dämmernde Stadt«, »Gewitterberg«, »Krumau bei Nacht«. Allerdings ist nicht daran zu denken, in einer Kleinstadt, die mit Schieles expressionistischer Kunstauffassung wenig anzufangen weiß, Käufer zu finden: Um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, ist Schiele auf Vorschüsse aus Wien angewiesen, wo sein Förderer Arthur Roessler und eine Reihe weiterer Kunstfreunde für Abnehmer sorgen. Damit beim Transport der fertigen Bilder keine zu hohen Frachtkosten anfallen, wird ihm geraten, »handliche« Formate zu wählen – es sind vorwiegend Holzbretter von 30 mal 40 Zentimeter Größe.
Unter den wenigen Einheimischen, die an Schieles Arbeit interessiert Anteil nehmen, ja ihm selbstlos zur Hand gehen, nimmt ein Gymnasiast namens Willi Lidl eine besondere Stellung ein: Der zwei Jahre Jüngere, der dem von ihm angehimmelten Künstler vor allem bei der Suche nach einem Krumauer Dauerquartier behilflich ist, vernachlässigt über seiner Schiele-Schwärmerei so sehr den eigenen Unterricht, daß er deswegen von der Schule fliegt. »Ich lebe nur für Dich«, schreibt er in einem seiner verzweifelten Briefe, und er fährt fort: »Hast Du mich lieb? Gib mir Gewißheit, sonst geschieht ein Unglück.«
Das Unglück tritt tatsächlich ein: Egon Schiele, seit kurzem mit dem ehemaligen Klimt-Modell Wally Neuzil liiert, kann auf die eindeutig homoerotischen Signale seines jugendlichen Verehrers nicht eingehen, die Beziehung zwischen den beiden kommt ins Stocken, Willi Lidl scheitert auf allen Linien, wird schwer krank, stirbt mit neunundzwanzig.
Was mich an der Schiele-Stadt Krumau vorrangig interessiert, ist jenes Schicksalsjahr 1911, in dem der Einundzwanzigjährige, vorübergehend nach Wien heimgekehrt, aufs neue und nunmehr endgültig in der Geburtsstadt der Mutter Fuß zu fassen versucht. Ich statte also dem in den Räumen der ehemaligen Stadtbrauerei in der Breitegasse installierten Schiele-Zentrum den obligaten Besuch ab, decke mich in dessen reich bestücktem Shop mit Reproduktionen der »Toten Stadt« und all der anderen örtlichen Schiele-Motive ein und suche in dem ebenfalls dazugehörigen Bistro-Café Stärkung (verwundert registrierend, daß Speise- wie Getränkekarte noch immer an der aus den Tagen der kommunistischen Planwirtschaft erinnerlichen Übung festhalten, bei jedem Posten die betreffende Materialmenge anzuführen, also im Fall meines »Türkischen« dessen 7 Gramm Kaffee).
Nun also fit für den auf Schieles »Adressen« und Bildmotive abgestimmten Rundgang, lasse ich die Schönheit der »Krummen Au« auf mich wirken – die vielerlei Krümmungen der die Stadt umschlingenden Moldau haben dem Ort einst seinen Namen gegeben. In den engen und eng verschachtelten Gassen der geschlossensten Renaissancestadt nördlich der Alpen drängen sich zu jeder Jahreszeit die Touristenmassen, und gar bei der Besteigung des Schloßturms, der eine der größten Burganlagen Europas krönt, geht’s so gut wie nie ohne Stau ab. Hier hat auch Schiele oft und oft Posten bezogen, um auf die Stadtlandschaft zu blicken und das Geschaute in Skizzen, Zeichnungen und Bilder umzusetzen; Franz Wischins opulentes Standardwerk »Egon Schiele und Krumau« ist mit einer genauen Konkordanz der tschechischen und deutschen Straßennamen ausgestattet, die es dem Schiele-Spurensucher leichtmachen, sich zurechtzufinden. Nur die Hausnummern bereiten Schwierigkeiten, haben sich im Lauf der Zeit geändert. Fischergasse Nr. 40, laut Marie Soukups Geburtsschein das Elternhaus von Schieles Mutter, ist nicht mit der heutigen Rybarska Nr. 40 identisch – hier wäre also eine Nachfrage auf dem Katasteramt vonnöten. Kein Problem bildet der »Goldene Engel«: Das Hotel auf dem Ringplatz, in dem Schiele in späteren Jahren abgestiegen ist, spielt nach wie vor seine traditionelle Rolle als Luxusherberge. Und auch die Schiele-Adresse Nr. 1, das ominöse Gartenhaus nahe der ehemaligen Schießstätte, aus dem der einundzwanzigjährige Bürgerschreck im Sommer 1911 verjagt worden ist, steht unversehrt an seinem alten Platz.
Als Schiele im April 1911, vorerst noch allein, aus Wien anreist, um das kleine Terrassengrundstück an der Südschleife der Moldau in Augenschein zu nehmen, tut er dies in der festen Absicht, sich in Krumau auf Dauer niederzulassen. Faktotum Willi Lidl, dem es zum Lebensinhalt geworden zu sein scheint, seinem Idol jeglichen Wunsch von den Augen abzulesen, hat das leerstehende Tuskulum ausfindig gemacht, mit dessen Besitzer, dem Textilhändler Max Tschunko, die Konditionen ausgehandelt und auch die nötigen Ausbesserungsarbeiten in die Wege geleitet.
Einen Monat später kehrt Schiele wieder, um »das herrliche Sommerhäuschen mit dem dichten Blumengarten«, wie er es in einem Brief an einen seiner Gönner, den Wiener Kunsthändler Oskar Reichel, enthusiastisch schildert, zu beziehen. An seiner Seite ist seine derzeitige Geliebte Wally Neuzil. Das Leben zu zweit in dem zehn Gehminuten vom Stadtzentrum entfernten Idyll läßt sich gut an: Schiele zeichnet und malt wie ein Besessener, Wally kümmert sich um den kleinen Haushalt, und dank Hausbesitzer Tschunkos Generosität, seinen Mietern den Zins zu erlassen, kommt man auch halbwegs mit dem nach wie vor wenigen Geld aus, das man zur Verfügung hat.
Gefahr droht lediglich von seiten mißgünstiger Kleinbürger, die Schieles exaltierten Lebensstil schon im Vorjahr mit Argwohn beobachtet haben. Wie heißt es so schön in Schillers »Wilhelm Tell«? »Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.« Was mag dann erst sein, wenn der »Frömmste« in den Augen der »bösen Nachbarn« alles andere als fromm ist? Schon, daß ein Mann mit einer Frau in wilder Ehe unter einem Dach zusammenlebt, erregt bei den Krumauer Sittenwächtern Anstoß. Und als sich dann auch noch herumspricht, daß bei Schiele junge Mädchen ein und aus gehen, die dem Künstler in leichtbekleidetem Zustand Modell stehen, ja schließlich sogar der »Skandal« auffliegt, eines von ihnen habe splitternackt vor einem Rosenstrauch in dem von drei Seiten einsehbaren Gärtchen posiert, kocht die Seele der aufgebrachten Moralapostel über, und Hausbesitzer Tschunko, obwohl selbst allem Künstlerischen zugetan und voller Nachsicht gegenüber seinem flotten Mieter, muß dem allgemeinen Drängen nachgeben und Schiele vor die Tür setzen. Acht Tage Frist räumt er ihm ein, dann muß das Gartenhaus geräumt sein.
Am 30. Juni schreibt Schiele an Arthur Roessler nach Wien:
» Sie wissen, wie gern ich in Krumau bin, und jetzt wird es mir unmöglich gemacht. Die Leute boykottieren uns einfach, weil wir rot sind. Ich muß bis 6. August ausgezogen sein, will aber schon am 4. fortfahren und zwar nach Neulengbach. Ich bitte Sie, senden Sie mir irgendeinen Betrag; ich muß außerdem einige Kisten transportieren.«
»Weil wir rot sind« – über diese Formulierung werden die Schiele-Biographen in späteren Jahren die unterschiedlichsten Überlegungen anstellen. Christian Nebehay sieht es so:
»Als ›rot‹ wurde vor 1914 jeder bezeichnet, der nicht regelmäßig in die Kirche ging. Nach allem, was uns bekannt ist, war Schiele kein politisch Gebundener. Wir glauben vielmehr, sein ›Rot‹ als Gegensatz zu ›Schwarz-gelb‹ deuten zu sollen, den Farben der Monarchie.« Und Franz Wischin ergänzt: »Der Vorwurf, ein ›Roter‹ zu sein, beinhaltete in der Monarchie noch nicht die Gleichsetzung mit einem parteipolitischen Bekenntnis, sondern galt im Volksmund als Synonym für antiautoritär, fortschrittlich, freizügig und unkonventionell.«
Wie auch immer – die Kündigung ist ausgesprochen, und die Behörde legt noch ein Schäuferl nach, indem sie zwei Polizeibeamte losschickt, die dem Verfemten auch den offiziellen Ausweisungsbescheid aushändigen.
Schieles Schlußwort, am Tag nach seiner Ankunft in Wien in einem Brief an Arthur Roessler zu Papier gebracht:
»Ich will nicht an Krumau denken, so lieb habe ich die Stadt. Aber die Leute wissen nicht, was sie tun.«
Ganz und für alle Zeiten von der »Stadt am blauen Fluß« zu lassen, fällt ihm dennoch schwer: Zumindest zu kurzen Aufenthalten kehrt er 1913 und 1914 wieder, und seinen letzten Besuch in Krumau, ein Jahr vor seinem frühen Tod, nützt er sogar dazu, Wally Neuzils Nachfolgerin Edith Harms, die er 1915 geheiratet hat, die böhmische Heimat seiner Mutter nahezubringen. Ob er ihr bei dieser Gelegenheit auch die Stätte seines höchsten Glücks und zugleich seiner tiefsten Schmach gezeigt oder aber um das »herrliche Sommerhäuschen«, aus dem er verjagt worden ist, einen großen Bogen gemacht hat, wissen wir nicht. Es war in der Zwischenzeit umgebaut und vergrößert worden, hatte einen zweiten Zugang erhalten, war aber weiterhin – da ohne Wasser, Strom und Kanalisation – nur eingeschränkt bewohnbar. Während des Zweiten Weltkrieges als Flüchtlingsquartier genutzt, wird es nach der Vertreibung seiner neuen Besitzer im Sommer 1945 ein Verfallsobjekt und erst gegen Ende der achtziger Jahre zu neuem Leben erweckt.
Einer der heutigen Grundstücksnachbarn, eine ehemalige Kunsterzieherin aus Deutschland, die sich wie Schiele in Krumau verliebt und am südlichen Moldauufer angesiedelt hat, zeigt mir den Weg, den ich ohne fremde Hilfe niemals finden würde: An der Brücke, die früher von der Linzerstraße zur alten Schießstätte führte, klettern wir die paar Stufen zu dem Wiesengrund hinab, der hier den Flußlauf säumt, und bekommen nach Durchqueren eines Übungsgeländes für radfahrende Kinder das gesuchte Objekt ins Visier: ein brüchiges Mäuerchen, ein paar hochaufragende Bäume und dahinter, strahlend hell getüncht und mit frischem rotem Mansardendach gekrönt, Schieles Gartenhaus. Um seinen weiteren Erhalt zu sichern, ist es unter staatlichen Denkmalschutz gestellt. Würde Schiele heute hier Einzug halten, fände er im Gegensatz zu den primitiven Wohnverhältnissen von damals jeglichen Komfort vor.
Apropos Komfort: Als Schiele nach seiner Ausweisung noch drei Mal zu Kurzbesuchen nach Krumau wiederkehrt, nimmt er, inzwischen von zahlungskräftigen Abnehmern seiner Bilder bestürmt und also besser bei Kasse als im Sommer 1911, im vornehmen Hotel Zum goldenen Engel Quartier. Zu den Krumauer Verwandten seiner Mutter, die bei seiner Verächtlichmachung und Verfolgung anno 1911 kräftig mitgemischt haben, hat er jeglichen Kontakt abgebrochen. Das wird sich übrigens, was seine Mutter betrifft, auch in Wien fortsetzen: Die beiden, ohnedies in gespannter Beziehung zueinander stehend, haben einander immer weniger zu sagen. In einem Brief an Arthur Roessler schüttet Schiele sein Herz aus und beklagt voller Bitternis, »daß sie für mich nicht das geringste Verständnis besitzt und leider auch nicht viel Liebe«.
Stifter allerwege
Im Sommer 1857 hat der knapp zweiundfünfzigjährige Adalbert Stifter ein Erlebnis, das ihn zutiefst aufwühlt: Er sieht zum ersten Mal das Meer. Begleitet von Frau und Ziehtochter, hat er eine Reise in den Süden angetreten – zuerst zu den Verwandten in Klagenfurt, dann weiter nach Triest. Der Anblick des fremden Elements löst in dem vielfach unglücklichen Mann, der sein Leben zu fünf Sechsteln hinter sich hat, gewaltige Erschütterungen aus:
»Ich wußte nicht, wie mir geschah. Ich hatte eine so tiefe Empfindung, wie ich sie nie in meinem Leben gegenüber von Naturdingen gehabt hatte. Jetzt, da ich es gesehen, glaube ich, ich könnte gar nicht mehr leben, wenn ich es nicht gesehen hätte. «
Heute hätte er es vor der Haustür. Zwar nicht das Meer, doch immerhin ein Gewässer von 44 Kilometer Länge und bis zu 12 Kilometer Breite: Es ist der 1959 fertiggestellte Moldau-Stausee, der das Land östlich des Böhmerwaldes mit Strom versorgt. Und mit Touristen.
Der Literaturfreund, Stifters Doktrin vom »sanften Gesetz« im Sinn, braucht sich dennoch nicht zu schrecken: Nur Paddelboote und Ausflugsschiffe sind zugelassen, lautlose Autofähren ersetzen lärmreiche Brücken, und an den Ufern gehen Angler ihrem stillen Tagwerk nach oder ziehen Radfahrer vorüber. Sogar die örtlichen Fremdenverkehrsstrategen, obwohl festen Willens, die nur zweimonatige Sommersaison in Hinkunft zu verlängern, scheinen von »ihrem« Dichter gelernt zu haben und propagieren einen »sanften Tourismus«.
Sobald man die österreichisch-tschechische Grenze bei Wullowitz und die ersten paar Straßenkilometer mit den offenbar unvermeidlichen Animierlokalen à la »Paradiso« und »Kamasutra« hinter sich hat, regieren nur noch Wasser und Wald: Baumriesen lassen ihre Fichten- und Lärchenzweige hoch über den Asphalt hängen, fliegende Händler bieten frisch gebrockte Heidelbeeren an, postmoderne Ferienbungalows wetteifern mit den schäbigen Datschas aus der kommunistischen Zeit. Dazwischen Wegkreuze, hinterm Ufergebüsch versteckte Campingplätze, einfache Proviantbuden – es könnte alles viel schlimmer sein. Den Besuch bei meiner tschechischen Übersetzerin hebe ich mir für den Rückreisetag auf; Jana Dušková lebt mit ihrer Familie in Loučovice, der letzten Ortschaft vor der Talsperre. Unbedingt noch vor Einbruch der Dunkelheit will ich Oberplan erreichen, mein vorrangiges Ziel. Hier ist am 23. Oktober 1805 der Leinenwebersohn Adalbert Stifter zur Welt gekommen, hier hat er seine Kindheit verbracht, und hierher ist er auch als erwachsener Mann wieder und wieder zurückgekehrt.
Schon meine ersten Kontakte mit den Einheimischen belehren mich, ich könne getrost »Oberplan« sagen: Horní Planá, wie der Name der 2000-Seelen-Gemeinde heute offiziell lautet, lebt von den deutschsprachigen Touristen, und die Leute aus dem Ort, die nach 1945 die vormals zu 95 Prozent deutschen Siedler verdrängt haben, haben sich klugerweise darauf eingestellt.
Auch mit ihrem »Lokalmatador« wissen sie umzugehen: Gleich am Ortseingang erblicke ich eine Tafel mit stilisiertem Stifter-Porträt, »Rostbraten Adalbert« lese ich auf der Speisekarte der Gastwirtschaft, die dem Stifter-Geburtshaus gegenüberliegt, und dortselbst wartet auf den Besucher eine vorzügliche Dokumentation zu Leben und Werk des Verehrten.
Nach dem Brand von 1934 originalgetreu wiedererrichtet, birgt der behäbige zweigeschossige Bau Memorabilien wie Stifters Reisezylinder und Reisepaß, eine Staffelei erinnert an seinen Zweitberuf als Maler, und das lateinische Lehrbuch in einer der Vitrinen lenkt den Blick auf den verehrten Landschulmeister Josef Jenne, der seinem Lieblingsschüler »Bertl« nicht nur Lesen und Schreiben, Zeichnen und Singen beigebracht, sondern dem vielfach Begabten, nach elterlichem Wunsch für einen geistlichen Beruf Bestimmten den Weg zur höheren Schule gewiesen hat.
Bei der Wiedereröffnung des Stifter-Hauses hat man übrigens auch an den berühmten Feldstein gedacht, der sich neben dem Eingang befand; hier hat der Bub, allein oder an der Seite des Großvaters, seine ersten Eindrücke von der ihn umgebenden Welt eingefangen:
»Ich saß gerne im ersten Frühlinge dort, wenn die milder werdenden Sonnenstrahlen die erste Wärme an der Wand des Hauses erzeugten. Ich sah auf die geackerten, aber noch nicht bebauten Felder hinaus, ich sah einen Geier darüberfliegen, oder ich sah auf den fernen blaulichen Wald, der so hoch ist, daß ich meinte, wenn man auf den höchsten Baum hinaufstiege, müßte man den Himmel angreifen können.«
In der Schausammlung des Stifter-Hauses fehlt es auch nicht an Zeichen der Endlichkeit: Der Sargschlüssel erinnert daran, daß dem Dichter nur eine Lebenszeit von 62 Jahren vergönnt gewesen ist, und die Fotos von den durch den Moldau-Stausee ausgelöschten Dörfern erklären, wieso manche der dem Stifter-Leser vertrauten Ortsnamen heute von der Landkarte verschwunden sind.
Im Obergeschoß des Stifter-Hauses erwartet den Besucher eine eigene Überraschung: Die stimmungsvollen Böhmerwald-Fotos, die hier zu einer separaten Ausstellung vereinigt sind, stammen von Adalbert Stifters Hand – es ist ein 1950 geborener Nachkomme, dessen Eltern der Versuchung nachgegeben haben, ihren Sohn auf den berühmten Vornamen zu taufen. Der heute Fünfundfünfzigjährige übt einen Doppelberuf aus, ist in der Verwaltung der Erzdiözese Salzburg tätig und zugleich als Theaterfotograf bei den Salzburger Festspielen akkreditiert.
An einer der Außenmauern der Pfarrkirche von Oberplan die Grabplatte von Stifters Mutter Magdalena – die des Vaters wäre auf dem Friedhof der oberösterreichischen Gemeinde Gunskirchen zu suchen, wo Johann Stifter, als sein Erstgeborener zwölf Jahre alt war, unter einem umgestürzten Leiterwagen zu Tode kam. Der 1906 auf dem Gelände des nahen Gutwasserberges angelegte Stifter-Park mit dem secessionistischen Dichterdenkmal, nach dem Zweiten Weltkrieg als Fußballplatz, Freilichtkino und Kleingartenkolonie genutzt, wird von einer nach der »sanften Revolution« von 1989 gegründeten Vereinigung gutwilliger Idealisten und freiwilliger Helfer Zug um Zug wiederhergestellt, und daß man sich dieser gewaltigen Aufgabe erklärtermaßen »zu Ehren unseres Landsmannes Adalbert Stifter« unterzieht, ist ein erfreulicher Beweis dafür, daß sich zumindest in Oberplan das vielpropagierte Werk der Aussöhnung zwischen Tschechen und Deutschen auf gutem Weg befindet.
Gleiches gilt für die Ruine der Burg Wittinghausen, die mein nächstes Ziel bildet. Es ist jenes auf der gegenüberliegenden Seite des Moldau-Stausees tief im Wald von St. Thomas versteckte Relikt, das für den jungen Adalbert Stifter von überragender Bedeutung gewesen ist. Mit 34 hält er die »zerfallene Ritterburg« in einem seiner schönsten Ölbilder fest; drei Jahre später, in seiner berühmten Erzählung »Der Hochwald«, schildert er, wie sie »von dem Tale aus wie ein luftblauer Würfel anzusehen« sei, »der am obersten Rande eines breiten Waldbandes schwebet«.
Während des 13. Jahrhunderts von einem Ritter Wittigo aus dem nahen Krumau als Festung errichtet, fällt die nur aus Wehrmauern und Turm bestehende Anlage in späterer Zeit an das Geschlecht der Rosenberger, die den Burgfried zu einem der größten von ganz Böhmen ausbauen. Hier schmachtet König Wenzel IV., als er im Zuge eines Feudalherrenaufstandes in den Kerker geworfen wird. Immer wieder wechselt Burg Wittinghausen ihre Besitzer, ist schließlich ganz dem Verfall preisgegeben, und erst 1871, als Kronprinz Rudolf den Originalschauplatz von Stifters Roman »Witiko« in Augenschein nehmen will, werden, dem hohen Besuch zu Ehren, die allernötigsten Ausbesserungs- und Konservierungsarbeiten vorgenommen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Gelände – der nahen Grenze zu Österreich und Bayern wegen – Sperrgebiet, der für militärische Zwecke unbrauchbaren Burgruine ein stählerner Turm zur Luftraumüberwachung an die Seite gestellt. Daß sich 1998 erstmals Kräfte zu regen beginnen, die die Revitalisierung der Anlage und die Umwandlung des Burgfrieds in einen Dreiländereck-Aussichtsturm zum Ziel haben, ist niemand anderem als Adalbert Stifter zu verdanken: Die eilends gegründete Bürgervereinigung Wittinghausen/Vítkuv Hrádek mag nicht mit leeren Händen dastehen, wenn es am 23. Oktober 2005 den 200. Geburtstag des Böhmerwalddichters zu feiern gilt. Das ist übrigens alles andere als eine Selbstverständlichkeit: Auch unter den erklärten Büchernarren Tschechiens bilden die Stifter-Leser heute wie ehemals eine verschwindende Minderheit.
Šumava heißt der Böhmerwald auf tschechisch, also »die Rauschende« – das ist schon vom Lautmalerischen her anheimelnd, anziehend. Auch wimmelt es in der 1999/2000 zur »Landschaft des Jahres« erklärten Region, die auf der deutschen Seite in den Nationalpark Bayerischer Wald übergeht, von Stifter-Motiven. Plöckenstein lautet eines der Ziele; wer sich von Oberplan aus, immer in Westrichtung fahrend, der wildromantischen Mixtur aus Heidewiesen und Hochmoor, aus Berggipfel und Bergsee nähern will, muß aufpassen, daß er beim Studium der Landkarte keine Straße erwischt, die sich als bloßer Wanderweg entpuppt. Die Bäume werden von Mal zu Mal höher, die Felsbrocken größer, die Fahrbahn enger. Bei dem Weiler Jeleni Vrchy ist das Auto abzustellen; eine Jausenstation bietet Stärkung für den Zwei-Stunden-Marsch, den der fränkische Schriftsteller Klaus Gasseleder, ein begnadeter Literaturpilger von für seine Generation ungewöhnlicher Ausdauer, so eindrucksvoll beschrieben hat.
Mich reizt vor allem ein Kuriosum, dem Gasseleder beim Aufstieg auf den Plöckenstein nachspürt. Es ist jenes unausgeführt gebliebene Projekt des seinerzeitigen Böhmerwaldvereins, das oberhalb des Plöckensteinsees eine monströse Stifter-Huldigung vorsah: In zwei Meter hohen Buchstaben sollten Kurzzitate aus dem Werk des verehrten Dichters in die Seewand gemeißelt werden, vom Geburtsort Oberplan aus mit dem Fernglas lesbar. Doch Fürst Schwarzenberg, der Grundbesitzer, versagte dem in der Tat irrwitzigen Plan seine Zustimmung, und so blieb es bei der 1875 realisierten Miniaturversion eines steinernen Obelisken von 15 Meter Höhe, dessen Inschrift heute selbst aus nächster Nähe nur mit Mühe zu entziffern ist: »Auf diesem Anger, an diesem Wasser ist der Herzschlag des Waldes.« Kein Geringerer als der berühmte Ringstraßenarchitekt Heinrich von Ferstel, der Erbauer der Votivkirche und der Wiener Universität, hat die Entwürfe gezeichnet.
Was mir bei meinen Streifzügen durch Adalbert Stifters Böhmerland noch fehlt, sind die Spuren, die der in seinen jungen Jahren so glücklose Liebhaber hinterlassen hat. »Ich bitte Dich, weiche mir nicht aus, sag es mir geradezu – ich kann und will nicht länger in diesem Zwitterverhältnis zwischen Freundschaft und Liebe schweben!« beschwört der Fünfundzwanzigjährige die drei Jahre jüngere Friedberger Kaufmannstochter Fanny Greipl, die er, nach der Gymnasialzeit in Kremsmünster nunmehr Student in Wien, während der Sommerferien in der alten Heimat kennengelernt hat.
Das stolze Mädchen, im Elternhaus streng gehalten und auch von so manchem ansehnlicheren Jüngling, als es der pockennarbige, schlecht gekleidete und im Umgang ungeschickte Adalbert Stifter ist, heftig umworben, verhält sich abweisend. Zwar stickt sie ihm – als Gegengeschenk für das Aquarell, das Stifter von Fannys Geburtsort Friedberg gemalt hat – einen Tabaksbeutel, doch seine schwärmerischen Briefe läßt sie unbeantwortet, und greift sie ausnahmsweise doch zur Feder, so nur, um ihm mitzuteilen, daß ihre Mutter einen armen Schlucker wie ihn nie und nimmer als Schwiegersohn akzeptieren würde. Das Haus des reichen Leinenhändlers Greipl auf dem Marktplatz von Friedberg darf Stifter lediglich als Motiv in sein Aquarell einfügen; als Ort des ersehnten Beisammenseins mit der »herzinnigst geliebten Freundin« bleibt es ihm verschlossen.
Verschlossen bleibt es auch mir. Zwar finde ich Friedberg/Frymburk in groben Zügen noch genau so vor, wie es mir von Stifters Bild her vertraut ist, erkenne den langgezogenen Hauptplatz mit dem baumbestandenen Grünstreifen, dem schmalen Rinnsal und dem alten Brunnen, und wenn ich mir die Veränderungen wegdenke, die die nach wie vor anmutigen Bürgerhäuser in den 175 Jahren erfahren haben, die in der Zwischenzeit verstrichen sind, ersteht noch immer ein erstaunlich klares Bild jenes Schicksalsortes, den Stifter an mehreren Stellen seines Werkes verewigt hat. Manchmal nennt er ihn bei seinem wirklichen, manchmal gibt er ihm den Namen Pirling. Wieso Pirling? Vielleicht soll ihm die dichterische Verfremdung eine Hilfe sein, den Schmerz des abgewiesenen Liebhabers zu lindern.
Mittelböhmen
»Wie glänzt mir deine Pracht!«
Schon die Wagenfahrt durch das naive Land war so schön …« Auch heute noch stimmt Rilkes schwärmerische Beschreibung seiner Annäherung an Schloß Janowitz. Einunddreißig ist der Dichter, als er im Herbst 1907 den Besuch der Prager Cézanne-Ausstellung mit einem Abstecher auf den Landsitz seiner Seelenfreundin Sidonie Nádherny von Borutín verbindet. Hier die sanften Hügel, die ihn an »leichte Musik« erinnern, dort die flachen Äcker und Apfelbaumreihen »wie ein Volkslied ohne Refrain«.
Bis zu der Kreisstadt Benešov geht es, von Prag kommend, auf fast gerader Strecke Richtung Süden; erst dort setzt die Suche nach jenen leicht in die Irre führenden, wenig befahrenen Nebenstraßen ein, die uns ans Ziel bringen sollen: Vrchotovy Janovice lautet die heutige Ortsbezeichnung.
Nirgends würde man altösterreichische Nostalgie weniger vermuten als auf dem Bahnhof dieses von häßlichen Industriebauten geprägten Städtchens. Eine Gedenktafel, goldene Schrift auf schwarzem Grund, klärt den Reisenden darüber auf, daß in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in dem kleinen Raum, der heute die Kanzlei des Bahnhofsvorstandes bildet, hohe und höchste Herrschaften auf ihren Zug gewartet haben: Kaiser Franz Joseph, der auf der Fahrt nach Prag einen Zwischenstop eingelegt, Thronfolger Franz Ferdinand, der im nahen Schloß Konopište residiert und Kaiser Wilhelm II., den die Jagdlust zu exklusiven Vergnügungen in die böhmischen Wälder gelockt hat. Der computerbestückte Schreibtisch des Bahnhofsvorstehers bildet einen reizvollen Kontrast zu den alten, hinter Glas gerahmten Photographien, die nach wie vor an den Wänden hängen: Momentaufnahmen von den Aufenthalten der Potentaten in dem mit sparsamer Eleganz ausstaffierten Salon. Der zur Abfahrt bereitstehende Schülerzug ist abgefertigt, der freundliche Beamte der Tschechischen Staatsbahnen kann sich uns zuwenden und die Ereignisse von damals, die er nur vom Hörensagen kennen kann, in einem kuriosen Gemisch aus Tschechisch und Deutsch zu schildern versuchen. Auch den weiteren Weg nach Vrchotovy Janovice beschreibt er bis ins Detail: Erst, als er ganz sicher ist, wir würden all die Abzweigungen, Kurven, Brücken, Waldstücke und Tankstellen nicht durcheinanderbringen, entläßt er uns mit einem herzlichen »Grüß Gott«.
Auch das Schloß, das unser Reiseziel bildet, bietet sich dem Auge des Besuchers so dar, wie es vor hundert Jahren Rainer Maria Rilke beschrieben hat: »durch einen alten Wassergraben abgetrennt, mit Fenstern und Wappenschildern gleichmäßig bedeckt, mit Altanen, Erkern und um Höfe herumgestellt, als sollte niemals jemand sie zu sehen bekommen«.
Wir aber bekommen