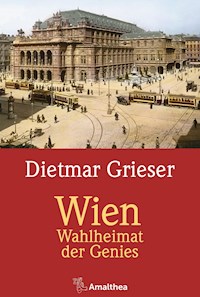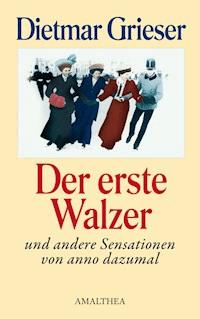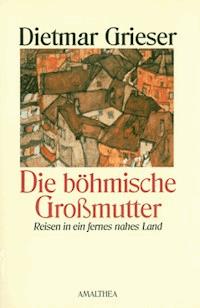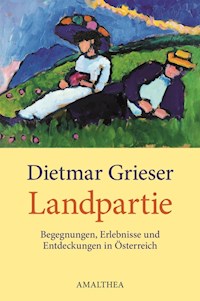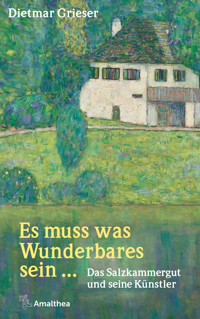Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Große Künstler und ihre treuen Untergebenen, die Weltprominenz im Lichte ihres Personals – von Bruckner bis Karajan, von Queen Elizabeth bis Thomas Mann Dietmar Grieser verrät seinen Leserinnen und Lesern, - wieso Beethoven ständig mit seinen Bediensteten im Streit lag - warum Goethe seine Küchenhilfe bei der Polizei anzeigte - wie Papst Pius XII. von seiner Haushälterin vergöttert wurde - was Kaiserin Zita ihrer Gesellschafterin "Korffi" zu verdanken hat - wie Erich Kästner seine Sekretärin vor dem Kriegseinsatz rettete - welche Frau sich ein Leben lang für Alma Mahler-Werfel aufopferte - wie Karl Valentin und Köchin Gisela ein Paar wurden - wie aus einem simplen Fan Zarah Leanders größte Stütze wurde - und vieles andere mehr Eine schillernde Revue des Dienens und Bedientwerdens
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
Die guten Geister
Sie dienten den Großen dieser WeltKöchin, Butler, Sekretär
Besuchen Sie uns im Internet unter amalthea.at
1. Auflage Juni 20082. Auflage August 20083. Auflage Dezember 2008
© 2008 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Kurt Hamtil, verlagsbüro wienUmschlagmotiv: © Fine Art Photographic Library/Corbis;Charles Green (1896)Bildredaktion: Corinna PreyHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11/14 Punkt New CaledoniaDruck und Bindung: CPI Moravia Books GmbHPrinted in the EUeISBN 978-3-903083-92-9
Für Christine H.
»Er ehrte sie im hohen Palastgleich seiner edlen Gemahlin …«
AUS HOMERS LOBGESANG AUF EURYKLEIA,DIE MAGD DES ODYSSEUS
Inhalt
Vorwort
Beethovens Bestien
Ludwig van Beethoven und seine Bediensteten
»Hauskorporal« Kathi
Anton Bruckner und Kathi Kachelmaier
Krieg in der Küche
Johann Strauß und sein Personal
Die Leibeigene
Alma Mahler-Werfel und Ida Gebauer
Die Kalorienkönigin
Emmerich Kálmán und Maria Pervich
»To Gustl with best wishes …«
Maria Jeritza und August Prossinger
Die Stimme seines Herrn
Herbert von Karajan und André Mattoni
Zarahs Zofe
Zarah Leander und Brigitte Anhöck
Kinderfrau ohne Kinder
Maria Cebotari und Hedwig Cattarius
»Widerspenstig, zudringlich und grob …«
Johann Wolfgang von Goethe und Charlotte Hoyer
Höchstes Lob
Fjodor Dostojewski und Elise Schmidt
Auf Augenhöhe
Gerhart Hauptmann und Erhart Kästner
»Besuch« in der Cottagegasse
Felix Salten und Pepi Wlk
»Fraudoktors« rechte Hand
Eugenie Schwarzwald und Marie Stiasny
Renate, Anna, Leni
Alfred Polgar und das Personal
»Nach dem Thee: Diktate an die Kahn«
Thomas Mann und Hilde Kahn
Wir die Herren, sie die Knechte
Marie von Ebner-Eschenbach und ihre Bediensteten
»Liebstes Fräulein!«
Egon Friedell und Hermine Schimann
Meine Frau, die Köchin
Karl Valentin und Gisela Royes
»Von keinerlei Launen getrübte Güte …«
Bertolt Brecht und Marie Miller
Der geborene Diener
Robert Walser als Lakai
Sechzig Zigaretten am Tag
Lion Feuchtwanger und Hilde Waldo
Kästner & Co.
Erich Kästner und Elfriede Mechnig
Ein Mädchen für alles, wirklich für alles
Karl Marx und Helene Demuth
La Tedesca
Papst Pius XII. und Schwester Pascalina Lehnert
Der gute Geist von Klein-Schönbrunn
Elisabeth von Habsburg-Lothringen und Paul Mesli
Habsburgerin h.c.
Kaiserin Zita und Gräfin Korff-Schmising-Kerssenbrock
Der erste Mann im Buckingham Palast
Elizabeth II. und Sir Robert Fellowes
Das Erbstück
Christina Onassis und Eleni Syros
Ein überforderter Butler
Freddie Frinton und sein »Dinner for one«
Nachwort
Vorwort
Wäre Vicki Baum ohne den Vorfall mit dem angebrannten Milchreis keine Schriftstellerin geworden und schon gar nicht die Autorin solcher Weltbestseller wie »Menschen im Hotel« und »Vor Rehen wird gewarnt«? Ist tatsächlich Haushälterin Lisbeth an allem schuld?
Schauen wir uns die Sache aus der Nähe an. Kiel, Frühjahr 1917. Die neunundzwanzigjährige Hedwig Lert geborene Baum, genannt Vicki, hat sowohl ihre Geburtsstadt Wien wie ihren Erstberuf Harfenistin hinter sich gelassen und ist dem Dirigenten Richard Lert, den sie vor wenigen Monaten geheiratet hat, nach Norddeutschland gefolgt, wo sich der zwei Jahre Ältere auf den Posten des Kieler Operndirektors vorbereitet.
Im März 1917 kommt das erste Kind zur Welt. Nicht nur »Kriegsbaby« Wolfgang, sondern auch die junge Mutter leiden unter der allgemeinen Lebensmittelnot. Freunde tun sich zusammen, um Vicki wenigstens am Tag der Taufe mit deren Lieblingsgericht zu verwöhnen: Milchreis. Es grenzt an ein Wunder, daß es ihnen gelingt, sämtliche nötigen Zutaten aufzutreiben: Weder Reis noch Zimt sind zu dieser Zeit »normal« zu haben, auch Zucker und Butter sind knapp.
Lisbeth, die »Perle« des jungen Haushalts, wird mit der Zubereitung betraut. Doch Vickis Vorfreude schlägt in bittere Enttäuschung um, als sie den ersten Löffel zum Munde führt. Zwischen Tränen der Dankbarkeit und ununterdrückbarem Ekel schwankend, ruft sie aus: »Der Milchreis ist ja angebrannt!«
Darauf Haushälterin Lisbeth, leicht verwundert: »Ja, ist denn Milchreis nicht immer angebrannt?«
In diesem Augenblick – so wird sich Vicki Baum Jahrzehnte später in ihrer Autobiographie erinnern – gehen wundersame Gedanken durch ihren Kopf: Gedanken, die nichts Geringeres als die Initialzündung für ihren künftigen Beruf auslösen. Dienstmädchen Lisbeths »Ist denn Milchreis nicht immer angebrannt?« öffnet der Neunundzwanzigjährigen die Augen für die Realitäten des Lebens, für den ewigen Widerstreit von Anspruch und Erfüllung, für die Kluft zwischen Schein und Sein. Sie schreibt: »Die Reise, die verregnet ist, der berühmte Mann, der in Wahrheit enttäuschend langweilig ist, das Kleid, das einem nicht wirklich steht, die große Liebe, die so schäbig endet – diese Kette von komisch-tragischen Ereignissen, die unseren Erwartungen zuwiderlaufen« – ist es nicht genau das, was unser Dasein ausmacht? Und vor allem: Liegen nicht hier die Stoffe, die ein Schriftsteller für seine Werke braucht?
Als Vicki Baum im darauffolgenden Jahr ihre literarische Tätigkeit aufnimmt und 1919 mit dem Roman »Frühe Schatten« debütiert, ist es genau dieses »Rezept«, dem sie bei der Zeichnung ihrer Charaktere, beim Entwurf der Handlungsstränge und bei der Schürzung der Konflikte folgt. Und auch, als sie längst Europa mit Amerika vertauscht hat und sowohl mit ihren Büchern wie mit ihren Filmen zum Weltstar avanciert ist, der sich jeden Luxus, also auch jede Menge Personal leisten kann, wird sie wieder und wieder dankbar jenes Kieler Dienstmädchens gedenken, das ihr vor Zeiten mit seiner schlichten »Kuchl-Philosophie« den Weg zur Schriftstellerei gewiesen hat: Ist denn Milchreis nicht immer angebrannt?
Schon als ich 1981 mein Buch »Musen leben länger« herausbrachte, in dem es um die Rolle der Frau an der Seite des Dichters ging, keimte in mir der Wunsch, eines Tages das Thema auch auf die professionellen Hilfskräfte auszuweiten, die den Künstlern (und nicht nur ihnen) bei ihrer Arbeit zur Seite stehen: die Sekretärinnen und Assistentinnen, die Diener und Gesellschafter und all die anderen, ohne deren treues Wirken so manche künstlerische Höchstleistung nicht zustande käme.
Über etliche dieser dienstbaren Geister sind im Lauf der Zeit eigene Bücher geschrieben worden – etwa über den Mozart-Adlatus Franz Xaver Süßmayr, über Rosa Luxemburgs »Alter ego« Mathilde Jacob oder über den »Hofstaat« des Dichters Hans Fallada (»Wir saßen alle an einem Tisch«).
Andere haben diese Bücher selber verfasst. Ich denke an die berührenden Memoiren von Céleste Albaret, der Haushälterin Marcel Prousts, an die »oral history« der Sigmund-Freud-»Perle« Paula Fichtl, an Jonny Mosers Jugenderinnerungen »Wallenbergs Laufbursche« oder an die spektakuläre Öffnung des »versiegelten Tagebuches« des Thomas-Bernhard-Faktotums Karl Ignaz Hennetmair.
Wieder andere, in jungen Jahren berühmten Künstlern als Sekretär dienend, haben sich später ihren eigenen Platz in der Literaturszene erkämpft: der Reiseschriftsteller Erhart Kästner, der für Gerhart Hauptmann, der Fernsehautor Wolfgang Fleischer, der für Heimito von Doderer, oder der Dichter Peter Rosei, der für den Maler Ernst Fuchs gearbeitet hat.
Für Thomas Mann, Lion Feuchtwanger und Erich Kästner sind ihre Schreibkräfte Hilde Kahn, Hilde Waldo und Elfriede Mechnig ebenso unentbehrlich wie für Anton Bruckner seine Haushälterin Kathi, für Johann Strauß seine Herrschaftsköchin Anna oder für Oskar Werner sein Leibchauffeur Erich Stangl. Goethe muß sich von seinem langjährigen Diener Carl Wilhelm Stadelmann trennen, als dessen Trunksucht jedes weitere Zusammenwirken unmöglich macht. Beethovens Umgang mit seinem stetig wechselnden Personal ist ein einziges Fiasko, und Maurice Ravel klagt, daß ihm »die Prohaska«, seine tschechische Dienstmagd, auf seinem Landsitz bei Rambouillet die Bibliothek geplündert hat.
Ein eigenes Kapitel bilden die dienstbaren Geister jener Prominenten, bei denen sich Berufs- und Privatleben folgenschwer vermischen: Lenchen Demuth, die Karl Marx nicht nur den Haushalt führt, sondern von ihm auch ein Kind empfängt; Küchenmädel Gisela Royes, die Karl Valentins Ehefrau wird; Egon Friedells »Perle« Hermine Schimann, die Zug um Zug auch ihre gesamte Verwandtschaft »einschleust«; oder die Krankenschwester Ida Gebauer, die von Alma Mahlers Kinderfräulein zu deren Hausdame und engster Vertrauter aufsteigt. Der junge Alban Berg »vergreift« sich an der Küchenhilfe des elterlichen Sommersitzes am Ossiachersee: Cupido domesticus hat man jene Konstellation in den noblen Häusern von anno dazumal genannt, wo es zu den unausgesprochenen Dienstpflichten der Mägde gehört hat, den männlichen Familiennachwuchs in der Kunst der körperlichen Liebe zu unterweisen.
Bleiben wir noch einen Moment bei der Literatur: Homer hat mit der Figur der »Schaffnerin« Eurykleia, die den inkognito heimkehrenden Odysseus beim Fußwaschen wiedererkennt, dem Domestikenstand ein immerwährendes Denkmal gesetzt, und Wilhelm Busch verarbeitet die Erfahrungen mit seiner Frankfurter Kurzzeit-Köchin Marie Euler zu der Bildergeschichte von der »Frommen Helene«. Einen Sonderfall bildet der Schweizer Schriftsteller Robert Walser, dem es nie in den Sinn käme, sich von einem anderen Menschen bedienen zu lassen. Im Gegenteil: Er unterzieht sich in jungen Jahren einer eigenen Ausbildung zum Butler und übt diesen Beruf tatsächlich eine Zeit lang aus.
Schon diese erste flüchtige Bestandsaufnahme zeigt: Das Beziehungsgeflecht zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern ist – um ein weiteres Mal den oft zitierten Fontane-Topos zu strapazieren – »ein weites Feld«. Und wenn es schon ein so weites Feld ist, wollen wir es nicht bei den Künstlern und deren Helfern belassen, sondern unseren Blick auch den Bereichen Politik, Aristokratie und Kirche zuwenden: Wer war die Frau, die die heimatlos gewordene letzte österreichische Kaiserin durch alle Höhen und Tiefen ihres Lebens begleitet hat? Wieso hat sich die deutsche Ordensschwester Pascalina Lehnert mit ihrem »Regime« im Papsthaushalt Pius XII. so viele Feinde gemacht? Welche Rolle spielen die »private secretaries« am Hof der Königin von England?
Es ist ein scheinbar unauflöslicher Widerspruch: Gilt in unseren emanzipierten Zeiten das Dienen – und gar dessen unterwürfigdevote Spielart – als »out«, als verpönt, ja als menschenunwürdig, so leben wir andererseits, wie uns die Soziologen lehren, in einer wie nie zuvor hochentwickelten Dienstleistungsgesellschaft, von der beide Seiten, Anbieter wie Konsument, gleichermaßen profitieren. Das vorliegende Buch geht diesem scheinbaren Widerspruch an dreißig Beispielen nach, die aus den verschiedensten Bereichen und aus den verschiedensten Zeiten ausgewählt sind. Auch das ist, denke ich, ein Stück Kulturgeschichte.
Beethovens Bestien
Ludwig van Beethoven und seine Bediensteten
Wien ist für ihn das ideale Biotop. Die Musikstadt mit ihren kolossalen Möglichkeiten, die lebensfrohen Dörfer und lieblichen Landschaften rund um die Metropole, die Nähe der Gönner und Mäzene und die schützende Hand zuverlässiger Freunde, dazu die vorzügliche Küche und der bekömmliche Wein: Beethoven könnte, als er sich 1792 auf Dauer in Wien niederläßt, keine bessere Wahl treffen. Auch die beiden Adlaten, die ihm einen Teil seiner Arbeit abnehmen, sind für den notorisch Überlasteten ein Segen: Franz Oliva, der sich wie kein zweiter in Geschäfts- und Banksachen auskennt, führt ihm die Korrespondenz, verhandelt mit den Verlegern und bereitet die Konzerte vor. Sein Nachfolger Anton Schindler liest dem Meister überhaupt jeden Wunsch von den Augen ab, und beide, obwohl unbezahlt und oft genug unbedankt, nehmen ohne Murren Beethovens Launen in Kauf.
Nur mit den Hausleuten gibt es permanent Ärger. Ob Vermieter, Hausmeister oder Dienstboten – ihr Unverständnis, ihre Anmaßung oder einfach ihre Unzulänglichkeit machen dem Genie Ludwig van Beethoven das Leben schwer. Daß er in den fünfunddreißig Jahren, die er in und um Wien zubringt, an die vierzig Mal das Quartier wechselt, sagt alles.
Natürlich ist auch er selber nicht frei von Schuld, wenn er sich laufend mit seiner Umgebung überwirft: Beethovens Temperament duldet keine Kompromisse, die anhaltenden und mit den Jahren noch zunehmenden gesundheitlichen Probleme erhöhen seine Reizbarkeit, Rückgang und Verlust der Hörkraft nähren sein Mißtrauen. Da er zeit seines Lebens niemals in den Ehestand tritt, also keine »femme ménagère« der »wahrhaft admirablen Confusion« seines Hauswesens Einhalt gebietet, kommt dem von ihm engagierten Personal umso größere Bedeutung zu.
Eigentlich sind die Ansprüche, die Beethoven an seine Bedienten stellt, bescheiden. In einem seiner vielen Briefe an Freund Nikolaus von Zmeskall listet er sie auf: Er erwartet eine »gute Empfehlung« und »ordentliches Betragen«, auch sollten sie »nicht mordlustig« sein, »damit ich meines Lebens sicher bin«. Verheiratete zieht er Unverheirateten vor: Von ersteren ist – wenn schon nicht mehr Ehrlichkeit – so zumindest »mehr Ordnung« zu erwarten. Angesichts der »gänzlichen moralischen Verderbtheit des österreichischen Staates« hat Beethoven allerdings Zweifel, ob es leicht sein werde, solch eine »rechtschaffene Person« zu finden.
Dabei verlangt er gar nicht übermäßig viel von ihr. Das Küchenmädchen, das er sucht, soll ihm seine Leibspeisen zubereiten – und zwar so, »daß man gut verdaue«. Da spielt der an chronischen Magen- und Darmbeschwerden Leidende auf »die fortdauernde Schlechtigkeit der Lebensmittel« an, die ihn krank mache. An sonstigen Diensten erhofft er sich von ihr lediglich, daß sie auch »für das Flicken der Hemden brauchbar« sei.
Im September 1813 ist es wieder einmal so weit, daß Beethoven nach einem neuen Domestiken Ausschau hält, Freund Zmeskall soll ihm dabei helfen. Er schreibt ihm aus dem Badener Sommerquartier: »Sollte Ihr Bedienter brav sein und einen Braven für mich wissen, so würden Sie mir eine große Gefälligkeit erweisen, durch den Ihrigen Braven auch mir einen Braven verschaffen zu lassen. Bis Ende dieses Monats geht meine jetzige Bestie von Baden fort, der Bediente könnte also mit Anfang des künftigen Monats eintreten.«
»Bestie«, »Vieh« und »schlechter Mensch« – das ist der Ton, in dem sich Beethoven über sein stetig wechselndes Personal äußert. »Unausstehlich« findet er sie, »ungebildet, viehisch, ja noch unter dem Vieh«. Einem von ihnen hat er »einen Tritt vor den Hintern gegeben und ihn zum Teufel geschickt«. Haushälterin Nanni und Küchenmädel Baberl nennt er »stumpfsinnig«, Nachfolgerin Pepi eine »Verräterin«, die gegen ihn konspiriere, und einem der männlichen Bedienten wirft er vor, »mit falschen Schlüsseln« in anderer Leute Gemächer einzudringen. Am liebsten käme er ganz ohne fremde Hilfe aus: »… ist es mir hart, in den Zustand geraten zu sein, so mancherlei Menschen brauchen zu müssen.«
Je älter Beethoven wird, desto mehr verdrießen ihn die Auseinandersetzungen mit seinen Bediensteten. In über sechzig Briefen schüttet er einer seiner engsten Vertrauten, Nanette von Streicher, sein Herz aus. Die ein Jahr Ältere, Gattin des Klavierbauers Johann Andreas Streicher, steht ihm mit engelhafter Geduld zur Seite, um Beethovens häusliche Probleme zu lösen, und ihr nicht minder menschenfreundlicher Mann läßt es still geschehen, daß sie dafür so manche kostbare Stunde opfert. Beethoven dankt es ihr, indem er sie als seine »Oberhofmeisterin« preist. Nicht nur, daß er sie bei plötzlich entstehenden Vakanzen als Vermittlerin einspannt, überträgt er ihr auch die Kontrolle der Haushaltsrechnungen, und als er schließlich im Umgang mit dem Personal gar nicht mehr aus und ein weiß, schickt er ihr einen umfangreichen Fragenkatalog, den sie auf der Rückseite des Blattes Punkt für Punkt beantworten möge:
»Was gibt man Dienstleuten mittags und abends zu essen – sowohl an der Qualität als Quantität?
Wie oft gibt man ihnen Braten?
Geschieht dies mittags und abends zugleich?
Das, was den Dienstleuten bestimmt ist – haben sie dieses gemein mit den Speisen des Herrn, oder machen sie sich solche besonders, das heißt, machen sie sich hierzu andere Speisen, als der Herr hat?
Wie viel Brotgeld die Haushälterin und Dienstmagd täglich? Wie wird es gehalten beim Waschen? Bekommen die Haushälterin und Dienstmagd mehr?
Wie mit Wein und Bier? Gibt man ihnen solches und wann?
Frühstück?«
Frau von Streicher, die Sanftmut in Person, unternimmt alles, die häuslichen Verhältnisse ihres Schützlings zu verbessern. Seine Klagen reißen dennoch nicht ab. Als ein neues Küchenmädel ins Haus kommt, das beim Holztragen »ein schiefes Gesicht macht«, holt Beethoven zu einem gewagten Vergleich aus: »Ich hoffe, sie wird sich erinnern, daß auch unser Erlöser sein Kreuz auf Golgatha geschleppt hat.« Mit Milde, so folgert er aus ihrem Verhalten, sei da leider nichts auszurichten: »Nicht durch Liebe, sondern durch Furcht müssen diese Leute gehandhabt werden.«Und wie stellt man das an? Etwa, indem er dem Küchenmädel, das ihm auf seine Vorhaltungen »keck und frech« erwidert, damit droht, sie »auf der Stelle aus dem Haus zu jagen«.
Auch Gewaltanwendung ist für Beethoven ein probates Mittel, die Aufmüpfige in ihre Schranken zu weisen: »Die Fräulein N. ist ganz umgewandelt, seit ich ihr das halb Dutzend Bücher an den Kopf geworfen.« Beim nächsten Übergriff ist es gar ein schwerer Sessel, den er ihr »auf den Leib« wirft, und er bereut es keinen Augenblick: »Dafür hatte ich den ganzen Tag Ruhe.«
Wenig hält Beethoven davon, daß Frau von Streicher selber ins Geschehen eingreift: »Sprechen Sie nicht viel mit ihnen«, beschwört er die gute Seele in einem seiner Briefe, »denn es wird dadurch doch nicht besser, macht sie nur noch erboster auf mich.«
Leider hat sich keiner der Gegenbriefe erhalten, und so wissen wir nicht, ob Nanette von Streicher zu all den Anschuldigungen Ja und Amen sagt oder vielleicht doch im einen oder anderen Fall Beethovens Domestiken in Schutz nimmt. Denn eines ist offensichtlich: Das Mißtrauen ihres Schützlings nimmt mehr und mehr pathologische Züge an. Wie kann Beethoven einen seitenlangen Brief an Nanette nur darauf verwenden, ihr den (seinem Diener in die Schuhe geschobenen) Verlust eines einzelnen Strumpfes anzuzeigen und eine solche Bagatelle zum Kriminalfall aufzubauschen?
Überhaupt ist Großzügigkeit seine Sache nicht: Als es wieder einmal um die Anstellung einer neuen Haushälterin geht, bittet Beethoven die als Vermittlerin eingeschaltete Frau von Streicher, zu klären, ob die Betreffende über eigenes Mobiliar verfüge, Bett, Matratze, Kommodekasten. »Wegen der Wäsche sprechen Sie auch mit ihr, damit wir über alles gewiß sind.«
Regelmäßig legt er seiner Beschützerin das »Küchenbuch« zur Überprüfung vor. Um alle Zweifel an der Ehrlichkeit der Haushälterin auszuräumen, möge Nanette von Zeit zu Zeit an Ort und Stelle Stichproben machen: »Sie müssen manchmal beim Essen als ein richtender Engel unverhofft erscheinen, um in Augenschein zu nehmen, was wir haben.«
Besonders gereizt reagiert Beethoven auf den »Verrat«, dessen er jene zwei Domestiken verdächtigt, die sich zur Zeit seiner Vormundschaft für den Neffen Karl mit dessen Mutter Johanna verbünden. Entgegen seinem Willen, die verhaßte Schwägerin von seinem Schützling fernzuhalten, erdreisten sich die beiden Bedienten, die Verbindung zwischen Mutter und Sohn wiederherzustellen, und lassen sich dafür mit Kaffee und Zucker bestechen. Die Angelegenheit regt Beethoven dermaßen auf, daß er darüber krank und folglich auch in seinem künstlerischen Schaffen zurückgeworfen wird.
Seit 1819 ist Beethoven vollständig taub, und das bedeutet: Er lebt in der ständigen Furcht, seine Mitmenschen könnten die zunehmenden Verständigungsschwierigkeiten zu ihrem Vorteil ausnützen und ihn betrügen. Fanny Giannatasio, eine der beiden Töchter des Privatlehrers seines Neffen, berichtet von einem gemeinsamen Gasthausbesuch in Baden, in dessen Verlauf sich Beethoven und der diensthabende Kellner in die Haare geraten, weil man sich beim Abrechnen nicht über die Zahl der verzehrten Semmeln einigen kann …
Es hat also nicht nur Beethoven seine Probleme mit den Bedienten, sondern auch diese mit ihm. Wie soll man einen Haushalt in Ordnung bringen, wenn der Dienstgeber ein solch chaotisches Durcheinander anrichtet und trotzdem jeder Gegenstand an seinem Platz bleiben muß? Näheres über dieses »Allegro di confusione«, wie er es selber spöttisch nennt, erfahren wir aus der Schilderung eines Freundes, der Beethoven in dessen Wohnung einen Besuch abgestattet hat.
Er schreibt: »Bücher und Musicalien in alle Ecken zerstreut. Dort das Restchen eines kalten Imbisses, hier versiegelte oder halb geleerte Bouteillen, dort auf dem Stehpult die flüchtige Skizze eines neuen Quatuors, hier die Rudera eines Déjeuners, dort auf dem Piano auf bekritzelten Blättern das Material zu einer noch als Embryo schlummernden Symphonie, hier eine auf Erlösung harrende Korrektur, freundschaftliche und Geschäftsbriefe den Boden bedeckend, zwischen den Fenstern ein respektabler Leib Straccino, ad latus erkleckliche Trümmer einer Veroneser Salami …«
»Hauskorporal« Kathi
Anton Bruckner und Kathi Kachelmaier
Ach, es ist schon zu verstehen, warum die zwei manchmal so schroff aneinandergeraten – der Bruckner und seine Kathi. Sollte die aus ärmlichen Verhältnissen stammende resolute Person wirklich jede Schrulle des Meisters widerspruchslos schlucken? Gut – gegen ein gewisses Quantum Frömmigkeit und Sittenstrenge hat auch sie nichts einzuwenden. Aber was ihr Dienstgeber da an Keuschheitswahn und Dämonisierung der Frau aufführt – das geht denn doch zu weit! Und sie, die Haushälterin Kathi Kachelmaier, ist es, die das Ganze auch noch organisieren muß, die also beispielsweise an Bruckners Beichttagen keinerlei Damenbesuch zu ihm vorlassen darf. Und läßt es sich einmal doch nicht gänzlich vermeiden, so hat sie zumindest dafür zu sorgen, daß auf dem Klavier der weiße Wollhandschuh bereitliegt, den er überstreift, falls er in die mißliche Lage gerät, vor dem Empfang der heiligen Kommunion einem weiblichen Wesen die Hand reichen zu müssen. Dabei hat ihm sein Beichtvater doch längst den Wahn ausgeredet, daß daran etwas Sündiges sein könnte!
Sie hat’s also nicht immer leicht mit ihrem Dienstgeber, die Kathi Kachelmaier aus Wien. Gezählte sechsundzwanzig Jahre steht sie Anton Bruckner zur Seite – buchstäblich bis zu seinem letzten Atemzug. Anfang Jänner 1870 übernimmt die Vierundzwanzigjährige den Job von Bruckners Lieblingsschwester Anna, die bis dahin für den schrullenreichen Single gesorgt hat. Schon in Linz hat die »Nanni« ihm die Wirtschaft geführt, und als der Vierundvierzigjährige am 1. Oktober 1868 seinen Posten als Professor für Harmonielehre, Kontrapunkt und Orgelspiel am Wiener Konservatorium antritt, zieht sie mit ihm in die Reichshaupt- und Residenzstadt und lebt mit ihm unter einem Dach: in einer Zwei-Zimmer-Küche-Wohnung im zweiten Stock des Hauses Währingerstraße 41. Daß Anna vor der Zeit stirbt, trifft ihn schwer. Seinem Gönner, Domdechant Schiedermayr, klagt er sein Leid und schreibt ihm nach Linz: »Ich mache mir die größten Vorwürfe, daß ich sie alle Hausarbeit verrichten ließ. Hätte ich das geahnt, hätte ich die Unvergeßliche um keinen Preis der Welt mit mir nach Wien ziehen lassen, ja ich selbst wäre eher in Linz geblieben. O, könnte ich jetzt einige Zeit weg von Wien! Alles ist mir durch diese traurige Heimsuchung verleidet worden!« Sein Brief schließt mit der Bitte, der Hochwürdige Herr möge ihm die Gnade erweisen, beim Heiligsten Meßopfer dieser seiner schmerzlichen Gefühle zu gedenken.
Auf dem Währinger Friedhof läßt Bruckner die geliebte Schwester bestatten. Da ihrem überraschend frühen Tod längeres Kranksein voranging, sind hohe Kosten aufgelaufen, die Bruckner nicht aus den laufenden Einkünften decken kann. Er wendet sich daher mit einer Bittschrift ans k.k. Unterrichtsministerium und sucht – unter Hinweis auf »den Versuch einer neuen Symphonie«, die er soeben abgeschlossen habe – um ein Künstlerstipendium an. Es dauert etliche Monate, bis die vierhundert Gulden bewilligt werden. Die sieben Gulden Monatslohn, die er für Annas Nachfolgerin aufzubringen hat, muß er also zunächst von seinen kargen Ersparnissen abzweigen.
Diese Nachfolgerin wird ihm von seinen Hausleuten empfohlen, die sich ihrer bereits als »Zuspringerin«, also einer Art Aushilfe, bedient haben. Sie heißt Katharina Kachelmaier, kommt aus einer Wiener Arbeiterfamilie, ist von einfachem Wesen, jedoch nicht – wie häufig behauptet – eine Analphabetin. Auch macht sie ihren Mangel an höherer Bildung mit Urteilskraft und gesundem Menschenverstand wett, mit Humor und Schlagfertigkeit – und vor allem mit einem Übermaß an Fürsorglichkeit, deren der in den Dingen des praktischen Lebens ebenso unerfahrene wie ungeschickte Bruckner dringend bedarf. Da sie ein strenges Regiment führt, gibt er ihr den Scherznamen »Hauskorporal«, und wenn es zwischen den beiden zu Unstimmigkeiten kommt, bringt Bruckner seine Kathi zum Schweigen, indem er sie darauf aufmerksam macht, sie werde durch ihn zu einer »historischen Persönlichkeit« werden. Trotz aller Selbstzweifel ist der vom oberösterreichischen Dorfschulmeisterssohn zum begabten Sängerknaben, begnadeten Organisten, hochgeschätzten Lehrer und genialen Komponisten mehrerer Messen und Symphonien Avancierte sich seines Ranges wohl bewußt.
Solange Bruckner gesund ist, halten sich Kathis Pflichten in Grenzen. Sie teilt nicht mit ihrem Dienstgeber die Wohnung, sondern kommt nur zu bestimmten Stunden in die Währingerstraße 41, um aufzuräumen und vor allem das Frühstück zuzubereiten. Ins Zimmer darf sie erst, wenn Bruckner fertig angekleidet ist: Es wäre mit seiner angeborenen Schamhaftigkeit unvereinbar, einem weiblichen Wesen im Schlafrock gegenüberzutreten. Nur, wenn er das Frühstück einnimmt, darf Kathi neben ihm stehen und ihm die Neuigkeiten des Tages erzählen. Zieht er sich anschließend zum Komponieren zurück, unterliegt auch sie strengstem Zutrittsverbot. Steht, um des ungestörten Durcharbeitens willen, kein mittäglicher Gasthausbesuch auf dem Programm, deponiert Kathi das von ihr vorbereitete Essen auf dem Küchentisch. Gegen 19 Uhr kehrt sie wieder und kredenzt Bruckner die obligate Nudel- oder Schokoladensuppe; das eigentliche Nachtmahl nimmt er zu später Stunde in einem der von ihm bevorzugten Wirtshäuser ein, begleitet von bis zu zehn Seideln Bier. Nur an den Freitagen meidet er das Gasthaus: Kathi sorgt dafür, daß er die Fastenvorschriften einhält und ausschließlich Fleischloses auf den Tisch kommt. An normalen Tagen sind Geselchtes mit Grießknödeln und Kraut, Schweinsbraten, Kalbsbrust und Gulasch seine Leibspeisen; zum Dessert wünscht er sich »Apfelschlangerln«, Milchnudeln oder Zwetschkenknödel.
Als in späteren Jahren einmal Kollege Hugo Wolf zu Besuch kommt und angesichts der üppigen Tafel Bruckner zu dessen »Appetit« gratuliert, unterbricht dieser wutentbrannt das Essen, fordert Kathi zu unverzüglichem Abservieren auf und raunt ihr zu: »So a Unverschämtheit! Den Flegel lassen S’ ma nimmer eina!« Ungebetene Besucher werden von der Haushälterin überhaupt abgewiesen. Bezüglich der einschlägigen Fachausdrücke total überfordert, sagt sie zur Begründung: »Der Herr Doktor darf nicht gestört werden, er ist am Kombinieren!« Hat er wieder einmal – was sie an den abgebrannten Kerzen erkennt – die Nacht hindurch »kombiniert«, stellt sie ihn anderntags zur Rede und fordert ihn auf, auf seine angegriffene Gesundheit Rücksicht zu nehmen. Bruckners Antwort: »Was verstehn denn Sie davon? Komponieren muß man, wenn einem was einfallt!«
Da Bruckner sehr wohl weiß, welche Stütze er an seiner Kathi hat, bereut er die Grobheit, mit der er sie bisweilen zurechtweist. Als er einmal beim Schlafengehen eine Nadel in seinem Nachthemd findet, die sie beim Flicken übersehen hat, verdächtigt er die Ärmste eines Mordanschlags und droht ihr, sie aus dem Fenster zu werfen. Die Folge: Kathi stürzt wutentbrannt aus dem Haus, Bruckner läuft ihr nach, holt sie aus ihrer Wohnung zurück, bittet sie um Verzeihung und wechselt vom sonst üblichen »Sie« zum vertrauten »Du«. Ja, sie sind schon ein wunderliches Gespann, diese zwei: der cholerische Künstler, der seine hantige »Perle«, wenn sie wieder einmal ausrastet, mild zu stimmen versucht, indem er sich ans Klavier setzt und ihr einen gemütvollen »Landler« vorspielt …
In den spärlichen Briefbotschaften, die sich von den beiden erhalten haben, geht man miteinander sachlich, formell und vor allem knapp um: Ersucht Bruckner die »verehrte Frau Kathi«, sie möge ihm »Schnupftabak und Cigarren« nach Steyr schicken, so hängt er seiner Bitte lediglich ein kurzes »Leben Sie wohl!« an, und wünscht Kathi dem »hochwohlgeborn Herrn Docktor« zum »wehrten Geburtstagsfest«, daß ihn »Gott noch recht lange Jahre erhalten möge«, so beschließt sie ihre Zeilen »mit Handkuß von Kathi«. Ausführlicher äußert sie sich nur, als Bruckner schon schwer krank ist und dringend medizinischen Beistand braucht. Sie schreibt in ihrem rührend unbeholfenen Deutsch an einen der behandelnden Ärzte: »Euer Wohlgeboren! Das Befinden von Hr. Docktor steht es nicht am besten. Er ist zeitweiße ganz verloren, und mit den Apetit ist es auch sehr wenig. Ich bitte Hr. Docktor, wen es Ihre Zeit erlaubt, den Hr. Docktor zu besuchen. Achtungsvoll, Kathi.«
Drei Wiener Adressen sind es, an denen Katharina Kachelmaier ihrem Dienstgeber den Haushalt besorgt: die schon erwähnte Währingerstraße 41, zwischen 1877 und 1895 die etwas größere Wohnung im dritten Stock des Hauses Heßgasse 7 und schließlich – in Bruckners letztem Lebensjahr – das ebenerdige »Kustodenstöckl« im Belvedere, das Kaiser Franz Joseph dem unter schwerer Atemnot Leidenden zur Verfügung gestellt hat.
Da wie dort kommt Bruckner mit einem Minimum an Mobiliar aus: Der einzige »Luxus«, den er sich gönnt (und den er auch so nennt), ist das englische Messingbett mit der hochmodernen Federung, das ihm seine Studenten zum Geschenk gemacht haben. Auf Empfehlung eines offensichtlich mit Farbpsychologie vertrauten Kurarztes werden die Wände des Arbeitszimmers blau gestrichen: Es soll nervösen, reizbaren Menschen Beruhigung verschaffen. An Musikinstrumenten sind ein alter Bösendorfer und ein Harmonium mit Orgelpedal vorhanden, die Badewanne steht im Vorzimmer. Fürs Notenschreiben genügen ihm ein einfacher Tisch mit Lederfauteuil, ein Schubladkasten und zwei mit hohen Wachskerzen bestückte Leuchter.
Ein eigenes Kapitel bildet Bruckners Kleiderkasten, in dem seine sackförmigen, knöchelkurzen Drillichhosen und seine der Bequemlichkeit halber ungestärkten Hemden verstaut sind. Einen wunderlichen Kult betreibt er mit seinen berühmt weiten Röcken, die alle einen bestimmten Namen tragen. Kathi braucht also ein gutes Gedächtnis, um den »Blauen«, den »Weichen«, den »Zottel« und den »G’schnürlten« auseinanderzuhalten. Was Kopfbedeckungen betrifft, kann er zwischen dem gewöhnlichen Schlapphut, dem Sonntagshut und dem »Cylinder« wählen. Schuhe kauft er in solchen Mengen, daß seine »Perle« immer wieder einschreiten und manche der Bestellungen rückgängig machen muß. Die übergroßen und stets knallbunten Taschentücher dienen ihm bei starkem Transpirieren als Schweißfänger und bei Gastbesuchen, zu denen er mit Kuchenspenden aus Kathis Backstube anrückt, als Transportmittel.
Ist die Haushälterin nicht zugegen, verfolgt ihn seit den Tagen des Ringtheaterbrandes eine ständige Angst vor häuslichen Katastrophen: Verläßt Bruckner die Wohnung, werden doppelt und dreifach die Sicherheitsschlösser an der vergitterten Glastür überprüft, und mehr als einmal kehrt er auf halber Strecke wieder um – aus Sorge, es könnte eine der Kerzen nicht gelöscht, das Herdfeuer nicht verglimmt oder der Wasserhahn nicht abgedreht sein.
In Bruckners letzten Lebensmonaten, die von einer Vielzahl körperlicher Leiden verdüstert sind, nimmt Kathis Arbeitspensum solchen Umfang an, daß sie außer einer Krankenpflegerin auch ihre Tochter Ludovika einspannen muß: Der Einundsiebzigjährige kann kaum noch einen Schritt ohne Begleitung tun, die früher so reichliche Kost muß auf strenge Diät umgestellt werden, und da es zu dieser Zeit noch kein Telefon gibt, können die Ärzte nur per Boten herbeigerufen werden. Als es am 11. Oktober 1896, fünf Wochen nach seinem zweiundsiebzigsten Geburtstag, mit Bruckner zu Ende geht, ist es Kathi, die, im Fauteuil neben dem Krankenbett sitzend, dem Sterbenden zur Seite ist und ihm den letzten Tee bereitet.
Das Testament, das Anton Bruckner hinterläßt, hat er schon vor drei Jahren aufgesetzt; es sieht seine beiden noch lebenden Geschwister Ignaz und Rosalia als Universalerben vor. Doch auch Katharina Kachelmaier wird mit einem – allerdings spärlichen – Vermächtnis bedacht. Der betreffende Passus lautet: »Meiner Bedienerin vermache ich in Anerkennung der mir geleisteten vieljährigen treuen Dienste einen Betrag von 400 Gulden. Für den Fall, daß sie bis zu meinem Ableben meine Bedienung noch besorgt, soll dieselbe noch weitere 300 Gulden erhalten, so daß sie bei Eintritt dieser Voraussetzung zusammen 700 Gulden bekommt. Ich wünsche, daß dieses Legat von meinen Erben ohne jedweden Abzug sogleich nach meinem Ableben ausbezahlt werde.«
Ignaz Bruckner sorgt dafür, daß alles im Sinne des Verstorbenen abgewickelt wird, und damit die nunmehr einkommenslose Kathi in den verbleibenden fünfzehn Lebensjahren nicht der völligen Verarmung ausgeliefert ist, unterstützt er sie mit laufenden Zuwendungen im Gesamtausmaß von 1000 Gulden. Als sie schließlich zum Sozialfall wird und in geistige Umnachtung verfällt, verschafft er ihr eine Dauerbleibe im Pavillon 15 des Spitals Am Steinhof. Am 23. März 1911, fünf Wochen nach ihrem fünfundsechzigsten Geburtstag, stirbt Katharina Kachelmaier; auf dem Wiener Zentralfriedhof wird sie bestattet. Die Prophezeiung ihres Dienstgebers, sie werde durch ihn zu einer »historischen Persönlichkeit« werden, geht in Erfüllung: Es gibt keinen Bruckner-Biographen, der es unterließe, Kathis Rolle an der Seite des »Musikanten Gottes« zu würdigen.
Krieg in der Küche
Johann Strauß und sein Personal
Die meisten sind auf Postkartengröße zugeschnittene Kartons – einige auch größer, andere kleiner, wieder andere im Visitkartenformat. Die Zeichnungen sind teils mit Bleistift, teils mit Tuschfeder ausgeführt, einzelne leicht koloriert. Es sind durchwegs Karikaturen von Personen, die der Zeichner in für sie typischen Situationen festgehalten hat – die einen en face, die Mehrzahl im Profil. Eine gewisse Flüchtigkeit und Zweidimensionalität der Strichführung lassen darauf schließen, daß die Porträtierten dem Künstler nicht bewußt Modell gesessen, sondern heimlich und in aller Eile von ihm konterfeit worden sind. Einige der Blätter sind auf der Rückseite beschriftet – wir lesen Vermerke wie »Stubenmädchen« oder »Diener«, dazu eine Reihe von Namen, die sich sonstwie der Biographie des Zeichners zuordnen lassen; andere sind entweder gar nicht zu entschlüsseln oder nur mit Fragezeichen. Ihre Identifizierung ist auch dadurch erschwert, daß es keinerlei Datierung gibt. Was am geringsten ins Gewicht fällt, ist das Fehlen der Signatur: Da die achtundachtzig Blätter einen Teil des Johann-Strauß-Nachlasses bilden, der in der Handschriftensammlung der im ersten Stock des Wiener Rathauses untergebrachten Wien-Bibliothek gehütet wird, unterliegt ihre Urheberschaft keinem Zweifel: Der Walzerkönig höchstpersönlich ist es, der hier zum Zeichenstift gegriffen hat.
Es ist eine der vielen Marotten von Johann Strauß Sohn: Es macht dem zu Schabernack Neigenden einen Riesenspaß, Menschen aus seiner nächsten Umgebung, Zeitgenossen, denen er bei dieser oder jener Gelegenheit begegnet, oder Freunde, die er bei sich daheim zu Gast hat, zu karikieren. Jetzt kommt es nur noch darauf an, daß das jeweilige Objekt, wenn der Meister das Resultat seiner Kunst herumzeigt, von den Betrachtern auch erkannt wird. Für Heiterkeit ist also gesorgt. Der Meister des Dreivierteltakts will auch als Schnellzeichner gewürdigt sein.
Johann Strauß ist um die vierzig, als er sein diesbezügliches Talent erkennt, und damit aus dem Talent ein Hobby wird, das auch vor den Augen der Mitwelt bestehen kann, nimmt er eigens Zeichenunterricht: Der renommierte Wiener Landschaftsmaler Anton Hlavaček ist es, der dem siebzehn Jahre Älteren die Kunst des Porträtierens beibringt.
Im Hause Strauß gehen die Berühmtheiten ein und aus, werden zum Kaffee oder zum Essen eingeladen: die Kollegen Brahms und Bruckner, Goldmark und Puccini, die Musiker Rubinstein und Grünfeld, der Klavierlehrer Theodor Leschetizky und der Klavierfabrikant Ludwig Bösendorfer, die Musikkritiker Eduard Hanslick und Max Kalbeck, der Theaterdirektor Franz Jauner, der Schauspieler Alexander Girardi, der Schriftsteller Ludwig Ganghofer, der Bildhauer Victor Tilgner, der Chirurg Theodor Billroth. Daß er sich an diesen allen nicht mit seiner Zeichenfeder »vergreift«, hat einen plausiblen Grund: Es könnte die erlauchte Gesellschaft irritieren, könnte den harmonischen Ablauf der gemeinsam eingenommenen Mahlzeit stören.
Leichter hat es der Karikaturist Johann Strauß mit den Leuten vom Personal: Diener und Gärtner, Kutscher und Stubenmädel, Köchin und Küchenhilfe sind ihm willige Opfer – er braucht sie nur bei ihren täglichen Verrichtungen zu beobachten und mit ein paar Zeichenstrichen einzufangen. Für sie ist es entweder eine Ehre, oder sie bekommen die Prozedur gar nicht mit. Auf diese Weise erfahren wir jedenfalls – zu einer Zeit, da noch nicht so viel photographiert wird –, wie »Peter der Große«, sein langjähriger Diener, wie Gärtner Thomas, wie Stubenmädel Rosa oder wie Köchin Anna ausgesehen haben. Vor allem letztere verdient unser Interesse – wir werden noch von ihr hören. Doch zunächst einmal ein Blick ins Hausinnere: Seit 1878 wohnt der Walzerkönig in der Igelgasse 4.
Alle drei Ehegattinnen – und jede auf ihre Weise – sind mit dem stolzen Besitz auf der Wieden eng verbunden: Jetty hat noch bei der Planung des Neorenaissance-Palais mitgewirkt, Lily hat die Bauarbeiten überwacht, für Adele und ihn wird es der Alterssitz, den Strauß bis zu seinem Tod beibehält. Es ist ein großbürgerlich-grundsolider, zweistöckiger Bau, den Architekt Arnold Heymann zwischen 1876 und 1878 nach den Wünschen des Meisters errichtet hat.
Zu diesen Wünschen zählt unter anderem, daß der leidenschaftliche Billardspieler gleich nach Durchschreiten des Entrées in einen langgestreckten, holzgetäfelten Saal tritt, in dessen Mitte ein mit allen nötigen Spielrequisiten ausgestattetes Billardbrett steht. Sitzgelegenheiten, eine Kartenspielecke und ein Blumentisch bilden das weitere Mobiliar. Strauß nennt es liebevoll »mein Kaffeehaus«. Im angrenzenden Arbeitszimmer dominieren das Stehpult, wo der Meister im Negligé aus dunklem Samt oder hellem Flanell pfeiferauchend seine Noten niederschreibt, sowie das Harmonium, auf dem er Gattin Adele seine jeweiligen Einfälle vorspielt, nachdem er die während des Komponierens in ihre Kemenate »Verbannte« über ein eigens installiertes Läutwerk aus dem Obergeschoß herbeigerufen hat.
Empfängt der »gnädige Herr« Besuch, so treten als erste Wachhund Croquet, ein schlohweißer Bernhardiner, und Faktotum Peter in Aktion, der den Gast in den Billardsaal geleitet. Läßt sich Strauß noch ein wenig Zeit bis zur Begrüßung des Ankömmlings, wird zu einem Rundgang durch den Gartenhof gebeten, wo in einem verschlossenen Pavillon die laufend einlangenden Lorbeer- und Blumenkränze vor sich hin welken und wo im Pferdestall die beiden feurigen Rappen bewundert werden können, die dem Hausherrn für seine Ausfahrten zur Verfügung stehen. Zur Unterhaltung der Gäste wird gern auch die immer wieder kolportierte Geschichte aufgewärmt, daß es in derselben Gasse, nur ein paar Häuser weiter, einen zweiten Johann Strauß gibt: einen Fleischhauer, mit dem der Meister seinen Namen teilt. Laufend kommt es zu den kuriosesten Verwechslungen, und Strauß hat seinen Spaß daran.
Überhaupt geht es bei Besuchen im »Igelheim«, wie der Hausherr sein Domizil zu nennen pflegt, locker zu: Alles Zeremonielle tritt hinter schlichter Herzlichkeit zurück. Was das mit den Gästen einzunehmende Mahl betrifft, so ist bestens vorgesorgt: Die Speisekammer ist ständig prall gefüllt, im Keller lagern die erlesensten Weine und Champagner. Die Rezepte, nach denen gekocht wird, sind ein Erbstück von Johann Strauß’ Schwester »Tante Netti«. Zu den Standardgerichten zählen Altwiener Spezialitäten wie Beuschel mit Knödel, gebackener Rostbraten mit Erdäpfelsalat, Kipfelbröselstrudel mit Zwetschkenröster und Erdäpfelnudeln mit Weinberln. Als traditionelle Vorspeise wird Gulasch gereicht.
Klar, daß bei alledem Gattin Adele Regie führt – mit ebenso kundiger wie leichter Hand. Nur, wenn die Frau des Hauses einmal abwesend ist, kann es geschehen, daß auch der »gnädige Herr« ins Haushaltsgeschehen eingreift. Wie sehr er den Umgang mit dem Küchenpersonal genießt, bezeugt ein Brief, der sich im Strauß-Nachlaß erhalten hat. Adele ist verreist, der daheimgebliebene Ehemann schildert ihr in epischer Breite, welche Kämpfe er mit seiner »Perle« auszufechten hat:
»Meine Adele!
Folgende Geschichte spielte sich bei meinem Nachhausekommen ab: Anna legte mir schlaftrunken (sie hatte die ganze Nacht bis zum frühen Morgen getanzt) ihr Programm für das nächste Sonntagsmahl vor. Sie begann mit dem Vorschlag, ihres Renommees halber das Diner recht fein zu halten. Ich machte ihr daraufhin begreiflich, daß von einem Diner keine Rede sein könne – es solle nur ein Mittagsmahl gewöhnlicher Art sein …«
Dieses bißchen Meinungsverschiedenheit soll für Johann Strauß schon ein Grund sein, seiner Adele einen zwei Seiten langen Klagebrief zu schreiben?