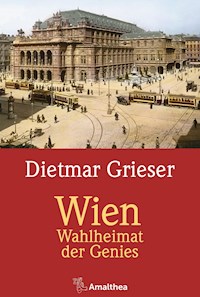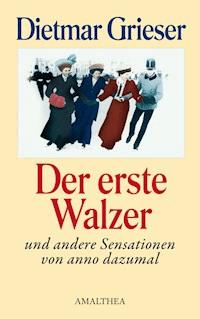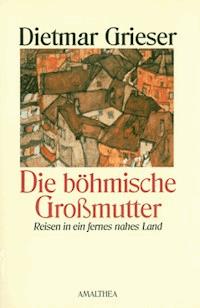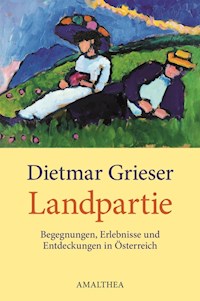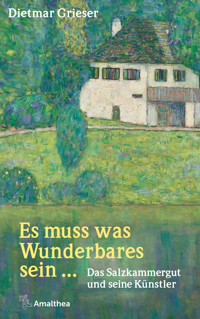Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von Liebesglück und Liebesleid Mutterliebe und Partnerliebe, Eigenliebe, Hassliebe und "verbotene" Liebe – an prominenten Beispielen geht Bestsellerautor Dietmar Grieser der Frage nach: Was macht die Liebe aus? Was können wir aus dem Beziehungsglück, aber auch aus Beziehungskonflikten von anderen lernen? Der 16-jährige Beethoven verliert mit dem Tod der Mutter seine beste Freundin; Thronfolger Franz Ferdinand bietet in puncto Brautwahl sogar dem Kaiser die Stirn; und Richard Gerstls "Amour fou" mit der verehelichten Mathilde Schönberg endet mit Suizid. "Massenmörderin" Agatha Christie lernen wir als hingebungsvolle Gattin, Erich Kästner als verzärteltes Muttersöhnchen kennen. Wer sich für komplizierte Partnerschaften interessiert, kommt an August Strindberg und Frida Uhl, an Bertolt Brecht und Marie Amann oder an Benjamin Britten und Peter Pears nicht vorbei. Wir bewundern Dora Diamant, Franz Kafkas letzte Liebe, ebenso wie den Praterakrobaten Nikolai Kobelkoff, der als "Rumpfmensch" enorme gesellschaftliche Hürden überwinden muss, um sein Familienglück zu finden. Kann das Zusammenleben mit einem geliebten Haustier das menschliche Miteinander ersetzen? Und was hat die Entstehung des US-Kultfilms "Casablanca" mit einer mysteriösen Hochzeitsreise ins Wien von 1938 zu tun? Dietmar Griesers Spurensuche zwischen Liebesglück und Liebesleid – ein Buch zum Verlieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
Was bleibt, ist die Liebe
Von Beethovens Mutterbis Kafkas Braut
Mit 29 Abbildungen
Für Annemarie
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2018 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagmotiv: Pierre Auguste Renoir, In the Garden,
Öl auf Leinwand, 1885 © Bridgeman Images
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH,
Heimstetten
Gesetzt aus der 11,15/14,9 pt New Caledonia
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-136-8
eISBN 978-3-903217-18-8
O lieb’, solang du lieben kannst!
O lieb’, solang du lieben magst!
Die Stunde kommt, die Stunde kommt,
Wo du an Gräbern stehst und klagst!
Diesen 1845 von Franz Liszt für Sologesang und Klavier vertonten Vers des erst 19-jährigen deutschen Freiheitsdichters Ferdinand Freiligrath stellte Maximilian Schell an den Schluss seines 1984 gedrehten Dokumentarfilms Marlene Dietrich – Porträt eines Mythos. Die damals 83-Jährige ließ sich für dieses außergewöhnliche Projekt nicht filmen, sondern war mit Regisseur und Interviewer Schell ausschließlich per Telefon verbunden. Beim gemeinsamen Rezitieren des von ihr hochgeschätzten Liedtextes zeigte sich Marlene Dietrich zu Tränen gerührt.
Inhalt
Vorwort
Mutterliebe
»Sehr geliebt und geacht’«
Beethovens Mutter Maria Magdalena Keverich
Jurka
Ein Kind, drei Bücher
»Mein liebes, gutes Muttchen, Du!«
Ida und Erich Kästner – ein Leben in Briefen
Ohne große Worte
Meine Mutter Elisabeth Grieser und ich
Partnerliebe
»Von meiner Sopherl laß’ ich nicht!«
Die Hochzeit von Reichstadt
Wunder einer Ehe
»Rumpfmensch« Nikolai Basilowitsch Kobelkoff
Der Engel von Korea
Franziska Donner, First Lady aus Wien
Kinderliebe
»Du bist und bleibst mein Licht.«
Ludwig Fels und seine Liebe zum Asylantenkind Udoka
Erste Liebe
Erinnerung an den Eugen B.
Die Muse von Augsburg
Letzte Liebe
»Ein wunderbares Wesen …«
Franz Kafka und seine letzte Gefährtin Dora Diamant
Liebe auf den ersten Blick
Wüstentraum
Wie Agatha Christie und Max Mallowan zueinander fanden
Die kleine Prinzessin
Antoine de Saint-Exupéry und Consuelo Suncin Sandoval
Hassliebe
In der Schlangengrube
August Strindberg am Mondsee
Männerliebe
My Beloved Man
Benjamin Britten und Peter Pears
Menschenliebe
Honorar: ein Vaterunser
Armenarzt Dr. Ladislaus Batthyány
Eigenliebe
Himmelblau
Silvio Berlusconi und Silvio Berlusconi
»Verbotene« Liebe
Die Hölle
Richard Gerstl und Mathilde Schönberg
Liebeskult
Der Tadsch Mahal von Wien
Karl Lanckoronski und Franziska Attems-Heiligenkreuz
Segretario di Giulietta
Glück und Leid eines Museumswärters
Tierliebe
Alle meine Esel
Am Schauplatz von Juan Ramón Jiménez’ Platero und ich
Hingabe
Der gute Mensch von Jena
Wieso sich Goethe von seinem Lieblingsdiener trennte
Habsburgerin h. c.
Kaiserin Zita und Gräfin Korff-Schmising-Kerssenbrock
Fügung
Casablanca und Wien
Hochzeitsreise mit Folgen
Nachwort
Bitte nur Schnittblumen!
Die Liebe des Autors zum Leser und umgekehrt
Literaturnachweis
Text- und Bildnachweis
Namenregister
Vorwort
Für alles und jedes gibt es ein Gütesiegel. Für Bankaktien. Für Büromöbel. Für schottischen Whisky wie für molukkische Gewürznelken. Auch für die Liebe?
Steht die letzte Liebe höher als die erste? Wieso musste die amour fou des Malers Richard Gerstl mit Mathilde Schönberg tödlich enden? Weshalb hat Ludwig van Beethoven seinen Vater so sehr gehasst? Der Fall Erich Kästner wiederum ruft die Psychologen auf den Plan: Wie weit darf Mutterliebe gehen?
Österreichs Thronfolger Franz Ferdinand musste den Widerstand »seines« Kaisers, der Praterakrobat Nikolai Kobelkoff die gesellschaftliche Ächtung körperlicher Missbildung brechen, um zu seinem Eheglück zu gelangen. Benjamin Britten’s Liebesleben – ein Problem für seine Mitwelt? Hier der Altruismus des Armenarztes Ladislaus von Batthyány, dort der Narzissmus eines Silvio Berlusconi; hier die Hassliebe der Strindbergs, dort der Totenkult des Fürsten Lanckoronski, der seiner über alles geliebten Frau mit dem Bau des »Tadsch Mahal von Wien« huldigt. Ohne die Wiener Flitterwochen eines New Yorker Brautpaares anno 1938 gäbe es den Kultfilm Casablanca nicht, ohne den Veroneser Grabhüter Ettore Solimani keine Antwortpost für jene unglücklich Liebenden, die Romeo und Julia ihr Herz ausschütten.
Wer sich für komplizierte Partnerschaften interessiert, kommt an Namen wie Franz Kafka und Bertolt Brecht, wie Agatha Christie und Consuelo de Saint-Exupéry ebenso wenig vorbei wie etwa an der Frage, inwieweit das Zusammenleben mit einem Haustier das menschliche Miteinander ersetzen kann. Für alle diese Konstellationen und viele mehr ist die Kulturgeschichte reich an Beispielen – einigen von ihnen bin ich für das vorliegende Buch nachgegangen.
Mutterliebe
»Sehr geliebt und geacht’«
Beethovens Mutter Maria Magdalena Keverich
Ab einem bestimmten Prominenzgrad dürfen auch die Anverwandten des Hochberühmten damit rechnen, in dessen öffentliche Lobpreisung einbezogen zu werden. Catharina Elisabeth Goethe geborene Textor, wahlweise »Frau Rath Goethe« oder »Frau Aja« genannt, wird in der Geburtsstadt ihres Sohnes gleich zweifach gewürdigt: mit einer Gedenktafel an der Frankfurter Hauptwache und einer Skulptur im Rosarium des Palmengartens. Beethovens Mutter Maria Magdalena geborene Keverich hat es sogar zu einem eigenen Museum gebracht. Das kleine Ehrenbreitstein, heute ein Stadtteil von Koblenz, huldigt der hier am 19. Dezember 1746 Geborenen mit einem Memorial, das nicht nur dem rheinland-pfälzischen Denkmalschutz unterliegt, sondern seit 2002 auch Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal ist.
Ehrenbreitstein – das ist zunächst einmal die alles weitum überragende, über Jahrhunderte dem Erzbistum Trier unterstellte, 1801 von den Franzosen gesprengte und in den folgenden Jahrzehnten zu einer der stärksten preußischen Bastionen ausgebaute Festung, die noch heute massenweise Besucher anzieht. Auch die Liste der an diesem Ort geborenen Berühmtheiten ist lang: Sie reicht von dem Romantikdichter Clemens von Brentano, der mit der von ihm und Freund Achim von Arnim herausgegebenen Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhornin die Weltliteratur eingegangen ist, bis zu dem deutsch-französischen Romancier und Dramatiker Joseph Breitbach, der mit seinem 1962 erschienenen Bericht über Bruno international Aufsehen erregte und bis heute in dem von ihm gestifteten und nach ihm benannten Literaturpreis fortlebt (der unter anderen dem österreichischen Lyriker Raoul Schrott zugesprochen worden ist). Und die Fernsehkonsumenten der 1970er-Jahre werden sich an den Kabarettisten Jürgen von Manger erinnern: Auch er stammt aus Ehrenbreitstein.
Ja, und dann jene Frau, die anno 1770 eines der größten Musikgenies aller Zeiten zur Welt gebracht hat: Ludwig van Beethoven. Man weiß wenig über die kaum 41 Jahre alt Gewordene, hat nie auch nur das kleinste Bild von ihr gesehen und muss sich auch im ihr gewidmeten Ehrenbreitsteiner »Mutter-Beethoven-Haus« mit Marginalem begnügen.
Den Geburtsort des berühmten Sohnes spare ich auf meiner Deutschland-Reise aus, fahre vom Flughafen Köln-Bonn gleich weiter nach Koblenz, verweile auch dort nur wenige Stunden: das Metternich-Geburtshaus am Münzplatz, die Liebfrauenkirche mit dem Mutter-Teresa- und Sophie-Scholl-Fenster. Nicht Maria trägt das Jesuskind im Arm, sondern Josef – ich registriere allgemeine Zustimmung insbesondere unter den jüngeren Touristen, die den Erklärungen des Fremdenführers folgen. Auch die nach dem Revoluzzer Johann Joseph von Görres benannte Buchhandlung ist mir einen Abstecher wert: Hier habe ich vor mehr als 40 Jahren aus meinen Büchern gelesen, es war ein besonders aufmerksames Auditorium, nur einer, noch dazu in der ersten Reihe, schlief auf der Stelle ein. Wie passte das zusammen, dass sich der alte Herr bei der anschließenden Diskussion als der Lebhafteste und Versierteste entpuppte? Er habe es sich, so erläuterte er, zur Angewohnheit gemacht, sich bei Vorträgen tief in das Gehörte zu versenken, um in dieser meditativen Haltung besonders aufnahmefähig zu sein. Von Schlafen keine Rede.
Erinnerungen werden auch an meine Studentenzeit in Münster wach: Beim Anblick eines Koblenzer Firmenschildes mit dem Namen Adenauer gehen meine Gedanken zu jenem hünenhaften Kanzlersohn Paul, der in einem unserer Seminare mein Sitznachbar war. Ganz der Vater, nur zwei Kopf größer. Ein Besuch am Grab Karl Baedekers, der mit dem Reisebericht Rheinreise von Mainz bis Köln 1828 die nach ihm benannten, nachmals weltberühmten Reiseführer begründete, geht sich leider nicht aus, obwohl er für mich als »Literaturdetektiv« (wie man mich zuzeiten genannt hat) so etwas wie ein Säulenheiliger sein sollte.
Am Deutschen Eck, wo die Mosel in den Rhein mündet, besteige ich die Seilbahn nach Ehrenbreitstein. Sie ist ein Überbleibsel der Bundesgartenschau von 2011, befördert 7600 Personen in der Stunde, legt die 890 Meter in fünf Minuten zurück und – weckt in mir patriotische Gefühle: Es handelt sich um eine Konstruktion der Vorarlberger Unternehmensgruppe Doppelmayr, die in ihrer Branche den Weltmarkt anführt.
Nun also Ehrenbreitstein. Keine zehn Minuten Fußweg und das Haus in der Wambachgasse 204 ist erreicht, in dem vor 271 Jahren Beethovens Mutter das Licht der Welt erblickt hat. Bis weit ins 19. Jahrhundert floss hier der Wambach offen an den Bürgerhäusern vorbei, ohne den Fuhrwerken, die sich den Weg zum Rheinufer und zur Fähre bahnten, ein Hindernis zu sein. Das dreistöckige Haus, kleinfenstriges Bürgerbarock mit Giebelfachwerk, ist wieder und wieder verändert, unter Verwendung der alten Bauteile zuletzt totalsaniert worden und seit 2001 ein öffentlich zugängliches Museum. Die zu großen Teilen aus dem asiatischen Raum anreisenden Touristen verbinden ihren Aufenthalt in der Beethoven-Geburtsstadt Bonn gern mit einer Rhein-Fahrt – Stichwort Lorelei! – und einer Visite im »Mutter-Beethoven-Haus«.
Was sie zu sehen bekommen, ist freilich – mangels unmittelbarer Memorabilien – dürftig: Maria Magdalena Keverichs Taufeintrag im Kirchenbuch, ein paar edle Möbelstücke »aus der Zeit«, die obligate Nachbildung der Beethoven-Totenmaske, Erstausgaben von Erasmus, Brentano und Sophie von La Roche, ein Narrenschiff mit den Holzschnitten Albrecht Dürers. Mutter B. begegnen wir nur in Gestalt eines fragwürdigen Phantasieporträts von heutiger Malerhand. Würde dem Besucher nicht ein höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügender Museumsführer mitgegeben werden, der ihn auf 70 reich bebilderten Seiten über die Baugeschichte des Hauses, die Familienchronik der Keverichs und Maria Magdalenas Lebensumstände instruiert, wäre der Abstecher nach Ehrenbreitstein verzichtbar.
Bei den Keverichs dreht sich über mehrere Generationen alles um die Herrschaft der seit dem 13. Jahrhundert in Ehrenbreitstein residierenden Trierer Kurfürsten. Das Zeremoniell bei Hof ist streng, in den »höheren Etagen« sind Französisch und Italienisch die Umgangssprachen. Zur Hofhaltung gehört neben den Regierungsbeamten eine große Zahl von Bediensteten und Lieferanten. Von den 7500 Einwohnern, die die heutige Großstadt Koblenz um 1790 zählt, steht ein Fünftel im kurfürstlichen Dienst. Allen – vom Gesinde über die Musiker bis zum Kanzler – ist eine feste Besoldung sicher, desgleichen freie Unterkunft, wenn nicht gar standesgemäße Dienstwohnung. Bei Krankheit sowie im Alter sind Pensionszahlungen vorgesehen, für die Ausbildung begabterer Kinder Beihilfen.
Während der Regierungszeit des Kurfürsten Johann Philipp von Walderdorff, dem nicht nur »aufrichtige Frömmigkeit«, sondern auch besonderer Kunstsinn und üppige Festesfreude nachgesagt werden, finden im Prunksaal der Philippsburg Konzerte statt, zu denen die erste Musikergarnitur aufgeboten wird. Am 18. September 1763 – da ist Beethovens Mutter ein Mädchen von knapp 17 – treten der siebenjährige Mozart und Schwester Nannerl in Ehrenbreitstein auf. Der sie begleitende Vater hat von den kurfürstlichen Höfen keine allzu gute Meinung: »Meißte besteht in Essen und tapfer trinken.« In seinem Tagebucheintrag vom 18. September hält der geschäftstüchtige Leopold Mozart immerhin lobend fest, man sei »gleich nach der Production mit 10 Louisdor beschenkt worden«.
Auch die Familie Keverich lebt vom Hof. Schon Maria Magdalenas Großvater dient den Kurfürsten als Kutscher, Vater Johann Heinrich ist Hofkoch und steigt 1744 zum Oberhofkoch auf. Der Mann, den die 17-jährige Maria Magdalena heiratet, ist der Leibkammerdiener Johann Georg Leym, der aus seiner ersten Ehe drei Kinder mitbringt und in der zweiten keinen weiteren Nachwuchs hat. Als er 1765 stirbt, lässt er eine kaum 19-jährige Witwe zurück. Maria Magdalena begibt sich wieder in elterliche Obhut, bis sie zwei Jahre darauf – die Quellen sprechen von einer Erstbegegnung in einem Ehrenbreitsteiner Gasthaus – den sechs Jahre älteren Bonner Hoftenoristen Johann van Beethoven kennenlernt und am 12. Jänner 1767 in der St. Remigius-Kirche zu Bonn ehelicht.
Die Verbindung wird von beiden Familien missbilligt: seitens der Beethovens, weil die Braut »nur« als Kammerzofe gedient hat, und seitens der Keverichs, weil der Bräutigam zu geringe Einkünfte hat (die allerdings auf dessen »Drohung« mit Weggang an den zahlungskräftigeren Hof von Lüttich erhöht werden). Der Trauung folgt ein dreitägiger gemeinsamer Aufenthalt bei den Ehrenbreitsteiner Verwandten der Braut, dann wird die erste Wohnung der jungen Eheleute bezogen, in der man sieben Jahre verbleibt: Bonngasse 386 (heute Nummer 20). Es ist der Ort, an dem im dritten Ehejahr Sohn Ludwig auf die Welt kommt. Von den weiteren sechs Kindern, die Maria Magdalena gebiert, überleben nur drei das Säuglingsalter.
Was das Auskommen der Familie betrifft, ist Sparsamkeit geboten: Das nicht unbeträchtliche Vermögen, das Maria Magdalena von ihrer Mutter geerbt hat, ist durch die Machenschaften eines nahen Verwandten verloren gegangen. Auch der Prozess vor dem Ehrenbreitsteiner Schöffengericht, dem sich der wegen Veruntreuung Angeklagte zu stellen hat, bringt der Klägerin nichts von ihrer Mitgift zurück.
Das Wenige, das wir über Beethovens Mutter wissen, über ihr Wesen, ihre Erscheinung und insbesondere ihren Umgang mit dem später so berühmten Spross, verdanken wir den Aufzeichnungen eines Mannes, der der Familie Beethoven eine Zeit lang als Vermieter nahesteht: Es ist der Bonner Bäckermeister Gottfried Fischer. Zunächst einmal hält er fest, »daß Maria Magdalena eine schöne schlanke Person war und keiner was auf sie bringen konnte«. Und er fährt fort: »Madamm v. Beethoven war eine geschickte Frau, sie konnte für Hohen und Nidrige sehr fein, geschickt, bescheiten red und antwort geben, deßwegen würte sie auch sehr geliebt und geacht, sie beschäftig sich mit Nähen und stricken, sie führten Beide eine rechtschaffene friedliche Ehe, sie zahlten alle Virteljahr ihren Haußmieht und gelifferte Brod auf den Tag, und so auch andere, sie war eine Häußliche, gute Frau, sie wußte zu geben, auch zu nehmen, wie jedem gut ansteht, der rechtschaffen denkt.«
Mit 16 Halbwaise: Ludwig van Beethoven
Alles überstrahlend, ja tief ergreifend Beethovens eigene Worte über seine Mutter; der 16-Jährige richtet sie nach deren Tod an einen seiner Wohltäter: Der Augsburger Geistliche Joseph Wilhelm von Schaden hat ihm für die Heimfahrt von Wien nach Bonn mit 35 Gulden Reisegeld ausgeholfen. Ihm schreibt er in seiner Dankadresse: »Sie war mir eine so gute liebenswürdige Mutter, meine beste Freundin; O! Wer war glücklicher als ich, da ich noch den süßen Namen Mutter aussprechen konnte, und er wurde gehört, und wem kann ich ihn jetzt sagen? Den stummen ihr ähnlichen Bildern, die mir meine Einbildungskraft zusammensetzt.«
Auch aus späterer Zeit ist eine Lobpreisung der Mutter überliefert: Beethovens Schüler und künftiger Berater, Ferdinand Ries, erinnert sich: »Von seiner Mutter besonders sprach er mit Liebe und Gemüthlichkeit, nannte sie öfters eine brave, herzensgute Frau. Von seinem Vater sprach er wenig und ungern.«
Gleichwohl nimmt die Rolle, die Johann van Beethoven im Leben des Heranwachsenden einnimmt, in allen Biografien weit größeren Raum ein. Das hat zwei Gründe: Erstens ist es der Vater, der sich um die musikalische Ausbildung des »Söhnchens« kümmert, und zweitens sind der Mutter durch deren frühen Tod nur 16 Jahre des Zusammenseins mit ihrem »Ältesten« vergönnt. An gemeinsamen Unternehmungen der beiden, die den Alltag unterbrechen, ist lediglich eine Reise nach Rotterdam überliefert, die im Übrigen bloß einem Besuch bei den dortigen Verwandten gilt. Die Frage nach Maria Magdalenas etwaiger eigener Musikalität kann nicht beantwortet werden; man weiß lediglich von einem ihrer Vettern, dem Bonner Hofmusikus Johann Konrad Rovantini, der dem jungen Ludwig Geigenunterricht erteilt. Spielt sie auch selbst ein Instrument, oder staubt sie nur das Klavier ab, an dem ihr Mann seinen Sohn zu den ersten Übungen zwingt? Rückt sie nur das Bänkchen zurecht, das der Kleine benötigt, um an die Tasten heranzureichen? Bringt sie nur das Kinderbett in Ordnung, aus dem der von spätabendlichen Wirtshausbesuchen schwer angeheitert heimkehrende Gatte das Büblein aus dem Schlaf zerrt, um ihn mit nächtlichem Klavierunterricht zu foltern? Beethovens Mutter tritt erst wieder aus dem Schatten, der über ihrem Leben liegt, hervor, als sie 1787 schwer erkrankt. Der Sohn, zum ersten Mal auf dem Weg in die künftige Wahlheimat Wien, wird nach Bonn zurückbeordert, trifft die 40-Jährige »in den elendsten Gesundheitsumständen« an.
Maria Magdalena leidet seit der Geburt eines ihrer Töchterchen an schleichender Auszehrung, lässt sich angesichts der andauernden Schmerzen gar zu der Bemerkung hinreißen: »Was ist heiraten? Ein wenig Freud, aber nachher eine Kette von Leiden.« Sie stirbt am 17. Juli 1787 im Alter von kaum 41 Jahren; auch ihr »Ältester« weilt am Sterbebett der »guten liebenswürdigen Mutter« und »besten Freundin«. Ihr Leichnam wird auf dem Alten Friedhof von Bonn beigesetzt.
Bis ihr »Ältester« zum zweiten Mal nach Wien aufbricht und nunmehr endgültig von seiner rheinischen Heimat Abschied nimmt, verstreichen über fünf Jahre. Und wieder ist es Wien, wo ihn die Nachricht vom Hinscheiden eines Elternteils erreicht: Der Vater hat die Mutter nur um fünf Jahre überlebt.
Doch so schlecht sich Vater und Sohn vertragen haben, eines ist klar: Dem Hoftenoristen und Gesangs-, Klavier- und Violinlehrer Johann van Beethoven sowie – mehr noch! – Großvater Lodewyk, der es als Solosänger, Chorleiter und Kapellmeister in Lüttich, Regensburg und Bonn zu großem Ansehen und Einkommen gebracht hat, verdankt Ludwig das für seine Entwicklung zum Musikgenie ausschlaggebende Gen.
Jurka
Ein Kind, drei Bücher
Ich bin keine Mutter, bin nicht einmal ein Vater. Ich sollte mir daher bei der Beurteilung von Elternverhalten Zurückhaltung auferlegen. Doch der Fall Jurka ist dermaßen krass, dass ich ihn Ihnen, meine verehrten Leserinnen und Leser, zur Diskussion stellen möchte. Jurka ist nämlich nicht irgendeines, sondern das Kind einer berühmten Frau, der die Welt (vor allem die deutschsprachige Welt) eine Reihe außergewöhnlicher und außergewöhnlich erfolgreicher Bücher verdankt.
Wer genau ist dieser Jurka? Alexander von Hoyer (Jurka wird er von den Seinen gerufen) ist das einzige Kind der russischen Schriftstellerin Alja Rachmanowa und des aus dem altösterreichischen Czernowitz stammenden Gymnasiallehrers Arnulf von Hoyer.
Über Alja Rachmanowa, mit bürgerlichem Namen Galina Djurjagina, habe ich in mehreren meiner Bücher geschrieben, sie ist also vielen meiner Leserinnen und Leser vertraut. Unter dem nom de plume »Milchfrau in Ottakring«, dem Titel ihres populärsten Werkes, hat die 1898 in der Uralstadt Kasli Geborene von 1933 an ein Millionenpublikum zu Tränen gerührt, und seitdem der Wiener Verlag Amalthea (der auch mein Verlag ist) 1997 meinem Rat gefolgt ist, das jahrzehntelang vergriffene Buch neu aufzulegen, ist die »Milchfrau« wieder in die Herzen ihrer alten und vieler neuer Verehrer zurückgekehrt. Es ist der Schlussteil einer Tagebuchtrilogie, deren weitere Bände, ebenfalls in den frühen 1930er-Jahren unter den Titeln Studenten, Liebe, Tscheka und Tod sowie Ehen im Roten Sturm den Buchmarkt aufgemischt haben.
Alja Rachmanowa schildert in ihren autobiografischen Aufzeichnungen das dramatische Schicksal einer zum Zeitpunkt ihres Debüts 33-jährigen Russin, die einer wohlhabenden Akademikerfamilie entstammt, an der Universität von Perm Philosophie, Psychologie und Literatur studiert, 1919 mit ihren Eltern vor den Bolschewisten ins sibirische Irkutsk flüchtet, in Omsk den aus der Kriegsgefangenschaft entlassenen sieben Jahre älteren Österreicher Arnulf von Hoyer kennenlernt, ihn im Jahr darauf heiratet und 1925, inzwischen Mutter eines Sohnes, aus ihrer Heimat ausgewiesen wird und in der ihres Ehegatten Fuß zu fassen versucht.
235 Schilling Bargeld haben sie in der Tasche, als Arnulf, Galina und der knapp vierjährige Jurka am 17. Dezember 1925 in Wien aus dem Zug klettern. Sie wissen sehr genau, dass sie auch hier, in Arnulfs Geburtsland, einen schweren Weg vor sich haben: Für Intellektuelle wie sie ist im von Arbeitslosigkeit und Not gebeutelten Österreich dieser Jahre kein Platz.
In einem billigen Hotel in der Laxenburger Straße verbringen sie die erste Nacht, dann folgen zwei Monate in einem der Barackenquartiere im sogenannten »Negerdörfel«, einem von der »Gesellschaft für Notstandswohnungen« im Bezirk Ottakring errichteten Auffanglager für Obdachlose mit Kleinkindern.
Nächster Schock: Mit den in Russland abgelegten Prüfungen kann Arnulf Hoyer in Österreich nichts anfangen. Er muss aufs Neue die Universität beziehen und seinen gesamten Studiengang wiederholen. Und wovon wird man in der Zwischenzeit leben?
Da kommt Galina bei einem der gemeinsamen Streifzüge durch die Stadt der rettende Einfall, es mit dem Betreiben eines kleinen Milchladens zu versuchen, und bei einem seiner alten Freunde aus den Tagen der Kriegsgefangenschaft gelingt es Arnulf tatsächlich, das dafür erforderliche Startkapital lockerzumachen. Mit einem Darlehen von 3500 Schilling ausgerüstet, erwirbt man ein leer stehendes Geschäft in der Hildebrandgasse im Bezirk Währing; die dazugehörige Ein-Zimmer-Wohnung gibt der Familie das nötige Dach über dem Kopf. Und während Arnulf sein Universitätsstudium fortsetzt, steht Galina hinter dem Verkaufspult und versorgt die Anrainer mit Butter und Milch, mit Käse und Brot.
Als Ausländerin – Galina ist nicht nur wegen ihres tatarischen Aussehens ein Fremdkörper, sondern spricht auch nur gebrochen Deutsch – wird sie angefeindet, schikaniert, betrogen. Und zwischendurch auch noch von Wiener Emissären des sowjetischen Geheimdienstes observiert. Aber immerhin: Die kleine Flüchtlingsfamilie aus dem Osten hat ihr leidliches Auskommen. Und vor allem: Die anderthalb Jahre von Februar 1926 bis Juli 1927, die die Akademikerin Galina Hoyer geborene Djurjagina als Greißlerin durchsteht, tragen literarische Früchte. Im Zuge der noch 1927 erfolgenden Übersiedlung in Arnulfs Heimatstadt Salzburg kommt man mit dem am selben Ort ansässigen Pustet-Verlag in Kontakt, der sich – ebenso mutig wie weitsichtig – zu einem Projekt bereitfindet, das ab 1931 auf dem österreichischen und bald auch auf dem internationalen Buchmarkt Furore machen wird: Galinas Tagebuchaufzeichnungen, von ihrem Mann ins Deutsche übersetzt, werden gedruckt!
Besonders Milchfrau in Ottakring wird ein Sensationserfolg. Der österreichischen Erstausgabe folgen Übersetzungen in 21 Sprachen, das Autorenpseudonym Alja Rachmanowa wird zum Markenzeichen, Leser in aller Welt (außer in der Sowjetunion) bewundern die explosive Sprachkraft und naive Frische, mit der hier ein heroisches Frauenschicksal dokumentiert ist, und schöpfen daraus Trost und Kraft für die Bewältigung des eigenen Existenzkampfes. Friedrich Hebbels berühmte Worte »Dies Österreich ist eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält« – hier finden sie ihre greifbare Bestätigung, exemplifiziert an der Leidens- und Überlebensgeschichte einer in der Heimat ihres Mannes Wurzel schlagenden Neubürgerin, die sich nicht nur nicht unterkriegen lässt, sondern, gestärkt durch ihren christlichen Glauben, hoffnungsvoll in eine mehr als ungewisse Zukunft blickt.
Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind – und mögen es über weite Strecken auch die ärgsten Albträume sein: 600 000 Exemplare sind bis zum Jahr 1938 von der Milchfrau abgesetzt. Die Hoyers könnten bequem von den Tantiemen leben. Doch das widerspräche ihrem Lebensstil: Arnulf hat endlich eine Stelle als Gymnasiallehrer gefunden, Galina eine Dozentur für Kinderpsychologie. Daneben setzt sie mit stupendem Fleiß ihre Aktivitäten als frischgebackene Erfolgsautorin fort, schreibt Romanbiografien über die Großen ihrer alten Heimat Russland, über Tolstoi und Dostojewski, über Puschkin und Tschechow, über Turgenjew und Tschaikowski, über die Mathematikerin Sonja Kowalewski. Ihr Buch Die Fabrik des neuen Menschen wird als »bester antibolschewistischer Roman der Gegenwart« mit einem französischen Akademiepreis ausgezeichnet.
Sohn Alexander, der das einzige Kind der österreichisch-russischen Jungfamilie bleiben wird, ist knapp vier Jahre alt, als seine Eltern ihr neues Leben in Wien beginnen (dem ab 1927 18 Jahre in der Stadt Salzburg und 1945 die Übersiedlung in die Schweiz folgen werden). Ist schon in dem Band Milchfrau in Ottakring der Entwicklung des Buben reichlich Platz eingeräumt, so widmet ihm die übersensible und überbesorgte Mutter in dessen 16. Lebensjahr ein eigenes Buch, dem sie den Titel Jurka gibt (und den Untertitel Tagebuch einer Mutter).
Es wird – nach der Lektüre des 400 Seiten starken Bandes ahnen wir es schon – nicht Alja Rachmanowas einziges Werk über den geliebten Sohn bleiben: Als Jurka in der Endphase des Zweiten Weltkrieges als Soldat der Deutschen Wehrmacht in der Nähe von Wiener Neustadt fällt, entschließt sich die Autorin zur Niederschrift des zweibändigen Werkes Einer von vielen, und auch als sie und ihr Mann Salzburg verlassen und sich in der Ostschweiz ansiedeln, greift sie ein weiteres Mal zur Feder und setzt ihr Erinnerungswerk mit dem Buch Jurka erlebt Wien fort. Auch wenn mir Rachmanowa-Fans vielleicht widersprechen werden: Einer Mutter, die so sehr an ihrem Kind hängt und dieses durch den Krieg verliert, ist jede noch so überbordende Verherrlichung ihres Sprösslings nachzusehen, einer Buchautorin nicht. Die Verleger mögen es mir verzeihen, aber zu viel ist zu viel.
Beginnen wir mit Jurka, Alja Rachmanowas erstem Versuch, ihre Mutterschaft schriftstellerisch aufzuarbeiten – und zwar die zwölf Monate bis zum ersten Geburtstag ihres Lieblings. 1. Februar 1922, in der Millionenstadt Perm herrscht wie überall im Sowjetreich nicht nur Not, sondern auch ein rauer Ton. Arnulf von Hoyer hat seine hochschwangere Frau im Schlitten zum Gebärhaus gebracht, nur jeden zweiten Tag darf er sie besuchen. Das Spitalshemd ist schmutzig, trägt noch Blutspuren der Vorgängerin; der Gebrauch eines eigenen Leintuches wird als »bourgeoiser« Luxus abgelehnt. Die Verköstigung ist dürftig, eine Bettnachbarin stiehlt Alja ihr Brot. Wieder daheim, fehlt es der jungen Mutter an Milch. »Ich quäle mich fürchterlich, habe Fieber und stechende Schmerzen in der Brust«, trägt sie in ihr Tagebuch ein. »Und dazu diese lähmende Verzweiflung, wenn ich mitansehen muß, wie das arme Kind nach Nahrung lechzt.« Wenigstens können sie sich im Garten hinter dem Haus eine Ziege halten, die einen Teil des Bedarfs deckt. Um zu ein paar frischen Eiern zu kommen, trennt sich Alja im Tauschhandel von einer ihrer Blusen. Das Baby müsste regelmäßig gewogen werden – nur wie? Die Mutter müsste den Kleinen auf den Bauernmarkt tragen – aber bei 30 Grad minus?
Natürlich gibt es auch glückliche Momente: Es ist lange her, dass Alja bei gemeinschaftlichem Singen mitgetan hat; jetzt fallen ihr Abend für Abend alte und auch flugs improvisierte neue Liedchen ein, mit denen sie ihren Liebling in den Schlaf wiegt. Am 73. Tag zittert sie vor Freude, als sie aus Jurkas Lallen zum ersten Mal den Laut »Ma« heraushört, der sich alsbald zum »Mam« steigert. Und wieder ein paar Monate später die ersten selbstständigen Schritte; Alja wäre keine Schriftstellerin, kleidete sie dieses Erlebnis nicht in enthusiastische Worte: »Jurka hielt sich am Rande des Bettes fest, setzte ein paar Mal den einen Fuß vor den anderen und machte dabei ein so ernstes Gesicht, als wäre er sich bewußt, daß er in diesem Augenblick aus der Klasse jener Lebewesen, die sich auf allen vieren fortbewegen, in das einzige Geschlecht derer eingetreten ist, die auf zwei Beinen gehen.«
Abgesehen von seinen Spielsachen sind Mutter und Vater zu dieser Zeit Jurkas einziger »Besitz«, und diesen Besitz verteidigt er. Die Mutter braucht nur nach dem Hut zu greifen und damit zu signalisieren, dass sie für eine Weile das Haus verlässt, da fängt er auch schon bitterlich zu weinen an, desgleichen wenn sich der Vater zum Korrigieren der Schulhefte an den Schreibtisch zurückzieht. Eifersucht lodert auf, wenn die Eltern einander küssen: Augenblicks drängt sich der kleine Kerl zwischen die beiden, zerrt den Vater bei den Haaren, reißt der Mutter die Kleider vom Leib.
Für Jurkas ersten Geburtstag, mit dessen Schilderung das Buch endet, ist ein großes Programm vorgesehen. Zuerst wird der kleine Mann trotz heftigen Widerstandes gemessen, Vater Arnulf trägt »Höhe im Stehen, Höhe im Sitzen, Brustumfang, Kopfumfang, Hals, Wade und Fußlänge« ins Tagebuch ein. Fürs Wiegen hat man sich beim Fleischhauer die große Federwaage ausgeborgt. Und zur eigentlichen Feier wird der »Jubilar« in ein rotes Plüschkleid gesteckt. Die Schuhe, die ihm die Eltern geschenkt haben, betrachtet er nicht als Kleidungsstück, sondern als Spielzeug; die Großeltern rücken mit einem Stehaufmännchen und einem Pfeifchen an; von dem laut quietschenden Gummi-Elefanten des Taufpaten wird sich Jurka sein Leben lang nicht trennen.
»Das Buch über sein erstes Lebensjahr«, so lesen wir in der vorzüglichen Rachmanowa-Biografie von Ilse Stahr, »erschien noch zu Lebzeiten Jurkas. Ob dies den damals Sechzehnjährigen mit Stolz erfüllt hat oder ob es ihm eher peinlich war, das Buch mit dem eigenen Bild in den Auslagen der Buchhandlungen zu sehen, ist nicht bekannt.« Die Autorin gibt lediglich zu bedenken, dass die extrem aufmerksame Mutter durch ihre minutiösen Verhaltensbeobachtungen dem Kind »nur wenig Freiraum ließ«. Und sie fährt fort: »So entwickelte sich Jurka in dem kleinen Kosmos seiner gelehrten Eltern zu einem altklugen, begabten Kind, das sich gern in seine Phantasiewelt flüchtete.« Im Erwachsenenalter, als die Fragen der Mutter dem Sohn zu aufdringlich werden, reagiert dieser manchmal mit dem Diktum »Nachrichtensperre«.
Auch in den Wiener und Salzburger Jahren der Familie Hoyer führt Alja Rachmanowa detailliert Tagebuch, und wieder nimmt darin der über alles geliebte Jurka breiten Raum ein, auch wenn die Mutter nun, ein Jahr lang gezwungenermaßen Geschäftsfrau und anschließend als Autorin an den Schreibtisch gebunden, nicht mehr so viel Zeit hat für ihren Sohn wie zuvor. Sie sorgt sich, seine Erziehung könnte ihr entgleiten, auch der Einfluss der Gassenbuben, mit denen sich Jurka anfreundet, ist ihr ein Dorn im Auge. Grässlich, welche Schimpfwörter er sich da aneignet! Immerhin freut es sie, dass er zweisprachig aufwächst. Der Vater macht ihn mit dem Geschenk eines Radiodetektors glücklich, die Mutter kauft ihm die erste Lederhose. Der Anblick des Stephansdoms raubt ihm die Sprache, Praterausflüge ersetzen ihm die lang entbehrte Natur.
Auch über diese Zeitspanne schreibt Alja Rachmanowa ein Buch, das allerdings erst nach Jurkas Tod erscheinen wird: Jurka in Wien. Was den Buben von seinen Altersgenossen unterscheidet, ist, dass er sich in seinem Zimmer kaum mit Spielzeug umgibt und stattdessen stundenlang die große Landkarte studiert, die vor ihm an der Wand hängt. In der Volksschule in Salzburg reift er zum Vorzugsschüler heran, zum Ausgleich zieht er im Schrebergarten hinter dem Haus Kaninchen auf. Als er ins Gymnasium übertritt, muss er seine Mutter – mit Rücksicht auf die hänselnden Mitschüler – darum bitten, ihn von nun an nicht mehr in die Schule zu begleiten. Glücklich machen ihn die gemeinsamen Ausflüge im Auto: Der Vater hat ein Steyr Cabrio angeschafft.
Auch als Jurka, von seinen Mitschülern »Schura« gerufen, zum Jüngling heranreift, bleibt er unter allzu liebevoller mütterlicher Aufsicht: Zwar wünscht sich Alja Rachmanowa nichts sehnlicher, als eines nicht zu fernen Tages Großmutter zu werden, doch die »Kandidatinnen«, die dafür in Betracht kommen könnten, unterliegen ihrer strengen Beurteilung. Ein Jahr nach Jurkas Matura hat allerdings der Krieg begonnen, und der 18-Jährige, noch kaum zum Jusstudium an der Münchner Universität immatrikuliert, muss zuerst einmal damit rechnen, zur Wehrmacht einberufen zu werden. Der fesche und kraftstrotzende Bursche, schon durch den Dienst bei der Hitlerjugend »vorgeschult«, schließt sich dem NS-Studentenbund an (so wie sein Vater dem NS-Lehrerbund). Die Mutter, aufgrund ihrer starken Bindung an die katholische Kirche von der Reichsschrifttumskammer mit Schreibverbot belegt und somit tief um ihre Zukunft besorgt, wird Mann und Sohn wohl kaum vom »Arrangement« mit dem herrschenden Regime abgeraten haben. Am 22. Juni 1941 tritt Hitler in den Krieg mit Russland ein, Jurka recte Alexander kommt an die Ostfront. Die Mutter hat ihm einen Zettel geschrieben, den er immer bei sich tragen soll: »Vergiss niemals, daß Du alles für uns bist, unsere Freude, unser Glück, unser Leben! Tag und Nacht werden wir an Dich denken, immer werden wir mit Dir sein. Gott schütze Dich!«
Von diesem Tag an gibt es in Alja Rachmanowas Tagebuchaufzeichnungen kaum noch ein anderes Thema als das Bangen um Jurkas Überleben. Hier die glücklichen Momente des Wiedersehens, dort die Schreckensnachrichten von den ersten Gefallenen. Die Kosenamen, die die Mutter ihrem einzigen Kind gibt, werden von Mal zu Mal zärtlicher: Aus Jurka ist längst Schurotschka geworden und aus Schurotschka »unser Katerchen, unser Spätzchen, unser Küken«.
März 1945. Jurka, den Zulassungsbescheid fürs Universitätsstudium in Berlin in der Tasche, vom Dolmetscherdienst inzwischen zur Infanterie abkommandiert, wird zu einem Ausbildungslehrgang in Wiener Neustadt verpflichtet. Die Panzer der Roten Armee stehen schon vor der Stadt, bereiten den Sturm auf Wien vor. Am 1. April – es ist der Ostersonntag – erfahren Galina und Arnulf Hoyer von Jurkas Tod: Er wurde von einem russischen Artilleriegeschoss getötet. Auf dem frisch errichteten Waldfriedhof im niederösterreichischen Bad Erlach wird der 23-jährige »stud. med., Fahnenjunker-Feldwebel und Träger der Ostmedaille« bestattet. Das Sterbebild zeigt ein Birkenkreuz mit Stahlhelm und dem Namenstäfelchen »Hoyer«, dazu das Matthäus-Wort »Ihr wisset, daß in zwei Tagen Ostern ist; dann wird der Menschensohn zur Kreuzigung ausgeliefert werden«.
Ein mit der Familie befreundeter Geistlicher zelebriert den Trauergottesdienst, aus Angst vor den Russen ist an eine Teilnahme der Eltern nicht zu denken. Erst 1947 lassen sie die sterblichen Überreste ihres Sohnes auf den Salzburger Kommunalfriedhof überführen; im selben Grab werden 1970 beziehungsweise 1991 auch ihre eigenen Urnen beigesetzt werden.
Alja Rachmanowa und Sohn Jurka
Alja Rachmanowas eigentliches Gedenken an den über alles geliebten Sohn wird – wie könnte es sich bei einer so leidenschaftlichen Schriftstellerin anders verhalten – abermals ein Buch sein. Einer von vielen wird das zweibändige Werk heißen und 1946 in der Schweiz erscheinen, wohin Alja Rachmanowa und ihr Mann ein Jahr nach Jurkas Tod übersiedelt sind.
»Mein liebes, gutes Muttchen, Du!«
Ida und Erich Kästner – ein Leben in Briefen
Berlin, 1930. Erich Kästner ist ein Mann von 31, vor zwei Jahren ist sein Kinderbuch Emil und die Detektive erschienen, auch mit Gedichtbänden wie Herz auf Taille und Lärm im Spiegel, dem Hörspiel Leben in dieser Zeit sowie zahllosen Beiträgen in so renommierten Organen wie Weltbühne, Vossische Zeitung und Berliner Tageblatt hat er sich deutschlandweit einen Namen gemacht. Der berühmte Max Ophüls führt Regie bei Kästners erstem Film Dann schon lieber Lebertran, und der noch berühmtere Billy Wilder hilft ihm beim Drehbuchschreiben für das nächste Projekt. Es ist ein gutes Jahr für den Autor, auch seine laufenden Einkünfte können sich sehen lassen. Wie ist es da zu verstehen, dass ein arrivierter Mann wie er nach wie vor – so wie einst in seiner Studentenzeit – regelmäßig seine Schmutzwäsche nach Hause schickt? Per Postpaket von Berlin (wo er) nach Dresden (wo seine Mutter lebt)?
Die Antwort ist so einfach wie verblüffend: Ida Kästner selbst ist es, die ihr Leben lang darauf besteht, ihren Sohn zu bedienen, zu verwöhnen, zu bemuttern. In vielen der Briefe, die nahezu täglich zwischen Mutter und Sohn hin und her gehen, kommt das Thema offen zur Sprache; greifen wir jenen vom 17. September 1930 heraus: »Mein liebes, gutes Muttchen! Vielen Dank für die schöne saubere Wäsche. Nun ist der Schrank wieder bummvoll. Hoffentlich hast Du Dich dabei nicht überarbeitet …«
Ja, es ist eine nicht alltägliche Mutter-Sohn-Beziehung, die Ida Kästner mit ihrem einzigen Kind verbindet. Die 1871 im mittelsächsischen Kleinpelsen geborene Ida Amalia Augustin kommt aus kleinsten Verhältnissen, aber sie hat einen starken Willen und einen hellen Verstand. Für eine ihren Anlagen entsprechende Ausbildung fehlt es im Elternhaus an Geld: Ida verdingt sich mit 16 als Stubenmädchen, eine Zeit lang auch als Vorleserin. Die Ehe, die sie mit dem Sattlermeister Emil Kästner eingeht, verläuft freudlos: Nicht er ist es, der im Sommer 1898 Sohn Erich zeugt, sondern der jüdische Hausarzt der Familie, Sanitätsrat Dr. Zimmermann, von dessen Vaterschaft die Öffentlichkeit allerdings erst lange nach dem Ableben des Autors erfahren wird. Ida Kästners übermäßiger Ehrgeiz, ihrem Sohn eine perfekte Mutter zu sein, mag zum Teil dem schlechten Gewissen geschuldet sein, das ihr jener folgenreiche Seitensprung vom Sommer 1898 bereitet.
Fest steht, Erich muss eine erstklassige Ausbildung erhalten, soll nach dem Willen der Mutter Lehrer werden. Doch woher das Geld nehmen für das Internat, für die teuren Bücher, für die Anschaffung eines Klaviers? Was »Schein-Vater« Emil Kästner in seiner Kellerwerkstatt mit der Anfertigung von Portemonnaies und Brieftaschen, mit dem Reparieren von Koffern und Taschen verdient, reicht dafür nicht aus. Also entschließt sich Ida Kästner, obwohl schon über 35, einen Beruf zu erlernen: Sie wird Friseuse. Da sie die Miete für ein Ladenlokal nicht aufbringen kann, bettelt sie dem Innungsmeister die Ausnahmegenehmigung ab, ihre Kundinnen in der eigenen Wohnung im dritten Stock des Hauses Königsbrückerstraße 48 empfangen und frisieren zu dürfen. An der Haustür wird ein Porzellanschild angeschraubt, das »zur Ausführung der einfachsten bis elegantesten Tages-, Ball- und Brautfrisuren« einlädt sowie zu »Kopfwaschen, Ondulation und Gesichtsmassage«. Aus einer der Ecken des Elternschlafzimmers wird also ein Frisiersalon; Sohn Erich, nun schon im Volksschulalter, darf an den freien Nachmittagen das auf dem Küchengasherd erhitzte Wasser für die Kopfwäsche in großen Krügen zu Mutters Arbeitsplatz schleppen.
In seinem Erinnerungswerk Als ich ein kleiner Junge war schreibt der Dichter über jene Zeit: »Meine Mutter blickte weder nach links noch nach rechts. Sie liebte mich und niemanden sonst: Sie war gut zu mir, und darin erschöpfte sich ihre Güte. Ihr Leben galt mit jedem Atemzuge mir, nur mir. Darum erschien sie allen anderen kalt, streng, hochmütig, selbstherrlich, unduldsam und egoistisch. Sie gab mir alles, was sie war und was sie hatte, und stand vor allen anderen mit leeren Händen da. Das machte sie unglücklich. Das trieb sie manchmal zur Verzweiflung.«
Diese Verzweiflung geht so weit, dass sie wiederholte Male durchdreht, auf dem Küchentisch einen Zettel mit den Worten »Ich kann nicht mehr! Sucht mich nicht! Leb wohl, mein lieber Junge!« zurücklässt und wegläuft. Erich, soeben aus der Schule heimgekehrt, rennt dann in Panik durch die Stadt, sucht seine Mutter – und findet sie meistens auf einer der Brücken der Stadt, wo sie bewegungslos auf den Elbstrom hinunterblickt, bereit zum Sprung. Der Bub packt sie, umarmt sie, schüttelt sie, bis sie aus ihrer Starre erwacht, die ersten Schritte macht und ihm schließlich zuflüstert: »Komm, mein Junge, bring mich nach Hause, es ist schon wieder gut.«
Erich Kästner weiß nun – und zwar fürs Leben: Auch wenn seine Mutter ihm solche Schrecknisse antut, ist es er und immer nur er, um den sie sich sorgt, für den sie sich aufopfert, und das heißt wiederum für ihn: Auch er darf sie niemals enttäuschen. So wie sie die vollkommene Mutter sein will, will er der vollkommene Sohn sein. »Meine Mutter war mein bester Freund!«, wird er später Bilanz ziehen.
Solange er noch bei den Eltern in Dresden lebt, steht einer hundertprozentigen Kommunikation nichts im Wege. Mutters Berufsausübung erfolgt ohnehin in der gemeinsamen Wohnung, und daran, dass sich der von ihr ungeliebte Mann in seiner Kellerwerkstatt verkriecht, hat man sich gewöhnt. Was aber wird sein, wenn der Sohn das Elternhaus verlässt, mit 20 zum Studium nach Leipzig und mit 28 als Theaterkritiker, Feuilletonist und Schriftsteller nach Berlin übersiedelt? Wie es zu dieser Zeit unter einfachen Leuten, die über keinen eigenen Telefonanschluss verfügen, Usus ist: Man schreibt einander. Auch Ida