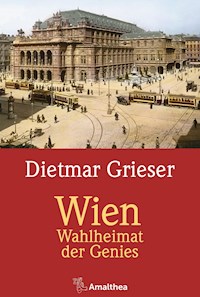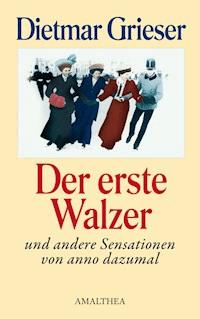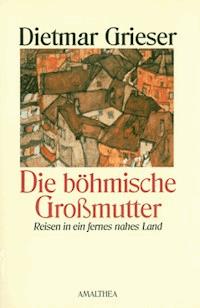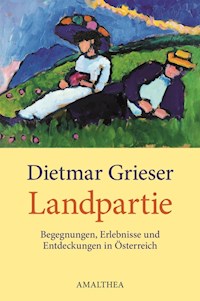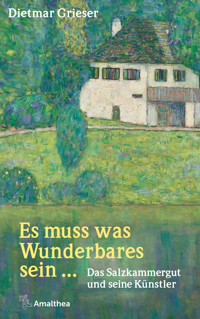Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Dietmar Grieser ist ein Literaturdetektiv der Sonderklasse. Auf seinen Streifzügen durch die Welt der Literatur, der Oper und des Films ist es ihm gelungen, die Urbilder zahlreicher literarischer Figuren von Weltruf zu erforschen. Wer steckt hinter Fausts Gretchen, hinter Thomas Manns Tadzio, hinter Fontanes Effi Briest? Wer sind die Personen, die für Schnitzlers "Leutnant Gustl", für Klaus Manns "Mephisto", für die Lara in Pasternaks "Doktor Schiwago" oder für den Krimihelden James Bond Modell gestanden haben? Auch so unsterbliche Operngestalten wie Sarastro aus Mozarts "Zauberflöte", La Traviata, Madame Butterfly oder Porgy aus Gershwins Oper "Porgy and Bess" sind nicht vom Himmel gefallen, sondern allesamt Menschen nachgezeichnet, die tatsächlich gelebt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Grieser
Sie haben wirklichgelebt
Von Effi Briest bis zu Herrn Karl,von Tewje bis James Bond
Die Kapitel »Ich habe es mir einfach nicht träumen lassen …«, »Epitaph für Tewje«, »Venedig – der Nerven wegen«, »Sorbas und die Folgen«, »Der wohlverdiente Himmel«, »Käthchen en gros«, »Je ne sais pas«, »Die Welt von Porgy und Bess«, »Erinnerungen an Eugen B.« und »Die Schande und das Glück« sind dem Buch »Piroschka, Sorbas & Co«, Langen Müller, München 1978, entnommen, das Kapitel »Der Herr Max« dem Buch »Kein Bett wie jedes andere«, Amalthea, Wien/München 1998. Die Kapitel »Das Duell« und »Der Kurschatten« sind mit freundlicher Genehmigung des NP Buchverlages St. Pölten/Wien dem Buch »Im Dämmerlicht«, 1999, bzw. »Im Rosengarten«, 1996, entnommen. Sämtliche Texte wurden vom Autor für diese Ausgabe durchgesehen und überarbeitet.
1. Auflage Juli 20012., durchgesehene Auflage Oktober 2001
Besuchen Sie uns im Internet unter amalthea.at
© 2001 by Amaltheain der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH,Wien · MünchenAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Wolfgang HeinzelUmschlagmotiv: James Bond, Tewje, Madame Butterfly.(Felix Weinold, Schwabmünchen)Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11/14 Punkt New CaledoniaDruck: Jos. C. Huber KG, DießenBinden: Frauenberger, NeudörflPrinted in GermanyeISBN 978-3-903083-87-5
Für Elfriede
Die Nachwelt wird auf dich als auf ein Muster sehen.
Ewald von Kleist
Zu allen Zeiten haben sich die Schriftsteller Modelleaus dem Leben geholt.
Jakob Wassermann
Der Dichter hat aus einer Privatangelegenheit eineSache der Menschheit zu machen.
Egon Friedell
Das Schriftstellerdasein ist auch dadurch abenteuerlich,daß einem viel und ganz Unvorhersehbares ins Hauskommt.
Martin Walser
Was da, Identität! Will er mich wohl mit seinenIdentitäten in Frieden lassen?
Thomas Mann
Inhalt
Vorwort
Rouge et blanc
Das Duell
Leutnant Gustl Brüsewitz
Epitaph für Tewje
Venedig – der Nerven wegen
Sorbas und die Folgen
Der wohlverdiente Himmel
»Es reizt mich in vieler Hinsicht …«
Lara oder: Leben und Leiden der Olga Iwinskaja
James Bond jagt nicht nur Verbrecher, sondernauch Kolibris
»Der Satan hat’s mir in den Sinn gegeben …«
Käthchen en gros
Der Kurschatten
Wer war Rudinoff?
»Ich brauche Sie sehr notwendig …«
Je ne sais pas
Der Leihonkel
Unter Freunden
Der Herr Max
Mozart nannte ihn Sarastro
Hoher Besuch
Butterfly hat überlebt
Die Welt von Porgy und Bess
Erinnerung an den Eugen B.
Die Schande und das Glück
Lederstrumpf – ein pfälzischer Auswanderer?
Selbst ist der Mann
Vorwort
»Ich habe es mir einfach nichtträumen lassen …«
Der Kellner des Gasthofes ›Zum Elephanten‹ in Weimar, Mager, ein gebildeter Mann, hatte an einem fast noch sommerlichen Tage ziemlich tief im September des Jahres 1816 ein bewegendes, freudig verwirrendes Erlebnis.« Nach 44 Jahren strikter Absenz war »die Hofräthin Witwe Charlotte Kestner, geb. Buff«, Goethes Wetzlarer Jugendschwarm und »Modell« der Werther-Lotte, der Versuchung erlegen (Stefan Zweig nennt es eine »süße Torheit«), den Theseus ihrer Mädchenjahre wiederzusehen: »Lotte in Weimar«. Thomas Mann wird 1939 dem »wahrhaft buchenswerten Ereignis« einen seiner vergnüglichsten Romane abgewinnen.
Dem Kellner Mager, ein »Mann von Kopf«, eine »von jung auf literärische Seele, wohlbelesen und citatenfest«, den die unverhoffte Konfrontation mit dem »geheiligten Wesen« gänzlich aus der Fassung bringt, räumt der Dichter fast das gesamte erste Kapitel ein. »Das Haus hat also die Ehre und die unschätzbare Auszeichnung, die wahre und wirkliche, das Urbild, wenn ich mich so ausdrücken darf –« stammelt der vor Ehrfurcht Erschauernde und unternimmt alles, die Formalitäten der Ankunft künstlich in die Länge zu ziehen, um der »Begegnung mit einer vom Schimmer der Poesie umflossenen Persönlichkeit« das Äußerste abzugewinnen, »die hier waltende Identität und die sich eröffnende Perspective« auszukosten: »Es ist nicht gemeine und unstatthafte Neugier.«
Was also ist es dann?
»Es ist einem beschieden, an der Quelle selbst – man muß es wahrnehmen, man darf es nicht ungenützt –«: Wieder geraten ihm im Taumel der Erregung die Worte außer Kontrolle: »Ich habe es mir einfach nicht träumen lassen.«
Eine lächerliche Figur, dieses Faktotum Mager – auf einer Stufe stehend mit Klatschmaul, Promi-Groupie und Autogrammsammler?
Wohl kaum. Hat es der Thomas-Mann-Leser denn nicht immerhin mit einem Mann zu tun, der auf präzise Kenntnis jenes Werkes verweisen kann, dessen »weltberühmte und unsterbliche Heldin« ihm nun »in voller Leiblichkeit« gegenübersteht? Wie oft haben er und »Madame Mager« sich »bei der Abendkerze mit zerflossenen Seelen über die himmlischen Blätter gebückt«!
Man wird ihn also lediglich in seinem unbändigen Gleichsetzungsdrang bremsen müssen: »Mein lieber Herr Mager, Sie übertreiben gewaltig, wenn Sie mich oder auch nur das junge Ding, das ich einmal war, einfach mit der Heldin jenes vielbeschrienen Büchleins verwechseln.«
Dann aber wird man wohl einräumen dürfen: Es hat schon seinen besonderen Reiz, den Blick auf das reale Alter ego einer literarischen Figur zu richten – was immer von jenem in diese eingeflossen sein mag: ein paar flüchtige Züge nur oder aber der ganze Mensch. Alles ist möglich: vom zarten Farbtupfen bis zur vollkommenen Abbildung, von der behutsamen Verfremdung bis zur radikalen Umformung, von der Kunstfigur bis zum Prototyp. Im Umgang mit dem der Wirklichkeit abgewonnenen Rohmaterial hat der Dichter freie Hand. Ob man ihm dabei über die Schulter blicken darf?
Verlockend ist es allemal: Wie war das doch gleich mit der »echten« Effi Briest? Wer verbirgt sich hinter Ibsens Hedda Gabler, hinter Schnitzlers Leutnant Gustl, hinter Brechts Puntila? Wie kamen Scholem Alejchem zu seinem Milchmann Tewje, Franz Werfel zu seiner Teta Linek, Heinrich Mann zu seinem »Blauen Engel«? Und überhaupt: Was sind das für Menschen, die in die Literatur eingehen – Auserwählte? Oder aber Durchschnitt: Leute wie du und ich? Tun sie selber etwas dazu, oder passiert »es« einfach? Und wie wirkt »es« auf sie zurück? Zahlt ihnen der Schriftstellerverband eine Leibrente, gehen sie fortan stolzerhobenen Hauptes durchs Leben oder im Gegenteil aufs schwerste verunsichert – wie Schlemihl, dem sein Schatten abhanden gekommen ist?
Thomas Manns Tadzio – ist er nicht einem Knaben nachgezeichnet, dem der Dichter in jungen Jahren tatsächlich am Lido von Venedig begegnet ist? Wie wär’s, man nähme seine Spur auf? Die Lara aus Boris Pasternaks »Doktor Schiwago« – auch da hat man irgendwann von persönlichen Nahverhältnissen gehört. Und der verkrüppelte Bettler Porgy aus den Slums von Charleston – richtig: Sogar er hat leibhaftig gelebt. Auf nach Amerika!
In keinem Adreßbuch der Welt wird man die Namen Sara-stro oder Madame Butterfly finden. Nachreisen kann man ihnen trotzdem. In Brechts »Hauspostille« steht eines der seltsamsten Liebesgedichte deutscher Sprache: »Erinnerung an die Marie A.« Die Dame ist kein Phantom. Nur klammern Sie sich nicht an das A – die Augsburger Jugendliebe des Dichters hat in späteren Jahren einen anderen geheiratet. Hinter Nathan dem Weisen lugt der mit Lessing befreundete Philosoph Moses Mendelssohn hervor; die Titelfigur aus Joseph Conrads Roman »Almayers Wahn« ist einem niederländischen Handelsmann namens William Charles Olmeyer abgeschaut, der dem Autor 1887 in Borneo über den Weg gelaufen ist. Und dem Münchner Kaufmannssohn Maximilian Kronberger setzt Stefan George mit der zum Gott erhobenen Gestalt des Maximin ein bleibendes Denkmal.
Kein Berufsstand, der von den höheren Weihen literarischer Verewigung ausgeschlossen bliebe: Als Wilhelm Busch seine »Fromme Helene« kreiert, gehen seine Gedanken zurück zu jener Marie Euler, die ihm in seinen Frankfurter Jahren 1869–1872 den Haushalt besorgt hat. In die Figur des Schwejk fließen mancherlei Züge des Prager Offiziersburschen Strašlipka ein, der demselben 91. Infanterieregiment angehört, in dem auch Autor Jaroslav Hašek seinen Militärdienst ableistet. Und das Mädchen Piroschka, das in Hugo Hartungs Nachkriegsbestseller dem deutschen Austauschstudenten Andreas den Kopf verdreht, hat sogar in Wien Spuren hinterlassen: In der Rodauner Klosterschule Santa Christiana hat Katalin Késöi aus Hódmezövásárhely ihr amüsantes Ungarndeutsch gelernt. In der Gruft des zum Hospital umgewandelten Schlosses im böhmischen Kuks sind die sterblichen Überreste jenes Reitergenerals Spork beigesetzt, den Rilke in der »Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke« aufleben läßt, und der Pariser Prominentenfriedhof Père Lachaise hat seinen Namen von jenem Beichtvater Ludwigs XIV., den Molière in der Gestalt des Lüstlings Tartuffe auf die Bühne bringt.
Eine Zeitungsnotiz gibt Gustave Flaubert den Anstoß zu seinem Roman »Madame Bovary«: Es ist die Nachricht vom Selbstmord einer gewissen Delphine Delamare, Gattin eines Landarztes aus der Gegend um Rouen, die aus Langeweile zur Ehebrecherin wird, sich in Schulden stürzt und schließlich keinen anderen Ausweg sieht, als den Giftbecher zu leeren. Doch was macht der Dichter nicht aus dem banalen »sujet terre-à-terre«! So sehr geht er in dem Stoff auf, daß er bei Abschluß seiner Arbeit, nach der »wahren« Emma Bovary gefragt, ohne jedes falsche Pathos antworten kann: »C’est moi.« Modell und Autor werden eins.
Ähnlichen Ursprungs ist die Fabel von Heinrich Manns »Professor Unrat«; in seiner Autobiographie »Ein Zeitalter wird besichtigt« gibt der Dichter bereitwillig zu Protokoll, wie er 1904 während eines Aufenthaltes in Florenz einer Vorstellung im Teatro Alfieri beiwohnt und in der Pause eine Zeitung kauft: »Darin las ich die Geschichte, die dereinst ›Der blaue Engel‹ heißen sollte … In meinem Kopf lief der Roman ab – so schnell, daß ich nicht einmal bis ins Theater-café gelangt wäre. Ich blieb versteinert sitzen, bemerkte dann, daß der Vorhang wieder offen war, und so viel Beifall aus dankbarem Herzen hat nicht oft ein Schauspiel von einem einzelnen Gast erhalten.«
Auch Robert Musil schöpft aus der Tagespresse: Die Berichte über den Zimmermann Christian Voigt, der 1910 im Wiener Prater eine Prostituierte umbringt, zu lebenslänglichem Kerker verurteilt wird und im Gefängnis von Garsten seine Strafe absitzt, liefern dem Dichter die Konturen für die Figur des Sexualmörders Moosbrugger im »Mann ohne Eigenschaften«. Und der Lyriker Theodor Kramer verwertet die makabre Zeitungsmeldung von dem Burschen, der den Leichnam seines Vaters beiseite schafft, in seinem Zimmer einschließt und auf Eis legt, um die Rente des Verblichenen zu kassieren, zu der Ballade »John Holmes«.
Einer, der bei der »Materialbeschaffung« ganz seinem Glück vertraut, ist James Joyce: Es werde schon auf ihn zukommen, was er brauche. Als ihn für eine Weile eine Arbeitsflaute lahmlegt, reist der Dichter nach Locarno und macht dort die Bekanntschaft einer reichlich abenteuerlichen Dame, die ihn auf »ihre« Insel im Lago Maggiore einlädt. Zwei Monate später sitzt er wieder über dem Manuskript des »Ulysses«: Das Circe-Kapitel beginnt Gestalt anzunehmen …
Die Frage nach dem »Who is who?«, für die einen unstatthafte Neugier und somit verächtlich, für die anderen aufschlußreiche biographische Fußnote und somit legitimer Teil der Datensammlung, wird gestellt, seitdem es fiktive Literatur gibt und Menschen, die sie lesen. Manches davon ist gängiges Lexikonwissen: Hinter Hölderlins Diotima darf man Susette Gontard, die Mutter seiner Frankfurter Zöglinge, vermuten; in der Beatrice der »Divina Commedia« spiegelt sich Dantes florentinische Jugendliebe; von einem Türknauf im alten Bamberg läßt sich E.T.A. Hoffmann zur Märchenfigur des »Apfelweibes« inspirieren. Friedrich de la Motte-Fouqué begegnet als Besatzungsoffizier in der Weserstadt Minden der fünfzehnjährigen Elisabeth von Breidenbauch: Urbild seiner »Undine«; die Kellnerin jener Weinwirtschaft, mit der Schiller während seiner Dresdner Zeit anbandelt, kehrt in »Wallenstein« als »Gustel von Blasewitz« wieder; und daß Lessing seinem Freund Ewald von Kleist, fünf Jahre nach dessen Tod, mit dem Major Tellheim in »Minna von Barnhelm« ein Denkmal setzt, hat für den in die Angelegenheit eingeweihten Verleger Friedrich Nicolai sogar eine »ganz besondere Rührung«.
Nicht immer machen es die Dichter, die sich bezüglich der »Herkunft« ihrer Figuren in der Regel bedeckt halten, den Spurensuchern so leicht wie Arthur Schnitzler: Als der Zweiundvierzigjährige, von einem spektakulären Suizidfall im damaligen Wien aufgeschreckt, sein Schlüsselstück »Das Wort« zu Papier bringt, sind die meisten der handelnden Personen noch am Leben. Um sie zu »schonen«, gilt es also einen Dreh zu finden, die wahren Zusammenhänge zu verschleiern. Bei den Namen fängt’s an: Peter Altenberg wird einfach auf den Kopf gestellt, aus »alt« wird »neu«, aus »Berg« wird »Hof«. Aber auch »Neuenhof« ist dem Dichter noch immer zu deutlich, zu platt. Es wird also weitergedrechselt. Bis er schließlich bei »Treuenhof« landet. Anastasius Treuenhof.
Aus dem Erfinder Robert Fulton, der mit dem um 1800 von ihm konstruierten Unterseeboot Nautilus in die Geschichte der Kriegstechnik eingeht, formt Jules Verne in seiner Romanutopie »20 000 Meilen unter Meer« die Gestalt des Kapitäns Nemo, aus dem westfälischen Pfandleiher Soistmann Berend wird in Annette von Droste-Hülshoffs Novelle »Die Judenbuche« der Jude Aaron, aus dem nach Amerika ausgewanderten Wiener Bildhauer Karl Bitter in Gerhart Hauptmanns Roman »Atlantis« die Nebenfigur des Bonifazius Ritter. Auch Ernst Toller schöpft aus der eigenen Erlebniswirklichkeit: Hinter Sonja L., der Protagonistin seines Dramas »Masse Mensch«, versteckt sich die Frau eines namhaften Münchner Gelehrten, die sich 1918 tatsächlich mit einer Gruppe revolutionärer Arbeiter solidarisiert und dafür ihr Eheglück opfert.
Als im Oktober 1960 im Londoner Old Bailey der Lady-Chatterley-Prozeß abrollt, scheut der Vertreter der Anklage nicht davor zurück, die Titelfigur des inkriminierten Romans mit Frieda von Richthofen, der Gattin des Verfassers, gleichzusetzen. Die Folge: Frau von Richthofens Biograph Robert Lucas läßt die Lebensgeschichte des Lady-Chatterley-Urbildes mit dem Seufzer enden: »Arme Frieda! Vier Jahre nach ihrem Tod saß man über sie zu Gericht …«
Auch von Fällen, wo sich das »Modell« (oder dessen Nachfahren) offen mit der Nobilität literarischer Verewigung brüsten, weiß man: Wenn der Bredstedter Advokat Heinrich Momsen die Kupferstiche aus dem ererbten Familienbesitz abstaubt, tut er es im stolzen Bewußtsein, der Ururenkel jenes »nordfriesischen Kopernikus« Hans Momsen zu sein, der Theodor Storms Schimmelreiter Hauke Haien zum Verwechseln ähnlich sieht; die spanische Bürgerkriegskämpferin Dolores Ibárruri läßt es sich gern gefallen, in Hemingways Roman »Wem die Stunde schlägt« als Partisanin Pilar verherrlicht worden zu sein; die Berliner Dichtermuse Lisa Matthias plärrt, als sie sich dazu entschließt, ihre Memoiren zu schreiben, 325 Buchseiten lang »Ich war Tucholskys Lottchen«; begierig stürzen sich die Medien auf den englischen Bautechniker Ian Potter, nachdem Joanne Rowling ihren Spielkameraden aus Kindertagen in einem Interview als den »originalen« Harry Potter geoutet hat; und in der »Bassa« zwischen Po und Appenin, wo Giovannino Guareschi seine berühmten Schelmenromane spielen läßt, setzt alsbald ein heftiger Wettstreit unter den Dörfern der Region ein: Jedes will, als es um die Identifizierung des »echten« Don Camillo geht, den streitbaren Pfarrer für sich reklamieren … Nur die Frankfurter Bankiersgattin Marianne Willemer, die als Suleika in den »Westöstlichen Diwan« eingegangen ist, lüftet erst lange nach Goethes Tod das Geheimnis ihres Beitrags zur Weltliteratur.
Ganz anders Arnold Schönberg: Höchst unwirsch reagiert er auf die Entdeckung, im »Doktor Faustus« als Vorlage für den wahnsinnigen Komponisten Adrian Leverkühn »benützt« worden zu sein: Als er in einem Supermarkt seines Exilsitzes Pacific Palisades zufällig der Thomas-Mann-Vertrauten Marta Feuchtwanger begegnet, ruft er ihr grimmig nach: »Aber Syphilis hab ich nicht!« Heinrich Böll, sowieso allergisch gegen jeden Versuch, die Begriffe »fiktiv« und »dokumentarisch« gegeneinander auszuspielen, wehrt nach dem Erscheinen des Romans »Gruppenbild mit Dame« alle Fragen nach der Identität seiner Leni mit der lakonischen Auskunft ab: »Sie ist zusammengesetzt aus meiner Erfahrung mit Frauen in Krieg und Frieden.« Und Françoise Sagan, ihrerseits von »Aufdeckern« bedrängt, gibt sich blasiert: »Leute, die mir bereits bekannt sind, in meinen Romanen unterzubringen, würde mich zu Tode langweilen.«
Sie tut gut daran, denn das freimütige Eingeständnis des Schriftstellers, auf nachprüfbare Realien zurückgegriffen zu haben, birgt auch mancherlei Gefahren in sich. Der Bankier Stephan Jakobowicz, dem Franz Werfel die Fabel seiner Emigrantenkomödie »Jacobowsky und der Oberst« verdankte, erhob allen Ernstes den Anspruch, an den Tantiemen des Autors beteiligt zu werden, und um den »Onkel Franz« aus Thomas Bernhards Roman »Die Ursache« wurde monatelang prozessiert. Alphonse Daudet sah sich gezwungen, seinen »Barbarin de Tarascon« mit Rücksicht auf eine ortsansässige Familie gleichen Namens in einen »Tartarin« umzutaufen – so, wie sich ein Jahrhundert später Tennessee Williams von der Heldin seines Schauspiels »Süßer Vogel Jugend« trennen mußte: Das »Original«, die mit ihm persönlich bekannte Tochter eines griechischen Diplomaten, verlangte 50 000 Dollar Schmerzensgeld. Anders Max Frisch: Als er sich nach der Uraufführung seines Schauspiels »Graf Öderland« über manche allzu aktuelle Deutung ärgern mußte, sperrte er den vorliegenden Text für sämtliche Bühnen und entschloß sich zu einer Neufassung.
Die Grenze des Zulässigen ist dort überschritten, wo der Spurensucher leer ausgeht, sich jedoch darüber hinwegsetzt und sich kurzerhand seine eigene Wirklichkeit zurechtzimmert: Edmond Dantès, Alexandre Dumas’ »Graf von Monte Christo«, ist eine durch und durch erfundene Figur – ohne jede Anleihe aus der Wirklichkeit. Der Tourist, der nach Marseille kommt und sich zum Château d’If, dem Schauplatz des Romans, übersetzen läßt, wird gleichwohl in »seine« Kerkerzelle geführt.
Ja, es sind Fälle bekannt, wo sogar der Autor selber beim Phantomspiel kräftig mitmischt. Vier Jahre nach Erscheinen des »Baal« schreibt Brecht eine Art Nachwort, in dem er sich über den Ursprung seiner Figur ausläßt: »Es war ein gewisser Josef K., von dem mir Leute erzählt hatten, die sich sowohl an seine Person als auch an das Aufsehen, das er seinerzeit erregt hat, deutlich erinnern konnten. K. war das ledige Kind einer Waschfrau. Er geriet früh in üblen Ruf. Verschiedene dunkle Fälle, zum Beispiel der Selbstmord eines jungen Mädchens, wurden auf sein Konto gesetzt.
Brecht-Forscher haben sich der Mühe unterzogen, anhand der Augsburger Kriminalakten dem »wirklichen« Baal nachzuspüren. Es ist ihnen nicht gelungen. Inzwischen weiß man auch wieso: weil es diesen Tunichtgut Josef K. niemals gegeben, weil der Dichter die ganze Sache fingiert hat. Welches Interesse er an dieser quasi-historischen »Beglaubigung« haben mochte? Ganz einfach: Ohne realen Hintergrund, so mutmaßte Brecht, könnte sich der »große Baal« zum unverbindlichen Mythos verflüchtigen, das wollte er verhindern, und deshalb das unecht-echte Modell.
Auch das also gibt es.
Der Systematiker, der einmal den »Gotha« der literarischen Figuren zusammentragen und zum Lexikon bündeln wird, hat ein hartes Stück Arbeit vor sich: Sein Terrain ist unabsehbar weit – von der Helene Alving bis zum Großen Gatsby, von Forsyte bis Karamasow, vom Nymphchen Lolita bis zur Irren von Chaillot. Einigen wenigen unter ihnen bin ich gefolgt, lebenden wie toten. Einigen schon vor vielen Jahren, anderen in allerjüngster Zeit. Manchen aus bloßer Neugier, manchen aus alter Anhänglichkeit, manchen – gleich Mager, dem Kellner des Gasthofes »Zum Elephanten« in Weimar – im Überschwang des Entdeckerglücks: »Ich habe es mir einfach nicht träumen lassen.« Träumen Sie mit!
Rouge et blanc
Acht Minuten Fußweg trennen sie voneinander: Ihr Grab liegt in Gruppe 15, seines in Gruppe 21. Die Kameliendame und ihr Dichter. Friedhof Montmartre, Paris.
Parallele und Kontrast halten einander die Waage: Beide vom selben Jahrgang 1824, erreicht Alexandre Dumas ein Alter von 71, Alphonsine Plessis stirbt mit 23. Pompe funèbre hier, schlichte Ornamentik dort: Die Skulptur der Poetengruft zeigt den Verblichenen in voller Mannesgröße, den Gedenkstein der Kurtisane schmückt eine Kamelienblüte aus Porzellan.
Rose-Alphonsine Plessis, die sich in späteren Jahren Marie Duplessis nennen und nach ihrem Tod als Marguérite Gautier beziehungsweise Violetta Valéry in die Roman-, Theater-, Opern- und Filmliteratur eingehen wird, kommt 1824 in einem kleinen Dorf in der Normandie zur Welt. Von der Mutter weiß man so gut wie nichts; der Vater, von Beruf Kesselflicker, ist ein schwerer Alkoholiker. Noch im Kindesalter von einem Landarbeiter aus der Gegend entjungfert, folgt die Minderjährige einem Mann, der dem Alter nach ihr Vater sein könnte, nach Paris, wo sie sehr bald dahinterkommt, daß man sich als Liebesdienerin leichter durchs Leben bringt als mit einer schlechtbezahlten Stelle als Korsettmacherin. Vor allem, wenn man, was die Freier betrifft, wählerisch und nur zahlungskräftigen Männern von Stand zu Willen ist.
Mit der Zeit pendelt es sich bei einer Zahl von sieben Verehrern mit festem Wochenplan ein: Jedem von ihnen bleibt »sein« Tag reserviert – ein präzis funktionierendes Syndikat der Lust. Auch der bejahrte Graf Stackelberg, in seiner aktiven Zeit Gesandter der russischen Botschaft in Paris, muß zur Kenntnis nehmen, daß all die üppigen Geschenke, mit denen er seinen Schützling überschüttet, nicht dazu ausreichen, sie von der »Konkurrenz« fernzuhalten.
Von Alphonsines frappanter Ähnlichkeit mit seiner frühverstorbenen Tochter fasziniert, will er die Zwanzigjährige von ihrem lasterhaften Lebenswandel befreien und zur Monogamie überreden – da tritt abermals ein neuer Galan auf den Plan. Diesmal handelt es sich um einen Gleichaltrigen: Alexandre Dumas ist – so wie sie – gerade zwanzig geworden. Sohn des Roman- und Theaterschriftstellers gleichen Namens, der mit Werken wie »Die drei Musketiere«, »Das Halsband der Königin« und »Der Graf von Monte Christo« zur ersten Garnitur unter Frankreichs Autoren der Zeit zählt, hat der Filius seine Karriere noch vor sich, sammelt erste Erfahrungen in den literarischen Salons der Hauptstadt, bereist zwischendurch Spanien und Nordafrika, stürzt sich ins Pariser Theaterleben. Und dort, in einer der Proszeniumslogen des »Théâtre des Variétés«, lernt er im Spätherbst 1844 die bildhübsche Alphonsine kennen und spannt sie ihrem betagten Begleiter aus. Es ist ebenjener Graf Stackelberg, der ihr kurz zuvor noch eine Luxuswohnung am Boulevard de la Madeleine eingerichtet sowie eine eigene Karosse und zwei Rassepferde zum Geschenk gemacht hat. Dumas zieht mit seiner Geliebten aufs Land, die Schwindsüchtige braucht unbedingt frische Luft. Doch auch diese Verbindung ist nicht von Dauer: Nach nur einem Jahr – Trennungsgrund: Eifersucht – gehen die beiden auseinander, Alphonsine (die sich mittlerweile, eine adelige Herkunft vortäuschend, Duplessis nennt) fällt wieder in ihr gewohntes Mätressendasein zurück. Die Dichter Alfred de Musset und Eugène Sue erfreuen sich ihrer Gunst ebenso wie der Klaviervirtuose und Komponist Franz Liszt, der sich gerade von der Mutter seiner drei Kinder, der Gräfin Marie Cathérine d’Agoult, losgesagt hat. Die schnöde Verlassene, deren jüngere Tochter Cosima später Richard Wagners Frau werden wird, rächt sich an dem untreuen Liszt, indem sie – unter dem männlichen Pseudonym Daniel Stern – einen Roman herausbringt, der deutlich autobiographische Züge trägt.
Alphonsine schert dies alles wenig, in ihrem Salon herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, vielleicht ahnt die immer wieder von Schwächeanfällen Heimgesuchte, daß ihre Tage gezählt sind. Apropos Tage: Zu ihrem zweifelhaften Ruhm trägt unter anderem auch jener delikate Tick bei, sich stets eine frische Kamelienblüte ans Dekolleté zu heften – an 25 Tagen im Monat eine weiße, an den restlichen fünf eine rote. Ihre Liebhaber sollen wissen, woran sie mit ihr sind – ein ebenso poetisches wie drastisches Signal. Madame Bar - jon, die Blumenhändlerin in der Rue de la Paix Nr.14, hat für ihre Stammkundin stets das Gewünschte auf Lager.
Am 5. Februar 1847, nicht einmal 23 Jahre alt, stirbt Alphonsine Plessis in ihrem Liebesnest am Boulevard de la Madeleine Nr. 11; es handelt sich um dasselbe Haus, das auch für Genüsse anderer Art berühmt ist: In den unteren Stockwerken stellt die Schokoladefabrik »Zur Marquise de Sévigné« ihre Spezialitäten her.
Ob unter den Verehrern, die Alphonsine Plessis auf ihrem letzten Weg das Geleit geben und ihrer Bestattung auf dem Friedhof Montmartre beiwohnen, auch Alexandre Dumas ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wäre er für sein Fernbleiben entschuldigt, denn Dumas tut ungleich mehr als all die anderen, die ihrem Sarg nur ein Schäufelchen Erde nachwerfen: Er macht sie unsterblich, indem er sich noch in ihrem Todesjahr an den Schreibtisch setzt und ihrem Andenken mit einem Roman huldigt, der zu einem der größten Publikumserfolge des 19. Jahrhunderts werden wird: »La Dame aux Camélias«. Es ist die nur mäßig verschleierte Geschichte der lungenkranken Marguérite Gautier, die aus Liebe zu dem sie umwerbenden Gesellschaftstiger Armand Duval ihren bisherigen Lebenswandel aufgibt, jedoch von dessen Vater bedrängt wird, mit Rücksicht auf den guten Ruf der Familie den Sohn »freizugeben«, daraufhin wieder in ihr früheres Milieu zurückkehrt und den verzweifelt Fallengelassenen erst auf dem Sterbelager über ihr heroisches Liebesopfer aufklärt.
Dumas legt seinen Roman nicht als schlüpfrig-schwüle »chronique scandaleuse« an, sondern entscheidet sich für ein Sittenbild mit sozialkritischem Einschlag, das bei aller Melodramatik der Handlung auf eine flammende Verteidigung des neuen Typus »ehrbare Dirne« hinausläuft: Seine Sympathie gilt nicht der verlogen-dünkelhaften »guten Gesellschaft« (der er selber angehört), sondern der sich selbstlos aufopfernden Liebenden aus der »demi monde« (ein Begriff, den Dumas als erster in die Literatur einführt).
Armand Duval – das ist niemand anderer als er selbst, hinter Marguérite Gautier verbirgt sich seine Kurzzeitgeliebte Mademoiselle Plessis, und das Boudoir in der Rue d’Antin Nr. 6, mit dessen Schilderung die Romanhandlung einsetzt, ist mit Alphonsines Wohnung am Boulevard de la Madeleine identisch. Für die Versteigerung ihres Nachlasses gibt es übrigens einen prominenten Zeugen: Alexandre Dumas’ dreizehn Jahre älterer englischer Kollege Charles Dickens, der seine Arbeit am »David Copperfield« unterbrochen hat, um in Paris frische Kraft zu tanken, befindet sich, auf das spektakuläre Ereignis aufmerksam geworden, unter den Zaungästen der denkwürdigen Auktion.
Die französische Erstausgabe des Romans umfaßt zwei Bände und erscheint 1848, also nur wenige Monate nach dem Tod der Protagonistin; zwei Jahre darauf folgt in einem Wiener Verlag die deutsche Übersetzung – zunächst noch in strenger Anlehnung an den Originaltitel: »Die Dame mit den Camelien«. Erst mit Otto Flakes neuer Version anno 1907 kommt es zu der griffigeren Variante »Die Kameliendame«, und bei der wird es wohl ein für allemal bleiben.
Gleich seinem Vater beherrscht auch Alexandre Dumas fils beide Sparten: die dramatische wie die erzählende, und so verstreichen keine vier Jahre, bis »La Dame aux Camélias« auch die Bühne erobert. Die Premiere am 2. Februar 1852 im Pariser »Théâtre Vaudeville« wiederholt, ja übertrifft noch den Erfolg der Buchausgabe, und da sich unter den vielerlei Gästen von auswärts, die der Aufführung beiwohnen, auch der neununddreißigjährige Giuseppe Verdi befindet, der – nach Erfolgen wie »Nabucco«, »Ernani«, »Macbeth«, Luisa Miller«, »Rigoletto« und »Der Troubadour« – nach einem weiteren Opernstoff Ausschau hält, ist es nur einen Schritt zur Vertonung des Kameliendame-Sujets: Francesco Piave, der Hausautor des Teatro la Fenice in Venedig, der schon mehrfach mit Verdi zusammengearbeitet hat, erhält den Auftrag, Alexandre Dumas’ Schauspiel in ein Libretto umzuwandeln, wobei die Handlung im großen und ganzen der des Originals folgt und nur die Namen der auftretenden Personen ausgewechselt werden. Aus Marguérite Gautier wird eine Violetta Valéry, aus Vater und Sohn Duval ein Georg und Alfred Germont, und der blumige, nur scheinbar romantische Stücktitel »La Dame aux Camélias« weicht dem schärferen »La Traviata«, obwohl sich durch das Motiv der »vom rechten Wege Abgekommenen« ein kritisch-moralisierendes Element einschleicht, das eigentlich der heroisierenden Parteinahme für die Hauptfigur diametral zuwiderläuft. Erst der Film – all den 33 Kinoversionen voran: George Cukors 1936 gedrehte Fassung mit Greta Garbo, Robert Taylor und Lionel Barrymore – greift wieder auf den Originaltitel zurück, und auch wenn es eines Tages in keinem Blumenladen der Welt mehr Kamelien zu kaufen geben sollte, weil der von dem auf die Philippinen ausgewanderten mährischen Jesuiten Georg Joseph Kamel um 1700 entdeckte und nach ihm benannte Zierstrauch von anderen und modischeren Gewächsen verdrängt sein wird: Der Kameliendame ist ein ewiges Leben gewiß.
Das Duell
»Alles erledigte sich rasch, und die Schüsse fielen. Crampas stürzte. Innstetten, einige Schritte zurücktretend, wandte sich ab von der Szene.«
Das Duell.
Das berühmte Duell aus Effi Briest.
Ehemann und Nebenbuhler zielen aufeinander.
»A tempo avancierend und auf zehn Schritt Distanz.«
Keine fünf Druckzeilen in Theodor Fontanes Roman – es scheint, als habe sich auch der Dichter das über dem Vorgang waltende Prinzip äußerster preußisch-militärischer Knappheit zu eigen gemacht.
Ort der Handlung: eine »Stelle zwischen den Dünen« am Ortsrand der hinterpommerschen Kreisstadt Kessin, »hart am Strand«, dort, wo der vorderste Sandhügel einen Einschnitt hat und den Blick aufs Meer freigibt. »Überall zur Seite hin standen dichte Büschel von Strandhafer, um diesen herum aber Immortellen und ein paar blutrote Nelken.«
Auf den Landkarten wird man dieses Kessin vergebens suchen: Es ist Fontanes Erfindung. In Wirklichkeit denkt der Dichter an Swinemünde, den renommierten Badeort an der Ostsee, den befestigten Vorhafen von Stettin.
Bevor Effi Briest in Buchform auf den Markt kommt, bringt die Deutsche Rundschau den Roman in sechs Fortsetzungen als Vorabdruck: von Oktober 1894 bis März 1895. Sie ist zu dieser Zeit eine der führenden Kulturzeitschriften im Reich, die Veröffentlichung erregt entsprechend großes Aufsehen, Fontane erhält eine Menge Post. In einer seiner Antworten deckt er die Hintergründe der Fabel auf:
»Es ist nämlich eine wahre Geschichte, die sich hier zugetragen hat, nur in Ort und Namen alles transponiert. Das Duell fand in Bonn statt, nicht in dem rätselvollen Kessin, dem ich die Szenerie von Swinemünde gegeben habe. Crampas war ein Gerichtsrat, Innstetten ist jetzt Oberst. Effi lebt noch, ganz in Nähe von Berlin.«
Kann es da ausbleiben, daß Neugierige sich sogleich auf die Suche nach den wahren Fakten machen – vor allem in Bonn? Doch weder die Heimatforscher noch die Fontane-Experten gelangen ans Ziel: In keiner der örtlichen Zeitungen findet sich rund um das bewußte Datum – als Termin des Duells steht der 27. November 1886 fest – auch nur der kleinste Hinweis auf ein Ereignis dieser Art, das sich in oder um die Stadt Bonn zugetragen hätte.
Dafür berichtet der Berliner Korrespondent der Bonner Volkszeitung am 3. Dezember 1886:
»Vergangenen Samstag fand hier ein Duell zwischen einem höheren Offizier und einem Amtsrichter aus Düsseldorf unter schweren Bedingungen statt. Der Letztere erhielt einen Schuß in den Unterleib und starb am Mittwoch.«
»Hier« – das heißt also: in Berlin.
Fontane hat, indem er das Ereignis in seinem Roman in den Phantasieort Kessin und in seiner Briefantwort nach Bonn verlegt, gleich doppelt geflunkert, und es ist leicht zu erraten, warum: Zwei seiner Protagonisten, nämlich die Urbilder von Geert Innstetten und Effi Briest, sind am Leben, noch dazu in nächster Nähe – da will er jede Enthüllung der tatsächlichen Umstände vermeiden, scheut die Peinlichkeiten indiskreter Verifizierung, führt die Spurensucher in die Irre.
Statt ins heimatliche Berlin ins davon weit entfernte Bonn.
Wieder sind es zwei Freundesbriefe, die näheren Aufschluß geben. Der eine geht an Marie Uhse, der andere an Clara Kühnast. Fontane schreibt:
»Es ist eine Geschichte nach dem Leben, und die Heldin lebt noch. Ich erschrecke mitunter bei dem Gedanken, daß ihr das Buch – so relativ schmeichelhaft die Umgestaltung darin ist – zu Gesicht kommen könnte.«
Im zweiten Brief wird er deutlicher:
»Vielleicht interessiert es Sie, daß die wirkliche Effi übrigens noch lebt, als ausgezeichnete Pflegerin in einer großen Heilanstalt. Innstetten, in natura, wird mit nächstem General werden. Ich habe ihn seine Militärcarrière nur aufgeben lassen, um die wirklichen Personen nicht zu deutlich hervortreten zu lassen.«
Das leidige Problem, das Schriftsteller immer dann haben, wenn sie ihre Stoffe der Wirklichkeit entlehnen – und gar zu Lebzeiten ihrer Protagonisten.
Berlin, Winter 1888/89. Theodor Fontane, soeben siebzig geworden, ist zu einer Abendgesellschaft bei Emma von Lessing eingeladen. Im Salon der Frau des Herausgebers der Vossischen Zeitung verkehrt auch das Ehepaar Ardenne: Major Armand von Ardenne und dessen Gemahlin Elisabeth geb. von Plotho. Da er die beiden schon längere Zeit nicht mehr hier angetroffen hat, erkundigt er sich bei der Gastgeberin nach ihrem Verbleib. Und erfährt, was geschehen ist: Herr von Ardenne hat eine ehebrecherische Beziehung seiner Frau aufgedeckt, sich von ihr scheiden lassen, den Nebenbuhler im Duell getötet, nach Verbüßung einer Festungshaft seine militärische Karriere fortgesetzt und schließlich ein zweites Mal geheiratet. Und Exgattin Elisabeth, durch Gerichtsbeschluß ihrer beiden Kinder beraubt, steht nunmehr auf eigenen Füßen, bringt sich fortan als Krankenpflegerin durch.
Theodor Fontane ist von dem, was er da zu hören bekommt, wie elektrisiert, macht es zum Sujet seines nächsten Romans: Effi Briest.
Wir wissen es seit dem Tag, da der 1997 in Dresden verstorbene Physiker Manfred von Ardenne sein jahrelang streng unter Verschluß gehaltenes Familienarchiv geöffnet und dem Literaturhistoriker Hans Werner Seiffert großzügig Einblick gewährt hat: Die Frau, die sich hinter Fontanes Romanfigur verbirgt, ist niemand anderer als Elisabeth von Ardenne, seine Großmutter.
Enkel Manfred selber ist es, der ihr – und zwar am Rande der Feierlichkeiten zu ihrem neunzigsten Geburtstag am 26. Oktober 1943 – die Zunge löst. Angeregt von der Zufallsbegegnung mit einem Neffen des Major-Crampas-Urbildes Emil Hartwich einige Jahre davor (der ihn mit den Worten »Ihr Großvater hat meinen Onkel im Duell erschossen!« in die wahren Zusammenhänge einweiht), beginnt sich Professor von Ardenne für die geheimnisumwitterte Gestalt dieses Mannes zu interessieren, erforscht dessen Biographie und bekommt auf diese Weise eine Schrift in die Hand, in der der an allen öffentlichen Problemen seiner Zeit brennend interessierte Jurist seine aufsehenerregenden sozialhygienischen Ansichten festgehalten hat: Woran wir leiden. Manfred von Ardenne empfindet spontan Sympathie für die fortschrittlichen Gedankengänge des Autors und teilt dies seiner Großmutter in einem Vieraugengespräch mit. Und er tut noch ein übriges – versichert die alte Dame, nun ganz offen auf die seinerzeitige Affäre anspielend, seiner uneingeschränkten Solidarität: »Ich hätte damals ganz genauso gehandelt wie du!«
Dieses Bekenntnis ist für die neunzigjährige Elisabeth von Ardenne das Signal, endlich ihr lebenslanges Schweigen zu brechen.
Tief bewegt von der offenherzigen Rede ihres Enkels, bringt sie wenige Tage später ein Päckchen zur Post und macht es Manfred zum Geschenk. Es ist jenes Briefbündel aus den Jahren 1882 bis 1886, das den Zweikampf vom 27. November 1886 ausgelöst hat: Emil Hartwichs Korrespondenz mit Elisabeth von Ardenne.
Im Begleitschreiben an den Enkel fügt sie hinzu:
»Du bist der einzige, der mich danach gefragt hat. So sollst Du auch das wenige bekommen, das ein hartes Schicksal mir von dem strahlenden Menschen gelassen hat. Daß Dir die Freude wurde, durch einen Verwandten in ein gerechtes gutes Licht den Mann gerückt zu sehen, der unendliches Leid, aber auch unendliches Glück in mein Leben gebracht hat, war mir ein Geschenk. Deshalb lege ich Euch die leichten Briefe bei, die einen Einblick gewähren in den Frohsinn und die Unbeschwertheit unseres Sonnendaseins damals.«
Schon bald werden über Elisabeth von Ardenne und ihr literarisches Alter ego Effi Briest die ersten wissenschaftlichen Abhandlungen, später sogar ganze Bücher erscheinen, und unter dem Titel Das Duell wird auch das Fernsehen das »Doppelleben« dieser bemerkenswerten Frau nachzeichnen.
Ebenso sind Identität und Biographie des Geert-Innstetten-Urbildes Armand von Ardenne geklärt: jenes Mannes, der, plötzlich mißtrauisch geworden, mit einem Nachschlüssel die Geheimschatulle seiner Frau aufbricht, die Briefe des Nebenbuhlers und damit dessen »verbotene« Beziehung entdeckt, die Ehebrecherin zur Rede stellt, sich von ihr scheiden läßt, sie unter Mitnahme der beiden Kinder verstößt und den anderen im Zweikampf tötet.
Nur dieser andere – Major von Crampas im Buch, Amtsrichter Emil Hartwich in Wirklichkeit – bleibt weiter im Dunkel der Geschichte.
Wer also ist dieser »Damenmann«, wie Fontane ihn nennt, dieser »Mann vieler Verhältnisse«?
Am 9. Mai 1843 kommt er in Danzig zur Welt; sein Vater, der Geheime Oberregierungs- und Baurat Emil Hermann Hartwich, wird es in vorgerückten Jahren bis zum Eisenbahnpräsidenten bringen, als Initiator der Berliner Stadtbahn geht er in die Baugeschichte der Reichshauptstadt ein. In Berlin absolviert der Junior das humanistische Gymnasium, an der Universität Heidelberg studiert er Jurisprudenz, nach seiner Militärzeit bei einem rheinischen Kürassierregiment und Referendarjahren in Berlin tritt er in Köln in den staatlichen Justizdienst ein und landet schließlich als Richter in Düsseldorf.
Hero Jung heißt die Frau, die er mit knapp fünfundzwanzig heiratet; trotz der drei Kinder, die zur Welt kommen, wird es keine glückliche Ehe. Noch hingebungsvoller als in seinen Jünglingsjahren widmet er sich nun seinen Steckenpferden Sport und Malerei. Passionierter Ruderer, gründet er eine Reihe von Sportvereinen; seine Kritik am herrschenden Erziehungssystem und sein vehementes Eintreten für den Sport als Allheilmittel gegen Verweichlichung und Dekadenz wird sogar im preußischen Unterrichtsministerium Widerhall finden und zur Einführung des obligaten Turnunterrichts an den Schulen beitragen. Seinen musischen Neigungen frönt er sowohl als Cellospieler wie als Landschaftsund Porträtmaler; in der Hautevolée, in der der Gesellschaftsmensch Hartwich verkehrt, sind es vor allem die Künstler, deren Nähe er sucht. Aber in einer Garnisonsstadt wie Düsseldorf bleiben auch Kontakte zu den hier stationierten Offizieren und deren Familien nicht aus, und so lernt der inzwischen Vierunddreißigjährige am 6. Jänner 1878 bei einem Abend im Künstlerverein »Malkasten« die zehn Jahre jüngere Frau eines vor einigen Monaten zum 11. Husaren-Regiment nach Düsseldorf abkommandierten Rittmeisters kennen, die ihn vom ersten Augenblick an fasziniert: Elisabeth von Ardenne.
Die Ardennes, ihrerseits seit fünf Jahren miteinander verheiratet, Eltern einer vierjährigen Tochter namens Margot und eines ein Jahr alten Sohnes namens Egmont, sind aus Berlin zugezogen und zählen nun für sieben Jahre (mit einer längeren Unterbrechung, die den Ehemann als Brigadeleutnant nach Metz führt) zu den oberen Zehntausend von Düsseldorf. Zunächst in der Kronprinzenstraße 32 wohnhaft, beziehen sie im Sommer 1881 ein Nobellogis im linken Flügel des Kavalierhauses von Schloß Benrath, und unter den Gästen, die sie in dem prachtvollen Rokokobau mit dem bis ans Rheinufer reichenden Park empfangen, ist auch Emil Hartwich. Die Benrather Tafelrunde, der unter anderem der Maler Wilhelm Beckmann, eine lokale Dichtergröße sowie eine Reihe ausgewählter Regimentskameraden des Hausherrn angehören, trifft sich fast täglich; ob Geburts- oder Namenstage – alles wird gemeinsam gefeiert, auch Weihnachten und die übrigen Feste, und bei besonderen Anlässen legt man historische Kostüme an und ergötzt sich im Stil der Zeit an »lebenden Bildern« und neckischen Scharaden.
Wer sich dabei am übermütigsten gebärdet, sind Elisabeth von Ardenne und Hausfreund Emil Hartwich.
»Mit wachsendem Bangen« sieht Malerkumpan Wilhelm Beckmann (wie er später in seinen Memoiren eingestehen wird) die Katastrophe voraus, »daß ein solcher Verkehr bei einem der Freunde eines Tages die gewaltsam zurückgehaltene Glut der Empfindungen sprengen und die Selbstbeherrschung durchbrechen würde …«
Es folgen Zusammenkünfte zu zweit, es folgen gemeinsame Ausritte, bei denen Emil Hartwich und Elisabeth die Freunde zurücklassen, und es folgen vor allem eine Reihe von Porträtsitzungen in Hartwichs Atelier: Der Verehrer malt das Objekt seiner Verehrung.
Das so entstehende Ölbild wird den beiden Liebenden zum willkommenen Alibi für weitere intime Stelldicheins. Und wenn sie nach außen hin – um der Konvention willen – streng am gebotenen »Sie« festhalten, so sprechen die Briefe, die zwischen Maler und Modell hin und her gehen, eine um so deutlichere Sprache:
»Wenn Sie mich morgen nicht brauchen können«, handelt Hartwich mit Elisabeth den Termin der nächsten Porträtsitzung aus, »werde ich mich den ganzen Nachmittag in meiner Klause verschließen und von dem reizenden gestrigen Abend zehren, der mal wieder ganz nach meinem Herzen war.«
Noch ist das Verhältnis von Ehemann und Nebenbuhler spannungsfrei: Rittmeister von Ardenne bemerkt nicht, wie ihm seine Frau zu entgleiten droht. Wohl aber werden Auffassungsunterschiede zwischen den beiden Männern spürbar – etwa, wenn bei einem der Hausfeste auf Schloß Benrath zu vorgerückter Stunde die Ardenne-Kinder, vom lauten Gesang der Gäste aus dem Schlaf geweckt, im Nachthemd zu der Gesellschaft stoßen, dort freudig begrüßt werden, aber, statt auf die Fragen der Erwachsenen artig zu antworten, ihnen schlaftrunken die Zunge herausstrecken und sich mit einem unwilligen »Bäh!« verabschieden.
Hausherr Armand von Ardenne ist über die Ungezogenheit der beiden Sprößlinge erzürnt und brüllt ihnen nach: »Was für eine Disziplinlosigkeit!« Strafend blickt er dabei seine Frau an, der er, der streng Autoritäre, wohl das Fehlverhalten der Kleinen anlastet. Und Elisabeth entschuldigt sich: »Es tut mir aufrichtig leid.«
Da schaltet sich Emil Hartwich ein: »Was, um Himmels willen, soll daran so schlimm sein? Disziplin lernen die Kinder noch früh genug. Ich habe selbst drei Jungen. Der Älteste hat neulich mein Handexemplar des Strafgesetzbuches mit lauter Strichmännchen illustriert!«
»Das Strafgesetzbuch?« Armand von Ardenne ringt um Fassung. Den auf bedingungslosem Gehorsam bestehenden Offizier und den nachsichtig-liberalen Richter mit den musischen Neigungen trennen Welten.
Am 1. Oktober 1884 tritt Armand von Ardenne, einer neuerlichen Versetzung folgend, seinen Dienst in Berlin an. Zum Adjutanten des Kriegsministers befördert, geht er nun noch mehr in seinen Berufspflichten auf, hat für Frau und Kinder kaum noch Zeit. Gattin Elisabeth trauert den unbeschwert schönen Tagen am Rhein nach – und dem Mann, dem diese schönen Tage in erster Linie zu verdanken gewesen sind: Emil Hartwich. Sind schon in Düsseldorf, wenn man sich gegenseitig einlud, Verabredungen traf, einander Glückwünsche übermittelte oder Dankadressen, laufend Briefe zwischen den Häusern Hartwich und Ardenne ausgetauscht worden, so nimmt die Korrespondenz nun, wo man auch örtlich voneinander getrennt ist, noch an Umfang zu, und vor allem: Absender und Adressat sind jetzt nicht mehr zwei miteinander befreundete Familien, sondern zwei Einzelpersonen, die einander in glühender Leidenschaft zugetan sind. Natürlich können sie – mit Rücksicht auf den Sittenkodex ihrer Zeit und ihres Standes – ihren Gefühlen nicht freien Lauf lassen: Wenn Emil Hartwich das Wort an die ferne Geliebte richtet, tut er es nie mit dem vertrauten »Du«; Anreden wie »Gnädigste und Hochverehrteste«, »Sehr geehrte Herrin« oder »Liebe Frau Else« sind schon das Äußerste an Intimität, das man riskiert. Wir müssen also, wenn wir die sich anbahnende Katastrophe begreifen wollen, lernen, zwischen den Zeilen zu lesen.
Es sind die ersten Weihnachten, die man nicht miteinander verbringt: Elisabeth fertigt in Berlin ein Geschenk für Hartwich an, und der bedankt sich überschwenglich:
»Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das stille Glücksgefühl, daß jemand mir in weiter Ferne durch seiner Hände Werk eine Freude zu bereiten suchte. Das haben Sie gewiß geahnt. Obgleich ich nie einen Weihnachtswunsch habe, ist es Ihnen doch gelungen, eine Lücke auf meinem Schreibtisch zu füllen.«
Hartwichs Gegengeschenk ist ein Bild von seiner Hand. Es zeigt eine Moorlandschaft in der Nähe von Bonn – der melancholische Charakter des Kunstwerks soll die düstere Seelenverfassung seines Schöpfers widerspiegeln, unter der dieser seit dem Weggang der Geliebten leidet:
»Der Boden schwindet einem unter den Füßen, und manchmal glaubt man, das ganze Land würde mit Baum und Strauch versinken. Wenn meine Stimmung besser ist, male ich Ihnen etwas Freundlicheres.«
Aber selbst wenn ihn der Trennungsschmerz zu übermannen droht, versteckt sich Hartwich konsequent hinter dem unverfänglichen »Wir«:
»Daß ich Ihnen gerade heute schreibe, hat seinen guten Grund. Heute vor sieben Jahren war jener denkwürdige ›Malkasten‹-Abend, den das Schicksal ausersehen hatte, die Familie von Ardenne mit Hartwich zusammenzufügen. Aber die Menschheit kommt mir vor wie die Scherben in einem Kaleidoskop; jede Drehung der Erde läßt das alte Bild zusammenfallen und erzeugt ein neues, das kaum wiederzuerkennen ist und mit dem alten nur die bunten Scherben gemeinsam hat.«
Auch Hartwichs Silvesterbrief ist scheinbar an die gesamte Familie gerichtet, doch eben nur scheinbar. Warum sonst enthielte Elisabeth ihn – ebenso wie alle anderen – den Ihren vor und verschlösse ihn in ihrer Geheimschatulle? Hartwich schreibt:
»Wenn ich auch unverantwortlich lange geschwiegen habe, so glauben Sie bitte nicht, daß ich nicht tief und schmerzlich die Lücke empfände, die mir das Scheiden der Familie Ardenne gebracht hat, und daß ich nicht wüßte, wie dankbar ich gerade Ihnen sein muß, deren Duldsamkeit und Nachsicht es mir ermöglichte, so oft die Gastfreundschaft Ihres Hauses zu mißbrauchen.«
Ein noch gewaltigerer Gefühlsstau entlädt sich in der Glückwunschadresse, die Hartwich zu Elisabeths Geburtstag losschickt:
»Was ich Ihnen alles wünsche, brauche ich Ihnen nicht herzuzählen: Sie wissen, wie aufrichtig ich es mit Ihnen und den Ihrigen meine. Ich will Ihnen bloß hinzufügen, daß meine Freundschaft an Treue und Innigkeit gewonnen hat. Die Trennung ist immer aber auch ein Prüfstein dafür, ob man jemandem wahrhaft ergeben ist. Ich glaube, daß ich meine Probe bestehen werde.«
Mit Verspätung sendet Hartwich der Angebeteten einen Stoß Photographien nach Berlin; sie sind bei einem der Kostümfeste im Düsseldorfer Ständehaus aufgenommen worden, wo die beiden als Ritterfräulein und Ritter posiert haben. Beziehungsvoll schon der Titel der Scharade: »Ein Schritt vom Wege«. Und beziehungsvoll auch Hartwichs Begleitschreiben:
»Halten Sie mich nicht für selbstlos, wenn ich sie Ihnen zu Füßen lege. Es ist der reine Egoismus, bei Ihnen durch äußere Zeichen die Erinnerung an Düsseldorf wachzuhalten.«
Hartwich wie Elisabeth sind sich darüber im klaren, daß sie beide an den falschen Lebenspartner geraten und nun Gefangene ihrer einmal eingegangenen Beziehungen sind. Was bleibt ihnen anderes übrig, als sich zu arrangieren?
Hartwich scheint darin der Erfolgreichere zu sein, und er weiß seiner Frau dafür ausdrücklich Dank. So nennt er sie einmal »die Gute«, ein andermal »die Vernünftige«, und er kommt dabei zu dem Schluß:
»Wir sind auf dem schönen Standpunkt angelangt, daß wir uns beide stets das Beste gönnen, ohne einer den anderen in seinem Tun zu beschränken. Wir Deutschen sind meistens zu spießbürgerlich und zu kleinlich.«
Vorsicht ist also geboten – übrigens auch gegenüber allzu neugierigen Briefträgern. Selbst bei der harmlosesten Nachricht gibt Hartwich dem verschlossenen Kuvert den Vorzug vor der offenen Korrespondenzkarte:
»Der Post wegen mache ich diese Hülle um den Brief. Zwar kann ihn jeder, der Lust hat, lesen, aber ich glaube, die Beamten sind instruiert, man muß ihnen das Handwerk erschweren. Verwahren Sie ihn; ich will auch Ihre persönlichen Zeilen fortlegen, sie werden uns später gewiß freudig an die unbestritten reizenden Tage erinnern, die wir in unserem kleinen Kreise erleben; ich glaube, daß nur wenige Menschen dieses reine und schöne Glück genießen.«
Als Hartwich eines Tages Elisabeth ein Tagebuch schenkt, schreibt er ihr eine Widmung auf die erste Seite, die offen ausdrückt, wie sehr er unter der Trennung leidet: