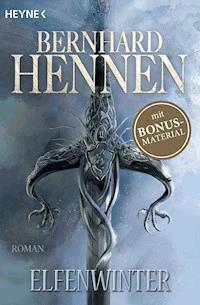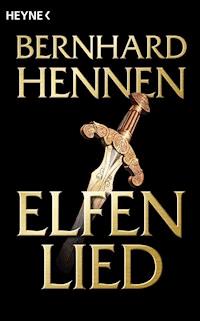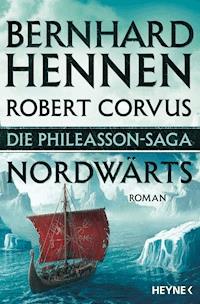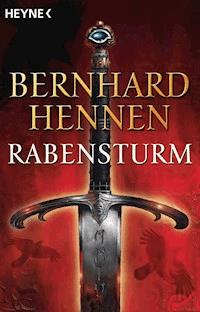9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken von Azuhr
- Sprache: Deutsch
Mit »Der träumende Krieger« schließt Bernhard Hennen, Deutschlands erfolgreichster Fantasy-Autor, seine Erfolgstrilogie »Die Chroniken von Azuhr« ab. Die Bewohner der Insel Cilia drohen zwischen dem großmächtigen Khanat und dem Reich von Kaiserin Sasmira zerrieben zu werden. Ein Schatten legt sich über die ganze Welt Azuhr. Vom Nebelwolf der Weißen Königin gehetzt, machen sich Milan, der Erzpriester Nandus Tormeno und die geheimnisvolle Nok auf die Suche nach einem zweiten Roten Kloster, in dem die höchsten Ränge der Erzpriester ausgebildet werden. Gemeinsam stoßen sie auf die Spur eines uralten Komplotts, dessen Ziel es ist, die junge Kaiserin wie auch den mächtigen Khan zu manipulieren. Ein Kampf steht bevor, den der träumende Krieger entscheiden wird – jener Krieger, der für seine Vision von einer besseren Welt alles zu opfern bereit ist. »Ein klassischer Hennen, spannend von der ersten bis zur letzten Seite und inhaltlich auf Elfen-Niveau.« Leserstimme »Mit seinem 14-bändigen ›Elfen‹-Zyklus ist Bernhard Hennen zum Star der Fantasy-Literatur geworden.« Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1029
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bernhard Hennen
Die Chroniken von Azuhr
Der träumende Krieger
Über dieses Buch
Deutschlands Fantasy-Autor Nr. 1 schließt seine Erfolgstrilogie ab
Die Bewohner der Insel Cilia drohen zwischen dem großmächtigen Khanat und dem Reich von Kaiserin Sasmira zerrieben zu werden. Ein Schatten legt sich über die ganze Welt Azuhr. Vom Nebelwolf der Weißen Königin gehetzt, machen sich Milan, der Erzpriester Nandus Tormeno und die geheimnisvolle Nok auf die Suche nach einem zweiten Roten Kloster, in dem die höchsten Ränge der Erzpriester ausgebildet werden. Gemeinsam stoßen sie auf die Spur eines uralten Komplotts, dessen Ziel es ist, die junge Kaiserin wie auch den mächtigen Khan zu manipulieren. Ein Kampf steht bevor, den der träumende Krieger entscheiden wird – jener Krieger, der für seine Vision von einer besseren Welt alles zu opfern bereit ist.
»Ein klassischer Hennen, spannend von der ersten bis zur letzten Seite und inhaltlich auf Elfen-Niveau.« Leserstimme
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Seit seinem Roman »Die Elfen« erreichen seine Bücher regelmäßig Spitzenplätze auf deutschen und internationalen Bestsellerlisten: Bernhard Hennen, 1966 in Krefeld geboren, ist Germanist, Archäologe und Historiker. Er arbeitete als Journalist für verschiedene Zeitungen und Radiosender und bereiste Zentralamerika, den Orient und Asien.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Für eine Liebe ohne Grenzen
Die Reiche der Zukunft sind Reiche des Geistes.
Winston Churchill
Korang Hom, Palast der sieben Freuden, Stunde des Affen, 14. Tag des Erntemondes im 15. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Der prächtige blaue Seidenschal schillerte im Abendlicht. Wie Rubine funkelten die Blutstropfen, die den abgetrennten Kopf des Herrschers säumten.
»König Varmajaya«, murmelte Nok mit leisem Bedauern. Erst gestern hatte sie ihm ein Tablett mit aufgeschnittenem Obst gereicht. Violette Drachenfrüchte, Mangos und Papayas. Er hatte ihr einige Herzschläge lang tief in die Augen gesehen.
Selbst im Tod war er immer noch ein schöner Mann. Sein ebenmäßiges schmales Gesicht mit der nur leicht gebräunten Haut unterschied ihn deutlich von den meist mondgesichtigen Adeligen und Beratern.
Ihre Mutter hatte ihr erzählt, er sei ein großzügiger und zärtlicher Mann.
Nok hatte sich Hoffnungen gemacht, bald seine Auserwählte zu sein, hatte König Varmajaya sie doch gestern gefragt, wann sie auf der Bühne ihre Stimme erheben würde. Mitten im dramatischen Finale der Uraufführung von Lebe wohl, meine Kaiserin hatte der König ihr einen Blick geschenkt. Dann hatte ihn das Stück wieder in seinen Bann gezogen.
Schritte ließen Nok aufschrecken. Im Schatten des überdachten Gangs, der den Hof einfasste, erschien ihr Onkel, General Sao Sovan. Jetzt waren in der Ferne wieder Waffengeklirr und Geschrei zu hören.
»Was tust du hier?«, fuhr Sao sie an. Mit langen Schritten eilte er über den Hof und griff ihr ins Haar, um ihren Kopf zu schütteln. »Bist du von allen guten Geistern verlassen? Du sollst dich verstecken!«
»Was ist geschehen, Onkel?«
Sao blickte auf den Kopf des Königs. »Der eitle Pfau hatte sich ein Nest zu viel bauen wollen …«
»Aber er war immer so nett …«, wagte sie zu sagen.
Sao hatte ein hartes, narbiges Gesicht. Und so gar nichts mit ihrem Vater gemein. Doch während ihr Vater den General nur auf der Bühne spielte, war ihr Onkel ein wirklicher Feldherr. Er hatte dem Tod hundertfach ins Auge gesehen. Und nun blickte der Tod aus seinen Augen.
»Nett zu sein ist keine Eigenschaft, die einen König groß macht, wie du siehst.« Er zog sie mit sich in den Schatten des Gangs. Säulen, die kunstvoll zu Statuen geformt waren, trugen das Dach. Sie zeigten Apsaras, Tänzerinnen, die der Herr des Himmels selbst an den Hof des ersten Königs geschickt hatte, um diesen zu erfreuen und die schönsten seiner Frauen die Kunst des Tanzes zu lehren. Auf einer Lotusblüte stehend, ein Bein angewinkelt, verkörperten sie Anmut und Schönheit …
Sao zog sein Schwert.
Männer der Palastwache stürmten den Hof und hielten an, wo der Kopf des Königs lag. Nok fragte sich, wo sie gewesen waren, als König Varmajaya starb.
»Habt ihr die Gäste aus Sri Naga in Sicherheit gebracht?«, fragte ihr Onkel.
Die Krieger zuckten zusammen, als sie die Stimme aus dem Halbdunkel vernahmen. Dann erkannten sie General Sao Sovan. Ehrerbietig verbeugten sie sich.
»Die Gäste reisen mit starker Eskorte nach Süden«, sagte einer der Krieger.
»Ihr seid jetzt meine Eskorte!«, entschied Sao.
Die Krieger schlugen vor der Brust die geballte rechte Faust in die offene linke Hand und verbeugten sich. »Wie Ihr befehlt, General.«
Sie trugen polierte bronzene Brustpanzer, die wie Gold in der Abendsonne funkelten. Darunter die purpurfarbenen Wickelröcke der Palastwache. Ihre nackten Oberarme waren mit jenen Drachentätowierungen geschmückt, die allein den auserwählten Kriegern des Königs vorbehalten waren.
Nok verachtete sie dafür, dass sie nicht dagewesen waren, als König Varmajaya starb.
»Zum Lotushof!«, befahl Sao Sovan barsch.
Im Gleichschritt setzten sich die Krieger in Bewegung. Laut knallten ihre genagelten Sandalen auf die Steinplatten. Sie marschierten durch den Gelben Turm, in dessen Mauern, viele Schritt hoch, das Gesicht von König Varmajayas Urgroßvater König Ayuttha gemeißelt war.
Gleichgültig folgten ihnen seine steinernen Augen, während sie über eine schön geschwungene rote Holzbrücke den Kanal überquerten, der den königlichen Palast von dem Palast der Schauspieler trennte.
Hunderte Male hatte Nok in diese Augen gesehen. Der Gelbe Turm war der einzige Zugang zum Refugium der Künstler. Ihr Palast lag inmitten eines Labyrinths von Kanälen.
Am Ende der Brücke wartete Kunthea, ihre Mutter. Sie war die schönste Frau im Palast. Onkel Sao hatte sie immer gehasst, und sie hatte diesen Hass erwidert, so sehr sie Saos Bruder Bun auch liebte. Bun und ihr Onkel waren wie Licht und Schatten. Auch Bun war gestern Nacht zum General geworden. Auf der Bühne. Ein tragischer Held.
»Pass besser auf die Kleine auf!« Sao hielt sie noch immer bei den Haaren gepackt. »Ihr habt dem König zu nahe gestanden!«
»Näher als der General, der die Krieger in seinem Palast befehligte?«, fragte Kunthea kühl.
»Hüte deine Zunge, Weib!« Seine Hand krallte sich noch fester in Noks Haar. Dann stieß er sie von sich.
Nok stürzte fast vor die Füße ihrer Mutter.
»Bewacht das Tor im Gelben Turm!«, befahl er seinen Kriegern.
Jetzt erst bemerkte Nok die Blutspritzer an der goldenen Parierstange von Saos Schwert. Sie funkelten wie königliche Rubine im Abendrot.
Korang Hom, Palast der sieben Freuden, Stunde des Affen, 14. Tag des Erntemondes im 15. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Sao Sovan hob Varmajayas Haupt auf. Seit mehr als drei Jahren hatte er als General des Königs heimlich den Karang, den lebenden Schatten, zugearbeitet. Er hatte ihnen Nachrichten zukommen lassen, sie vor den Truppen der anderen Generäle gewarnt. Als er Zeuge geworden war, wie Varmajaya mit Abgesandten des Wandernden Hofs verhandelte, um ihnen einen weiteren großen Hafen des Königreichs zu verkaufen, so wie es einst sein Urgroßvater König Ayuttha getan hatte, um von dem Gold noch schönere Paläste zu bauen, hatte Sao seinem Herrscher ein Ende bereitet.
Traurig schritt Sao durch die weiten Hallen des Palastes. Er hatte den Karang nur gestattet, bis in die Vorhöfe zu kommen. Und wie stets in den letzten Jahren hatten sich die lebenden Schatten an ihre Vereinbarungen gehalten. Es hieß, ihr Anführer sei ein Weiser. Sao war ihm nie begegnet – soweit er wusste … Die Karang machten aus allem ein Geheimnis. Am Anfang, als er sie noch bekämpft hatte, war er dabei gewesen, wie gefangene Aufständische gefoltert wurden. Sie hatten fast nichts verraten können, weil sie nichts wussten. Ihre Anführer waren legendenumwobene Gestalten. Ihr General, den sie nur den Schwarzen Panther nannten, wie auch der Erste Schatten, jener geheimnisvolle Weise, der angesichts immer höherer Abgaben den Widerstand gegen König Varmajaya zu einem Heer von Schatten hatte anwachsen lassen.
Sao trat in die Halle der tausend Geister. Bis hoch unter die rot lackierten Deckenbalken waren die Wände hier mit Schreinen geschmückt. Dämonische Fratzen, mal aus bunt bemaltem Holz, mal aus dem Stein der Mauern geschnitten, starrten auf ihn herab. Dazwischen tanzende Apsaras, wunderschöne Frauen, die – glaubte man den Mären – in den Quellen der Flüsse und in den Wolken lebten. Tausende Räucherstäbchen brannten bei Tag und bei Nacht in der Halle der tausend Geister. Blaugrauer Rauch wogte durch das Halbdunkel, das hier stets herrschte, denn außer durch die beiden hohen Portale an den gegenüberliegenden Enden der fast zwanzig Schritt hohen Halle fiel kein Tageslicht herein.
Wenn man durch den wogenden Rauch schritt und die Wohlgerüche die Sinne benebelten, fiel es nicht schwer, sich vorzustellen, dass hier wirklich Geister lauerten.
Sao hatte nie verstanden, warum diese unheimliche Halle der einzige Weg in den Inneren Palast war. Sollten Besucher durch die Welt der Geister gehen, bevor sie in den Himmel traten? Die Welt aus Licht, in die der Herr des Himmels die Seelen jener holte, die sein Wohlgefallen fanden, konnte nicht schöner sein als der Palast, den König Ayuttha einst erbaut hatte.
Sao trat durch das große Portal in die Nacht. Dort warteten sie, die Schatten. Sie hatten Fackeln entzündet. Schweigend standen sie in dem weiten Hof. Sie trugen schwarze Tuniken und schwarze Hosen. Die meisten waren barfuß. Nur wenige Füße steckten in schlichten Sandalen. Keiner von ihnen besaß maßgefertigte Stiefel, so wie er. Sie waren mit Bambusspeeren bewaffnet und mit einfachen Bögen. Sie trugen Haumesser für den Dschungel in ihren Gürteln. Sao war überrascht, viele Kinder unter ihnen zu sehen. Die Hälfte, schätzte er, war erst dreizehn Jahre alt oder jünger. Er kannte ihre Geschichten, ohne eines der Gesichter zu kennen.
Es waren Kinder von Kleinbauern, die ihr Land verloren hatten, weil immer mehr Abgaben zu entrichten waren. Korang Hom war eine wunderschöne Stadt. Die größte im Königreich. Fast eine halbe Million Menschen lebten hier. Aber sie hatten sich vom Blut der einfachen Bauern genährt. All die Handwerker und Künstler, die Dichter und Kaufleute, Gelehrten und Tunichtgute. Seit Jahren wehrten sich die Karang, die Schatten, die Angehörigen jener, die verhungert waren oder sich in ihrer Verzweiflung das Leben genommen hatten. Seit Jahren herrschte ein Bürgerkrieg, von dem man hier im Palast der sieben Freuden fast nichts mitbekommen hatte.
Die Karang, die schwarze Kleidung trugen und ihre Gesichter mit dem Schlamm der Pfützen schwärzten, trugen goldgelbe Schals, gefärbt mit Safran. Sie waren ein Symbol für das Gold ihrer Seelen, das Gold, das ihnen niemand stehlen konnte.
Sao hob den Kopf des Königs am Haar hoch. »Der Krieg der Schatten ist beendet!«, rief er mit fester Stimme. »Der König ist tot. Ihr habt gesiegt. Nun könnt ihr in eure Dörfer zurückkehren.«
Schweigend starrten ihn die hageren Gestalten an. Sie zeigten keine Regung, als hätten seine Worte sie gar nicht erreicht. Vielleicht waren sie ja wirklich keine richtigen Menschen mehr, sondern nur noch Schatten?
Ein junger Mann löste sich aus der Menge der schweigenden Krieger. Sein Kopf war kahlgeschoren. Ihm fehlten beide Ohrmuscheln. »Der Panther hat einen Befehl für dich, General.«
Sao blickte den jungen Mann durchdringend an. Er sah aus wie die anderen Schatten, trug einen schmutzigen gelben Schal um den Hals, war barfuß und hielt einen Bambusspeer. Ein Bauernsohn wahrscheinlich. Nie zuvor hatte Sao von so jemandem Befehle empfangen.
»Was will der Panther?«
»Morgen um diese Stunde soll die Stadt geräumt sein. Wer nicht freiwillig seine Bleibe verlässt, den holen wir.«
»Ich verstehe nicht … Wer soll gehen?«
»Alle«, sagte der junge Bauer leichthin.
»Das ist unmöglich. Die Stadt braucht Menschen, der Palast …«
»Wir brauchen Korang Hom nicht. Der Erste Schatten sagt, dass es Städte wie diese gibt, ist der Beginn allen Übels«, erklärte der junge Bauer in einem Tonfall, als habe er ein einfältiges Kind vor sich. »Wir werden Korang Hom aufgeben. Soll sich der Dschungel zurückholen, was nie hätte sein sollen.«
Sao blickte über die Unzahl von schwarz gewandeten Gestalten auf dem Palasthof. Er hatte um ihren Marsch durch den Dschungel gewusst. Hatte gewusst, dass sie hier in der Stadt nur auf wenig Gegenwehr stoßen würden. Seit Anfang des Jahres beherrschten die Schatten mehr als die Hälfte der Provinzen des kleinen Königreichs. Das Heer des Königs lieferte nur noch Rückzugsgefechte. Alle Generäle des Königs hatten begriffen, dass dieser Krieg lediglich hinausgezögert, jedoch nicht mehr gewonnen werden konnte. Nicht ohne Hilfe von außen. Aber die war nicht gekommen.
Ein König, der sich mehr dafür interessierte, ein Theaterstück des Ersten Dichters des Khans aufführen zu lassen, als dafür, dass Gerechtigkeit in seinem Königreich herrschte, hatte sein Recht auf den Thron verwirkt. So hatte er geurteilt. Und dann hatte er dieses Urteil vollstreckt. Aber das hatte er nicht kommen sehen. Das war Wahnsinn! Man eroberte doch nicht eine Stadt, um sie dem Dschungel zu übergeben! Er hatte geglaubt, der Erste Schatten würde den Thron an sich reißen …
»Wer die Stadt nicht auf seinen Beinen verlässt, den werden wir an seinen Haaren herauszerren. Oder aber als Fraß für die Geier zurücklassen.« Der junge Bauer sah ihn an, ohne zu blinzeln, ohne eine Miene zu verziehen. Und Sao war sich sicher, dass die Karang diese Drohung wahrmachen würden.
Korang Hom, Palast der Schauspieler, Stunde des Pferdes, 15. Tag des Erntemondes im 15. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Noch nie hatte Nok den Palast der Schauspieler in solcher Aufregung erlebt. Alle liefen durcheinander, packten, schrien einander an. Die Angst war mit Händen greifbar. Die Karang waren gekommen. Sie hatten die Hauptstadt besetzt, der König war tot, die Welt, in der Nok aufgewachsen war, hatte über Nacht aufgehört zu bestehen.
Abgesehen von einigen wohlbehüteten Ausflügen hatte sie den Palast noch nie verlassen.
Ihre Mutter kniete sich vor ihr nieder. Kunthea hatte ihr Haar auf kunstvolle Art durcheinandergebracht. Es sah nicht mehr nach einer Frisur aus, und doch war sie immer noch atemberaubend schön. »Hab keine Angst, meine Kleine. Wir werden eine Rolle spielen. Wir alle sind Theaterleute. Die Besten! Wir werden das schaffen.«
Kunthea hatte mit ihnen fast die ganze Nacht nähend verbracht. Sie hatten Hosen und weite Tuniken aus grobem schwarzem Stoff gefertigt, die sie nun alle trugen.
Nok sah ihre Eltern fassungslos an. Sie war kein kleines Kind! Ganz gleich, was die beiden ihr erzählten, sie hatte verstanden, dass die Welt, in der sie bis gestern gelebt hatte, mit dem Tod des Königs untergegangen war. Dennoch hatten ihre Eltern Schminke eingepackt, Masken und zwei leichte Kostüme.
Vor zwei Tagen hatten Kunthea und Bun die Hauptrollen in dem neuen Stück Lebe wohl, meine Kaiserin gespielt. Ihre Mutter die goldhaarige Kaiserin Marcia und ihr Vater den stolzen General Xiang Yu. Sie hatten die Mächtigen des Königreichs mit ihrer Kunst verzaubert. Und Nok wusste, wie viel Arbeit hinter dem stand, was auf der Bühne so leicht aussah. Alle Darsteller mit einer Sprechrolle hatten an dem Abend einen Lotus geschickt bekommen. Noch nie war ein Stück so begeistert aufgenommen worden! Noch nie hatte es so viele Einladungen zu diskreten Treffen gegeben. Und das Ensemble ihrer Mutter hatte ein zweites Mal glänzen können.
Nok dachte wieder daran, wie der König sie angesehen hatte. Im nächsten Stück hätte sie eine Sprechrolle bekommen. Sie war so weit! Sie war dreizehn Jahre alt und hatte ihr ganzes Leben unter Schauspielern verbracht. Sie kannte die zwei Rollen, die jeder Theaterabend einforderte. Die auf der Bühne und die danach. Wer eine Sprechrolle annahm, gab damit dem Publikum das Zeichen, nicht abgeneigt zu sein, an dem Abend noch weitere Rollen zu geben. Nok beherrschte drei Instrumente, sie konnte sich in vier Sprachen unterhalten, war eine gute Tänzerin, allerdings nur eine sehr mittelmäßige Sängerin. Manchmal blieb es dabei, öfter endete ein solcher Abend mit dem Spiel von Wolke und Regen. Doch ganz gleich, wie er endete, er begann immer mit einem Geschenk. Und ihr Vater bestand darauf, dass diese Geschenke nun alle zurückblieben. Die Ketten aus schweren Silbermünzen, die Edelsteine, das Gold. Er war zutiefst davon überzeugt, dass ihnen all dies nur noch Unglück bringen würde, da es die Welt, aus der diese Schätze kamen, nicht mehr gab.
Kunthea hörte nicht auf ihn. Nok hatte beobachtet, wie ihre Mutter einige Edelsteine und etwas Gold in ihrem ausgehöhlten Wanderstab verbarg. Ihr indes bürdeten sie einen kleinen Sack mit Reis, einen Kupferkessel und gleich mehrere wassergefüllte Kürbisflaschen auf.
So schritten sie nebeneinander über die rote Brücke und durchquerten den Palast des Königs bis hin zur Halle der tausend Geister. Nok hatte diesen Ort immer geliebt. All die Wohlgerüche, aber auch das Zwielicht und die treibenden Rauchschwaden, die sie vor neugierigen Blicken verborgen hatten, wenn es ihr gelungen war, sich an den Palastwachen vorbei bis hierher zu schleichen.
Ihr Vater legte ihr einen gelben Schal um den Hals, als sie durch das hohe Portal hinaus in die Welt der Karang traten.
Nok war überrascht zu sehen, dass viele der Schatten nicht älter waren als sie. Mit ernsten Gesichtern betrachteten sie die Künstler, Bediensteten, Berater und Adeligen, die den Palast verließen. Hunderte Angehörige des Hofs versammelten sich auf dem weitläufigen Platz, die meisten bunt wie Paradiesvögel gekleidet. Nur die engsten Freunde ihrer Eltern hatten das Schwarz der Karang angelegt. Die übrigen legten noch Wert auf eine Kleidung, die Privilegien und Standesunterschiede betonte, die es nicht mehr gab.
Nok entdeckte ihren Onkel Sao unter den Aufständischen. Auch er trug das einfache schwarze Leinen der Karang. Seine Füße steckten in schlichten abgewetzten Sandalen. Er hatte das Haar kurz geschoren und trug den gelben Schal der Rebellen als Stirnband.
Sobald er sie entdeckte, eilte er ihnen entgegen. Er hielt sein Schwert in der Linken. Die mit Perlen geschmückte Scheide war nun mit schwarzem Stoff umwickelt und unauffällig.
»Das war klug, Bun«, bemerkte Onkel Sao leise, als er sie erreichte, und deutete auf ihre Kleider. »Von nun an gilt es, unsichtbar unter den Karang zu werden. Sie mögen wie Kinder aussehen, aber sie haben die Seelen von Dämonen.«
Nok überlief ein Schauer. Ob das stimmte? Wenn ihr Onkel eines nicht war, dann ein Schwätzer. Aber Dämonen … die gab es doch nur in Mären, genauso wie Geister oder Apsaras oder die weißen Füchse, die sich in wunderschöne Frauen verwandelten und das Chi ihrer Opfer tranken, und die Riesen in den Bergen des Weltenrückens.
Ihr Onkel beugte sich zu ihr herab. »Kannst du unsichtbar werden, Nok? Du musst sein wie die um dich herum. Und blicke ihnen nicht direkt in die Augen. Für viele ist das eine Herausforderung.«
Nok erinnerte sich an Geschichten über Dämonen, in denen man seine Seele verlor, wenn man ihnen zur falschen Zeit in die Augen sah.
Argwöhnisch blickte sie zu den mürrischen Knaben mit den Bambusspeeren. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass diese ungewaschenen Bauerntrampel solche Macht besaßen.
Ein Junge, dem die Ohren fehlten, kam zu ihnen. Er grüßte Sao, als würde er ihren Onkel kennen, was Nok sehr verwunderte.
»Ihr kommt mit mir! Ihr werdet nach Melu Wat gehen.«
»Wo ist das?« Nok hatte noch nie von einer solchen Stadt gehört.
»Mein Dorf!« Der Junge ohne Ohren strahlte sie an, und Nok musste sich beherrschen, um nicht auf die knorpelverwachsenen Höhlen zu starren. »Melu Wat liegt in einer Ebene voller Reisfelder. Wir ernten zweimal im Jahr. Es gibt mehr als hundert Wasserbüffel im Dorf. Und das beste Essen. Riesige Mangos und Wassermelonen, so schwer, dass sich ein Mann das Kreuz bricht, wenn er allein versucht, sie anzuheben und …«
»Und die Bienen tragen einem den Honig in den Mund, wenn man nur die Zunge herausstreckt?«
Der Junge sah sie verwundert an. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein, das tun sie in Melu Wat nicht.« Er wirkte geknickt, als sei es für ihn bisher nicht vorstellbar gewesen, dass irgendetwas in seinem Dorf nicht besser als überall sonst sein könnte.
Sao gab Nok einen Klaps auf den Hinterkopf. »Das Mädchen scherzt nur, Trang.«
Ein breites Lächeln erschien auf dem Gesicht des Bauernjungen. »Dann ist ja gut … Dann …« Das Lächeln verschwand. Er sah sich um, wirkte argwöhnisch. Ganz so, als habe er Angst, lächelnd gesehen zu werden. Rasch deutete er mit seinem Bambusspeer auf ihre Eltern. »Ihr kommt mit nach Melu Wat. Und ihr da!« Er ging weiter, wählte weitere Schauspieler, aber auch etliche Palastdiener aus, bis ein großer, kräftiger Kerl ihn anschrie. Daraufhin brach Streit los. Von überallher kamen Knaben, aber auch erwachsene Männer herbei und wollten Frauen aus dem Palast.
Sao winkte Nok und ihren Eltern. Er zog sie auf die Seite.
»Mach nie wieder solche Scherze wie mit den Bienen!«, fuhr er Nok an. »Die Karang verstehen keinen Spaß. Wenn einer von ihnen auch nur glaubt, dass er durch einen Scherz von dir das Gesicht verloren hat, wird er dir deines wegschneiden.«
Ihr Onkel ging vor ihr auf ein Knie nieder und packte sie fest bei den Handgelenken. »Trang ist nicht so harmlos, wie er dir erscheint. Was glaubst du, warum sie niemals lachen? Sie haben es in Jahren der härtesten Entbehrungen verlernt. Ihr werdet das auch.«
Er sah zu Noks beiden kleinen Schwestern, Chenda und Jiut, den Zwillingen. »Bei ihnen wird es anfangen.«
Südlich von Korang Hom, Stunde des Hundes, 15. Tag des Erntemondes im 15. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Noks Schultern schmerzten. Sie würde noch lange gehen können. Die endlosen Übungen während ihrer Ausbildung zur Schauspielerin hatten sie zäh gemacht. Aber sie war es nicht gewohnt, über Stunden schwere Lasten zu tragen. Der Reissack, der Kessel, all die Kürbisflaschen … die Tragriemen schnitten ihr in die Schultern. Weißer Staub haftete an ihrer groben Kleidung.
Chenda, ihre kleine Schwester, hielt ihre linke Hand. Auch sie trug einen kleinen Sack voller Reis. Sie murrte nicht, war aber so erschöpft, dass sie sich immer wieder an Nok anlehnte oder sich von ihr ziehen ließ. Kunthea, ihre Mutter, hatte die jungen Schauspieler im Palast ausgebildet. Sie war eine strenge Lehrerin gewesen. Und bei ihren eigenen Töchtern hatte sie noch weniger Milde walten lassen als bei den anderen Schülern. Onkel Sao hatte keine Ahnung, wie das Leben im Palast der Künstler gewesen war. Er kannte nur den Palast der sieben Freuden. Das war wahrlich eine andere Welt gewesen.
Obwohl sie schon den ganzen Tag die Straße entlangmarschierte, hörte Nok nicht auf, darüber zu staunen, wie unglaublich viele Menschen es gab. Ihr Onkel hatte gesagt, dass alle die Stadt verlassen mussten. Und alle mussten auf ihren eigenen Füßen gehen, so verlangte es die neue Gerechtigkeit. Es gab keine Sänften mehr, die von unzähligen Dienern getragen wurden. Keine Reisewagen mit seidenen Kissen und mannshohen Rädern. Alle waren sie nun gleich.
Die Karang redeten nicht viel, aber das wiederholten sie immer wieder: Sie alle waren gleich. Es gab keine Diener und keine Herren mehr. Und man sollte nur noch das bekommen, was man sich durch ehrliche Arbeit auch wirklich verdiente.
»Hinsetzen!« Trang, der Bauernjunge ohne Ohren, kam die Straße entlanggelaufen und wedelte mit den Armen. »Hinsetzen! Sofort!« Einige andere Burschen begleiteten ihn, und wer dem Befehl nicht schnell genug folgte, dem schlugen sie mit einem Bambusrohr in die Kniekehlen.
Nok ließ sich, wo sie stand, zu Boden fallen und zog Chenda mit sich.
»Warum sind die Karang alle so gemein?«, flüsterte Chenda ängstlich.
»Vielleicht haben sie was Falsches gegessen. Das würde auch erklären, warum sie so lange Gesichter machen.«
Chenda kicherte.
Ihre Eltern und Jiut rückten zu ihnen auf. »Wir müssen näher zusammenbleiben«, zischte Kunthea sie an. »Du wirst nicht wieder mit Chenda vorauslaufen. Und jetzt schlag die Augen nieder!«
Trang kam die Straße entlang zurück. Alle paar Schritt blieb er stehen, raunte den Kauernden etwas zu und ging dann eilig weiter. Auch vor Nok hielt er an.
»Der Hammermann kommt«, stieß er gehetzt hervor. »Ihr dürft ihn niemals belügen! Er kann riechen, wenn man lügt. Sagt immer die Wahrheit, und alles wird gut!«
»Was hat das schon wieder zu bedeuten?«, flüsterte ihr Vater.
»Wer ist der Hammermann?«, rief ihre Mutter Trang nach, doch der Bauernjunge lief schon weiter.
Ihr Vater legte einen Arm um Nok und zog sie zu sich heran. Sie alle fünf hockten dicht beieinander.
Palmen säumten die breite Straße. Ein leichter Wind war mit der Abenddämmerung aufgekommen und trieb kleine Wirbel weißen Staubs zwischen den Heimatlosen dahin.
Jenseits der Palmen lagen Reisfelder. Die wenigen Bauern, die Nok entdecken konnte, hielten weiten Abstand zur Straße. Wasserbüffel konnte sie keine sehen.
Ein ganzer Trupp von schwarz gewandeten Karang kam langsam die Straße herab. Es mussten über hundert sein. Immer wieder hielten sie an und redeten mit den Heimatlosen. Ab und an wurde einer der Kauernden hochgezerrt und fortgebracht. Dann hörte Nok gellende Schreie. Sie wagte es nicht, den Kopf zu heben, um besser sehen zu können, was vor sich ging.
»Alles wird gut«, flüsterte ihr Vater mit seiner warmen, freundlichen Stimme, als die Zwillinge zu weinen begannen. »Alles wird gut.«
Nok drängte sich ganz eng an ihn. Sie zitterte, so wie ihre beiden kleinen Schwestern auch. Ihr Vater aber wirkte in sich ruhend wie der Mondberg, zu dem der Khan ziehen musste, wenn er seine Krone vom Herrn des Himmels verliehen bekam.
Immer näher kamen die lebenden Schatten. Nok erkannte auch ihren Onkel Sao unter ihnen. Ein kleiner, sehr dürrer Mann führte sie an.
Schließlich blieben die Rebellen auch vor ihnen stehen. »Das ist ja mal ein ungewöhnlicher Anblick.« Die Stimme des dürren Mannes klang unangenehm hoch. »Nach Tausenden von Volksverrätern, die sich auch jetzt noch bunt wie die Papageien kleiden, plötzlich eine Gruppe von Flüchtlingen, die aussehen, als seien sie Karang. Wie ist das möglich?« Er wandte sich an einen mondgesichtigen Mann, der neben ihm stand. »Arun, diese hier sollen doch in dein Dorf. Erkläre mir dieses Wunder.«
Der Angesprochene gab ein paar gestammelte Laute von sich. Dann schrie er los. »Trang! Wo steckt der Kerl? Er hat sie ausgesucht. Ich habe damit nichts zu tun.«
Der kleine dürre Mann legte den Kopf schief und sah den Mondgesichtigen durchdringend an. »Diese hier sollen in deinem Dorf zum neuen Leben geführt werden, Bruder Arun, und du hast nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, ob dem Ersten Schatten diese Einstellung gefallen würde.«
Trang kam herbeigelaufen.
»Wer sind diese neuen Menschen? Wo hast du sie gefunden?«, fragte der Dürre ihn.
»Sie kamen aus dem Palast des Königs, Bruder Hammermann.«
»Aus dem Palast …« Der Anführer der Karang knetete nachdenklich sein Kinn. Seine Finger sahen seltsam aus. Kurz und krumm, und sie waren voller grässlicher Narben. »Ihr da!« Er deutete auf Noks Eltern. »Zeigt mir eure Hände!«
Kunthea und Bun gehorchten.
Der Hammermann trat näher. Betrachtete die Hände. »Schön gewachsene Nägel«, sagte er leise. »Kein Schmutz darunter. Aber Schwielen … Kräftige Hände. Und so schöne schmale Finger.« Er blickte zu den übrigen schwarz gewandeten Flüchtlingen, die sich Kunthea und Bun angeschlossen hatten. »So viele schöne Frauen … Die Frauen aus dem Dschungel sehen anders aus.« Er ging vor ihnen in die Hocke. »Schaut mich an!«, sagte er mit seiner unangenehm hohen Stimme.
Einen wie ihn hätte man niemals auf einer Bühne geduldet, dachte Nok. Ihm zuzuhören war, als würde einem heißes Wachs ins Ohr geträufelt. Er hatte dunkle, leere Augen. Nok musste an die Geschichte über die Dämonen denken, die ihr Onkel ihr erzählt hatte. In diesen Augen lebte keine Seele mehr.
Der Hammermann streichelte Chenda über das lange schwarze Haar. »Du wirst das Rätsel für mich lösen, meine Hübsche. Sag mir, was war dein Vater am Hof des Königs?«
Chenda sah hilfesuchend zu ihrer Mutter.
»Nur sie spricht!«, sagte der Hammermann scharf, um sich dann wieder an Chenda zu wenden. »Keine Angst, meine Kleine. Ihr Kinder seid der Same der Zukunft. Die Karang lieben Kinder. Ich werde dir nichts tun. Nun sag mir, was war die Rolle deines Vaters am Hof des Königs? War er ein bedeutender Mann? Er sieht wichtig aus.«
»Er ist ein General!«, sagte Chenda. Seit sie die ersten Silben gebrabbelt hatte, hatte sie Sprechunterricht von Kunthea erhalten, genau wie Nok selbst. Ihre Stimme war klar, von angenehmem Klang und trug weit, obwohl sie noch ein Kind war.
»Ein General also …« Der Hammermann erhob sich und trat einige Schritte zurück.
»Sie redet Unsinn«, versuchte Kunthea das Unglück abzuwenden. »Sie ist verunsichert …«
»Kindermund spricht wahr!«, entgegnete der Anführer der Karang. »Ich glaube ihr!«
Nok blickte zu ihrem Onkel. Sao stand mit teilnahmsloser Miene hinter dem dürren kleinen Mann. Er unternahm nichts, um ihnen zu helfen.
»Es stimmt!« Ihr Vater stand auf. »Ich bin General Sao Sovan, der Befehlshaber der Palastwache.« Ihr Vater hatte seine Stimme verändert. Er sprach jetzt in demselben überheblichen Tonfall, den er vor zwei Jahren dem General Ming in dem Theaterstück Die roten Kraniche geliehen hatte. Aber warum gab er vor, sein Bruder zu sein?
Ihr Vater richtete sich zu seiner ganzen Größe auf. Er war immer schon von stattlicher Gestalt gewesen. Den Hammermann überragte er um mehr als Haupteslänge. Keiner unter den Karang war so groß wie er. Die Bauern mit den Bambusspeeren wichen vor ihm zurück. Nur Onkel Sao nicht. Er legte die Hand auf den Griff seines Schwertes.
Die beiden würden sie retten, dachte Nok. Die zwei Brüder würden dafür sorgen, dass die lebenden Schatten sie nicht töteten.
»Glaubst du, ich habe Angst vor dir?« Nur der Hammermann war auf seinem Fleck stehen geblieben. »Deine Welt ist untergegangen, General Sao. Nicht mehr deine Geburt bestimmt, was du bist. Einzig deine Taten. Dies wird das erste Land, in dem alle Menschen gleich sind. Und diese Idee wird in die Welt hinausziehen, denn sie ist richtig. Künftig bekommt jeder in seinem Leben nur noch, was er sich verdient hat. Und was man sich durch seiner Hände Arbeit erschaffen hat, kann einem nicht mehr einfach genommen werden, nur weil Männer wie du es so entscheiden.« Er winkte seinen bewaffneten Bauern. »Bringt ihn auf die Knie!«
Die Bambusspeere senkten sich.
Nok sah zu ihrer Mutter. »Wir müssen ihm helfen«, flüsterte sie.
»Nein«, entschied Kunthea. »Das will er nicht. Er will uns retten. Wir müssen unsere Rollen spielen.« Sie sah Nok, Jiut und Chenda streng an. »Bleibt sitzen!«
Die Krieger umringten ihren Vater. Plötzlich sprang einer vor und stach mit der Spitze seines Speers nach Buns Gesicht.
Ihr Vater wich elegant aus, griff nach dem Speer und drehte dem Bauern die Waffe aus der Hand. Jeder gute Schauspieler lernte zu kämpfen, um Krieger auf der Bühne auch glaubwürdig verkörpern zu können. Ihr Vater war am Hof des Khans aufgetreten! Er war ein Meister. Im ganzen Königreich gab es wahrscheinlich nur eine Handvoll Krieger, die mit dem Schwert und der Schwertlanze besser umgingen als er.
Er ließ den Bambusspeer herumwirbeln und schlug die Waffen eines Dutzends Bauern zur Seite. Das stumpfe Ende rammte er dem Hammermann gegen die Brust, der in den Staub geschleudert wurde.
Die Bauern schrien erschrocken auf, griffen jedoch weiter an.
»Ich will ihn lebend!«, rief der Hammermann.
Immer mehr Karang drängten heran. Unter den wütenden Rufen ihres Anführers schienen sie alle Angst zu vergessen.
Fasziniert sah Nok ihren Vater kämpfen. Nie hatte er so in einer Rolle geglänzt. Er wirbelte herum, schickte etliche Bauern zu Boden. Doch weil er kämpfte, wie man auf der Bühne kämpfte, tötete er keinen. Die Karang bezogen Prügel, aber es schien, als seien sie das gewöhnt. Und ihr Wille wuchs, ihn mit Todesmut anzugreifen, als sie begriffen, dass in diesem Kampf nur einer sterben würde: der General.
Dutzende zerbrochene Bambusspeere lagen auf der Straße. Die Bauern hatten einen weiten Kreis um ihn gebildet. Es mussten fast hundert Speerspitzen sein, die sich aus drei Reihen von versetzt hintereinander stehenden Karang auf Bun richteten.
Nok sah den Stolz in den Augen ihrer Mutter. Sie, die immer etwas an ihrem Mann zu verbessern gefunden hatte, folgte ergriffen diesem Kampf.
Da zog Onkel Sao sein Schwert und trat zwischen die anderen Karang.
Eines der Augen ihres Vaters war fast zugeschwollen. Blut tropfte aus einer Wunde an seinem linken Arm auf die Straße.
Jemand klatschte. Es war jene Art von Applaus, den alle Schauspieler fürchteten. Müde und ohne Begeisterung. Mehr Spott als Anerkennung.
»Was für ein Spektakel, General!« Der Hammermann schob sich in die Lücke zwischen den Speerträgern, durch die Onkel Sao in den Kreis getreten war. »Und doch wissen wir beide, wie es enden wird. Das Volk siegt immer. Nun sag mir, warum trägst du schwarz? Und wer sind die anderen?«
Ihr Vater setzte ein so selbstgefälliges Lächeln auf, als sei er noch immer Herr der Lage. »Ich dachte, ich mische mich unter die Karang und fliehe, während in der Stadt nach der Eroberung Chaos herrscht.«
Der Hammermann schüttelte den Kopf. »Aber es herrschte kein Chaos. Es ist die Arroganz, die deinen Untergang besiegelt hat, General. Und wer sind die anderen?«
Ihr Vater machte eine wegwerfende Geste. »Meine Köchin und ihre Bälger. Ein paar Bedienstete … Von den meisten kenne ich nicht einmal die Namen. Diener eben.« Er sprach noch immer mit der überheblichen Stimme des Bühnengenerals.
»Dann wird es dir gewiss nichts ausmachen, wenn wir einem der Bälger den Kopf abschneiden.«
»Ganz im Gegenteil. Es wäre mir sogar eine Freude, dabei zuzusehen. Könntest du bitte mit der hirnlosen kleinen Kröte anfangen, die mich verraten hat?«
Es lief Nok eiskalt den Rücken herunter, als sie ihren Vater so sprechen hörte. Es klang so echt, als wünschte er sich wirklich Chendas Tod. Nok sah, wie ihrer kleinen Schwester die Tränen über die Wangen rannen, auch wenn kein Laut über ihre Lippen kam.
»Habt ihr das alle gehört?«, rief der Hammermann triumphierend. »Nun hat dieser große Krieger seine Maske fallen lassen! So sind sie in Wirklichkeit, die Helden aus den Palästen. Kindermörder! Die Karang bestrafen nur jene, die es verdient haben. Niemals Unschuldige!« Er wandte sich ihnen zu. »Hab keine Angst, Köchin. Dir und den Kindern wird nichts geschehen. Wir sind gekommen, um euch zu neuen Menschen zu machen und vom Joch der Knechtschaft zu befreien.« Er winkte seinen Bauernkriegern. »Zwingt ihn zu Boden!«
Wieder stürmten die Bauern auf Bun ein, dieses Mal noch wütender. Doch nun war Onkel Sao unter den Kämpfern. Er wich den Angriffen ihres Vaters geschickt aus und arbeitete sich an ihn heran. Sein Schwert hatte Onkel Sao wieder in die Scheide geschoben und parierte ausschließlich mit verhüllter Waffe.
Nok sah, wie ihr Vater seinem Bruder zunickte. Nur wer mit den Bewegungsmustern der Theaterkämpfe vertraut war, konnte bemerken, dass es diese winzige Geste an der falschen Stelle gab.
Kaum drei Herzschläge später versetzte Onkel Sao ihrem Vater einen Schlag in die Kniekehlen, der Bun zu Boden gehen ließ. Sofort wurde ihm ein Dutzend Speerspitzen auf die Brust gesetzt. Es war vorüber. Und Nok war sich sicher, dass dies nur geschah, weil ihr Vater es so gewollt hatte.
Ihre Mutter drückte ihre Hand fester. Ihr Gesicht jedoch blieb so teilnahmslos, als sei wirklich ein ungeliebter Schinder zu Boden gegangen.
Onkel Sao drehte ihrem Vater die Waffe aus der Hand.
Grobe Hände zerrissen Buns Tunika. Ein halbes Dutzend Bauern hielt ihn fest, so dass er auf den Knien blieb. Onkel Sao aber nahm den Kopf seines Bruders und zwang ihn, zum Anführer der Karang aufzublicken. Der zog einen Hammer unter seiner ausgeblichenen schwarzen Tunika hervor.
»Dieses Werkzeug hat schon sehr viel Ungerechtigkeit aus der Welt geschafft, General«, verkündete er mit seiner unangenehm schrillen Stimme. Plötzlich hielt er einen langen vierkantigen Nagel in der Hand. Er setzte die Spitze des Nagels auf Buns Stirn. »Die meisten sind sofort tot, General. Einige quälen sich viele Stunden lang … und ganz selten kommt es vor, dass der Herr des Himmels entscheidet, dass ein Verurteilter noch eine Aufgabe in unserer neuen Welt hat. Dann lässt er dich weiterleben, mit dem Nagel in der Stirn. Sehen wir nun also, was das Schicksal für dich vorgesehen hat, General.«
Jetzt waren es Noks Finger, die sich fest wie eine Eisenkralle um die Hand ihrer Mutter schlossen. In einem Theaterstück würde gleich Onkel Sao sein Schwert ziehen, ihre Feinde erschlagen und sie über die Reisfelder in Sicherheit bringen.
»Hast du noch letzte Worte, General?«, fragte der Anführer der Karang.
»Wer den Sturm der Tyrannei herbeiruft, wird vom Blitzschlag der Gerechtigkeit gefällt werden.«
Ein Kloß stieg Nok in den Hals. Ihr Vater hatte diese Worte mit seiner warmen, freundlichen Stimme gesprochen. Seiner wirklichen Stimme!
Der Hammer fuhr nieder. Ein einziger Schlag genügte, um den Nagel fast ganz in der Stirn ihres Vaters zu versenken.
Bun tat einen langen Seufzer. Seine Augen verdrehten sich nach oben. Ein einzelner Blutstropfen trat aus der Wunde, rann an seiner Nase herab, um an deren Spitze hängen zu bleiben.
Die Karang traten von ihrem Vater zurück. Auch Onkel Sao.
Bun hielt sich auf den Knien. Er sackte nicht nach vorn. Sein Mund öffnete sich. Er stieß ein paar leise, unartikulierte Laute aus.
»Dir sind wohl für immer die Worte im Halse stecken geblieben«, bemerkte der Hammermann und schob sein Mordwerkzeug unter seine Tunika. Dann kam er zu ihnen herüber.
»Du und deine Kinder, ihr seid jetzt neue Menschen. Ihr seid zum ersten Mal in eurem Leben frei.« Er beugte sich herab und tastete über den Sack, den Nok trug. »Ihr werdet nun einen köstlichen Reisbrei für mich und meine Freunde kochen.«
Südlich von Korang Hom, Stunde des Ebers, 17. Tag des Erntemondes im 15. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Zischend schnitt die Bambusrute durch die Luft und klatschte auf den Rücken des wimmernden Maskenschneiders, während einige Karang die Goldstücke aufhoben, die aus seinem aufgetrennten Ledergürtel gerollt waren.
»Nutzloser Tand!«, rief Arun, der mondgesichtige Dorfvorsteher, und ließ noch einmal die Rute auf den Rücken des Handwerkers niedersausen, der im Palast der Künstler die Masken gefertigt hatte, die von den Adeligen zu ihren Festen getragen worden waren. So berühmt waren seine Arbeiten, dass selbst der Khan ihn an seinen Wandernden Hof hatte holen wollen.
Arun bückte sich nach einem der Goldstücke und hielt es dem Handwerker dicht vor die Nase. »Das hier ist nichts!« Er schleuderte das Goldstück in das weite Reisfeld, das den Weg säumte.
Nok hörte, wie es mit einem leisen Platschen im Wasser verschwand.
»Noch mal nichts!«, rief Arun und schleuderte ein weiteres Goldstück in die Nacht. »In der neuen Welt bekommt jeder, was er verdient. Kleidung, Essen, einen Platz zum Schlafen, ein Dach über dem Kopf. Wir sind eine große Gemeinschaft aus Brüdern und Schwestern. Wir teilen alles. Es wird für jeden gesorgt sein, der der Gemeinschaft dient. Münzen haben keinen Wert mehr. Sie wurden von Tyrannen ersonnen, um das Volk ausplündern zu können.« Der Mondgesichtige drehte eine der Münzen zwischen den Fingern. »Warum sollte so ein Ding mehr wert sein als ein großer Sack voller Reis?«
»Ich erkenne, das ist dumm«, wimmerte der Maskenschneider.
»Dann ist ja nicht alle Hoffnung verloren.« Der Dorfvorsteher von Melu Wat klopfte dem Maskenschneider auf die Schulter. »Befreie dich vom Ballast deines alten Lebens. Wirf die übrigen Münzen weit ins Reisfeld hinaus. Du wirst sehen, danach fühlst du dich erleichtert. Und wenn du deine erste Schale mit selbst angebautem Reis isst, wirst du ein glücklicher Mensch sein. Es gibt nichts Besseres als die Zufriedenheit, nachdem man die Früchte seiner Arbeit genossen hat. Ich verspreche dir: Besser hast du dich in deinem ganzen Leben noch nicht gefühlt.«
Nok überlegte, ob das stimmen konnte. Ihr Magen knurrte. Eine Schale voll Reis hätte sie jetzt auch glücklich gemacht. Ihre Mutter hatte für den Hammermann gekocht. Er und sieben andere Männer hatten sich die Bäuche vollgeschlagen und den köstlichen Reisbrei gelobt. Und dann hatten sie für Nok und ihre Familie nur eine Schale wässrigen Reis übrig gelassen. Doch ihre Mutter wagte es nicht, neuen zu kochen. Der Hammermann hatte sie ermahnt, nicht ein Reiskorn zu stehlen. Konnte man von seinem eigenen Reis stehlen?
Der Hammermann hatte entschieden, dass ihr Reis nun ihm gehörte. Sie mussten ihn für ihn tragen, mussten ihn für ihn kochen, aber essen durften sie ihn nicht.
Nok fuhr mit der Hand durch den Kupferkessel, den sie zum Kochen nutzten. Nicht ein Reiskorn war darin geblieben. Hungrig schielte sie zu den mit Reis gefüllten Säcken hinüber. Ihr Vater kauerte daneben. Mit leerem Blick stierte er vor sich hin. Ab und an kamen wirre Silben über seine Lippen, die sich nicht zu Worten formen wollten. Drei Fingerbreit ragte der Nagel aus seiner Stirn. Wie ein dünnes Horn. Mutter hatte ihm die Hälfte der spärlichen Reisration zu essen gegeben.
Noks Magen verkrampfte sich. Sie presste sich die Faust gegen den Bauch. Noch nie war sie so hungrig gewesen.
Der Maskenschneider warf sein Gold ins Reisfeld und lobte dabei überschwänglich die Weisheit des Dorfvorstehers Arun. Kunthea gesellte sich zu den beiden. Nok sah genau, was ihre Mutter tat. Sie hatte von Kunthea schon viel über die zweite Rolle des Theaterabends gelernt. Sie sah, wie ihre Mutter sich in der Kunst des flammenlosen Feuers übte. Die Art, wie sie stand, der Ton, in dem sie sprach … Es gab unzählige diskrete Möglichkeiten, in seinem Gegenüber den Traum von einem Rausch der Sinne erwachsen zu lassen. Doch ging sie viel subtiler vor als jene Frauen, denen Liebe zum Geschäft geworden war. Sie verstand es, die Hitze der Leidenschaft zu schüren, ohne dass der andere bemerkte, dass es eine Flamme gab. Arun sollte glauben, dass alles von ihm ausging. Das Begehren und die Kunstfertigkeit, die Frau zu umgarnen, bis sich seine Wünsche erfüllten. Er sollte sich als unwiderstehlicher Eroberer fühlen, um die Früchte der Nacht noch süßer werden zu lassen. Dies war der Unterschied zwischen den Huren und den Schauspielerinnen, die sich in der zweiten Rolle übten.
Auch wenn Nok den Dorfvorsteher nicht leiden konnte, hoffte sie, dass ihre Mutter ihn gewinnen konnte und er sich als großzügig erwies. Denn dies war das Risiko dabei. Glaubte ein Mann, er habe ganz und gar aus eigenem Vermögen eine Frau erobert, dann verfiel er womöglich dem Irrtum, der Beischlaf sei für die Frau Belohnung genug.
Am Hof des Königs war es nicht so gewesen. Die kultivierten Gäste der Theatervorstellungen waren sich der Regeln des Spiels abseits der Bühne bewusst. Durfte man das auch von einem Bauern erhoffen?
Wieder zog sich Nok der Magen zusammen. Sie stellte den sauber gewischten Kessel fort und legte sich am Rand der Straße in den Staub. Mit dem Blick auf ihren Vater schlief sie ein.
Südlich von Korang Hom, Stunde der Ratte, 17. Tag des Erntemondes im 15. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Nok erwachte mit einem Gefühl, als würde ein großer, schwerer Stein auf ihrer Brust liegen, der ihr das Atmen unmöglich machte. Sie hielt die Augen geschlossen, wusste selbst im Halbschlaf sofort, wo sie sich befand: im Staub der Straße nach Süden. Sie hörte Schnarchen. Irgendwo entfernt leises Wimmern. Und kaum noch wahrnehmbar das Geräusch der Leidenschaft.
Ganz in der Nähe aber wurde geflüstert. Sie erkannte die Stimme ihres Onkels.
»Entschuldige … So lange habe ich dich falsch eingeschätzt. Dich falsch behandelt … Wenn unser Vater dich hätte kämpfen sehen! Du bist ein Sovan, ein Krieger. Und ein Held.«
Da lag etwas in der Stimme ihres Onkels, das Nok die Augen aufschlagen ließ.
Sao kauerte bei ihrem Vater. Er hielt Bun im Arm, wie man ein Kind im Arm hielt, wiegte ihn und presste ihm dabei fest die Rechte auf Mund und Nase.
»Du bist schon nicht mehr hier … Deine Seele hat dich verlassen. Ist im Palast bei all den anderen. In der weiten Halle, in welcher der Rauch den Geistern Gestalt verleiht. Dies ist nur noch eine Hülle. Das bist nicht mehr du, mein Bruder.«
Ihr Vater leistete keinen Widerstand.
Nok sah, wie seine Beine zitterten, doch der Körper bäumte sich nicht auf, kämpfte nicht an gegen die Hand, die ihm den Atem nahm.
Ihr Magen knurrte. Sie dachte daran, wie ihre Mutter ihm die Hälfte von allem Reis gegeben hatte. Dabei hatte er nichts von ihren Lasten getragen und redete auch nicht mehr. Er hatte sich den Reis nicht verdient!
Das waren die Worte der Karang, wurde ihr bewusst. War es Verrat, so zu denken? Der Hunger peinigte Nok.
Ihr Vater lag jetzt still in den Armen ihres Onkels.
Sao ließ den Leib sanft auf die Straße sinken. Als er sich erhob, bemerkte er, dass sie ihn ansah. Er legte einen Finger an die Lippen.
Nok nickte.
Ihr Onkel kam zu ihr herüber. »Es war meine Pflicht.« Seine Stimme klang gehetzt. »Das war nicht mehr dein Vater. Der Hammermann hat ihm die Seele entrissen …« Sao stockte, suchte nach Worten. »Ich werde jetzt auf euch aufpassen. Auf deine Mutter und auf dich und deine beiden Schwestern. Ihr seid Sovans. Ihr seid stark. Jede von euch hat das Herz eines Kriegers, so wie euer Vater. Ich kann es in deinen Augen sehen, Nok. Du bist etwas Besonderes. Du wirst all dies überstehen. Du wirst bis zum Ende der Straße gehen. Wir Sovan sterben oder wir siegen, aber wie geben niemals auf. So wie dein Vater.«
Nok brauchte keine Worte. Sie war in einer Theaterfamilie aufgewachsen. Sie spürte, wenn jemand seinen Text nicht beherrschte. Ihr Onkel improvisierte. Versuchte schönzureden, was er getan hatte. Es vor sich selbst zu rechtfertigen. Und auch vor ihr. Sie aber brauchte keine Worte. Und auch Chenda und Jiut nicht, nicht einmal ihre Mutter. Nok musste an den köstlichen weißen Reis denken, den Kunthea ihrem Vater in den Mund geschoben hatte.
»Bring uns zu essen!«, sagte sie fordernd zu Sao. Dann schloss sie die Augen und dachte an ihren Vater. Daran, wie er sie in den Armen gehalten hatte. Wie er ihr von klein auf beigebracht hatte, eine Rolle zu spielen und ganz darin aufzugehen, jemand anders zu sein. Alles hinter sich zu lassen. Alle Gefühle.
Der Mann mit dem Nagel in der Stirn war nicht mehr ihr Vater gewesen. Auch nicht der vorgebliche General, der so verächtlich von den Bälgern der Köchin gesprochen hatte. Das alles waren nur Rollen. Ihr Vater war ein Mann mit freundlicher Stimme und liebenden Augen. Und in ihrer Erinnerung würde er so lange weiterleben, wie sie atmete.
Korang Hom, Stunde des Ebers, 10. Tag des Hitzemondes im 15. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Es war eine Lektion in Demut, zu sehen, wie das, was bis vor Kurzem der Mittelpunkt seines Lebens gewesen war, in Bedeutungslosigkeit versank.
Sao schritt durch die verlassene Königsstadt Korang Hom. Die breiten Straßen, die gerade noch vor Leben überquollen, lagen verwaist. In den Fugen zwischen den großen Platten des Straßenpflasters wucherte bereits Gras, obwohl kaum mehr als drei Wochen vergangen waren. Er sah die Auslagen der Stände. Feine Töpferwaren, Säcke mit kostbaren Gewürzen, auf denen blaugrau der Schimmel wucherte. Die Karang hatten nichts von all dem angerührt. Nirgends war geplündert worden. Sao hatte in seinem langen Leben als Krieger schon eroberte Städte gesehen. Er war zwei Jahre mit General Xiang Yu in dessen Eiserner Horde geritten. Als einer von vielen Befehlshabern, die für den großen Krieg, der da kommen musste, Erfahrungen im Kampf gegen die Käsestinker sammeln sollte. Er hatte erlebt, wie es war, wenn ein Heer eine Stadt mit Gewalt nahm, und wie schwer es war, die Krieger nach den Plünderungen wieder zu Zucht und Ordnung zu zwingen.
Die Karang hatten ihn überrascht. Er hätte es niemals für möglich gehalten, dass es eine Eroberung fast ohne Blutvergießen geben könnte. Und dass man diese Stadt, von der alle Macht ausgegangen war, im Augenblick des Sieges einfach aufgab.
Er blickte zum Hammermann, den er begleitete. Der kleine, zähe Rebell bemerkte sofort, dass er ihn ansah. Sie mochten einander nicht. Sao hatte keinerlei Zweifel daran, dass der Hammermann die Versammlung, die der Erste Schatten im Königspalast einberufen hatte, nutzen würde, um ihn zu diskreditieren und hinrichten zu lassen.
»Freust du dich darauf, endlich dem Ersten Schatten zu begegnen?«, fragte ihn der Karang.
»Gefühle wie Freude und Neugierde sind überkommen und aus der alten Welt«, entgegnete Sao glatt. »Ich schöpfe meine Freude daraus, dem Ersten Schatten zu dienen.« Sao war immer wieder überrascht, wie viel Aufhebens die Rebellen um Geheimhaltung machten und was für bösartige Intrigen sich die Machthaber vom Rang des Hammermanns lieferten.
Kaum einer hatte den Ersten Schatten je zu Gesicht bekommen. Gleiches galt für den Schwarzen Panther. Und auch die verschiedenen Befehlshaber auf Provinzebene kannten sich untereinander nicht. Da waren nur die Namen, mit denen man keine Gesichter verband.
Sao hatte herausgefunden, dass der Verräter im Königspalast die Schwarze Distel genannt worden war. Diese Distel war eine Legende. Sao vermutete, dass es der Name war, den die Karang ihm gegeben hatten. Sicher war er sich da nicht, denn die Spitzel, denen er Berichte über Planungen und Truppenbewegungen gegen die Rebellen hatte zukommen lassen, hatten ihn nie so angesprochen. Aber da offensichtlich niemand sonst sich so nennen ließ, hatte Sao den Namen einfach für sich in Anspruch genommen. Der Hammermann hätte ihn gern umgebracht, weil er einer aus dem Palast war. Aber seit er in Anwesenheit von mehr als hundert Karang behauptet hatte, die Schwarze Distel zu sein, war dies nicht mehr möglich.
Der Ruhm der Distel reichte weiter als der des Hammermanns. Und dieser kleine Mistkerl wusste nicht, ob Sao den Ersten Schatten vielleicht sogar persönlich kannte. Sao hatte das nie behauptet, aber Andeutungen gemacht, die man so auslegen konnte.
»Und du bist ein guter Diener des Ersten Schattens?«, fragte der Hammermann gereizt.
»Der Erste Schatten weiß um meinen Beitrag, die neue Welt zu begründen. Er kennt meinen Namen und weiß, dass ich jeden seiner Befehle zu seiner vollsten Zufriedenheit umgesetzt habe«, behauptete Sao. Tatsächlich hatte er nie Befehle vom Ersten Schatten bekommen. Jede seiner Taten, jeden Verrat hatte er aus eigenem Entschluss begangen. Er hatte unzählige Briefe an den Ersten Schatten übermitteln lassen, aber nie einen schriftlichen Befehl vom Anführer der Karang erhalten. Aber das konnte der Hammermann nicht wissen. »Dreimal hat mir der Erste Schatten Briefe gesandt, in denen er mir für meine Hilfe dankte, die neue Welt zu erschaffen, nachdem die Seen-Provinz und die Affenberge erobert werden konnten. Aber das kennst du gewiss, Hammermann. Auch dir wird er für deine großen Taten im Kampf um den Süden gedankt haben.«
Mit großer Genugtuung nahm Sao den Blick zur Kenntnis, mit dem ihn dieser mordende Drecksack bedachte. Eifersucht, Angst und widerwilliger Respekt, all das war in diesem Blick vereint. Wenn dieser dürre kleine Hammerschwinger meinte, er könnte ihn durch eine billige Intrige loswerden, dann hatte er sich geirrt. Sao hatte ein Leben am Hof des Königs verbracht. Ja, er war sogar ein Jahr lang als Gesandter am Wandernden Hof des Khans gewesen. Wie man Intrigen konterte, hatte er mit der Muttermilch aufgesogen.
Der Hammermann sah ihn an. »Weißt du, was passieren wird, wenn ich dir jetzt einen Nagel in den Kopf schlage? Nichts, Distel, denn der König ist tot, der Palast gefallen. Der Erste Schatten braucht dich nicht länger.«
Das war eine stärkere Antwort, als Sao erwartet hatte. Vielleicht steckte in diesem kleinen Bauern ja mehr, als er vermutet hatte?
Sao blieb stehen und drehte sich so, dass das Schwert an seiner Seite gut zu sehen war.
Die beiden Bauern mit Bambusspeeren, die sie als Eskorte begleiteten, sahen nervös zum Hammermann.
»Erinnerst du dich an den Kampf von General Sao auf der Straße nach Süden?«
»Ich wundere mich immer noch über seinen plötzlichen Tod. Dabei schien er den Nagel so erstaunlich gut vertragen zu haben.«
Sao musste all seine Willensstärke aufbieten, um nicht nach seinem Schwert zu greifen. Es durfte nicht hier sein. Diese drei durften hier nicht von seiner Hand sterben. Andere Karang wussten, dass er mit dem Hammermann unterwegs war. Und man würde die Schwertwunden erkennen. Selbst diese dämlichen Bauern. Er musste abwarten. Er durfte sich nicht von seinen Gefühlen hinreißen lassen!
»Das Schicksal nimmt manchmal seltsame Wege«, erwiderte er leichthin.
»Und was war mit dem Kampf gegen General Sao?«, fragte der Hammermann eisig.
»Du erinnerst dich daran, wie er gegen deine Bambusspeerträger gekämpft hat?«
»Weißt du, wie viele Krieger auf den Speeren meiner Männer gestorben sind, Distel? Es ist etwas anderes, gegen einen General zu kämpfen. Vergleichst du dich etwa mit ihm?«
»Wenn ich mich recht erinnere, war ich es, der ihn zu Fall brachte.«
Der Hammermann lachte auf. »Nachdem er schon lange gekämpft hatte und verwundet war. Überschätze dich besser nicht, Distel. Nur weil du ein Schwert an deiner Seite trägst, bist du noch lange kein Kämpfer wie Sao. Es heißt, er sei an der Seite von General Xiang Yu in die Schlacht gezogen.«
»Wahrscheinlich hast du recht …« Sao deutete eine Verbeugung an. »Bitte verzeih meine Unbeherrschtheit, Bruder.«
»Schon vergessen.«
Schweigend folgten sie der breiten Straße zum Palast.
Sao wusste, dass der Hammermann niemand war, der einen Streit vergaß. Er hatte in ihm einen Feind, und im Palast würde der Dreckskerl versuchen, ihn umbringen zu lassen. Sich mit ihm zu streiten war dumm gewesen. Aber er würde ihn töten! Und wenn es das Letzte war, was er tat!
So viele Jahre hatte Sao seinem kleinen Bruder Bun Vorhaltungen gemacht. Hatte mit ihm gehadert, weil er Schauspieler geworden war statt ebenfalls ein Krieger, wie ihr Vater es sich gewünscht hätte. Er hatte Bun verprügelt in seinem Zorn, hatte ihn bedroht, aber sein kleiner Bruder war unbeirrt seinen Weg gegangen. Sao hatte ihn einen Weichling genannt, einen Tofu. Aber Bun schaffte es, den König von seinem Talent zu überzeugen, und wurde für seine Familie unantastbar. Er kam in den Palast der Künstler und erhielt seine Ausbildung. Von da an hatte Sao ihn lange nur noch von Ferne gesehen. Und als er dann auch noch diese Kunthea heiratete … sie stammte aus Samhan, einem Königreich weit im Norden, das berühmt war für seine Künstler, für seinen Gesang und für schöne Kleider.
Für Sao war Kunthea immer nur eine Hure gewesen. Eine sehr teure Hure … Er wusste, dass sie sich König Varmajaya hingegeben hatte wie auch anderen … und dann hatte er begriffen, dass sein Bruder Bun das ebenfalls tat. Jeder, der auf der Bühne stand und eine Sprechrolle hatte, war danach zu haben. Und diese Schauspieler fanden offensichtlich nichts dabei! Er hatte jahrelang mit seinem Bruder nicht gesprochen. Und als Kunthea die Kinder bekommen hatte … Immer, wenn er die Kinder angesehen hatte, hatte er gedacht, dass Bun nicht wissen konnte, von wem sie waren. War seinem Bruder das egal? Und er duldete, dass seine drei Töchter zu Schauspielerinnen ausgebildet wurden. Zu Huren!
Sao war verzweifelt gewesen, wie sein Bruder ihren Namen so in den Dreck ziehen konnte. Seit Jahrhunderten waren die Sovans mit dem Königshaus verbunden. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte er darüber nachgedacht, Bun zu ermorden, um alldem ein Ende zu setzen.
Jetzt bereute Sao, dass er nicht zu seinem kleinen Bruder gegangen war, um mit ihm zu reden. Als Bun aufgestanden war und behauptet hatte, er zu sein, als er seinen Bruder hatte kämpfen sehen, völlig furchtlos, als Bun bis zuletzt alles gegeben hatte, um seine Familie zu beschützen – und auch ihn –, da erst hatte Sao begriffen, wie wenig er seinen Bruder gekannt hatte.
Sie erreichten die Brücke zum Palast. Ein einzelner Karang stand dort Wache. Ein junger Bursche von höchstens vierzehn Jahren, schätzte Sao. Er musterte sie mit verschlossenem Gesicht, machte aber keine Anstalten, sie aufzuhalten. Eine Narbe lief quer über seine linke Wange. Diese Narbe … Sao erinnerte sich. Der Junge war ein Stallbursche im Palast gewesen. Er sah ihn scharf an. Erkannte der Kerl ihn auch? Konnte er ihn verraten? Schweißtropfen standen auf der niedrigen Stirn des Jungen. Er hatte etwas Animalisches an sich. Seine Augen waren leer. Keine Spur des Erkennens lag in seinem Blick.
Sao mochte die Karang nicht. Sie hatten den Bürgerkrieg gewonnen, aber richtige Krieger waren sie nicht. Ihr größter Vorteil war es gewesen, von dem überzeugt zu sein, wofür sie kämpften. Von den Schatten, die sich nun hier, im verlassenen Palast, versammelten.
Sao blickte auf das mächtige Portal, hinter dem die Halle der tausend Geister lag. Würde Bun dort sein? Würde sein Bruder voller Verachtung auf ihn hinabsehen, wenn er die Halle durchquerte? Am Ende war der, der den General nur auf der Bühne gespielt hatte, der größere Krieger von ihnen beiden gewesen.
Korang Hom, Palast der sieben Freuden, Stunde des Huhns, 10. Tag des Hitzemondes im 15. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Pau hatte Mühe, den Worten des Ersten Schattens zu folgen. Das große Haus des Königs beunruhigte ihn. Der Saal, in dem sie sich versammelt hatten, war größer, als es alle Häuser seines Dorfes zusammen gewesen wären. Des Dorfes, das es längst nicht mehr gab. Wegen des Königs!
Pau fragte sich, wozu ein einzelner Mann einen so großen Saal gebraucht hatte. Früher am Tag war er sogar in einem noch größeren Saal gewesen, in dem ein goldener Stuhl mit glitzernden Steinen gestanden hatte. Er wünschte, der Erste Schatten würde auf dem Hof zu ihnen sprechen, wo er den Himmel hätte sehen können.
Er tastete nach dem Hammer unter seiner schwarzen Tunika. Ob die anderen ihm anmerkten, dass ihm dieser riesige Saal zu schaffen machte? Oder ging es ihnen wie ihm?
Aus dem Augenwinkel spähte er zu den übrigen Karang. Sie waren nun die mächtigsten Männer des Königreiches. Die derben Gesichter machten Pau Mut. Sie waren wie er. Aber der Erste Schatten war anders. Er schien es zu genießen, vor ihnen auf und ab zu gehen und in diesem viel zu großen Saal zu sein. Er sprach von ihren Siegen. Lobte sie. Nannte einige bei ihren Namen. Den Namen, die sie im Krieg angenommen hatten. Mit den richtigen Namen sprachen sie sich nie an. Im Krieg war das besser gewesen. So konnte kein Gefangener etwas über die Familien seiner Mitstreiter verraten.
Paus Blick blieb an der Schwarzen Distel haften. Keiner saß so aufrecht wie dieser Verräter. Er hatte den König hintergangen, in diesem großen Haus gelebt, den Bauch immer voll gehabt, und doch hatte er sich für die Hungernden eingesetzt. Pau konnte diesen Verrat nicht begreifen. Und was er nicht begriff, schaffte er gern aus der Welt. Darum ging es in ihrem Kampf: die Welt einfacher zu machen, damit sie zugleich wieder gerechter wurde.
Die Schwarze Distel passte nicht in diese neue Welt. Das würde Pau dem Ersten Schatten erklären, sobald er Gelegenheit dazu hatte.
Wieder tastete er nach dem Hammer unter seiner Tunika. Es war gut, das Eisen zu spüren. Er hatte auch schon einen Nagel für die Schwarze Distel ausgewählt. Der Krieger strahlte Macht aus, so aufrecht, wie er da auf seiner Matte saß, den Blick fest auf den Ersten Schatten gerichtet. Als Einziger trug die Distel das gelbe Halstuch um die Stirn gewickelt. Als Einziger unter allen Befehlshabern hier führte er ein Schwert. Bambusspeere oder aber einfache Werkzeuge waren die Waffen des Volkes. Die Distel passte nicht hierher. Er war ein alter Mensch. Und er gab sich keine Mühe, das zu verbergen. Wenn man Männer wie ihn am Leben ließ, dann konnte die Welt nicht gut und gerecht werden.
Der Steuereintreiber des Königs, der in ihr Dorf gekommen war, war so ein Mann gewesen. Voller Macht und ohne Gnade. Pau war Dorfvorsteher. Er war mit ihm zu den Feldern gegangen, hatte es ihm gezeigt: Die halbe Ernte war verdorben gewesen. Dennoch hatte der Steuereintreiber darauf bestanden, dass die vollen Abgaben an den König geleistet wurden. Seine Krieger hatten den Reisspeicher leergeräumt. Taub für die Klagen der Bauern. Taub für die weinenden Kinder.
Pau hatte es dabei nicht bewenden lassen. Er war dem Steuereintreiber und den großen Lastkarren gefolgt. In der Nacht hatte er einen Sack Reis gestohlen. Er hätte besser erst die Hunde getötet, aber damals war er nur ein Dorfvorsteher gewesen. Kein Dieb und schon gar kein lebender Schatten.
Der Sack Reis war zu schwer gewesen. Noch ein Fehler … aber er hatte ja auch genügen sollen, um seine Familie durchzubringen. Seinen alten Vater, seine Frau und seine beiden Söhne.
Die Wachen des Steuereintreibers hatten ihn schnell gefasst. Heute noch konnte er sich an jede Einzelheit der Hütte erinnern, in die sie ihn gebracht hatten. Vor allem an den grob gezimmerten Tisch. Sie hatten ihn festgehalten, seine Arme gestreckt, und dann hatten sie zwischen seinen Fingern Nägel in das Holz getrieben, um anschließend jeden einzelnen Finger mit einer starken Schnur festzubinden.
Dann erst war der Steuereintreiber gekommen. Mit einem Hammer. Der Beamte des Königs hatte davon erzählt, was für ein schweres Verbrechen es war, den Herrscher zu bestehlen. Und nach jedem Satz hatte er Pau mit dem Hammer auf die Hände geschlagen. Er hatte ihm alle Finger gebrochen und auch einige der Knochen mitten in der Hand.
Wenn das Wetter umschlug, wenn die Regenzeit kam, dann schmerzten Paus Hände so sehr, dass er Opium rauchen musste, um die Tage zu überstehen. Und erst die Nächte … In den Nächten sah er immer wieder das Gesicht des Steuereintreibers.