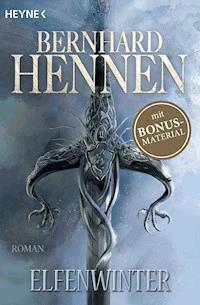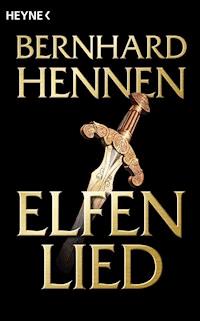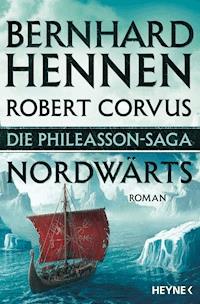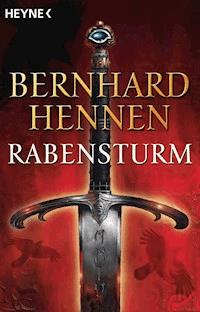9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Chroniken von Azuhr
- Sprache: Deutsch
Der Beginn eines neuen magischen Zeitalters – die neue Bestseller-Serie von Deutschlands Fantasy-Autor Nr. 1: Bernhard Hennen! Der junge Milan Tormeno ist dazu ausersehen, seinem Vater Nandus in das Amt des Erzpriesters zu folgen: Er soll einer jener mächtigen Auserwählten werden, die die Geschicke der Welt Azuhr lenken. Doch Milan kann nicht akzeptieren, dass sein Schicksal vorherbestimmt ist. Er rebelliert – und verstrickt sich mit der Meisterdiebin Felicia und der geheimnisvollen Konkubine Nok in ein gefährliches Netz von Intrigen. Gemeinsam geraten sie in den Bann einer alten Prophezeiung – einer Prophezeiung, nach der die Ankunft des »Schwarzen Mondes« in Azuhr ein neues Zeitalter der Magie einläuten wird ... »Man nennt ihn auch den ›Herrn der Elfen‹: Bernhard Hennen ist der zurzeit erfolgreichste Fantasy-Autor im deutschsprachigen Raum.« Express
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 804
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bernhard Hennen
Die Chroniken von Azuhr
Der Verfluchte
Über dieses Buch
Der Beginn eines neuen magischen Zeitalters: Der junge Milan Tormeno ist dazu ausersehen, seinem Vater Nandus in das Amt des Erzpriesters zu folgen: Er soll einer jener mächtigen Auserwählten werden, die die Geschicke der Welt Azuhr lenken. Doch Milan kann nicht akzeptieren, dass sein Schicksal vorherbestimmt ist. Er rebelliert – und verstrickt sich mit der Meisterdiebin Felicia und der geheimnisvollen Konkubine Nok in ein gefährliches Netz von Intrigen.
Gemeinsam geraten sie in den Bann einer alten Prophezeiung steht – einer Prophezeiung, nach der die Ankunft des »Schwarzen Mondes« in Azuhr ein neues Zeitalter der Magie einläuten wird ...
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Karte]
[Widmung]
[Motto]
Arbora, Atrium hinter dem Oktagon, früher Abend, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Kornmarkt, früher Abend, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Haus des Hafenmeisters, erste Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Via Monte, vor dem Mondtor, erste Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Palazzo Canali, zweite Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Zwinger der Hafenfestung der Ritter des Ordens vom Schwarzen Adler, zweite Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Hafen, längsseits der Fernhandelskogge Magdalena, zweite Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Schreibzimmer im Palazzo des Erzpriesters von Arbora, dritte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Mondtor, Stadtmauer von Arbora, dritte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Palazzo Canali, dritte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Via Monte, vor dem Mondtor, dritte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Stadtmauer am Mondtor, dritte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Rosengarten des Palazzo Canali, vierte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Brunnenkanal unter der Stadt, vierte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, vor der Stadtmauer, vierte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, vor der Stadtmauer, vierte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Festungswerk des Mondtors, fünfte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Landgut Solarino, 23 Meilen südöstlich von Arbora, fünfte Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
53 Jahre später
Dahlia, Oktagon, früher Abend, 17. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Oktagon, früher Abend, 17. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, unweit des Oktagons, früher Abend, 17. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Versteck der Diebe, Abend, 17. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Hafen, Abend, 17. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, später Abend, 17. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Fischmarkt, Mittagsstunde, 18. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Turm der Conoscenti, Abenddämmerung, 18. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Gasse der Tuchfärber, Morgendämmerung, 19. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Fischmarkt, Morgendämmerung, 19. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Piazza Cynthia, Morgendämmerung, 19. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Oktagon, Abendstunde, 19. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Platz der Helden, Nachmittag, 21. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Viertel der Tuchhändler, Nachmittag, 24. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Piazza Cynthia, vor der Morgendämmerung, 25. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Viertel der Tuchhändler, Stunde des Hasen, 25. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Hafen, früher Nachmittag, 25. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, später Nachmittag, 25. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, später Nachmittag, 25. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Straße der Brunnen, vor der Morgendämmerung, 26. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Weißer Berg, Morgendämmerung, 26. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, Abend, 30. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Straße der Brunnen, Abend, 30. Tag des Erntemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Platz der Helden, Nachmittag, 1. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Fischmarkt, Nachmittag, 1. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Kerker der Stadtwache, Morgengrauen, 2. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Straße der Schmerzen, Morgen, 2. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Fischmarkt, Morgen, 2. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Fischmarkt, Morgen, 2. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, Abend, 2. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Kontor Cornaro, Nacht, 2. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, Nacht, 2. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Dach des Palazzo Tormeno, Nacht, 2. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Kontor Cornaro, vor dem Morgengrauen, 3. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, Stunde der Abendmesse, 3. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, nach der Abendmesse, 3. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Apolita, Abend, 3. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, kurz nach Mitternacht, 4. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, nach Mitternacht, 4. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, alte Stadtmauer, nach Mitternacht, 4. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Dritte Insula an der Mauergasse, nach Mitternacht, 4. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, nach Einbruch der Nacht, 4. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Oktagon des Heiligen Filippo, Nacht, 4. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Oktagon des Heiligen Filippo, kurz nach Mitternacht, 5. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Viertel der Tuchhändler, Stunde des Hasen, 5. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, kurz nach der Mittagsstunde, 5. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, später Nachmittag, 5. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, eine Stunde vor dem Morgengrauen, 6. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, vor den Stadtmauern, kurz vor dem Morgengrauen, 6. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Korntor, später Morgen, 6. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Ferranta, Palazzo Trimini, später Morgen, 8. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Ferranta, Palazzo Trimini, später Morgen, 8. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, später Nachmittag, 11. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Rote Gasse, später Nachmittag, 11. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Oktagon des Heiligen Filippo, früher Abend, 11. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Brücke an der Wolfsklamm, 17 Meilen südlich von Dahlia, Abend, 13. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Oktagon des Heiligen Filippo, Vormittag, 14. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Oktagon des Heiligen Filippo, Vormittag, 14. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Oktagon des Heiligen Filippo, Vormittag, 14. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Oktagon des Heiligen Filippo, Vormittag, 14. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Ferranta, Palazzo Trimini, später Morgen, 14. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, Mittag, 14. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Garten des Palazzo Apolita, Abend, 14. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Kerker der Stadtwache, Abend, 14. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Viertel der Tuchhändler, Stunde des Ebers, 16. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Oktagon, Frühmesse, 17. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, früher Morgen, 17. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, Morgen, 17. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Kerker der Stadtwache, Morgen, 17. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Kerker der Stadtwache, Mittag, 17. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, vor dem Morgengrauen, 18. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Platz der Helden, früher Morgen, 18. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Palazzo Tormeno, nicht lange vor Einsetzen der Abenddämmerung, 18. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Fischmarkt, Abenddämmerung, 18. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Fischmarkt, früher Abend, 18. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, am Rand des Schwertwaldes, Nachmittag, 19. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Krakenbucht, Mittag, 20. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Gasse der Blumenfärber, Abenddämmerung, 20. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Hafenkai, Abend, 20. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Palazzo Canali, kurz vor Mitternacht, 20. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Garten des Palazzo Canali, kurz vor dem Morgengrauen, 21. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Hafen, kurz vor dem Morgengrauen, 21. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Arbora, Palazzo Tormeno, Morgengrauen, 21. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Via Silesa, nahe Calatania, Mittag, 21. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Schwertwald, nahe Thouar, Nachmittag, 23. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Viertel der Tuchhändler, Stunde des Ebers, 23. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Thouar, Zunftsaal, Mittag, 24. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Blutbrücke, Nachmittag, 24. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Tief im Schwertwald, Nacht, 26. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Vor den Mauern von Thouar, Abend, 27. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Nördlicher Schwertwald, Mittag, 29. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Eine Lichtung im Schwertwald, Mittag, 29. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Thouar, Zunftsaal, Mittag, 30. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Thouar, Kerker der Rosenburg, früher Abend, 30. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Nördlicher Schwertwald, Abend, 30. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Thouar, Rittersaal der Rosenburg, Abend, 30. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Thouar, Schwarzer Krake, Abend, 30. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Thouar, Hafen, Abend, 30. Tag des Hitzemondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Thouar, Kerker der Rosenburg, früher Morgen, 1. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Thouar, Zunftsaal, Morgen, 1. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Südlicher Schwertwald, später Nachmittag, 5. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Weißer Wald, Palast der Weißen Königin, Abenddämmerung, 5. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Weißer Wald, Palast der Weißen Königin, Morgen, 6. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Weißer Wald, unweit des Palastes der Weißen Königin, Mittag, 6. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Bauernhof, Hügelland östlich des Schwertwaldes, früher Morgen, 7. Tag des Apfelmondes, im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Via Matani, 143 Meilen nordöstlich von Kamarina, Mittag, 7. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Abseits der Via Matani, 138 Meilen nordöstlich Kamarina, Nacht, 7. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Viertel der Tuchhändler, Stunde des Ebers, 9. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Fischmarkt, eine Stunde vor Mitternacht, 9. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Fischmarkt, Stunde der Ratte, 9. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Nördlicher Schwertwald, nahe der Küste, eine halbe Stunde vor Mitternacht, 9. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Nördlicher Schwertwald, nahe der Küste, kurz nach Mitternacht, 10. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Fischmarkt, Stunde des Hasen, 10. Tag des Apfelmondes im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Dahlia, Bienengasse, kurz vor Mittag, 13. Tag des Apfelmondes, im Jahr von Sasmiras zweiter Thronerhebung
Danksagung
Für ein Lächeln in der Nacht.
Uns ist in alten Mæren wunders vil geseit
von Helden lobebæren, von grôzer arebeit,
von freuden, hôchgezîten, von weinen und von klagen,
von küener recken strîten muget ír nu wunder hœren sagen.
(Erste Strophe des Nibelungenliedes)
Uns wird in alten Mären viel Wundersames berichtet,
von ruhmreichen Helden, von großer Mühsal,
von Festen, von glücklichen Tagen, von Weinen und von Wehklagen,
von Kämpfen kühner Recken wird euch nun Wunderbares erzählt werden.
(Übersetzung: Bernhard Hennen)
Arbora, Atrium hinter dem Oktagon, früher Abend, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Die schillernden Federn leuchteten im Abendlicht. Wie Rubine funkelten die Blutstropfen, die den abgebissenen Pfauenkopf säumten.
»Cato!« Es war eher ein Stoßseufzer als ein Aufschrei.
Blutige Pfotenabdrücke auf den Sandsteinplatten des Atriums verrieten, dass der Pfauenmörder sich hinter den Brunnen verzogen hatte. Und den Kadaver hatte er dabei mit sich gezerrt.
Lucio war aus der kleinen Pforte an der Rückseite des Oktagons getreten. Gerade noch war er in Hochstimmung gewesen, da fast doppelt so viele Gläubige wie üblich zur Abendmesse gekommen waren. Er hatte die Mär vom Krähenmann erzählt. Eine wunderbare Geschichte darüber, wie am Ende stets die Gerechtigkeit über das Dunkel in der Welt obsiegte.
Natürlich war sich Lucio bewusst, dass die meisten Besucher vor der drückenden Hitze des Abends in den kühlen Kuppelbau des Oktagons geflüchtet waren. Aber sei’s drum; er hatte siebzehn Zuhörer gehabt, so zahlreich waren seine Tempelbesucher schon lange nicht mehr gewesen. Arbora hatte zu viele Verlockungen zu bieten. In den anderen Städten erzählte man sich, dass hier selbst die Bettler reich genug waren, um ins Hurenhaus zu gehen.
Lucio straffte sich. Er war Erzpriester und ein verheirateter Mann. Seit Sibelle sich mit Nandus, ihrem gemeinsamen Sohn, für den Sommer auf den großen Gutshof ihres Bruders in den Bergen zurückgezogen hatte, dachte er viel zu oft an die Verlockungen der Freudenhäuser. Nie hatte er dieser Versuchung nachgegeben, wusste er doch aus den Geständnissen bußfertiger Gläubiger nur allzu gut, wie die süßen Geschenke der Nacht das Leben danach vergällten.
Lucio trat in den Innenhof und hob den Kopf des Pfaus auf. Tote Augen, schwarz wie Obsidian, starrten aus königsblauer Federpracht.
Er würde wenig Freude haben, wenn Sibelle zurückkehrte. Seine Frau hatte diesen arroganten Pfau geliebt, ihn mit Trauben und kleingeschnittenen Apfelstücken verwöhnt. Ihm, Lucio, indes hatte sie schon lange keinen Teller mit aufgeschnittenem Obst mehr gebracht …
»Cato?« Der Kater sollte ihr besser nicht in die Hände fallen. Der einohrige Jäger würde als Füllung in den Fleischpasteten für die nächste Armenspeisung enden. Er sollte ihn fangen und für ein paar Monde in der Festung der Kaiserritter ins Exil bringen.
»Cato? Zeig dich, alter Halunke!« Lucio umrundete den Brunnen und starrte auf die traurigen Überreste des Pfaus. Die prächtigen Schwanzfedern würden sich nie mehr zu einem Rad fächern. Die Bauchhöhle war aufgerissen und ausgeweidet. Offensichtlich hatte er Cato bei seinem Festmahl gestört. Der alte Kater ahnte, dass Ärger im Verzug war.
Weitere blutige Pfotenabdrücke führten zur Rosenlaube, hinter der eine kleine Gittertür in der ursprünglichen Festungsmauer den Durchgang für Zweibeiner versperrte. Jenseits der halb verfallenen Mauer, über welche die Stadt längst hinausgewachsen war, lag die Gasse der Blumenfärber.
Lucio wollte sich schon abwenden – eine Katzenjagd durch nächtliche Gassen erschien ihm lächerlich; er würde den Leichnam des Pfaus in einen Sack mit Steinen packen und im Hafen versenken –, da ließ ein leises Keuchen jenseits der Gittertür ihn innehalten. Ein Betrunkener? Lucio trat an die Eisenstäbe.
Ein Mann, mehr Schatten als Gestalt, kauerte im Durchgang. Eine Kreatur wie aus den Mären, ersonnen, um Kinder zu erschrecken.
Unwillkürlich tastete Lucio nach dem Schwert an seiner Seite, dem Zeichen seines Amtes als Erzpriester.
Die Gestalt wandte ihm den Kopf zu. Ein bärtiges, wettergegerbtes Gesicht blickte zu ihm empor. Ein heiseres Röcheln drang aus der Kehle des Mannes.
Zögerlich schloss der Erzpriester die Tür auf und trat in den gewölbten Durchgang, der nach Blumenfarben und Urin stank. Da war etwas im Blick des Mannes. Ein Flehen, wie er es von Sündern kannte, die zum Richtblock gingen. Sein Blick bat um Verzeihung. Aber wofür?
Der Fremde war massig, seine Arme tätowiert. Ein Seemann. Wildheit und Kraft schienen sein Leben gewesen zu sein. Aber etwas hatte ihm beides genommen. Er war nicht einfach nur ein Betrunkener. Eine Ahnung von drohendem Unheil umgab ihn.
»Mag…, Mag…«
Lucio beugte sich vor, in der Hoffnung, dass sich die gekrächzten Silben zu Worten fügen würden.
Das Gesicht des Mannes verzerrte sich in unsäglichem Schmerz. »Erlöse mich«, stieß er hervor. Sein Blick heftete sich auf Lucios Schwert. »Bitte …«
Eisiger Schrecken erfasste den Erzpriester. Er beugte sich noch tiefer und tastete nach der linken Achselhöhle des Fremden. Durch den groben Stoff des schweißgetränkten Hemdes fühlte er die Schwellung.
Der Seemann zuckte bei der Berührung vor Schmerz zusammen.
Lucio spürte ein Kribbeln auf der Hand. Dann sah er die hüpfenden dunklen Punkte. Flöhe!
»Hernando! Manuelo!«, rief er nach den beiden einzigen Dienern, die seine Frau zurückgelassen hatte. »Bringt die Sänfte der Herrin!«
Der Tod war in dieser Sommernacht nach Arbora gekommen. Und der grausame Schnitter wollte reiche Ernte halten.
Arbora, Kornmarkt, früher Abend, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Elisa hatte den Schlag erwartet, und doch war er so heftig, dass er sie von den Beinen riss.
»Das ist meine Nachricht an deinen Patron Tercio«, zischte Giacomo Fornio. Das Gesicht des korpulenten Kaufmanns war von der Hitze des Tages gerötet. Seine dunklen Augen lagen tief eingesunken unter buschigen Brauen. Sein Doppelkinn schwappte auf und nieder. Doch trotz der Fettleibigkeit war er erstaunlich kräftig. »Steh auf! Ich hab noch was hinzuzufügen.«
»Das muss doch nicht sein«, versuchte ihn Julio Costa, sein Schwager, aufzuhalten. Elisa kannte den ergrauten Patrizier seit ihrer Kindheit. Er hatte die älteste Tochter des Hauses Fornio geheiratet und besuchte regelmäßig die großen Landgüter, die den Fornios aufgrund bestehender Handelsverträge einen Großteil ihrer Ernte schuldeten.
»Misch dich nicht ein. Du hast ein zu weiches Herz. Dieses faule Pack betrügt uns, wo es nur kann. Härte ist die einzige Sprache, die sie verstehen.« Er stieß ihr mit dem Fuß in die Seite. »Los, auf die Beine mit dir! Oder erwartest du etwa, dass ich mich nach dir bücke, du ungewaschene Dirne.«
Elisa sah die Tränen in den Augen ihrer beiden Mädchen. Zum Glück waren Viola und Arianna klug genug, nichts zu sagen.
Der metallische Geschmack von Blut füllte ihren Mund. Elisa biss die Zähne zusammen, rappelte sich auf und wappnete sich innerlich gegen den zweiten Schlag. Hoffentlich brach er ihr nicht die Nase.
Er schlug ihr mit dem Handrücken ins Gesicht. Seine schweren Goldringe schrammten über ihre Wange.
»Lass sie doch! Wir müssen uns noch für Matteos Fest umkleiden«, drang Julio auf seinen Schwager ein. »Das bringt doch nichts.« Der ganz in Schwarz gekleidete kleine Mann hob beschwörend die Hände.
»Du weißt, dass der Kornpreis in den nächsten Wochen jeden Tag fallen wird.«
Eine weitere, schallende Ohrfeige riss Elisas Kopf zur Seite, und ein durchdringender Ton schrillte in ihrem linken Ohr.
Tränen traten ihr in die Augen und nahmen ihr die Sicht. Sie war sich bewusst, dass sie angegafft wurde. Die Schauerleute, die auf den Kais herumlungerten, Matrosen und ein einbeiniger Bettler ergötzten sich an dem Spektakel.
»Es geht mir besser, wenn ich sie prügele!« Giacomos Atem ging keuchend. Fleisch klatschte auf Fleisch. Elisas Mund füllte sich mit Blut. Sie beugte sich vor, spuckte auf das Pflaster.
»Das genügt!«
Überrascht blickte sie auf. Ein Mann im weißen Waffenrock der Kaiserritter baute sich vor dem Kaufherren auf. »Sollte es nicht unter Eurer Würde sein, eine Dame zu schlagen?«
»Eine Dame? Gewiss. Aber ich sehe hier nur eine billige Kebse.«
»Es tut mir leid, dass es um Euer Augenlicht so schlecht bestellt ist, Kaufherr.«
Giacomo öffnete und schloss den Mund wie eine Forelle, die aus dem Wasser gezerrt wurde. Entgeistert starrte er den hochgewachsenen Waffenknecht an, einen blonden Krieger mit rot verbrannter Nase, der wohl erst vor kurzem aus der fernen Westermark gekommen war.
»Ihr Patron soll sehen, was ihn erwartet, wenn ich aufs Herrengut hinausreite. Dafür ist sie hier. Um meine Botschaft an ihn zu überbringen.« Giacomo hob erneut die Hand.
Der Waffenknecht fiel ihm in den Arm. »Ich denke, Eure Botschaft war deutlich genug. Ist es im Übrigen nicht gerechter, den zu strafen, der Euren Zorn erweckt hat, als die unschuldige Botin?«
»Lasst meinen Schwager los«, mischte sich nun Julio ein. »Euch ist wohl nicht bewusst, dass Ihr vor einem der einflussreichsten Patrizier der Stadt steht.«
Der Krieger lockerte seinen Griff. Giacomo löste sich mit einem Ruck. »Du bist noch neu auf Cilia, nicht wahr?« Der Kaufherr trat einen Schritt zurück und musterte sein Gegenüber. »Wie ist dein Name? Ich werde mich bei deinem Komtur über dich beschweren.«
Elisa warf sich auf die Knie. Sie wünschte sich, der Fremde wäre nie erschienen. Sie wusste nur zu gut, welches Unheil der Zorn eines Fornio anzurichten vermochte. Demütig hob sie den pelzbesetzten Saum des Kaufmannsrocks an die Lippen und küsste ihn. »Bitte, Herr, das müsst Ihr nicht. Schlagt mich. Er ist fremd und mit unseren Gebräuchen nicht vertraut.«
Giacomo bedachte sie mit einem Blick, als sei sie eine räudige Hündin. »Du weißt, welche Nachricht du deinem Patron zu überbringen hast. Sein Korn sollte heute hier auf dem Markt sein. Jeder Tag, den sich seine Lieferung verspätet, bringt mich um ein kleines Vermögen.« Der Kaufherr sah zu einem Schiff, das weit draußen im Hafen vor Anker lag und im Abendlicht nur ein Schatten vor dem glühenden Horizont war. Dann wandte er sich abrupt dem Krieger zu. »Und nun zu dir, edler Recke. Wie lautet dein Name?«
»Ilja.«
»Dein Komtur wird von mir hören.« Mit diesen Worten wandte sich der Kaufherr ab und strebte der Landungsbrücke entgegen, an der einst die Seidenschiffe festgemacht hatten. Julio warf Elisa einen bedauernden Blick zu, dann folgte er seinem Schwager.
Der junge Krieger aber kniete vor ihr nieder. »Geht es Euch gut, meine Dame?«
Elisa senkte beschämt den Blick. »Ich bin wirklich keine Dame«, sagte sie leise. Sah er denn nicht, was für schäbige, geflickte Kleider sie trug?
»Eine Dame erkennt man an ihrem Lächeln und weltgewandten Auftreten«, entgegnete er ernst. »So gnädig, wie Ihr mit diesem ungehobelten Klotz umgegangen seid, kann es nicht den geringsten Zweifel daran geben, dass Ihr eine Dame seid. Ihr habt ungewöhnlichen Großmut gegenüber diesem Barbaren bewiesen.«
»Bin ich auch eine Dame?« Viola, die kleinere ihrer beiden Töchter, bedachte den Krieger mit einem zahnlückigen Grinsen.
»Du bist peinlich!« Arianna versetzte ihrer Schwester einen Knuff mit dem Ellenbogen.
»Meine Dame?« Er hob sanft Elisas Kinn und sah sie an. Seine Augen waren blau wie der Sommerhimmel. Nie zuvor hatte sie in solche Augen geblickt.
»Alles in Ordnung«, entgegnete sie hastig und richtete sich auf.
»Bist du ein richtiger Ritter?«, bedrängte Viola ihn.
»Still«, mahnte Elisa. »Belästige unseren Retter nicht!«
»Lasst sie nur fragen. Ein Ritter bin ich nicht, doch ich reite an der Seite von Rittern in die Schlacht und halte ihnen den Rücken frei, während sie ihre Heldentaten vollbringen.«
Viola sah ihn mit großen Augen an. »Du hast ein Pferd? Dann musst du aber reich sein!«
Ilja lachte auf. »Das Pferd gehört mir nicht. Der Orden vom Schwarzen Adler stellt es mir zur Verfügung.«
»Ritter helfen doch, wenn die Ungeheuer kommen …«
»Das sollten sie.«
»Dann bist du also doch ein Ritter!«, verkündete Viola überzeugt. »Du hast den dicken Kerl vertrieben und …«
»Ungeheuer gibt es nur in Mären«, unterbrach sie Arianna.
»Zumindest hatte dieser Giacomo ein ungeheuer schlechtes Benehmen«, entgegnete Ilja in gespieltem Ernst.
Ein flüchtiges Lächeln huschte über Ariannas Gesicht, und Elisa ging das Herz auf. Seit Arianna miterlebt hatte, wie ihr Vater unter den Rädern eines voll beladenen Kornkarrens gestorben war, hatte sie nicht mehr gelächelt.
»Ihr seid ein sehr höflicher Mann.« Elisa war sich bewusst, wie ungelenk sie klingen musste. Sie konnte ohne Murren von Sonnenaufgang bis Sonnuntergang arbeiten, aber schöne Worte zu machen war ihr nicht gegeben.
»Ich stehe in Eurer Schuld, meine Dame. Ich hätte verhindern sollen, dass dieser Kerl Hand an Euch legt und …«
»Das Ungeheuer!«, berichtigte Viola ihn lautstark.
Ängstlich sah Elisa dem Kaufherren und Julio nach. Hatten die beiden das gehört? Wenn sie Giacomo das nächste Mal begegnete, würde es keinen edlen Recken geben, der sie vor seinem Zorn in Schutz nahm. Es war besser, wenn sie jetzt zu ihrem Patron zurückkehrten. Bis zum Gutshof würden sie es vor Einbruch der Dunkelheit nicht mehr schaffen, ja, nicht einmal ein Viertel des Weges, aber zumindest bis zur Blutbrücke kämen sie noch. »Gehen wir!«
»Aber …« Arianna standen Tränen in den Augen. Sie biss sich auf die Lippe und sagte nichts mehr. Sie war alt genug, um zu wissen, was geschehen war.
»Habe ich Euch beleidigt, meine Dame?«
»Wir müssen jetzt wirklich gehen …«
»Die heult, weil sie kein Fischbrot bekommt und wir nicht …«
»Viola!« Elisa wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken.
Der Krieger sah sie bestürzt an. »Ihr habt Euren Botenlohn nicht bekommen, weil ich mich eingemischt habe.«
Jetzt wusste er also, dass sie so bettelarm war, dass sie kein einziges Kupferstück besaß. Sie griff nach Violas Hand. »Wir müssen …«
»Bitte gestattet mir, dass ich den Schaden, den ich angerichtet habe, wiedergutmache.«
Fassungslos sah sie den Krieger an. Verspottete der Kerl sie?
»Bitte, Mama«, sagte Arianna leise.
Elisa schluckte. Sie wusste, worauf das hinauslaufen würde. Seit Riccardo tot war, erdreistete sich ihr Patron Tercio, ihr selbst vor den Augen der Mädchen unter die Röcke zu greifen, und die Knechte waren nicht besser. Schlimmer würde der hier auch nicht sein.
»Wir werden uns zu dritt ein Brot teilen.«
»Das kommt gar nicht in Frage! Meine Ehre gebietet mir, meine Schuld ganz und gar abzutragen. Ich kenne eine Garstube, in der es köstlichen …«
»Thunfisch muss es sein!«, belehrte Viola den Krieger. »Mit gebratenen Zwiebeln und einer weißen Soße mit Knoblauch. Das Ganze auf einem Fladenbrot.«
»Das hört sich ganz so an, als wüsstet Ihr sehr genau, wohin wir am besten gehen sollten, um zu speisen, junge Dame.«
»Stimmt!«
Elisa blickte zum Himmel. Es dauerte noch mindestens eine Stunde, bis das Mondtor bei Einbruch der Nacht geschlossen wurde. Sie hatten genug Zeit.
Arbora, Haus des Hafenmeisters, erste Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Lucio ließ den schweren Löwenkopf des Türklopfers auf die Metallplatte krachen. »Öffnet das Tor! Hier steht Lucio Tormeno, Erzpriester von Arbora, und ich verlange den Hafenmeister zu sprechen. Sofort!«
Er war sich der Blicke der Faulpelze, die auf dem Kai vor dem festungsgleichen Haus des Hafenmeisters herumlungerten, wohl bewusst. Eigentlich hatte er wenig Aufmerksamkeit erregen wollen. Deshalb klopfte er auch am Tor zum Hof und nicht an dem prächtigen, von Säulen flankierten Hauptportal des Amtsgebäudes. Aber jetzt war sein Temperament mit ihm durchgegangen.
Auf dem Pflaster hinter dem Tor erklangen Schritte. Der schwere Riegel wurde zur Seite geschoben, ohne dass die kleine Sichtluke geöffnet worden wäre, um nachzusehen, wer auf der Straße stand. Seine Worte hatten also Wirkung gezeigt.
»Hebt die Sänfte an«, befahl er Hernando und Manuelo. Das Haar klebte den beiden in schweißnassen Strähnen auf der Stirn. Mit Einbruch der Dämmerung war heute kein Wind vom Meer gekommen. Es war noch immer so drückend heiß, wie es den ganzen Tag über gewesen war. Die Hitze hatte sich in die Stadt hineingefressen und ließ sie nicht mehr los, als läge Arbora im Fieber.
»Auf, auf!«, bedrängte er die beiden Diener, kaum dass sich das Tor öffnete.
Drei Fackeln erhellten den Innenhof, in den die Sänfte getragen wurde. Gelbes Licht schnitt in die Schatten des Kreuzgangs, der den Hof einfasste. Dort stapelten sich beschlagnahmte Güter. Fässer und Kisten, Stoffballen und Kornsäcke. Ein wahres Vermögen! Sobald diese Waren veräußert waren, wäre der Erlös den Rittern des Ordens vom Schwarzen Adler zu überstellen, aber Tommaso Galli, der Hafenmeister, ließ sich damit offensichtlich Zeit.
Einige Waffenknechte hatten sich auf dem Hof eingefunden und beäugten Lucio misstrauisch. Als Erzpriester war er unantastbar, einer der höchsten Würdenträger Cilias. Er las Trotz und Schuld in den Blicken der Krieger. Sie wussten, dass ihr Gebieter etwas zu verbergen hatte.
»Wo steckt Tommaso?«
»Hier!« Eine schmale Gestalt trat, begleitet von zwei Laternenträgern, durch die schwere Tür, die vom Haus auf den Hof führte. Tommaso trug eine der unsäglichen hautengen Hosen, die Mode unter den Patriziern und reichen Kaufleuten geworden waren. So knapp war sie geschnitten, dass man deutlich sehen konnte, wie sich das Gemächt des Hafenmeisters unter dem Stoff abzeichnete. Zu allem Überfluss war die Hose auch noch von einem geradezu obszönen Rot. »Was bringt Euch so auf, mein Freund? Ihr stürmt hier herein, als stünden die wilden Horden des Khanats vor unseren Stadtmauern.«
»Wir sollten besser unter vier Augen reden!«
Tommaso, der, während er sprach, über den Hof geeilt war, hob überrascht die Brauen. Sein weißes Seidenhemd mit goldenen Knöpfen wehte offen um seinen Leib. Letzte Reste von hastig abgetupftem Rasierschaum benetzten seine Wangen. Sein schmaler Schnauzbart war perfekt gestutzt.
»Und was ist mit der Dame?« Der Hafenmeister nickte zu der Sänfte hinüber.
»Die Dame bleibt!«, entgegnete Lucio barsch.
»Warum machen wir es so kompliziert? Redet frei heraus. Ich gestehe, ich bin ein wenig in Eile. Der Kaufmann Matteo Canali gibt heute Abend ein großes Fest, auf dem ich erwartet werde. Auch das gehört zu den Pflichten meines Amtes.« Er bedachte Lucio mit einem selbstgefälligen Lächeln und begann damit, sein Hemd zuzuknöpfen. »Könnte es sein, dass Ihr nicht geladen seid?«
Lucio rang um Fassung. Dieser aufgeblasene Wichtigtuer sollte, wenn es nach ihm ginge, noch in dieser Nacht den Kopf auf den Richtblock legen. »Ihr werdet nicht wollen, dass andere mithören, was ich Euch zu sagen habe.«
Tommaso zog eher verärgert als besorgt die Brauen zusammen. Mit lässiger Geste winkte er seinen Waffenknechten. »Geht ins Haus. Wir haben über Entscheidungen des hohen Rates zu sprechen.«
Wie leicht ihm Lügen über die Lippen kommen, dachte Lucio angewidert. »Geht vor das Tor und wartet auf mich«, wies er Hernando und Manuelo an.
»Nun?« Tommaso hob mit provozierender Gelassenheit die Hände, als wolle er ihn gleich umarmen. »Welches Geheimnis wollt Ihr mit mir teilen?«
Lucio machte einen Satz nach vorn, packte den völlig überrumpelten Hafenmeister bei seinem kurzen Lockenhaar und zwang ihn auf die Knie. Dann stieß er dessen Kopf zwischen den Vorhängen der Sänfte hindurch. Eine Kerze hinter Glas erhellte das Innere. Dort lag, auf einem Leinenlaken zusammengekrümmt, der Seemann, den Lucio im Mauerdurchgang hinter der Rosenlaube gefunden hatte. Er hatte ihm das Hemd ausgezogen. Blanker Schweiß stand dem Fremden auf dem nackten Oberkörper.
»Ahnt Ihr, was ich von Euch wissen will, Tommaso?«
»Ich … ich kenne diesen Mann nicht!« Der Hafenmeister bäumte sich auf, doch Lucio war ihm an Kraft deutlich überlegen. Er hielt ihn in die Sänfte gedrückt.
»Wer hat Euch bestochen? Welchem Schiff habt Ihr erlaubt, in den Hafen einzulaufen, obwohl es Kranke an Bord gab?«
»Ihr habt kein Recht …«
»Ich nehme mir jedes Recht, Tommaso.«
Der Sterbende starrte sie beide mit glasigen Augen an, ohne sie zu erkennen. Hin und wieder zuckte er zusammen. Die Schwellung unter seiner linken Achsel hatte sich dunkel verfärbt.
Seit die Pest in der Westermark wütete, gehörte es zu den Aufgaben des Hafenmeisters, jedes Schiff, das in Arbora vor Anker gehen wollte, noch weit draußen auf See zu inspizieren. Fand er Kranke an Bord, wurde die schwere Kette, welche die Einfahrt zum Hafenbecken sicherte, nicht heruntergelassen. Drei Koggen war in diesem Sommer schon ein Ankerplatz im Hafen verweigert worden. Während die Pest das Reich heimsuchte, hatte sie Cilia bislang verschont.
»Welches Schiff hat ihn gebracht?«, drängte Lucio. Er drückte den Kopf des Hafenmeisters herab, bis dessen Lippen nur noch eine Handbreit von der Pestbeule unter der Achsel des Seemanns entfernt waren. »Ich lasse Euch dieses Geschwür küssen, wenn Ihr nicht redet. Damit Ihr begreift, was Ihr in diese Stadt geholt habt!«
»Ich kann nicht …«
Lucio stieß Tommasos Kopf nach unten. Der Hafenmeister schrie auf und wand sich verzweifelt. Auch der fremde Seemann keuchte. Schon die leiseste Berührung der Pestbeule schien ihm grässliche Schmerzen zu bereiten.
Ein übler Gestank stieg aus der Sänfte auf. Tommasos Schrei wurde zu einem entsetzten Röcheln. Mit schier übermenschlicher Kraft bäumte er sich auf. Blut und Eiter besudelten seine Lippen und seinen Schnauzbart. Er wischte sich mit dem Seidenhemd über den Mund.
Die Pestbeule war aufgebrochen. Tommaso spuckte. Dann begann er zu würgen.
Lucio hatte davon gehört, dass es genügte, den fauligen Odem der Krankheit einzuatmen, um sich anzustecken. Der Tod hatte nun auch ihm seine kalte Hand auf die Schulter gelegt.
»Welches Schiff?«
Tommaso erbrach sich in die Sänfte.
»Beim Herrn des Himmels, ich schwöre Euch, Ihr werdet diese eiternde Wunde noch einmal küssen, wenn Ihr nicht …«
»Die Magdalena«, stieß Tommaso hervor und würgte erneut. »Er ist der Steuermann. Er kam mit mir an Land. Nur er. Sonst keiner.«
Lucios Gedanken überschlugen sich. Falls das stimmte, gab es, wenn er nur schnell und entschlossen genug war, noch Hoffnung.
»Lasst mich gehen«, wimmerte der Hafenmeister.
Lucio blickte auf die Jammergestalt in dem zerrissenen Seidenhemd. »Das kann ich nicht. Ihr habt einen Pestkranken geküsst«, sagte er ruhig und zog sein Schwert.
Arbora, Via Monte, vor dem Mondtor, erste Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
»Du musst gehen«, drängte Elisa. »Es ist zu spät.« Dabei hielt sie Iljas Hände fest umklammert.
Der Waffenknecht der Kaiserritter hatte sie überrascht. Er hatte sie weder begrabscht noch eine einzige anzügliche Bemerkung gemacht. Nach einer Weile hatte sie befürchtet, dass er sie abstoßend fand, aber seine Augen sprachen eine andere Sprache.
Er hatte die Mädchen zum Lachen gebracht und sie mit Fischbroten und süßem Apfelkompott verwöhnt. Die Zeit mit ihm war wie im Fluge vergangen.
Jetzt fiel es Elisa schwer, ihn ziehen zu lassen. Ihren Retter, der so plötzlich in ihr Leben getreten war. Den edlen Ritter, an den sie schon lange nicht mehr geglaubt hatte.
Er sah so gut aus! Ein Mann mit Goldhaar, aus der Westermark. Er trug einen schweren Waffenrock, unter dessen Stoff sich, wie sie wusste, Eisenplatten verbargen, die wie Fischschuppen übereinanderlagen. Der schwarze Adler, das Wappentier des Ordens der Kaiserritter, prangte auf dem weißen Stoff.
Ilja war erst vor einem Mond aus der Westermark nach Cilia versetzt worden. Die Hitze der sonnengesegneten Insel machte ihm zu schaffen, und obwohl er nicht geklagt hatte, spürte sie, wie sehr er die Westermark vermisste. Trotz all der Schrecken, die dort lauerten, der plündernden Krieger des Khanats und des Schwarzen Todes, den die Reiterhorden aus den weiten Steppen des fernen Westen mitgebracht hatten.
»Du musst gehen«, drängte sie erneut und ließ seine Hände los, auch wenn sie es nicht wollte. Elisa wusste, dass der Orden selbst kleine Vergehen mit strengen Strafen ahndete. Und Ilja hätte bei Einbruch der Nacht in der Hafenfestung sein müssen.
»Kommst du uns besuchen?«, fragte Viola. Die Kleine war so müde, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.
»Bitte!«, bedrängte ihn auch Arianna.
»Manchmal schickt der Komtur einige Ritter auf Patrouille zum Rand des Schwertwalds. Ich bin mir sicher, dass wir auf dem Weg dorthin an eurem Gutshof vorbeikommen.«
»Zum Schwertwald, wo die bösen Bogenmänner wohnen?«, fragte Arianna besorgt.
Ilja klopfte mit der flachen Hand auf seinen Plattenrock. »Das Eisen hier schützt sehr gut vor Pfeilen. Und wenn wir einen von den Bogenschützen erwischen, dann stutzen wir ihm den Zeige- und Mittelfinger, damit er nie wieder eine Bogensehne ziehen kann und friedlich wird.«
Elisa glaubte nicht, dass sie ihn wiedersehen würde, auch wenn er die Worte, die er zu den Kindern sagte, vielleicht ehrlich meinte. Dankbar für die schöne Stunde, die er ihnen geschenkt hatte, stellte sie sich auf die Zehenspitzen und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. Dann wich sie zurück, erschrocken vor ihrem eigenen Mut.
»Ich komme Euch besuchen«, sagte er mit fester Stimme und sah Elisa an. Dann strich er den Mädchen noch einmal über das Haar, ehe er die Straße an der Ringmauer entlang zum Hafen hinabeilte.
Elisa suchte sich mit ihren Töchtern einen Platz unter einem der Karren, die vor dem versperrten Tor abgestellt waren. Viola schmiegte sich in ihren Arm und war binnen Augenblicken eingeschlafen.
Elisa sah zwischen den Speichen eines Rades zum Himmel hinauf. Schon leuchteten erste Sterne in dem samtigen Blau.
»Magst du ihn so wie Papa?«, fragte Arianna.
»Mit deinem Vater war es anders«, antwortete sie sanft. »Er war mein Mann.« Mehr zu sagen, brachte sie nicht über sich. Sie hatte Riccardo schon lange nicht mehr geliebt, als er gestorben war. Ihre Liebe war nur ein Strohfeuer gewesen. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte Ricardo sich sehr um sie bemüht. Jeden Morgen hatten Feldblumen auf der Schwelle ihrer Hütte gelegen. Er hatte ihr kleine Geschenke zugesteckt. Mal einen Apfel, ein kleines Töpfchen Honig und einmal sogar ein schönes Tuch, das ihr Haar bei der Arbeit vor dem Staub der Felder schützte. Nie zuvor war sie so beschenkt worden. Sie hatte geglaubt, dass er sie wirklich liebte. Damals war sie erst sechzehn und zu ahnungslos, um zu begreifen, dass es nicht Liebe war, sondern ein Wettkampf, wer die Jungfräulichkeit des hübschesten Mädchens auf dem Gut pflücken würde – der alte Patron, einer der anderen Knechte oder Ricardo, der, wie sie erst viel später erfuhr, mehr als ein Dutzend Wetten darauf abgeschlossen hatte, dass er sie bekommen würde.
Schließlich hatte sie sich Ricardo geschenkt. Gegen den Rat ihrer Eltern. Nach ihrer ersten Nacht endete sein Werben abrupt. Aber als sich Wochen später zeigte, dass sie schwanger war, blieb ihm keine Wahl, als sie zu heiraten, denn er hatte überall mit der Nacht im Heu geprahlt.
Von dem Mann, für den sie ihn gehalten hatte, war nichts geblieben. Er war mürrisch geworden, trank mehr Wein, als gut für ihn war, und machte den anderen Mädchen auf dem Landgut schöne Augen. Nicht, dass die anderen Knechte besser gewesen wären … Elisa hatte sich damit abgefunden, dass das Leben nun einmal so war. Dass die Kindbettgabe nach der Geburt eines Mädchens eine Tracht Prügel war und dass es die strahlenden Ritter, welche die Jungfrauen in Not retteten, nur in den Mären gab.
Aber nun, da sie längst aufgehört hatte, daran zu glauben, war eine Mär für sie Wirklichkeit geworden. Sie hatte doch noch den Ritter ihrer Mädchenträume getroffen.
So lebendig, so glücklich wie an diesem Abend hatte Elisa sich seit Kindertagen nicht mehr gefühlt. Die Sterne am Himmel leuchteten heller in dieser Nacht, weil sie ihm begegnet war.
Sie hatte längst jegliche Hoffnung begraben, je solch ein Glück zu erleben. Ihr Herz war wie tot gewesen, und sie hatte es als gegeben hingenommen. Doch das würde sie nie wieder tun. Sie würde das Gefühl dieses Abends festhalten. Es war ihr geheimer Schatz. Und keiner könnte ihr den je nehmen.
Arbora, Palazzo Canali, zweite Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Bleierne Müdigkeit quälte Camilla. Dabei war die Nacht noch jung, und sie hatte seit der Mittagsstunde erst drei Freier gehabt. Nicht genug, um Essen und Schlafkammer im Schwarzen Mast zu bezahlen.
»Du da!« Der hagere Glatzkopf zeigte auf Raisa, das Mädchen zu ihrer Linken. »Traurige Bohnenstangen wie dich will mein Herr nicht in seinem Ballsaal sehen.«
»Warum hat er dich dann angestellt?«, fuhr ihre Freundin ihn an, zog sich aber eilig zurück, als der Hofmeister drohend seinen schweren Zeremonienstab hob.
Camilla drückte den Rücken durch und hielt den Atem an, um ihre kärglichen Rundungen ein wenig üppiger aussehen zu lassen. Dazu bedachte sie den Hofmeister mit ihrem schönsten falschen Lächeln.
Der Alte griff ihr an die Brust und schnaubte verächtlich. »Mir musst du nichts vormachen. Ich hab einen Blick für euch Huren und kenne all eure Tricks. Hast Glück. Matteo Canali vergnügt sich gern mit kleinen, knabenhaften Mädchen. Wenn er dir die Nacht versilbert, weißt du, was du mir morgen früh schuldest.«
Sie senkte den Blick. »Dann werde ich mit Freuden meine Schulden begleichen.«
Er packte sie grob am Kinn und zwang sie, ihren Kopf zu heben. Harte, schwarze Augen hielten sie gefangen. »Red keinen Unsinn! Wir beide wissen, dass du es nicht mit Freuden tun wirst. Aber du wirst deine Schulden begleichen. Ich behalte dich im Blick.« Er ließ von ihr ab und deutete auf die grün gestrichene Hintertür, von der in breiten Streifen die Farbe abblätterte.
Der Atem des Hofmeisters stank nach fauligen Zähnen. Sicher erwartete er, geküsst zu werden, wenn er seinen Tribut einforderte.
Sie sah Raisa nach, die schon fast das Ende der Gasse erreicht hatte. Ein Freier hatte ihrer Freundin vorigen Sommer die Nase gebrochen. Seitdem konnte sie nichts mehr riechen. Das war geradezu ein Geschenk des Herrn des Himmels.
Camilla trat durch die schäbige Tür in einen dunklen Flur. Irgendwo im Innern des Gebäudes spielte Musik, und es roch nach gebratenem Fleisch.
»Hierher!« Sie wurde in eine Kammer gewunken, in der ein großer Holzzuber stand. Zwei Mädchen schrubbten sich darin mit groben Schwämmen.
»Ausziehen«, blaffte eine alte Vettel sie an, die Ringe, groß wie Kaisertaler, an den Ohren trug. Ein Dutzend dünner, silberner Armreife klimperte an jedem ihrer Handgelenke. Camilla betrachtete das grell geschminkte Gesicht der Alten mit forschendem Blick. Wie hatte sie es geschafft, reich zu werden? Schön war sie nicht …
»Du musst eben etwas Besonderes sein«, sagte die Herrin des Badezubers kühl, als habe sie ihre Gedanken gelesen. »Das bleibt. Schönheit welkt. Und jetzt zieh dich aus!«
Gehorsam löste Camilla die Schnüre ihres leichten Kleides und ließ es zu Boden sinken.
»Waschen!«, befahl die Alte. »Vor allem zwischen den Beinen. Wenn du den feinen Herren gefallen willst, darfst du nicht riechen, als hättet du da unten ein paar alte Fischköpfe versteckt.« Sie stieß ein meckerndes Lachen aus und schob Camilla zu dem Zuber hinüber.
Das Wasser war eisig, aber in der schwülen Nacht eine willkommene Abkühlung. Eine üppige Blonde drückte Camilla den Schwamm in die Hand, mit dem sie sich gerade gesäubert hatte.
Camilla wusch sich unter den Achseln. Dann befolgte sie den Rat der Alten.
Als sie fröstelnd aus dem Zuber stieg, drückte ihr die Alte einen angeschlagenen Tonbecher in die Hand. »Trink was. Das macht die Wangen rot. Und wenn du den Becher bis zur Neige leerst, werden auch die Gäste ansehnlicher.«
Camilla fragte sich, ob die Alte in besseren Tagen auch einmal zu denen gehört hatte, die das Haus durch die Hintertür betraten, um in den Zuber zu steigen. Dennoch nippte sie nur an dem Wein. Sie fühlte sich schon jetzt ein wenig benommen. Es war besser, einen klaren Kopf zu haben, wenn sie die Reichen der Stadt umgarnte. Diese Nacht könnte ihr Leben verändern …
Die Alte nahm ihr den fast vollen Becher wieder ab. »Du musst es wissen.« Sie klang enttäuscht. Dann deutete sie auf einen Durchgang hinter dem Badezuber. »Dort entlang.«
Camilla hatte vergessen, ihre Sandalen wieder anzuziehen. Der Boden war feucht und kühl. Sie ging einem goldenen Licht entgegen, durchquerte mehrere Kellerräume, in denen sich Amphoren und Vorratsfässer türmten.
Gelächter lockte sie. Camilla entdeckte die Blonde aus dem Zuber, die nun ein scharlachrotes Kleid trug, das dazu geschaffen schien, alle ihre Vorzüge hervorzuheben und kaum etwas zu verhüllen.
»Da vorn gibt es noch mehr solcher Gewänder, Kleine.« Sie deutete auf einen dunklen Winkel. »Viel Glück!« Dem Wunsch folgte leicht angeheitertes Gelächter.
In der Ecke, in die sie gewiesen hatte, standen mehrere Truhen, und überall verteilt lagen Kleider. Camilla hob eines auf und roch daran. Es stank nach Schweiß und billigem Parfüm. Ein Rotweinfleck verunzierte, dunkel wie altes Blut, den eigentlich kostbaren weißen Stoff. Wie es schien, wurden diese Sachen von allen getragen, die als Huren herkamen, und nur selten gewaschen.
»Heute Abend werde ich mein Glück machen«, flüsterte Camilla, als würden die Worte, wenn sie diese nur aussprach, wahr werden.
Nachdenklich betrachtete sie die Truhen. Wenn sie es schaffte, für einige Monde die Geliebte eines der Kaufherren oder Patrizier zu sein, würde sie nicht mehr in den Schwarzen Mast zurückmüssen. Selbst dann nicht, wenn der hagere Hofmeister künftig einen Teil ihres Silbers einforderte. Aber immerhin hatte er ihr einen wertvollen Rat gegeben. Sie wusste nun, was Matteo Canali mochte. Sie musste es nur schaffen, ihn auf sich aufmerksam zu machen.
Camilla dachte an den Seemann, der sie kurz vor der Dämmerung genommen hatte. Ein großer, muskulöser Kerl mit roten Haaren. Wie ein Tier hatte er geschwitzt, während er auf ihr lag, und sie aus glasigen Augen angestarrt, als wäre er von Sinnen. Unheimlich war er gewesen. Nie wieder wollte sie für so einen die Beine breit machen.
Entschlossen trat sie an die hinterste der Truhen und wühlte in ihr. Sie würde keines der Kleider anlegen, die oben lagen. Sie wollte etwas, was die Gäste dieser ausschweifenden Feste schon lange nicht mehr gesehen hatten.
Unter Bergen aus Seide und feinstem Linnen fand sie einen Wickelrock mit Fransen, die in allen Farben des Regenbogens leuchteten, und ein Leibchen, das bis zu ihrem Bauchnabel hinab ausgeschnitten war. Ihre kleinen Brüste lagen frei, als sie hineinschlüpfte. Camilla kannte solche Gewänder aus den Erzählungen eines jungen Freskenmalers, der sie manchmal besuchte. Die feinen Damen der Vergangenheit hatten sich einst so gekleidet. Nun ließen sich die Reichen Bilder dieser Damen auf die Wände der Schlafgemächer ihrer Landhäuser malen.
Inzwischen war Camilla nicht mehr allein. Zwei weitere Dirnen wühlten in den Kleidertruhen und bedachten sie mit abfälligen Blicken. Die beiden versuchten, sich zu Abbildern reicher Edeldamen auszustaffieren. Camilla belächelte sie. Wie reizvoll war das, was die hohen Herren ohnehin schon in ihren Betten hatten, auch wenn die beiden sicherlich jünger waren als die meisten Ehefrauen?
Sie riss breite rote Seidenstreifen von einem bunten Schultertuch und flocht sie in ihr schwarzes Haar, bis es in zwei schweren Zöpfen ihre bloßen Brüste umspielte. Dann ging sie der Musik entgegen.
Arbora, Zwinger der Hafenfestung der Ritter des Ordens vom Schwarzen Adler, zweite Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
Klatschend traf der lange Rohrstock auf den Rücken des blonden Hünen, der an den Pfahl in der Mitte des Zwingers gefesselt war.
Komtur Karol Kavallin führte die Züchtigung des Waffenknechts höchstselbst durch. Lucio wusste, dass es sinnlos wäre, ihn zu bitten, die Bestrafung zu unterbrechen, auch wenn die Zeit drängte. Karol war ein aufbrausender Mann. Es wäre nicht gut, ihn zu verärgern, bevor er ihn um Hilfe bat. Als Erzpriester stand Lucio im Rang höher als der Komtur, aber bei Karols schwierigem Charakter war nicht auszuschließen, dass sich der Kaiserritter jedem Gespräch verweigerte, sobald er ihn daran erinnerte.
Wieder und wieder sauste der Rohrstock nieder. Außer einem leisen Ächzen gab der Verurteilte keinen Laut von sich. Lucio empfand Respekt vor dem Mann und fragte sich, welche Ordensregel er wohl übertreten hatte.
Endlich trat der Komtur von dem Geschundenen zurück. »Ich hoffe, dich hält künftig kein Rock mehr davon ab, pünktlich deine Wache anzutreten. Bis heute Abend habe ich große Stücke auf dich gehalten, Ilja. Du hast mich tief enttäuscht.«
Zwei Waffenknechte lösten die Fesseln des Kriegers und wollten ihn stützen, doch er bestand darauf, aus eigener Kraft zu gehen.
»Vielleicht steigst du wieder ein wenig in meiner Achtung, wenn du trotz der Bestrafung deinen Wachdienst leistest. Du kannst dich aber auch im Spital behandeln lassen.«
Der Krieger wandte sich dem Komtur zu. Er beherrschte seinen Schmerz, hielt sich steif und antwortete mit fester Stimme: »Es wird mir eine Ehre sein, meinen Dienst zu tun, wie ich es geschworen habe.«
Meine Achtung hast du gewonnen, dachte Lucio und fragte sich, wie der Orden es schaffte, solche Männer aufzutreiben.
»Erzpriester.« Der Komtur beachtete den Waffenknecht nicht weiter und trat vor Lucio. »Was führt Euch zu so später Stunde hierher?« Eine Sorgenfalte erschien zwischen seinen buschigen Brauen. Karol war von bulliger Gestalt. Die Jahrzehnte im schweren Harnisch der Ordensritter hatten seinen Rücken gebeugt. Er galt als harter, asketischer Mann, und seine Berufung zum Komtur hatte den Kaufherren der Stadt nicht gefallen. Er passte nicht nach Arbora, in jene Stadt, die wie keine andere auf Cilia für ihren Reichtum und Luxus bekannt war.
Lucio bedeutete ihm mit einem Nicken, ihm ein paar Schritt zu folgen, bis sie außer Hörweite der Ritter und Waffenknechte waren, die der Züchtigung beigewohnt hatten. »Ich brauche einige Krieger und eine Rudermannschaft für ein Boot. Ich muss einer Sache auf den Grund gehen.«
Die Sorgenfalte zwischen den Brauen des Komturs verschwand. »Ich glaube nicht, dass dies in die Zuständigkeit des Ordens fällt«, entgegnete er barsch. »Ihr solltet den Hafenmeister fragen.«
»Es ist der Hafenmeister, der in die verwerflichen Geschäfte verwickelt ist, denen ich auf den Grund gehen muss. Wenn ich mich seinen Männern anvertraue, werde ich mich in einem Sack voller Steine auf dem Grund des Hafenbeckens wiederfinden. Glaubt mir, ich behellige Euch nicht ohne triftigen Grund. Die Stadt wäre nicht in größerer Gefahr, wenn die Eherne Horde des Khanats vor den Toren stünde.«
Der Komtur kniff die Augen zusammen. Misstrauen und Vorsicht spiegelten sich auf seinen Zügen. »Ihr bekommt die Männer und das Boot. Und ich werde Euch begleiten.« Er wandte sich um und rief mit einer Stimme, die es gewohnt war, das Getöse von Schlachtfeldern zu übertönen: »Die Ruderer in Bereitschaft, zur Mole! Zehn Mann aus der Nachtwache als Eskorte!«
Arbora, Hafen, längsseits der Fernhandelskogge Magdalena, zweite Stunde der Nacht, 7. Tag des Hitzemondes, 53. Jahr vor Sasmiras zweiter Thronerhebung
»Keine Bordwache?« Karol sah Lucio an. Es war das dritte Mal, dass er nach der Wache gerufen hatte, doch über ihnen an Deck der großen Kogge rührte sich nichts. Was nicht heißen musste, dass dort nicht eine kleine Heerschar bis an die Zähne bewaffneter Bastarde auf sie lauerte. Er blickte zu seinen Männern, welche die Riemen des langen Wachbootes eingezogen hatten und zum Kampf bereit waren.
Karol hob den Arm, wie er es tat, wenn er auf dem Schlachtfeld eine Reiterattacke befahl, und deutete zur Reling der Kogge hinauf. Drei Wurfanker schnellten hoch.
Tormeno griff nach den Sprossen in der gewölbten Bordwand.
Karol packte den Erzpriester am Handgelenk und hielt ihn zurück. Der Kerl hatte Schneid. Er war nicht solch ein verweichlichter Schönschwätzer wie die übrigen Priester der Stadt. Das gefiel ihm. Aber er würde ihn nicht als einen der Ersten dort hochlassen. »Mit Verlaub – mein Schädel ist weniger kostbar als der Eure. Ich fordere den Vortritt.«
Kurz schien es, als wolle Tormeno protestieren, doch Karol drängte sich einfach an ihm vorbei. Er trug volle Rüstung, und mit jeder Sprosse, die er sich höherzog, ließen seine alten Knochen ihn spüren, was für ein Narr er war.
Noch ehe er die Reling erreichte, klappte er das Visier seines Helms herunter. Er hatte zu viele schlechte Erfahrungen gemacht, um noch leichtfertig zu sein.
Karol wappnete sich, dann schob er sich über die Reling, darauf gefasst, dass ein Schwerthieb ihn treffen könnte.
Nichts geschah. Keuchend hallte sein Atem im Helm.
Drei seiner Waffenknechte standen bereits mit blanken Klingen in den Händen auf dem Deck. Die jungen Spunde waren, selbst wenn sie sich Hand über Hand an einem Seil hochziehen mussten, schneller als er an den verdammten Sprossen. Er wünschte sich, ein Lanzenstoß hätte beizeiten auf dem Schlachtfeld sein Leben beendet. Für das Altwerden war er nicht geschaffen.
»Unter der Ruderpinne im Heck liegt ein Mann«, meldete Ilja. »Sonst ist niemand an Deck.«
»Seh ich«, erwiderte Karol übellaunig und schob das Visier hoch, das die Welt auf zwei schmale Sehschlitze verengt hatte. Beklommen blickte er zur Ladeluke in der Mitte des Decks. Waren sie dort unten? Tormeno hatte ihn über das, was vorgefallen war, unterrichtet. Aber nur ihn. Seine Männer hatten keine Ahnung, was sie hier erwartete. Sie rechneten wohl mit Schmugglern oder dergleichen, aber ganz gewiss nicht damit, dass sie auf dieser Kogge ein viel heimtückischerer Tod erwartete …
Karol schluckte hart. Er versuchte zu vergessen, was er in der Westermark gesehen hatte. Und auf der verfluchten Insel. Vielleicht hatten sie ja Glück. Vielleicht war es nur der Eine gewesen … Wieder sah er zu der reglosen Gestalt am Heck. Nein, es war mehr als einer. Er sollte sich nichts vormachen.
Der Erzpriester stieg neben Karol über die Reling. Ohne zu zögern, ging er zum offenen Achterkastell, das nicht mehr als eine zinnenbewehrte Plattform im Heck des Schiffes war, unter welcher der Steuermann Schutz vor den Elementen fand.
Der Komtur folgte Tormeno, der sich neben den Mann am Boden kniete. Rings um ihn war Blut auf dem Deck.
Erst als Ilja eine Laterne brachte, sah der Komtur, dass sich die Brust des Seemanns trotz mehrerer Stichwunden noch hob und senkte.
»Sucht unten nach anderen Mannschaftsmitgliedern«, wies er Ilja an und nahm dem Waffenknecht die Laterne ab.
Tormeno hatte sich tief über den Sterbenden gebeugt und flüsterte ihm etwas ins Ohr.
Der Komtur verstand kein einziges Wort. Mit den Jahren war er schwerhörig geworden. Vielleicht hatte er zu viele Schläge auf den Helm bekommen.
Jetzt bewegten sich die Lippen des Seemanns. Breite fleischige Wülste inmitten eines schwarzen Vollbarts, in dem sich das erste Grau zeigte. Der Sterbende hatte ein derbes Gesicht mit tiefen Falten um die Augen, die zu lange gegen das grelle Licht über dem Meer angeblinzelt hatten, um den Horizont im Blick zu behalten.
Der Erzpriester nahm eine Hand des Sterbenden. Der Gesichtsausdruck des Seemanns wurde immer verzweifelter. Die Augen weiteten sich vor Schreck, als blickte er bereits in jene Welt, die jenseits der ihren lag. Er rang um Worte, stockend, mit dem letzten Atem, der ihm noch gegeben war. Dann sank er zurück.
Als Tormeno aufblickte, war alle Farbe aus seinem Antlitz gewichen. »Wir sind verflucht«, stieß er hervor. »Die Gier, die Arbora reich gemacht hat, wird uns nun alle umbringen.«
Der Komtur blickte auf den Seemann. Ihn hatten Dolchstöße getötet. »Wie meint Ihr das?«
»Dieses Schiff hat Seide aus Löwenburg geladen.«
Karol lief ein eisiger Schauer über den Rücken, und jene Kälte, die sich auf der Insel der hundert Tage tief im Mark seiner Knochen eingenistet hatte, breitete sich in seinem Körper aus.
Er kniete neben dem Toten nieder und tastete nach dessen linker Achsel. Er spürte die Beule im Fleisch. Die Magdalena hatte die Pest nach Arbora gebracht. Nicht nur einen Kranken – sie hatten verseuchte Fracht geladen, diese raffgierigen Dummköpfe!
»Warum wurde sie nicht draußen vor dem Hafen aufgehalten? Was hat der Hafenmeister …«
Tormeno nickte kaum merklich. »Bestochen. Die Seide kommt aus den Kontoren von Löwenburg. Sie hätte verbrannt werden müssen. Das Haus Canali hat sie für einen Bruchteil ihres Wertes eingekauft. Seit der Krieg gegen das Khanat begonnen hat und die Handelswege in den fernen Westen abgeschnitten sind, hat sich der Preis für Seide im Reich verfünffacht. Die Ladung dieses Schiffes würde das Haus Canali zur reichsten Kaufmannssippe Cilias machen.«
Karol ballte die Fäuste. »Wir holen diese Bastarde aus ihrem Palazzo und hängen sie an den Zinnen auf. Diese …« Wieder übermannten ihn die Erinnerungen. Er war Komtur in Krähenfeld gewesen, einer der ersten Städte in der Westermark, die von der Pest heimgesucht worden waren. Alle Bewohner waren auf eine karge Insel vor der Küste gebracht worden. Man hatte ihnen versprochen, nach hundert Tagen zu kommen und die Überlebenden zu holen.
»Komtur?« Der Erzpriester sah ihn fragend an. Offenbar hatte Tormeno schon zuvor mit ihm geredet, und er hatte es nicht mitbekommen.
»Was sollen wir tun?«, bedrängte ihn der Priester. »Ihr habt die Pest erlebt. Was …«
»Komtur?« Ilja kam durch die Frachtluke zurück an Deck. »Wir haben dort unten Fässer gefunden, in denen Tote liegen. Was geht hier vor?«
Karol gebot dem Waffenknecht mit einer harschen Geste, Abstand zu halten. »Der Erzpriester spricht den Sterbesegen. Störe uns nicht! Nimm deine Kameraden und geht zum Bug. Ich komme gleich zu euch.« Damit wandte er sich wieder an Tormeno. »Wann, sagtet Ihr, ist das Schiff in den Hafen eingelaufen?«
»Am späten Nachmittag. Der Kapitän hier hat versucht, seine Männer daran zu hindern, von Bord zu gehen. Daraufhin haben sie ihn niedergestochen. Das war kurz nach Einbruch der Dämmerung. Alle siebzehn, meinte er, die bis heute Abend überlebt haben, sind in der Stadt. Ihr habt es schon einmal mitgemacht, Komtur. Was erwartet uns?«
Karol fühlte sich unendlich müde. Als er nach Arbora versetzt worden war, hatte er gehofft, nach all den Schrecken noch ein paar friedliche Jahre zu erleben. »Krähenfeld, die Stadt, in der meine Komturei lag, hatte etwas mehr als dreitausend Einwohner und einen rasch wachsenden Hafen. Als die Pest ausbrach, wurden wir alle auf die Insel der hundert Tage geschafft, sofern wir noch lebten – die Kranken und auch alle, die noch keine Anzeichen der Seuche zeigten.« Während er sprach, standen ihm die Bilder wieder vor Augen. »Ich habe mit meinen Kaiserrittern dafür gesorgt, dass keiner fortlaufen konnte. Wir haben alles an Vorräten mitgenommen. Knapp zweitausend kamen auf der Insel an. Wir hatten genug zu essen, dachten wir. Aber kaum Brennholz. Keine Zelte. Eigens dafür abgestellte Armbrustschützen bewachten uns aus der Ferne. Auf der Insel haben wir alle Boote zerschlagen müssen. Die anderen sollten nach hundert Tagen kommen und die Überlebenden holen. So war es abgesprochen. Aber als es so weit war, gab es niemanden mehr, der uns noch holen konnte. Am Ende waren wir noch fünfhundertdreiundsiebzig.«
Darüber, wie sie überlebt hatten, hatte er nie gesprochen. Als der Hunger kam und jede Hoffnung schwand, hatten sie ihre Menschlichkeit verloren.
»Stimmt es, dass die Pest binnen eines Tages töten kann?« Der Schreck war aus dem Antlitz des Priesters gewichen. Jetzt war da stattdessen eine Härte, wie Karol sie zuvor nur in den Gesichtern der Väter gesehen hatte, die ihre eigenen Kinder verzehrt hatten.
»Manchmal dauert es nur einen Tag oder gar ein paar Stunden. Andere kämpfen eine ganze Woche, ehe der Tod siegt. Und einige bleiben unberührt. Es ist ein Rätsel, wen der Schnitter mit sich nimmt und wen er verschont. Aber ich verstehe das nicht. Wie konnte der Hafenmeister …«
»Sie haben ihm offenbar vorgespiegelt, dass alles gut ist.« Tormeno presste die Lippen zusammen. »Die Kranken und die Toten waren unter Deck, und die Männer an Deck hat er sich nicht so genau angesehen. Der, den er in die Stadt mitgenommen hat, war ein Vertrauensmann der Canali. Er sollte Bericht erstatten und danach zurück an Bord gehen. Aber daran hat er sich nicht gehalten. Er stank nach Wein und dem billigen Parfüm der Hurenhäuser.« Der Erzpriester klang erstaunlich gefasst. »Und dann sind noch die anderen an Land gegangen. Ich denke, für eine Rettung der Stadt ist es nun zu spät.«
Karol nickte langsam. »Wenn ich ehrlich bin, ist selbst ein einziger Kranker in der Stadt schon zu viel …« Er sah zu seinen Männern im Bug, die Art und Ausmaß der Katastrophe noch nicht begriffen hatten.
»Wie groß ist der Vorrat an Kaiserwasser in der Stadt?«
Wie vom Donner gerührt wandte sich Karol wieder dem Erzpriester zu. »Das könnt Ihr nicht tun.«
»Würdet Ihr mir den Gehorsam verweigern?« Tormenos Frage klang so beiläufig, als erkundige er sich nach dem Wetter.
Karol hatte in seinem ganzen Leben noch keinen Befehl verweigert. Darauf war er immer stolz gewesen. Aber an dem, was Tormeno da andeutete, wollte er keinen Anteil haben.
»Wie viele Ritter unterstehen Eurem Befehl?«
»Elf.«
»Und Waffenknechte?«
»Einhundertsiebzehn.«