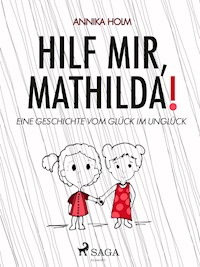Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Drachenkinder. So nannte man die Kinder, die während des Bürgerkriegs in Nicaragua, Geheimbotschaften, die in bunten Papierdrachen versteckt waren, der Widerstandsbewegung der Sandinisten überbrachten.Die drei Freunde Isabell, Victor und David gehörten einst zu dieser Gruppe. Doch jetzt ist Frieden. Das Land ist seit vier Jahren von der Diktatur befreit, aber Not und Armut beherrscht das tägliche Leben. Isabell, Victor und David sind noch immer unzertrennbare Freunde. Zusammen versuchen sie täglich das Beste aus ihren schweren Lebensumständen zu schöpfen. Sie wollen die Welt verbessern – das ist ihr klares Ziel! Doch wie lange wird der Frieden bestehen?DIE DRACHENKINDER VON NICARAGUA ist ein spannendes Buch über drei Freunde, die ihren Lebensmut nie verlieren.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Annika Holm
Die Drachenkinder von Nicaragua
Deutsch von Marianne Vittinghoff
Saga
Die Drachenkinder von Nicaragua
Aus dem Swedish von Marianne Vittinghof
Originaltitel: Drakbarnen © 1987 Annika Holm
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711501221
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Es war in den ersten Märztagen. Der Staub auf den Straßen des Vororts wirbelte im Wind und legte sich wie feiner Sand über alles, auch im Innern der Häuser. Es knirschte, wenn die Kinder Reis aßen. Wollten sie ihn ausspucken, protestierten ihre Mütter: „Nein, nein, tut so, als sei es Zimt!“
Gelächter schallte von den Wänden des fensterlosen Zimmers, der Schatten an der Decke wurde immer größer. Er schien sie bald zu verschlingen. Isabel wickelte sich fest in das Laken ein und kauerte sich zusammen. Endlich verschwand der Schatten, und das Gelächter erstarb.
Es war Morgen. Sie blieb noch solange liegen, bis sie sicher war, daß sie nicht mehr träumte. Dann kroch sie aus dem Bett, steckte ihre Füße in die Plastiksandalen und tastete sich in die Richtung, aus der sie den Hahn krähen hörte. Es war dunkel und still, und nur der Hahn zeigte an, daß es Morgen war. Sie öffnete die Tür und trat ins Licht. Auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes, in dessen Mitte ein großer Bananenbaum wuchs, stand Tante Maria in der Küche und kochte Reis.
„Hast du gut geschlafen?“ rief sie.
„Aber sicher“, log Isabel wie immer.
Sie konnte nicht von ihren Alpträumen erzählen, selbst wenn sie gewollt hätte. Die Traumbilder, die sie im Bett hin und her wälzen oder vor Schreck weinen ließen, waren nur dann zu sehen, wenn sie schlief und in den kurzen Augenblicken, wenn sie nachts aufwachte. Dann aber war niemand da, dem sie davon erzählen konnte. Am anderen Morgen war der Traum in ihrer Erinnerung verblaßt. Die Bilder lösten sich auf, keine Formen und Gestalten waren mit ihnen zu verbinden. Nur eine dumpfe Ahnung blieb zurück, doch darüber konnte sie nicht sprechen.
Tante Maria stellte vier Teller auf den Tisch neben dem Herd.
„Gib mir bitte den Jungen“, bat sie Isabel und horchte in den Hof hinaus. Von der Hängematte kam lautes Geschrei. Camilo war schweißnaß und schlug heftig um sich. Als er Isabels Gesicht über sich gebeugt sah, hörte er sofort auf, zu schreien und herumzufuchteln. Isabel lächelte ihn an und setzte ihn auf ihre linke Hüfte.
„Wir haben beide eine Dusche nötig“, sagte sie und trat hinter den Vorhang neben der Hängematte. Sie zog Camilo die Stoffwindeln aus und drehte das Wasser an. Da fiel ihr ein, daß sie ihr Nachthemd noch anhatte und wich schnell vor dem Wasserstrahl zurück. Sie setzte Camilo auf den Boden, wand sich mit viel Mühe aus ihrem viel zu engen Hemd, hob den Jungen wieder auf und stellte sich unter den Strahl.
Das kühle Wasser rieselte über ihren Körper und wusch Schweiß und Angst weg. Sie schloß die Augen und wandte ihr Gesicht direkt in den Wasserstrahl. Dann seifte sie sich und Camilo ein, der dabei vor Vergnügen schrie und kicherte. Seit drei Jahren wohnte Isabel bei ihrer Tante und ihrem Onkel, aber sie hatte sich immer noch nicht daran gewöhnt, die Dusche als etwas Selbstverständliches zu betrachten. Sie blieb ein Wunder. Die Rohre an der Decke des kleinen Schuppens, der Hahn an der Wand, das Wasser, das fließt, ja strömt! Keine Eimer, keine Kannen zu schleppen, keine Wannen, die umkippen, wenn man über sie stolpert! Und sogar ein Loch im Boden, in dem das Wasser abfließen kann. Wenn Mutter gewußt hätte, daß es so etwas gibt!
Sie drehte das Wasser ab und streckte den patschnassen Camilo aus der Dusche heraus.
„Hier ist er!“ rief sie. Tante Maria nahm ihren Sohn entgegen und hüllte ihn in ein Handtuch. Isabel schüttelte das Wasser aus ihrem Haar und schlich zur Wäscheleine, um ihre Schulkleider herunterzuholen. Eine weiße Bluse und ein blauer Rock, den sie einmal aus ein paar alten Jeans genäht hatte, die Tante Maria nicht mehr flicken konnte. Die Stoffreste, die nicht allzu verschlissen waren, reichten gerade für einen Rock, der anfangs bis zu ihren Knien reichte. Nun, da sie ein Stück gewachsen war, hörte der Rocksaum zehn Zentimeter über den Knien auf, aber Isabel gefiel er so besser, weil er ihr mehr Bewegungsfreiheit gab. Sie knöpfte den Rock zu und versuchte, die Bluse hineinzustopfen, aber es gelang ihr nicht. Seufzend setzte sie sich auf einen Stuhl und langte nach einem Teller Reis.
„Ich muß ein Stück an die Bluse ansetzen. Ich kann sie nicht mehr hineinstopfen. Schau her!“
Tante Maria überlegte.
„Am besten heben wir sie für Camilo auf und versuchen, für dich eine andere zu finden. Vielleicht kann ich etwas auftreiben.“
Sie sah erstaunt zu Isabel, die schon aufgestanden war, und am Spülbecken stand, um ihren Teller abzuwaschen.
„Du hast es aber heute eilig! Ist etwas Besonderes los?“
Isabel hatte den Mund voll Reis und konnte nicht antworten. Während sie noch die letzten Reiskörner hinunterschluckte, dachte sie nach. War heute etwas Besonderes los? Eigentlich nicht. Und trotzdem war es ihr so. Sie wollte schnell zur Schule.
„Es ist erst kurz nach sechs. Du hast fast eine ganze Stunde Zeit.“
„Ich weiß“, sagte Isabel und umarmte ihre Tante.
„Es ist ganz einfach so, daß ich Lust habe, schon jetzt in die Schule zu gehen.“
Draußen war es noch kühl. Die Morgensonne schickte ihre Strahlen durch das spröde Blattwerk der Tamarindenbäume und beleuchtete einige Hibiskusglocken, die noch nicht von der Dürre betroffen waren. Isabel hüpfte unter den Bäumen entlang in die Stadt. Sie grüßte Kinder, die an einer Tortilla knabberten oder eine Orange lutschten, Mütter, die ihren Teil des Gehwegs kehrten, sie grüßte Väter, die durch die Tür kamen und auf dem Weg zur täglichen Arbeit über ihre Kinder hinwegstiegen.
Als sie an der Brücke vorbeikam, verlangsamte sie ihre Schritte und blickte in die Straße, die nach rechts führte. Sollte sie eine Runde um die Kirche drehen und an Davids Haus vorbeigehen? Sie blieb eine Weile stehen und überlegte. Sicher war David schon losgegangen.
Auf dem Marktplatz herrschte noch Ruhe. Einige Verkäufer waren dabei, ihre Obstkörbe aufzustellen, einige Lastautos parkten am Eingang der Fleischhalle, Menschen trugen Schüsseln, schwer beladen mit Fleisch und Brot. In einer halben Stunde würden Tante Maria und Davids Mutter auch mit ihren Waren hier sein. Nach der Schule würde sie selbst hier stehen und verkaufen.
„Hallo!“
Eine Orange kam durch die Luft geflogen und landete vor ihren Füßen. Sie hob sie auf und lachten dem Jungen auf der Ladefläche des Lastautos zu.
Er lachte auch und rief: „Was macht das Kabarett? Wollt ihr heute abend üben?“
Isabel trat näher und nahm sich noch zwei Orangen aus dem goldroten Riesengebirge auf der Ladefläche. „Für David und Victor!“ erklärte sie und fuhr fort: „Wir üben heute abend im Jugendtreff. Orlando hat versprochen zuzuschauen.“
„Seht zu, daß ihr nicht zu spät kommt“, sagte er, „denn er will auch bei unserem Stück heute dabeisein. Wir spielen bei der Versammlung außerhalb der Stadt.“
„Wir kommen, sobald wir mit der Arbeit fertig sind. Vielen Dank für die Orangen. Adios!“
Sie winkte und ging weiter, in Richtung Schule. Sie hüpfte leicht, während sie lief. Sie war gutgelaunt. Es würde ein schöner Tag werden, das spürte sie genau.
„Victor, Victor!“
Großmutter rüttelte Victor, aber er wachte nicht auf. Sie rüttelte noch einmal und rief seinen Namen. Nein, Victor schlief weiter.
Großmutter setzte sich auf die niedrige Pritsche, streckte ihre Hände nach Victor aus und zog ihn hoch, bis er aufrecht saß. Langsam wiegte sie ihn ein paarmal hin und her. Dann stand sie rasch auf. Victor blinzelte und blieb sitzen. Er war jetzt wach.
„Ich habe deine Sachen gebügelt, aber zuerst mußt du Eier suchen gehen. Ich vermute, daß einige im Stroh hinter dem Haus liegen. Oder im Gebüsch unter dem Orangenbaum.“
Victor stand auf, auf einmal hellwach. Wie spät konnte es sein? O weh, warum war er bloß so ein Siebenschläfer?
Er stürzte in den Hof hinaus und fing an, die Eier zu suchen. Wunderbar, es lagen tatsächlich zwei im Stroh hinter dem kleinen Häuschen. Aber unter dem Orangenbaum waren keine. Die Hühner gackerten spöttisch um seine Füße herum und gaben ihm nicht den kleinsten Wink, als er herumwirbelte und suchte. Doch, da lag eines, neben der Pumpe. Ein seltsamer Platz, um Eier zu legen. Die Eier der Großmutter bringen, wieder zurück zur Pumpe, Wasser ins Gesicht und über den Oberkörper, wieder ins Haus, anziehen, los!
Nein, doch nicht! Er hatte Großmutter und das Frühstück vergessen.
Victors Großmutter war eine ungewöhnliche Frau. Sie hatte eine andere Meinung über das Essen als die meisten Mütter, die Victor kannte. Es gab nicht mehr zu essen bei der Großmutter als woanders, manchmal sogar weinger. Aber sie bestand auf dem Frühstück. Victor sollte ein ordentliches Frühstück zu sich nehmen, das aus mehreren Gerichten bestand: aus Eiern, gepreßten Orangen. Großmutter sprach von Vitaminen und Proteinen, Dinge, die niemand, den Victor kannte, jemals erwähnte.
„Wir sind zwar arm“, pflegte Großmutter zu sagen, „aber aus purer Unvernunft brauchen wir deshalb nicht zu verhungern. Besonders du nicht!“ Sie nahm sich viel Zeit, um die wenigen Dinge, die sie besaßen, zu pflegen: Sie lockerte die Erde rings um die Orangenbäume auf und legte den Mist der Hühner und Schweine in regelmäßigen Abständen dorthin. Sie goß fleißig die Maispflanzen und versuchte, die Hühner zu kurieren, wenn sie krank wurden; sie kratzte sogar das Schweinchen am Kinn, damit es fröhlich war, solange es lebte.
„Heute habe ich aber keine Zeit für das Frühstück“, widersprach Victor, als Großmutter ihn hereinrief.
„Hilf mir lieber, die Orangen zu pressen“, antwortete Großmutter ruhig und goß Eierteig in die Pfanne.
„Du läufst viel schneller zur Schule, wenn du was im Magen hast, das weißt du.“
„Dann darfst du nicht vergessen, daß du versprochen hast, Großvater bei der Reparatur der Nähmaschine heute nachmittag zu helfen. Vielleicht ist es ihm bis dahin gelungen, das fehlende Dingsda aufzustöbern.“
Victor liebte seine Großmutter, was auch immer geschah. Nicht einmal jetzt, da er nichts anderes wollte, als losrennen, konnte er sich über sie ärgern.
Seit Vaters Tod klammerte er sich an sie und an Großvater. Seine Mutter hatte sich den Guerillas angeschlossen, als Victor noch klein war. Es war so lange her, daß er sich nicht mehr an sie erinnern konnte. Man sagte, sie sei im Kampf gefallen, aber dafür gab es keine eindeutigen Beweise. Was wäre, wenn sie eines schönen Tages vor der Tür stünde? Vielleicht war sie in irgendeinem, schon lange zurückliegenden Kampf verwundet worden und hatte das Gedächtnis verloren? So etwas passierte im Krieg, hatte Victor gehört. Es wäre ja aber möglich, daß sie ihr Gedächtnis wiedererlangt hatte, und deshalb nach Hause finden konnte!
Er stellte sich vor, wie sie vielleicht aussah. Er kannte kein Photo von ihr, doch seine älteren Brüder hatten erzählt, sie hätte große Ähnlichkeit mit Großmutter. Ähnliche Augen, ähnlicher Mund, ähnliches Haar. Er versuchte sich Großmutter zwanzig Jahre jünger vorzustellen, aber es war schwierig, sich ihre runzeligen Backen, den buckligen Rücken und die vorgebeugten Schultern wegzudenken. Er mußte darauf vertrauen, daß seine Mutter ihn wiedererkannte.
Nun reichte ihm Großmutter einen Teller mit Eiern und Reis. Victor tauchte aus seinen Gedanken auf und fing an zu essen. Es schmeckte, und er wollte kein einziges Reiskorn übriglassen, obwohl er es eilig hatte. Er kaute noch, als er draußen auf der Straße stand.
Der Staub wirbelte um seine Füße in der Märztrockenheit, und als ein Jeep vorbeifuhr, staubte es ihm sogar ins Gesicht. Er schloß den Mund, um die letzten Reiskörnchen zu retten, und rannte schneller. Während er lief, versuchte er seine Zähne vom Sand zu befreien, der doch in den Mund gekommen war. Er kicherte vor sich hin, als er daran dachte, was Großmutter den kleinen Nachbarkindern zu sagen pflegte, wenn sie die staubigen Reiskörner nicht hinunterschlucken wollten:
„Tut so, als sei es Zimt! Reis mit Zimt ist etwas ganz Leckeres.“
Noch ein Jeep fuhr vorbei, und Victor kniff seinen Mund zusammen. So würde es jetzt einen Monat lang weiter stauben, bis endlich im Mai der Regen kam. Am besten gewöhnt man sich daran, weil man doch nichts anderes tun kann, als den Mund fester zuzukneifen.
Er ging langsamer, als er die große Straße erreichte, die zur Stadt führte. Sie war mit Kopfsteinen bepflastert, und auf dem Gehweg standen in regelmäßigen Abständen Bäume. Hier war es nicht so staubig, und wenn er auf die andere Straßenseite überwechselte, brannte die Sonne nicht so heiß herunter.
Er blieb vor einer Werkstatt bei einem Ölfaß stehen und begann, auf den Deckel zu trommeln. Ein neuer Rhythmus, der gar nicht so schlecht klang: drei lange Schläge, dann ein Schlag im Gegentakt und zwei kurze! Plötzlich merkte er, daß etwas in seinen Rhythmus einfiel. Eine Autohupe mischte sich neckend unter seine Trommelschläge. Er blickte auf und sah in Lidias fröhliche Augen. Lidia war Lehrerin an der Schule. Sie saß am Steuer ihres Wagens, am Beifahrersitz ihr Mann Orlando.
„Klingt gar nicht so übel“, rief Lidia lachend und ließ die Hände von der Hupe. „Bist du zufällig auf dem Weg in die Schule? Dann hoch mit dir auf die Ladefläche.“
Dieser Tag fängt gut an, dachte Victor und sah den langen öden Schulweg rasch an sich vorbeifliegen. Nun würde er auch nicht auf den letzten Drücker kommen, sondern viel Zeit haben. Viel Zeit, um mit Isabel und David zu reden, bevor die Schule anfing.
David wachte nie von selbst auf. Nein, da hatte er keine Chance. Immer schaffte es ein anderer, der erste zu sein, zum Beispiel einer seiner kleineren Brüder, der dann auf seinen Bauch sprang oder ihn an den Füßen kitzelte. Heute früh war es Ernesto, der auf Davids Schultern saß. Er prustete vor Lachen, als David seinen Kopf hob und ihn mit seinen schwarzen Haaren am Bauch kitzelte.
„Weiter, weiter! Noch einmal!“
David stöhnte und versuchte, wieder einzuschlafen. Ernesto gab aber nicht auf. Er grapschte Davids Haare und spielte mit seinem dicken Schopf. David öffnete die Augen und beurteilte die Lage. Das Licht im Zimmer war noch grau, also noch etwas Zeit zu schlafen.
„Laß es sein“, zischte er laut genug, um Ernesto zu erschrecken, aber noch leise genug, um nicht den Rest der Familie zu wecken.
Ernesto umarmte David, kauerte sich dicht an seine Schultern und blieb eine ganze Weile ruhig liegen.
David konnte aber nicht mehr einschlafen. Er seufzte, schob Ernesto etwas zur Seite und lauschte den Schlafgeräuschen um sich herum. Ganz hinten aus der Ecke, wo seine Mutter zusammengekauert schlief, vernahm er ruhige Atemzüge. Daneben war der leere Schlafplatz von Ernesto, und vom unteren Ende des Bettes hörte er das Pfeifen von Pepe und Carmen. Die Hanfseile der Hängematte knirschten, sobald sich Oscar im Schlaf bewegte. Im Klappbett an der Seite röchelten Karla und Dora um die Wette, beide kämpften noch mit der gleichen hartnäckigen Erkältung. Draußen im Hof wühlte das Schwein in der Erde. Die Hühner waren ihm wohl dabei im Weg, denn sie gackerten plötzlich ganz aufgeregt. Halb sechs las David auf der Uhr, die er auch nachts nie abnahm.
Es war so, als ob er es laut ausgesprochen hätte, denn im selben Augenblick saß seine Mutter kerzengerade im Bett und fragte: „Ist es schon halb sechs?“
Ohne eine Antwort abzuwarten, kroch sie über die schlafenden Kinder hinweg auf den Boden. Sie tastete mit den Händen ihren Rücken ab, verzog ihr Gesicht, schlich über den Erdboden und öffnete vorsichtig die Tür zum Hof.
Als David das Geräusch des laufenden Wassers hörte, befreite er sich aus Ernestos Griff und setzte sich auf die Bettkante. Durch die Tür hindurch konnte er sehen, wie seine Mutter sich das Wasser über Gesicht und Hände goß. Sie sah müde aus, aber sie war mehr als nur müde. Seine schöne Mutter mit dem aufrechten strammen Körper, seine Mutter mit den jungen fröhlichen Augen, die jeden zum Mitlachen ansteckten, seine Mutter stand nun im Licht der frühen Morgendämmerung, und David konnte sehen, wie sehr sie sich verändert hatte. Sie war sehr mager, und man spürte förmlich, wie sich ihr Körper gegen jede Bewegung wehrte, als ob jeder Schritt und jeder Handgriff schmerzte. Er fühlte einen Anflug von Angst in sich aufkommen und ging hinaus in den Hof.
„Wie geht es dir, Mutter?“
Ernesto war in diesem Augenblick auch in den Hof getreten, hüpfte herum und wiederholte die Frage: „Wie geht es dir, Mutter?“
Mutter lächelte etwas und ging über den Hof zu dem Platz unter ein paar losen Dachbalken, der die Küche darstellte.
„Gut, ich bin nur etwas müde.“
Sie öffnete eine Dose, blickte hinein und verschloß sie seufzend, bückte sich über einen Topf auf der Erde und erhob sich wieder.
„Wir haben keinen Mais. Ich habe vergessen, daß er gestern zu Ende ging.“
„Nein“, dachte David, „vergessen hast du das bestimmt nicht. Aber was hätte es schon ausgemacht, selbst wenn du dich daran erinnert hättest? Wir hatten auch gestern kein Geld.“
Doch er sagte nichts, und Mercedes sprach weiter mit sich selbst, während sie suchte.
„Na ja. Wir haben ein paar Bananen, das muß reichen. Sie machte Feuer zwischen den Steinen, die ihr als Herd dienten, und stellte den Topf darauf. Sie goß einige Tropfen Öl in den Topf und begann, die Bananen zu schälen. Das zischende Geräusch der bratenden Bananen erreichte David, als er sich gerade am Wasserhahn wusch.
„Ist das das letzte Öl?“ fragte er.
„Nein, wir haben noch ein paar Löffel.“
David seufzte. Er hatte vorgehabt, heute direkt zur Schule zu gehen. Er konnte es kaum erwarten, Isabel und Victor das neue Lied vorzustellen, das er am gestrigen Abend noch zu später Stunde fertig geschrieben hatte. Es war das Lied, das noch für das Kabarett fehlte, und er war der Meinung, es sollte die beste und lustigste Nummer im Programm werden. Er malte sich genau aus, wie Isabel dazu singen würde und wie er und Victor währenddessen die Geschichte mimen würden. Eigentlich fehlte noch eine Person, um das Stück perfekt zu machen. Es war aber nun nicht mehr zu ändern, es war zu spät, um noch eine vierte Person zu finden, da nur noch eine Woche bis zum Fest übrigblieb.
In der hinteren Hosentasche der verschlissenen blauen Jeans steckte der Notizblock mit dem neuen Text. Er strich zufrieden darüber, als er seine Hose anzog. Sie würden staunen, daß er fertig geworden war. Er malte sich Victors bewundernden Blick und Isabels Freude aus. Er mußte lächeln. Doch das Lächeln erstarb, als ihm seine schlafenden Geschwister wieder in den Sinn kamen. Er konnte nicht direkt zur Schule gehen. Ja, die Frage war, ob er überhaupt zur Schule gehen konnte. Aber er wollte gehen, er mußte einfach gehen. Er überlegte, daß er jetzt am Morgen einen Stapel Zeitungen verkaufen könnte, wenn er sich beeilte. Und mit einem kleinen bißchen Glück würde er am Nachmittag in der Werkstatt ein paar Reparaturarbeiten machen dürfen. Das würde wenigstens ein bißchen Geld einbringen. Er könnte das alles schaffen, vielleicht sogar noch die Probe am Abend. Sollte er Oscar zum Zeitungsaustragen mitnehmen? Er blickte zweifelnd zur Hängematte hinüber, wo sein vier Jahre jüngerer Bruder gerade aufzuwachen schien. Nein, allein konnte er schneller fertig werden, als wenn Oscar mithalf.