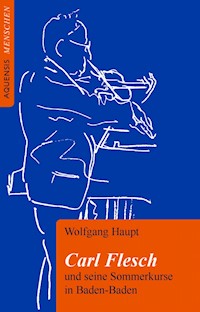Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pierre Larut wird zu einem Tatort gerufen, weil der hiesige Kommissar in Ratlosigkeit ertrinkt. Ein Toter liegt in einer Baugrube, auf dieselbe Weise hingerichtet wie ein anderes Opfer einst. Doch der Mörder sitzt seit zwölf Jahren in Haft. Der ehemalige Polizeichef begibt sich auf die Suche nach einer Vergangenheit, die ihm besser verborgen geblieben wäre. Denn er ist nicht der Einzige, der von Schuld getrieben ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Luka, den Weltumsegler, Astronauten, Rennfahrer, Arzt,Physiker.
Aber in erster Linie für Luka, den guten Menschen, den ich gerne kennengelernt hätte.
Wo Schuld ist, kann nur Schuld entstehen.
Wo Vergebung ist, herrscht Frieden.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
1
Leichen im Regen. Ein trauriger Anblick, vor allem nachts. Wenn sich die Strahlen der Taschenlampen kreuzen, und verzweifelt zwischen den Tropfen nach Hinweisen suchen. Wenn die Kapuzen der Regenmäntel tief ins Gesicht gezogen werden und Stimmen in der Nässe verhallen. Das nimmt den Toten irgendwie die Würde.
Larut stellt das Fahrrad ab und geht zu Complatier, der in einem blauen Regenmantel vor einer Baugrube steht. Allein. Keinerlei Absperrbänder, Gipsreste, Markierungen, Reifenspuren. Keine Presse, keine Ermittler, die mit gewitzten Theorien um sich werfen. Nur ein verlegenes Nicken von Complatier, in seinen glatt polierten Schuhen und den maßgenau angepassten Hosenumschlägen. In der Rechten hält er eine Taschenlampe, deren Licht durch die Tropfen schneidet.
»War die Spurensicherung schon da?«, fragt Larut.
Complatier hebt ansatzweise die Schultern, wendet den Blick für einen Moment ab.
Larut hatte bei ihm schon oft das Gefühl, dass er nachlässig ist, sich aber nicht die Blöße geben will, einen Fehler zuzugeben.
»Wer hat die Leiche gefunden?«
»Ein gewisser Yanis Miloud, Weinbauer und…«
»Ich kenne Yanis.« Den Bauern kennt jeder, der sich gerne einen hinter die Binde kippt.
»Was hatte er in der Grube zu suchen?«
»Sein Hund hat angeschlagen. Zuerst wollte der Bauer gar nicht hingehen, weil die Leute immer ihren Dreck in der Grube entsorgen. Normalerweise frisst der Hund irgendetwas und kommt dann wieder. Dieses Mal nicht, da…«
Larut winkt ab.
»Darf ich?«, fragt er, hält Complatier die Handfläche hin.
»Haben Sie getrunken?«, fragt Complatier.
Larut antwortet nicht, nimmt die Taschenlampe und steigt in die Baugrube. Der geschwefelte Bandol läuft eher unter Chemielabor als Betrinken.
»Kennen Sie ihn?«, schreit Larut, tastet mit dem Lichtstrahl den Toten ab. Grauer Anzug mit erdigen Akzenten, jede Menge Haargel, das mit Blut vermischt in die Erde sickert. Complatier hebt die Schultern, Larut die Augenbrauen. Larut macht ihm mit einer Handbewegung klar, dass er zu ihm kommen soll. Widerwillig steigt er in den Matsch und stellt sich neben ihn.
»Das sieht eher wie eine Hinrichtung aus«, sagt Larut.
»Was meinen Sie?«
Er leuchtet mit der Taschenlampe in den ersten Schusskanal, dann in den zweiten.
»Zwei Schüsse«, skandiert Larut aus der Hocke.
»In den Hinterkopf. Das sagte ich bereits«, ergänzt Complatier und stopft die Hände in die Hosentaschen.
»Zwei Schüsse in den Hinterkopf. In der Grube, auf der einmal das Haus von Auguste Petrus gestanden hat,…«, sagt Larut, macht eine Pause und fügt schließlich hinzu: »… liegt ein Mann, der auf dieselbe Weise hingerichtet wurde wie Monsieur Petrus. Fast genau zwölf Jahre danach, nur einen Stock tiefer.« Complatier fixiert Larut, verengt die Lider.
»Halten Sie das für Zufall?«, fragt Larut.
Ohne eine Antwort abzuwarten, setzt er fort: »Gehen Sie zum Wagen, rufen Sie Guerlaine an und erzählen Sie ihm von der Sache.«
Complatier verlässt die Grube, Larut sieht sich den Toten noch einmal genau an. Er zieht ihn an den Haaren hoch, mustert das Gesicht. Keine Ahnung, noch nie gesehen. Ein Griff in die Gesäßtasche, nichts, er tastet die Arme ab, die Schultern, umrundet die Leiche, bis er in der Bewegung verharrt. Fast hätte er es übersehen.
1984: Ein ermordeter Säufer in dem Haus, das sich an dem Ort befand, wo jetzt der Mann im Anzug liegt. Hingerichtet mit zwei Schüssen in den Hinterkopf. Der einzige Verdächtige: François Ranfort, ein Kommissar aus Saint-Lemis. Mit bis dato einwandfreiem Leumund, dem Alkohol nicht abgeneigt, aber grundsätzlich harmlos und unauffällig. Dazu der beste Freund und Saufkumpan des Ermordeten.
Ansonsten keinerlei Hinweise. Keine Fingerabdrücke, Spuren oder Anzeichen irgendwelcher Feindschaften. Das einzige Indiz, das gegen die Schuld von Ranfort spricht, sind die Leute, die so schnell auftauchen, wie sie wieder verschwinden. Männer ohne Gesicht oder Identität. Der Staatsanwalt tritt auf den Plan, der Täter so klar wie der Himmel an einem Sommertag. Alles passt zusammen, jedes Teil des Puzzles an seinem Platz. Der vermeintlich Schuldige Ranfort streitet zwar alles ab, kann aber seine Unschuld nicht beweisen. Er sucht Hilfe bei seinem Chef, Principal Larut, der sie ihm in seinem grenzenlosen Pflichtbewusstsein verwehrt. Ein Mord im Streit unter Säufern, das kommt vor, in dörflichen Kreisen keine Seltenheit. Besonders, wenn der Täter Ranfort mit der Schwester von Monsieur Petrus liiert war und das Einverständnis gegenüber der Liaison äußerst fragwürdig blieb. Ebenso die Rolle der Schwester, die in der stillgelegten Fischfabrik neben zwei Unbekannten erschossen aufgefunden wird, deren Anzüge dem der Leiche in der Baugrube zum Verwechseln ähnlichsehen. Die Tätowierungen an ihren Oberarmen lassen auf ehemalige Fremdenlegionäre schließen, deren Identitäten allerdings ungeklärt bleiben.
Principal Larut wird die Sache unheimlich, will ermitteln, aber ihm werden vom Staatsanwalt die Hände gebunden. Eine Drohung seitens der Judikative wird nicht ausgesprochen, schwebt jedoch im Raum.
Larut ist vor nicht allzu langer Zeit Vater geworden, ein spätes Wunschkind, Saint-Lemis ein Ort, an dem man sich die Zukunft für den Jungen gut vorstellen kann. Die Rückkehr nach Paris sowie jegliches Vorgehen gegen den Dienstgeber wären ein Risiko. Er hält sich bedeckt, schiebt die Unfehlbarkeit der Judikative vor und schenkt der Akte keinerlei Beachtung mehr. Die Schuldgefühle sind überdeckt von der Harmonie und der Belobigung, die ihm zuteilwird.
Die gleichen Gefühle, die sich gerade seinen Bauch hinaufzwängen, im Hals stecken bleiben, sich nicht mehr verdrängen lassen.
Larut verzichtet darauf, der Ankunft der Kollegen beizuwohnen und entscheidet sich, den Weg in Richtung Westen fortzusetzen, wo sich die Polizeiwache befindet. Entgegen den Polizeifahrzeugen, die sich ein paar hundert Meter weiter zu der Baustelle zwängen, in der Complatier die Stellung hält. Ein guter Zeitpunkt, seine Vorahnung zu überprüfen. In der schwach besetzten Wache, wo in solchen Fällen der Unwilligste den Dienst verrichtet.
Sie kennen sich von früher, auch Dupin, ein äußerst schmächtiger Typ, tituliert Larut mit Principal, wie es ihm im Ruhestand ergehe, ob er den Dienst vermisse. Larut fragt, welche Art Ruhestand er denn meine, es folgt ein gezwungenes Lachen. Ein Moment ratloses Schweigen, dann widmet sich der Polizeibeamte wieder den Abendnachrichten.
Larut schleicht durch das Revier, bleibt jeden Meter stehen, sieht sich um, lässt die Atmosphäre wirken. Er war in Paris und Marseille, hat viele Kollegen kommen und gehen sehen. Eine Menge menschlicher Abgründe, die tiefer nicht sein könnten. Dennoch stand ein Ausscheiden aus dem Polizeidienst stets außer Frage. Selbst im Ruhestand kann er sich dieser Magie nicht entziehen. Er spürt diesen Hauch der Verbrecherjagd, dieses Taktieren, das etwas Animalisches in sich trägt. Wie ein Raubtier, das die Spur aufnimmt und sich lautlos anschleicht, um einen tödlichen Hieb auszuteilen.
Die breiten Stufen tragen den Duft des Verbotenen, dessen Attraktivität er sich nur schwer erwehren kann. Er geht in Complatiers Büro, dreht die Schreibtischlampe an und drückt den Einschaltknopf des Computers. Ein Piepton, die Festplatte frisst die Daten hinein, das Lämpchen blinkt hektisch im Takt.
Larut reißt es aus den Gedanken, als der Computer das Startsignal ausspuckt. Er setzt sich vor den Bildschirm, den Pass des Toten legt er neben sich. Er tippt die Anmeldeinformationen ein, das Gerät lässt sich Zeit, bis sich die Datenbank öffnet. Er gibt den Namen ein, den er dem Pass des Toten entnimmt. Caspar Vestal. Ein Glücksfall, dass er ihn gefunden hat. Andererseits erscheint ihm dieser Zufall ein wenig zu glücklich.
Der Computer quält sich, sucht, es vergeht eine gefühlte Ewigkeit, dann ein Ergebnis: nichts. Keine Übereinstimmung. Er vertauscht Vor- und Nachnamen, ersetzt das V in Vestal durch ein W, das C in Caspar durch ein K. Kein Ergebnis.
Er steht auf, geht zum Fenster, lenkt sich mit dem Funkeln des nassen Asphalts ab. Ein Mann dieser Sorte hat nie und nimmer einen einwandfreien Leumund, das spürt er. Er muss schon verhaftet worden sein, irgendwann war er bestimmt auffällig. Vielleicht einer vom Geheimdienst oder einer anderen Regierungsorganisation? Warum taucht dann niemand auf und untersucht die Angelegenheit? Warum wird er ausgerechnet in Saint-Lemis erschossen? Ist es das Haus, das nach Toten verlangt? Ein Fluch? Larut presst Luft durch die Nase und wehrt sich gegen den Anflug des Aberglaubens. Geister schießen nicht mit Pistolen.
Eine kurze Nacht für Larut. Ein klarer Morgen, den er kaum genießen kann. Gejagt von Gedanken, Theorien, Möglichkeiten, die ihn nicht loslassen wollen. Eine Sache für Interpol oder den Inlandsnachrichtendienst DST?
Vielleicht täuscht er sich, doch die Erfahrung sagt etwas anderes. Auch der Ort spielt eine Rolle. Keine Spuren, die auf einen Transport hindeuten, kein Einschlag, als sie ihn in die Grube geworfen haben. Die Spurensicherung wird Klarheit bringen. Zudem benötigt Larut mehr Informationen.
Am besten vor Ort.
Das Fahrrad klappert die Rue Pouy hinab, möglichst schnell vorbei an dem Duft, der den Weinberg um diese Zeit in Beschlag hält. Wie frische Leinentücher.
Seine Frau Sarah liebte diesen Duft und zerrte die Pflanze buschweise nach Hause. Seit sie nicht mehr bei ihm ist, kann er diesen Gestank nicht mehr ertragen. Normalerweise würde er in die andere Richtung fahren, weg von der Folter. In Yanis’ Richtung, dem Lockruf des Bandol-Verschnitts nach.
Larut lenkt das Fahrrad in die Rue Marseille. Er lässt sich Zeit, um den Geist an den bunten Fassaden und den gusseisernen Balkongeländern hängen zu lassen. Eine Sache, die sie beide liebten. Die überschaubare Hektik von Saint-Lemis. Ein paar Straßencafés, kleine Geschäfte, ein Markt, der nicht viel bietet, außer einem gewissen Charme. Deshalb waren Sarah und er hierhergekommen. Um Paris Lebewohl zu sagen, dem Chaos der Großstadt zu entfliehen, in eine ruhigere Heimat. Sie hatten sich schnell daran gewöhnt, von jedem gekannt und gegrüßt zu werden, auch wenn es für jemand, der in Marseille geboren wurde und in Paris gelebt hat, zunächst komisch anmuten mag.
Doch diese Art Gemeinschaft erleichtert Larut die Zeit. Keine allzu tiefen Bekanntschaften, jedoch eine willkommene Ablenkung.
Er kreuzt den Marktplatz, steuert auf das Polizeirevier zu und stellt das Fahrrad neben den Aufgang. Das Büro von Kommissar Complatier befindet sich direkt neben seinem ehemaligen. Ein Klopfen, ohne eine Antwort abzuwarten, die Tür geht auf. Complatier diskutiert mit Laruts Nachfolger, ihre Augen richten sich auf Larut, ein Moment Stille.
Principal Guerlaine. Ein junger Aufstrebender, gefüllt mit Ehrgeiz und einem Klumpen Arroganz. Akribischer Kleidungsstil, wahrscheinlich vom Herrenausstatter, alles aufeinander abgestimmt. Jedes Stück hat seinen Platz. Im Gegensatz zu Complatier zieht er es vor, die Hände in den Hosentaschen zu lassen.
»Wieder nüchtern?«, fragt Guerlaine, einen Mundwinkel hochgezogen.
»Ich möchte mit Kommissar Complatier sprechen. Allein.«
»Wir haben keine Geheimnisse voreinander«, sagt Guerlaine.
»Das habe ich bemerkt«, sagt Larut, den Blick auf Complatier. »Es geht um den Toten. Haben wir eine Identifikation?«
Guerlaine sieht Larut an, mustert ihn, den rechten Ellbogen hält er mit der linken Hand und streicht sich über das Kinn. Er lehnt sich vor, sagt:
»Wir haben gar nichts. Den Fall übernimmt Kommissar Complatier. Danke für Ihre Hilfe, Pierre.«
Nicht nur die Zunge, sein ganzer Körper trampelt auf Laruts Vornamen herum.
»Warum rufen Sie mich dann mitten in der Nacht an?«
»Ich habe die Sache mit Kommissar Complatier geklärt. Das wird nicht wieder vorkommen. Verzeihen Sie die Störung und danke für die Mühe.«
Was bezweckt Guerlaine? Warum will er ihm nichts erzählen? Stimmt Laruts These? Ist das eine bizarre Fortsetzung?
»Haben Sie mit Interpol Kontakt aufgenommen? Weiß die DST davon?«
Guerlaine massiert sich mit Daumen und Zeigefinger die Nasenwurzel. Er löst die Pose und wedelt mit dem Finger den Worten hinterher.
»Gehen Sie nach Hause, Larut. Trauern Sie oder lassen Sie sich endlich helfen. Und uns die Arbeit machen.«
»Welche Arbeit meinen Sie? Die Sache im Sand verlaufen zu lassen? Mit Ihren Golffreunden Ihr Handicap zu verbessern? Alles unter den Tisch zu kehren, damit es nicht an die Öffentlichkeit kommt?«
»Ich verstehe Ihre Aufregung, Pierre. Sie suchen eine Aufgabe, sehnen sich nach Abwechslung von Ihrem Alltag. Doch in diesem Fall sehen Sie Geister. Möglicherweise liegt es an der mäßigen Qualität des Bandols, der ihnen die Sinne vernebelt.«
»Sie waren nicht dabei, Guerlaine. Sie haben Ranfort nicht ins Gefängnis gehen sehen.«
»Sie doch auch nicht. Wenn man den Leuten Glauben schenken darf, haben Sie sich einen Dreck um ihn geschert. Oder irre ich mich?« Pause. »Ihre Reue kommt spät, das liegt in ihrer Natur.«
»Wie Sie meinen, Principal«, sagt Larut kalt, verlässt das Büro und schließt leise die Tür.
Damit niemand die Wut sieht, die ihm den Bauch hinaufkriecht.
»Monsieur Larut«, sagt eine Stimme, als er das Revier verlässt und sich auf das Fahrrad schwingen will. »Monsieur Larut.«
Er kennt diese Stimme. Monsieur Goutelle. Der Gerichtsmediziner aus Marseille.
»Warum waren Sie nicht bei mir? Es gibt interessante Neuigkeiten«, sagt der Arzt.
»Gehen Sie mit mir auf einen Petit Jaune?«
»Wenn Sie einen guten haben«, sagt er, nickt, rückt sich die Brille zurecht und klemmt sich die Ledertasche unter den Arm.
Larut schiebt das Fahrrad über das leere Kopfsteinpflaster des Place de la Brise und biegt in die Hafenstraße ein. Sie gehen etwa dreihundert Meter dem Kreischen der Möwen hinterher und folgen dem Hafendamm, bis sie einen Kiosk erreichen.
»Ich kann dem Regen etwas abgewinnen«, sagt Larut mit einem Grinsen auf den Lippen. »Es hält die Besucher fern.«
Der Arzt lächelt, als ob er wisse, was er meint. Sie stellen sich an einen der runden Tische, Larut bestellt, ein kleiner, alter Mann mit Fischermütze bringt wortlos zwei Pastis.
Klirrende Gläser, ein Zug, ein Handzeichen für zwei weitere. Dieselbe Prozedur ein weiteres Mal.
»Sie haben etwas von Neuigkeiten erzählt?«, fragt Larut.
»Warum sind Sie nicht zu mir gekommen?«
»Die Situation ist momentan etwas schwierig.«
»Das heißt, Sie sind nicht an dem Fall dran.«
»Nicht so ganz.«
»Sie ermitteln privat?«
»Ich ermittle gar nicht.« Das Noch nicht spart er sich.
»Was interessiert Sie die Sache dann?«
»Ich habe da so eine Vorahnung.«
»Und welche wäre das?«
Larut sieht ihn an, lässt sich Zeit, ihn von oben nach unten zu mustern. Sie kennen sich seit etwa zwanzig Jahren. Ein zuverlässiger, integrer Mann. In Cordsakko mit Flicken an den Ellbogen, irgendein Farbton zwischen beige und braun.
Larut atmet durch, überlegt, gibt dem Besitzer des Kiosks ein Zeichen.
»Einer reicht nicht, und drei sind einer zu viel«, sagt er, die Mundwinkel nach oben gezogen.
»Wie lange kennen wir uns?«, fragt der Arzt mit steifer Miene. Suggestiv. Sie beide wissen das.
»Sie werden mich für verrückt halten«, sagt Larut.
»Das glaube ich nicht.«
Zwei Pastis erreichen den Tisch, sie senken den Kopf, die Hände greifen zu den Gläsern, erneutes Klirren, ausweichende Blicke.
»Sie kennen den Fall Auguste Petrus?«, fragt Larut.
Stoisches Nicken.
»Dann wissen Sie auch, wie er ums Leben kam?«
Keine Frage. Natürlich weiß er das. Er hatte ihn vor sich auf dem Seziertisch liegen.
»Halten Sie das für Zufall?«
»Ich halte nichts für Zufall.«
»Auch nicht, dass ich nicht ermitteln darf?«
»Auch das nicht. Mich wundert, dass noch niemand von auswärts hier ist, der sich der Sache annimmt. Das hat damals eine Menge Staub aufgewirbelt. Ich habe den Prozess verfolgt. Mustergültig würde ich sagen.«
»Ich habe den Pass des Toten überprüft«, flüstert Larut.
»Und nichts gefunden«, ergänzt der Arzt.
Larut senkt langsam das Kinn, sagt: »Haben Sie Informationen über seine Identität?«
»Was glauben Sie?«
»Dass es ihn nicht gibt. Keine Fotos, keine Identität, wahrscheinlich ist er nicht einmal im Kindergarten gewesen.«
Der Arzt beugt sich zu Larut, sieht sich um, ob niemand zuhört, sagt: »Das ist nicht einmal das Auffälligste.«
Larut kriecht ein unangenehmes Gefühl durch die Brust. Er drängt den Kloß, der am Gaumen klebt, nach unten und beugt sich zu ihm.
»Wir haben Informationen über die Waffe.«
»Eine Walther P21 mit Schalldämpfer«, sagt Larut.
Ein Nicken, beinahe apathisch.
»Dieselbe Walther P21?«
»Sogar die Entfernung stimmt. Schmauchspuren am Hinterkopf wie seinerzeit. Alles spricht für eine Hinrichtung.«
»Und einen Zusammenhang.«
»Würde mich wundern, wenn es nicht so wäre.«
»Eine Frage noch.«
Der Arzt dreht die Handflächen nach oben, lehnt den Kopf zur Seite.
»Haben Sie Kontakt zu Interpol?«
»Warum?«
Larut zieht eine Kopie des Passes aus der Hosentasche und schiebt sie über den Tisch.
Ein kurzer Blick, der Arzt nickt und bestellt zwei weitere Pastis. Drei sind heute nicht genug.
2
Dunkelheit klebt an den Fassaden wie hartnäckiger Zahnbelag. Allein die Stille wird von den Hauswänden reflektiert und in die laue Nacht entlassen. Der Horizont zeigt sich kupfern, genauso fern wie die Hoffnung selbst. Ein paar zerfledderte Turnschuhe schleichen die Rue Puits du Denier hinab Richtung Panier. Der Mann, der darin steckt, hält den Blick geradeaus, nicht nach links oder rechts, schon gar nicht zurück.
Die Hände in den Hosentaschen vergraben, den Kopf zwischen den Schultern eingezwängt. Die buschigen Augenbrauen haben sich zu einer vereint, er denkt an die Vergangenheit, die ihn nicht loslassen will, ihn verfolgt. Egal wohin er geht, was er auch denkt, er kann es nicht vergessen. Auch wenn es verschwiegen wird, niemand darüber spricht, passiert ist es dennoch. Ein kalter Nebel, unaufhaltsam, der durch die Fenster kriecht, in die Ecken schleicht, sich festhält und alles erdrückt. Wie Schicksal, das bewältigt werden will. Eine Flucht: ausgeschlossen.
Er hat Widerstand geleistet, sich gewehrt, allen Ablenkungen ergeben, doch es ist immer noch da und präsenter als jemals zuvor. Im Moment klebt es als Schatten an seinen Fersen, die er immer schneller in den Stein presst. Dabei lässt er Vorsicht walten, die sollen nicht merken, dass sich Panik in ihm breitmacht. Aber er weiß, was passieren wird. Deshalb hält er sich an den Wänden, damit die Silhouette im Schatten der Gebäude verschwindet, sein Geruch sich mit dem der Abfalleimer und Müllsäcke vermischt. Möglicherweise haben sie Hunde, die seine Fährte aufgenommen haben.
Wenn sie ihn kriegen, wird es nicht gut für ihn aussehen, dann ist er schnell wieder da, wo er früher war. Dort, wo er nie wieder hin will. Die Erinnerungen, die ihm den Schlaf rauben, ihm den Boden unter den Füßen wegreißen, sie sollen verschwinden, auf keinen Fall erneuert werden.
In den Gassen hat er die besseren Karten, dort kennt er sich aus, kann Abkürzungen nehmen. Damit sie ihm mit dem Fahrzeug, das in einer Seitenstraße wartet, um ihn hineinzuzerren, nicht verfolgen können. Da kann ein Betonpfeiler, sei er noch so klein, die Rettung bedeuten.
Dann müssen sie schneller laufen als er. Er ist schnell, wenn es darauf ankommt. Zudem listig, sonst hätten ihn schon andere erwischt. Dass es irgendwann passieren wird, ist nicht auszuschließen.
Aber nicht heute. Nicht, wenn er vorbereitet ist.
Er bleibt stehen, drängt den Körper in eine dunkle Ecke, spitzt die Ohren, sieht sich um. Nichts. Nicht einmal eine hungrige Katze. Kein Rascheln zwischen den Müllsäcken, kein Huschen in der Dunkelheit. Vielleicht galten die Schritte nicht ihm, vielleicht hat ihm die Fantasie einen Streich gespielt. Er atmet tief ein, nicht zu auffällig, dass sich der Brustkorb kraftvoll hebt, bläst langsam Luft aus der Lunge.
Glück gehabt. Deine Beine haben dich gerettet.
Ein Nicken, er mustert sich, der gesamte Körper ist in Aufruhr. Die Ohren gespitzt, kein Geräusch kann ihm entgehen.
Er wartet, harrt aus, die Augäpfel quellen aus den Höhlen, sein Blick sucht die Umgebung ab. Sein Herz beruhigt sich, der Atem wird flacher, ein Schritt aus dem Versteck.
Absätze hacken sich in das Pflaster, ein keuchender Schatten von links, Karim dreht den Kopf, zu langsam, er nimmt den dumpfen Hieb nicht wahr.
Was zum…?
Sternenhimmel, verzweifelte Lider, die Hand will das Unverständnis berühren, es begreifen. Doch sie erreicht es nicht. Stattdessen weicht die Kraft aus den Knien, ein harter Aufprall, die Welt verschwimmt im Dunkel.
Du hast es geahnt, Karim. Diese verdammte Euphorie, die dich alles vergessen lässt. Bazou hat dich gewarnt.
Kälte durchfährt seinen Körper. Eine Kälte, die sich festgräbt, in die Knochen frisst, ihn bis ins Innerste frösteln lässt. Ausgeliefert, hilflos, abgelegt. Wie ein Sack verschimmelter Reis, der auf die Abholung der Müllabfuhr wartet. Sie haben ihn in ein Auto gezerrt, wie er es geahnt hat. Eine Fahrt im Dunkeln, stumm, die Lichter der Stadt zogen vorbei, blendeten ihn durch den Plastiksack, der gerade genug Luft zum Atmen durchließ. Ein erneuter Schlag, nicht ganz das gewünschte Ergebnis, ein Stück Besinnung ist ihm noch geblieben. Zwei Männer zogen ihn an den Armen aus der Tür, in ein Haus, durch einen Gang, ein Stockwerk tiefer. In einen Raum, der selten die Sonne sieht, wahrscheinlich auch an warmen Tagen die Feuchtigkeit hält. Ein Fenster zur Straße, dessen Öffnung die Freiheit verheißt, aber zu klein ist, um hindurchzuklettern.
Am anderen Ende des Raumes eine Eisentür, abgeschlagenes Metall, die Klinge abgegriffen. Er ist nicht der Erste, der hier zu Gast ist und mit Sicherheit nicht der Letzte. Ein Rütteln an der Klinke scheint sinnlos, das haben schon andere vor ihm versucht. Im Moment kann er nur die Beine an den Körper ziehen, weg von der Wand, die ihm die restliche Wärme entzieht. Die Haut spannt wie ein Brett voller Nägel. Er reibt sich die Hände, bis die Hitze unangenehm wird, streicht die Beine entlang. Ein Schauer zieht den Rücken hinab, der ganze Körper schüttelt sich.
Sie haben dich erwischt und du hast es nicht glauben wollen.
Alles andere wäre wohl ein Wunder gewesen. Die guten Jahre, die ein anderer niemals so bezeichnen würde, wo sind sie hin? Warum hat er nicht das bisschen genossen, das er hatte?
Mehr kannst du nicht erreichen.
Tropfen fallen von den Wänden, nichts außer Kälte und Dunkelheit. Wäre er doch in Bias geblieben, wie die anderen, die sich nicht lösen können von der Vergangenheit, sogar ein Haus gebaut haben neben dem Lager. Mit Vorgärten, in denen die Kinder spielen, Blumen an den Fenstern, die verschönern sollen, was damals geschah. Blumen, die einen Dämon in einen Engel verwandeln sollen. Neben dem Bann der Tricolore, die sie heute noch dort hält. Niemand interessiert sich dafür, was ihnen widerfahren ist, deshalb übermalen sie die Vergangenheit mit neuen Bildern. Warum stehen sie nicht auf, packen das Übel und ziehen die zur Rechenschaft, die es verdienen? Stattdessen stehen sie da, in den alten Kostümen, die sie Uniformen nennen und freuen sich über einen Handschlag desjenigen, der damals ihren Rücken mit der Reitpeitsche bearbeitet hat.
Lieber verrottest du in diesem Loch, als es ihnen gleichzutun.
Soll sich doch die Kälte in sein Gebein fressen, ihm das Leben aussaugen, bevor er jenen vergibt. Sie sind wie der Dämon Iblis: Verwirrer, Verleumder, Faktenverdreher. Doch sind sie nicht aus Stein, sondern aus Ton wie er selbst.
Karim will sich aufrichten, zum Kampf bereitmachen oder wenigstens zum Laufen. Er stützt sich auf die Hände, lehnt sich vor, auf die Knie, die Fersen schmerzen, sind gefroren. Die Knie vermögen kaum das Gewicht zu tragen, die Hand hält sich am Gemäuer fest. Er drückt den Rücken gegen die Wand, reibt sich die Füße warm und humpelt zur Tür. Knapp hinter der Spur, die in den Boden gekratzt wurde, in einem Winkel, den man nicht so leicht einsehen kann.
Nicht mit dir, schon gar nicht heute.
Der Schlüssel dreht sich, die Klinke knackt, ein Sicherheitsschuh schiebt sich in den Raum. Eine Pistole wird entsichert, Karim stürmt nach vor, ein Grinsen, die Beine verlassen ihn. Die zwei Männer lachen, der eine steckt die Pistole in den Hosenbund, sie hieven ihn hoch und zerren ihn weg.
Nicht weit, bloß zwei Meter, eine andere Tür, ungesichert, eher von einem Büro. Ein Mann presst ihn in den Sessel, die Hand auf der Schulter, der andere nimmt hinter ihm Platz.
Etwas kommt von hinten, Karim erschrickt, kein Grund zur Panik. Das Kratzen einer Decke am Rücken, die er automatisch nach vorne zieht. Er drängt die Beine an den Bauch, drückt die Fußsohlen an den Bezug des Bürostuhls. Die zwei Hünen hinter ihm stoßen ein Lachen hervor, ihre Blicke treffen sich in Amüsement, die Körper schütteln sich. Derb und grell drängen die Laute in seinen Kopf, wie eine Dampflok in den Tunnel.
Karim presst die Hände gegen die Ohren, die Decke kriecht nach unten, er holt sie zurück, die beiden imitieren seine kläglichen Versuche, die Würde zu bewahren.
Bis sich die Tür öffnet und ein Mann eintritt.
Leichter Bauchansatz, an die sechzig, harte Gesichtszüge. Die Haut spannt an den Wangenknochen, der Körper täuscht Gebrechlichkeit vor. Eine Täuschung, der Karim nicht erliegen darf. Der Mann hält eine Stoffrolle in der Hand, die ebenso alt wie er sein dürfte, legt sie auf den Tisch, an dem er gegenüber Platz nimmt und sich gemächlich die Hemdsärmel hochkrempelt. Ein Blick in eine Akte, zu Karim, eine eiskalte Miene. Der Mann stützt sich auf die Ellbogen, die dürren Augenbrauen angespannt. Die Furchen im Gesicht geraten mit den Dellen am Kopf in Bewegung, er sagt:
»Karim Zidane. Ein Mann, der mit seinem Landsmann lediglich den Nachnamen teilt. Weder ist ihm der leichtfüßige Umgang mit dem Ball vergönnt noch dessen Geschenk der Schnelligkeit.«
Der Mann dreht sich zu den zwei Hünen mit den Sicherheitsschuhen, kollektives Lachen, das sich in Karims Gehirn frisst.
»Er macht Schwierigkeiten, wie so einige seiner Landsmänner, taucht hie und da auf, ein paar kleine Delikte, man möchte fast sagen, dass er in diesem Sinne seiner Herkunft alle Ehre bereitet. Ein wenig Hasch, folglich übt er sich im Nichtstun, lässt das Leben an sich vorbeiziehen. Es scheint ihm alles egal zu sein.« Kurze Pause. »Bis er die Rue Puits de Denier entlanggeht und merkt, dass seine Handlungen nicht ohne Folgen bleiben.«
Keine Bullen, und wenn, dann mit Sicherheit nicht der reguläre Verein. Vielleicht eine Splittergruppe, die Selbstjustiz übt, sich an den Arabern rächt. Wofür auch immer.
»Was wollen Sie?«, fragt Karim.
»Ich möchte Sie dazu bewegen, uns mitzuteilen, was wir wissen wollen.«
»Was möchten Sie denn wissen, Monsieur?« Karim legt die ganze Verachtung, die er zu geben bereit ist, in das letzte Wort.
»Lesen Sie Zeitung, M’sieu Zidane?«
Mit dem Lesen hat er es noch nie gehabt, trotz der Mahnungen seines Vaters. Schon gar nicht die Hetzblätter, die den Franzosen Angst vor den Arabern machen sollen.
»Kaum.«
Der Mann steht aus dem Sessel auf, nimmt die Rolle in die Hand, wirft sie auf den Tisch. Er umkreist Karims Stuhl, langsam, stoppt, legt ihm die Hände auf die Schultern und hält den Kopf neben sein Ohr. Kein Mundgeruch, trotz des sichtlich maroden Zahnstatus. Der Atem dringt in seine Nase wie ein Sturm. Der Mann zieht den Mundwinkel hoch, schnaubt ihm ins Ohr, stößt sich von Karims Schultern ab.
Dann geht er wieder in Richtung des Sessels, auf dem er zuvor gesessen hatte.
»Der Bombenanschlag in der Rue Émile Pollak ist, was uns im Moment brennend interessiert. Nehmen Sie sich ruhig Zeit, sinnieren Sie ein wenig, antworten Sie nicht zu vorschnell.«
»Worüber sollte ich denn sinnieren, Monsieur? Dass Sie Araber fangen und in ein Loch sperren, bis sie verrotten? Das haben Sie schon immer mit uns gemacht. Dass mein Vater…«
Lass es. Das geht ihn nichts an.
»Dass Ihr Vater ein Harki war? Ein Mann, der sein eigenes Volk verraten hat? Weil er glaubte, ein Franzose zu sein? Selbst wenn, und ich sage das in höchsten Glauben, M’sieu Zidane, selbst wenn seinesgleichen Frankreich zum Sieg verholfen hätte, so wäre sein Status stets der eines Verräters am eigenen Volk geblieben. Aber eines muss man ihm lassen.« Der Blick sticht in Karims durchgefrorenen Körper. »Er war wenigstens ein Mann.«
»Was weißt du schon von meinem Vater?«, kreischt Karim wie ein trotziges Kind, springt auf, will dem Dürren an die Gurgel. Der schnalzt mit der Zunge, die beiden mit den Sicherheitsschuhen drücken die Arme unter Karims Achseln und schleifen ihn fort.
»Alles, was fortan passiert, M’sieu Zidane, haben Sie sich selbst zuzuschreiben«, sagt der Dürre, den Blick fest auf ihn gerichtet. Stoisch, doch es könnte bestimmter nicht sein.
Die Eisentür fällt in den Rahmen und Karim ist mit dem unaufhörlichen Tropfen des Wassers allein. Die Decke haben sie ihm gelassen, gerade groß genug, dass er entweder darauf liegen oder sich damit zudecken kann. Perfide, aber effektiv.
Besonders, wenn der Rest des Körpers ohne Unterhose in einem Keller verschimmelt. In Karim steigt Hass auf, Wut, die ihm die Kälte aus den Knochen treibt. Der Kopf errötet, fast glüht er. Er hat nur einen Wunsch: Dem Dürren das Leben aus dem Gerippe zu prügeln, ihm den letzten Tropfen Blut herauszuquetschen, bis die kalten Augen die Dschahannam erblicken.
Was hat er für eine Ahnung von seinem Vater? Er darf sich kein Urteil erlauben. Sein Vater hätte sein Leben gegeben für Frankreich, es mit dem letzten Atemzug verteidigt. Wie stolz stand er da, in seiner Uniform, bereit, für das zu kämpfen, woran er glaubte? Dass dieser Krieg nur einen Ausgang, einen Sieger kennt. Einen Glauben, der sich als Betrug entpuppte. Selbst, als alles verloren war, trat er ein für seine Überzeugung. Entwaffnet von den Vorgesetzten, zurückgelassen, ohne Ehre. Wartend auf das, was kommen sollte. Seinen Vorgesetzten hat er nicht angefleht wie viele seiner Waffenbrüder.
Er hat nicht gebettelt, dass sie ihn mit nach Frankreich nehmen. Er hat keinen Gedanken daran verschwendet, dem Schicksal zu entkommen. Dabei hatte er gesehen, was die FLN mit denen macht, die sich mit den Franzosen verbrüdert hatten. Einer seiner Kameraden hatte versucht, zu flüchten. Verfolgt von FLN-Kämpfern, Maschinengewehren, zwischen den Kugeln hindurch hinein in eine Menschenmenge. Untergetaucht, in einem Taxi Richtung Algier. In einem alten Citroën, der niemals die Stadtgrenze von Tizi Ouzou erreichte. Sie zerrten ihn aus dem Wagen, traktierten ihn mit Stromstößen und schnitten ihm die Zunge heraus. Dann führten sie ihn öffentlich vor, damit ihn die Leute beleidigen und bespucken konnten. Tag für Tag waren sie gekommen. Menschen, die ihn früher gemocht hatten. Menschen, die ihm nahe gestanden hatten.
Karims Mutter hatte versucht, seinen Vater von der Flucht zu überzeugen, doch er wusste, dass er nirgends sicher war. Die Stadt war abgeriegelt, die Bahnhöfe dicht, eine Flucht keine Option. Nicht mehr. Seine einzige Möglichkeit: Zu hoffen, dass sie gnädig wären.
Ähnlich wie bei Karim. In diesem Moment.
Die Tür öffnet sich, die Hünen kommen herein, ein entschlossenes Glitzern in den Augen. Ein Sicherheitsschuh trifft ihn in die Seite, noch ein Hieb, er krümmt sich, will die Eingeweide schützen. Ein Husten entkommt dem Körper, er fleht nicht, bittet nicht, hält die Worte im Inneren. Das innere Auge auf den Vater gerichtet, der aufrecht fortgezerrt wurde in die Ungewissheit.
Eine Sohle steht auf den brennenden Rippen, hält die Lunge davon ab, sich auszudehnen. Ein gefälliges Schnauben, der Laut eines Reißverschlusses. Langsam, Zacken für Zacken, knackt der Schieber nach unten, bis er das Ende erreicht. Ein Genital, das sich aus der Hose schält, ein Lachen, das Klatschen nackter Haut auf dunkelblauen Jeans. Karim schließt die Lider, denkt sich woanders hin.
Urin läuft über sein Gesicht, er presst die Lippen zusammen, um dem sauren Geschmack zu entgehen.
Damit das Brennen nicht die Schleimhäute befällt.
Für einen Moment vergisst er die Kälte, spürt die Wärme, die gleich wieder vergeht, als es seine Würde ertränkt.
Diesem Schicksal wolltest du entgehen. Dein Leben sollte anders verlaufen.
Er hat es geschafft, ist weg aus diesem Land, das er für seine Heimat hielt. Durch die Lager, zu zweit, allein. Ihn haben sie nicht gebrochen, nicht zerstört, nur wütender gemacht. Die langen Tage im Lager in Bias, die Störungen in der Nacht durch die Soldaten, das Geschrei, die sinnlosen Befehle, das Antreten im Morgengrauen vor der Tricolore. Warum haben die Soldaten das gemacht, die Flüchtigen dazu gezwungen? Deshalb waren sie doch hier, weil sie die Heimat für Frankreich aufgegeben, ihr Heim verlassen hatten. Für eine Hoffnung, die sie zerstörten.
Karim war noch ein kleiner Junge, doch schnell hatte er verstanden. Zum ersten Mal als ihn die Soldaten der FLN wegstießen, an den Fuß des Vaters geklammert. Daheim in Tizi Ouzou, am Fuße des intensivsten Grün, das man sich vorstellen kann, hatte er das erste Mal Bekanntschaft mit dem Holz eines Gewehrkolbens gemacht.
Eine Erfahrung, dass Jungen weinen und der Dämon in verschiedensten Gewändern, in allen Farben zu Tage tritt. Jede Witterung und jede Kulisse vermag der Dämon in Dunkelheit zu tauchen. Die Männer, die zuvor über die weißen Teufel geweint hatten, hatten sich zu braunen Teufeln gewandelt. Mächtig und unbarmherzig.
Immun gegen die Tränen der Frauen, das Jammern der Kinder und das Blut der Männer.
Da ist es wieder, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins, dem er abgeschworen hatte. Im Gesicht die Rückstände fremden Urins, das die Decke nur notdürftig aufzusaugen vermag, fast nackt auf dem Boden liegend, in einer Lache verlorener Selbstachtung. Die letzten Worte des Vaters in den Ohren klingend.
»Studiert… Denn Wissen bedeutet das edelste Leben und die Unwissenheit den größten Tod!«
Doch das hat er nicht geschafft, er hat versagt, dem Appell des Vaters zu folgen. Trotz der Versprechungen der Regierung. Trotz der Schwere des Zitats von Ahmed Zabana, der 1956 in Barberousse von den Franzosen exekutiert wurde.
Bauern und Beamte wurden in Frankreich nicht gebraucht, waren nutzlos. Umschulungsprogramme in der neuen Heimat nur unzureichend vorhanden und in der Regel den Rapratiés, den Heimkehrern vorbehalten. Algerienfranzosen, Pied-noirs, die selbst nicht genug hatten, sich das, was sie brauchten, gewaltsam zu holen bereit waren. Mit den Kommandos der OAS, die schon zuvor in Algier Terror verbreitet hatten.
Doch Karim war bei keiner Siegertruppe dabei, er war fern der Aggressoren. Verloren, dem Leben hingegeben, hoffend, dass ihm das Schicksal in die Hände spielt.
Eine trübe Hoffnung, die sich bald der Realität ergeben hat. Hätte er nicht Bazou getroffen, einen Tagelöhner und Gelegenheitsdieb, wäre sein Leben schlimmer verlaufen. Bazou erkannte Karims Talent und bot sich als Mentor an, ja beinahe aufgedrängt hatte er sich, ihm gezeigt, wie man Taschen ausräumt, ohne sich bemerkbar zu machen. Eine Ablenkung, ein nettes Bonjour, so weich wie möglich. Damit sie die zwei Hände, die unabhängig voneinander funktionieren, nicht bemerkten. Von den Insassen, die es anfangs als Spaß belächelten, bis zu den Soldaten, deren Prügel er gespürt hätte. Wenn nicht seine Schnelligkeit wäre, die ihm das Leben mehr als einmal gerettet hat. Die Mädchen liebten seine flinken Finger. Ein Magier sei er, jemand, der hundert Finger an zwanzig Händen hätte.
Karim spielte mit ihnen, war sich der Betörung bewusst, die er ausstrahlte. Die Mädchen, zahlreich, er konnte nicht sagen, welche die Schönste war, welche Haut die weichste.
Der Gedanke wärmt ihn, lässt ihn vergessen was ist, ersetzt den Geruch des Urins durch den eines zarten Halses.
Die Mundwinkel ziehen sich in die Länge, ein Kichern, das sich zu einem Lachen hochschaukelt, an Bass gewinnt, ihn an der Achsel packt und aus dem Raum zerrt.
3
Der Regen hat sich verzogen und den Schaulustigen Platz gemacht. Meist eine gute Gelegenheit, um aufs Meer zu fahren. Larut hatte sich ein paar Jahre vor dem Ruhestand ein Boot gekauft. In Saint-Lemis eine verschwindende Tradition. Viele waren Fischer, konnten sich aber gegen die subventionierte Hochseefischerei nicht durchsetzen. Das hatte die meisten ruiniert. Manche versuchten, sich mit Ausflugsfahrten über Wasser zu halten, zogen Wasserskifahrer oder Bananenboote hinter sich her. Keines der Dinge, die Larut und seine Frau seinerzeit nach Saint-Lemis gelockt hatten.
Dennoch genießt er die Stimmung im Hafen, wenngleich nicht so sehr wie früher. Weniger Touristen wären besser, genauso verhält es sich mit den Ständen, die belanglosen Ramsch aus Asien zu überteuerten Preisen anbieten. Doch es ist ein erträgliches Übel und oftmals die einzige Einkommensquelle für die Händler.