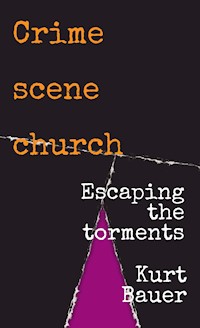14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine große Erzählung über Österreichs braune Jahre und ein spannendes Panorama vielfältiger Schicksale zwischen Begeisterung, Skepsis und Verzweiflung: Der bekannte Wiener Historiker Kurt Bauer erzählt virtuos über die Jahre nach dem »Anschluss« Österreichs an das »Dritte Reich«. Im März 1938 wurde Hitler in Wien von jubelnden Menschen empfangen. Bekannte Bilder – doch wer waren diese Menschen, was dachten sie wirklich, und wie ging es für sie weiter? Unzählige Tagebücher, Autobiographien und Briefe hat Kurt Bauer zu einer atemberaubend lebensnahen Geschichte gebündelt. Er erzählt, warum Sozialdemokraten zu Nazis wurden, schildert die bewegenden Schicksale von Menschen, die vor Verfolgung flüchten mussten, und lässt viele weitere Menschen aus den verschiedenen Regionen zu Wort kommen, die sich so ihre eigenen Gedanken machten. Eine einzigartige Geschichte der gesamten Bevölkerung Österreichs während des Nationalsozialismus – mit allen Facetten von Widerstand über Mitläufertum bis hin zur Beteiligung an Gewalt und Mord.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 721
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
KURT BAUER
Die dunklen Jahre
Politik und Alltag im nationalsozialistischen Österreich 1938 bis 1945
Über dieses Buch
Eine große Erzählung über Österreichs braune Jahre und ein spannendes Panorama vielfältiger Schicksale zwischen Begeisterung, Skepsis und Verzweiflung
Im März 1938 wurde Hitler in Wien von jubelnden Menschen empfangen. Bekannte Bilder – doch wer waren diese Menschen, was dachten sie wirklich, und wie ging es für sie weiter? Unzählige Tagebücher, Autobiographien und Briefe hat der Wiener Historiker Kurt Bauer zu einer atemberaubend lebensnahen Geschichte verwoben.
Er erzählt, warum Sozialdemokraten zu Nazis wurden, schildert die bewegenden Schicksale von Menschen, die vor Verfolgung flüchten mussten, und lässt viele weitere Menschen aus den verschiedenen Regionen zu Wort kommen, die sich zum Teil so ihre eigenen Gedanken machten.
Eine einzigartige Geschichte der gesamten Bevölkerung Österreichs während des Nationalsozialismus – mit allen Facetten von Widerstand über Mitläufertum bis hin zur Beteiligung an Gewalt und Mord. Das Buch zum 80. Jahrestag des Anschlusses – für alle, die wissen wollen, wie Menschen in ganz Österreich die sieben Jahre im »Dritten Reich« erlebten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Prolog
Euphorie und Panik/1938
Berchtesgaden
Doppelherrschaft
Schuschniggs Entschluss
Hitlers Entschluss
11. März
Einmarsch
Hitler in Linz
Heldenplatz
Volksabstimmung
Terror
Ernüchterung/1938–1939
Einverleibung
Die Partei
Ostmärker
Volksgemeinschaft
Raub und Vertreibung
Aufschwung
Stimmungen
Rosenkranzfest
»Reichskristallnacht«
August ’39
Illusionen/1939–1942
September ’39
Soldaten
Zivilisten
Deportationen
Mauthausen
Hartheim
Täter
Angst/1943–1944
Soldaten
Zivilisten
Abwendung
Luftkrieg
Ausbeutung
Moskauer Deklaration
Widerstand
Panik und Hoffnung/1945
Untergang
Soldaten
Zivilisten
Massenmord
Ende und Anfang
Schlüsse
Nachwort
Literatur und Quellen
Abkürzungen
Akteure
Orts- und Personenregister
ORTE
PERSONEN
Dieses Buch widme ich dem Andenkenmeiner Mutter Margarete Bauer (1937–2016).Ihre Kindheit stand im Dunkel jener Jahre.
Prolog
Der Anschluss Österreichs an Deutschland hat eine lange Vorgeschichte. Sie beginnt mit dem preußisch-österreichischen Krieg von 1866.[1] Die Niederlage in der Schlacht bei Königgrätz verursachte in Österreich einen gewaltigen Schock. Die Deutschösterreicher sahen sich aus Deutschland hinausgeworfen und dazu verdammt, eines der vielen Völker des Habsburgerreiches zu sein statt Deutsche unter Deutschen. Die österreichischen Deutschnationalen fühlten sich von den anderen Nationalitäten der Monarchie bedrängt und bedroht und warfen sehnsuchtsvolle Blicke hinaus ins mächtige, nach der Weltmacht greifende Reich der Hohenzollern. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus ein radikal antisemitischer, antislawischer, antimarxistischer Pangermanismus.[2]
Am nachdrücklichsten vertraten die Alldeutschen unter Georg Schönerer diese extreme Position. Hitler war von Schönerer so fasziniert, dass er ihm in »Mein Kampf« Dutzende Seiten widmete. Die Historikerin Brigitte Hamann bezeichnet ihn als Hitlers »Jugendidol«. Hitler habe Schönerers politische Grundsätze nicht nur aufgenommen, sondern geradezu kopiert.[3] Im zersplitterten deutschnationalen Lager der österreichisch-ungarischen Monarchie waren die Schönerianer allerdings nur eine Gruppe von vielen, und zwar keineswegs die dominierende, sondern bestenfalls diejenige, die am meisten Lärm erzeugte. Bei den meisten österreichischen Deutschnationalen verband sich die Liebe zum Deutschtum mit dem grundsätzlichen Bekenntnis zum Habsburgerstaat. Auch die Sozialdemokratie – trotz der Deutschtümelei vieler ihrer führenden Protagonisten – war am Erhalt des Großraums der Monarchie interessiert. Die eigentlich staatstragende, prohabsburgische Partei der Deutsch-Österreicher waren die katholisch-konservativen Christlichsozialen. Der Historiker Ernst Hanisch spricht von einer »doppelten Identität« der Österreicher: »Eine starke deutsche, vermittelt durch Herkunft, Sprache, Erziehungssystem, Literatur, Kommunikationskreise, und eine schwächere österreichische, die sich auf die Donaumonarchie bezog und durch dynastische Symbole gestützt wurde.«[4]
Am Beginn des Ersten Weltkriegs herrschte in beiden Reichen dieselbe überbordende Begeisterung, vor allem in den bildungsbürgerlichen Schichten. Und während des Krieges betonte man nach außen hin bei jeder Gelegenheit unverbrüchliche »Waffenbrüderschaft« und »Nibelungentreue«. Tatsächlich aber war das Verhältnis zwischen den Bündnispartnern gespannt und konfliktbeladen. Mit zunehmender Kriegsdauer geriet Österreich-Ungarn militärisch und ökonomisch immer mehr in ein Abhängigkeitsverhältnis zu Deutschland.
Trotz aller Konflikte im Krieg entflammte danach, als die Monarchie zerfiel und eine demokratische Republik entstand, die Idee eines Anschlusses an das Deutsche Reich. Die Führungsschichten der neu entstehenden Republik Deutschösterreich waren ganz dem Großraumdenken der Monarchie verhaftet. Wie sollte der neu geschaffene Rumpfstaat eine realistische Lebenschance haben? Die existentiellen Erfahrungen von Not, Hunger und Deklassierung, die Millionen Menschen im Weltkrieg gemacht hatten, weckten in allen politischen Lagern und Bevölkerungsschichten die Überzeugung, ökonomisch nur im Großraum überleben zu können.[5]
Am 12. November 1918 wurde die demokratische Republik Deutschösterreich ausgerufen. Im Artikel 2 des Gesetzes über die Staats- und Regierungsform dieser Republik hieß es: »Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik.«[6] Allein, die Siegermächte dachten nicht daran, einen bedeutenden Zugewinn an Territorium und Bevölkerung für das Deutsche Reich als Ergebnis des Weltkriegs zu akzeptieren. Ein Anschluss, das wäre ja so, als hätte Deutschland nachträglich den Krieg gewonnen, hieß es in Paris. Der Republik Österreich wurde daher im Artikel 88 des Vertrags von Saint-Germain ein Anschlussverbot auferlegt.[7]
Wie die Stimmung in Österreich war, zeigte sich bei zwei Volksabstimmungen, die im Frühjahr 1921 stattfanden: In Tirol votierten 98,8 und in Salzburg 99,1 Prozent der Bürger für einen Anschluss an Deutschland. Weitere Abstimmungen unterblieben auf Betreiben der Siegermächte.[8] Zugleich entstand eine Reihe teils einflussreicher Vereinigungen, die den Anschluss zum Ziel hatten. Der 1925 gegründete »Österreichisch-deutsche Volksbund« etwa war eine Massenorganisation, an der sich Verbände und Körperschaften aller politischen Richtungen beteiligten. In Deutschland existierte ein Pendant, der »Deutsch-österreichische Volksbund«, geführt vom sozialdemokratischen Reichstagspräsidenten Paul Löbe.[9] 1930/31 betrieben die beiden Regierungen das Projekt einer deutsch-österreichischen Zollunion. Frankreich und Italien, die selbst nach Suprematie im Donauraum strebten, traten energisch dagegen auf, ebenso Großbritannien und die Tschechoslowakei. Frankreich konnte, indem es Österreichs Finanznöte ausnutzte, den Plan schließlich 1931 zu Fall bringen.[10]
Im September 1930 stieg die reichsdeutsche NSDAP mit 18,3 Prozent zur zweitstärksten Partei im Deutschen Reich auf. Im Vergleich dazu kam die ebenfalls Hitler unterstehende österreichische Partei bei der Nationalratswahl vom November 1930 auf überaus bescheidene 3 Prozent. Aber 1932 ging es auch in Österreich aufwärts. Bei drei Landtagswahlen im April 1932 kam die NSDAP auf Ergebnisse zwischen 14,1 und 20,8 Prozent. Das war beachtlich, aber nichts gegen die von Hitler zur selben Zeit im Deutschen Reich errungenen Siege.[11]
Am 30. Januar 1933 übernahm Hitler die Macht in Deutschland und zertrümmerte die noch vorhandenen Restbestände des demokratischen Systems der Weimarer Republik binnen weniger Monate. Diese Entwicklung führte indirekt auch in Österreich zur Erschütterung und letztlich Auflösung der Demokratie. Bundeskanzler war seit Mai 1932 der Christlichsoziale Engelbert Dollfuß. Anfang März 1933 nutzte er eine unbedacht herbeigeführte Geschäftsordnungskrise, um das Parlament auszuschalten und auf der Grundlage von Notverordnungen zu regieren. Zur Verbreiterung seiner schmalen Führungsbasis führte Dollfuß Geheimverhandlungen mit den Nationalsozialisten. Zugleich versuchte er, sich Mussolini anzunähern. Als sich die Verhandlungen über die Beteiligung an der Regierung zerschlugen, gingen Österreichs Nationalsozialisten ab Mitte Mai 1933 zu offenem Terror über. Hitler übte mit einer von der notorischen deutschen Devisenknappheit inspirierten Boykottaktion gegen Österreichs Fremdenverkehr (»Tausendmarksperre«) zusätzlichen Druck aus. Am 19. Juni 1933 verhängte die Regierung Dollfuß ein Betätigungsverbot über die NSDAP. Österreichs wichtigste NS-Führer flüchteten nach Deutschland und steuerten von dort aus den mit allen Mitteln von Propaganda, Sabotage und Terror geführten Untergrundkampf gegen den Staat Österreich.
Der organisatorische Zusammenhalt der Nazibewegung in Österreich konnte gewahrt werden, indem die ehemaligen Parteimitglieder vordergründig unpolitischen oder sogar dem herrschenden Regime nahestehenden Organisationen beitraten und diese unterwanderten. Die bereits zuvor von Nationalsozialisten vereinnahmten Vereine des deutschnationalen Lagers wurden zu organisatorischen Plattformen für den illegalen Kampf umfunktioniert. Viele, zumeist junge, arbeitslose, unverheiratete Österreicher trieb eine tatsächliche oder auch nur vermeintliche Verfolgung wegen illegaler Betätigung zur Flucht ins Dritte Reich. Dort wurden sie im Regelfall in die »Österreichische Legion« gesteckt, eine feldmäßig gerüstete, an die zehntausend Mann starke SA-Formation, die im entscheidenden Moment als Bürgerkriegstruppe in Österreich eingreifen sollte.[12]
Die österreichische Regierung antwortete mit oft willkürlichen Verhaftungen und Abstrafungen, mit der Einrichtung von Anhaltelagern und einer ständigen Verschärfung des Strafmaßes für verbotene politische Betätigung. Angesichts des anhaltenden NS-Terrors setzte Kanzler Dollfuß nun stärker noch als vorher auf die Anlehnung an Italien. Mussolini nahm ab Mitte 1933 entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung in Österreich, die ganz in Richtung Diktatur verlief.
Nach dem blutig niedergeschlagenen sozialdemokratischen Aufstand vom 12. Februar 1934 konnte sich das Dollfuß-Regime zunehmend festigen. Die mächtige Sozialdemokratie war zerschlagen, die »Vaterländische Front«, eine künstlich geschaffene Einheitspartei, befand sich scheinbar erfolgreich im Aufbau, das faschistische Italien hielt seine schützende Hand über Österreich. Am 1. Mai 1934 ließ Dollfuß die neue autoritäre Verfassung verkünden. Die Gesellschaft sollte sich nach sozialharmonischen »Ständen« formieren. So nannte sich das betont katholische Gebilde denn auch »Christlicher Ständestaat«.[13]
Als »austrofaschistisch«, etwa im Sinn der Faschismusdefinition von Emilio Gentile,[14] kann man das Dollfuß-Schuschnigg-Regime allerdings nicht bezeichnen. Sowohl Dollfuß als auch Schuschnigg stützten sich in erster Linie auf den traditionellen Staatsapparat. Anleihen beim italienischen und deutschen Faschismus sind in der Literatur treffend als »Imitationsfaschismus« charakterisiert worden. Die als Einheitspartei im faschistischen Sinn gedachte Vaterländische Front etwa blieb stets ein Papiertiger ohne wirkliche Mobilisierungskraft. Der Ständestaat ist daher dem Typus des autoritären Regimes zuzurechnen und als »Kanzlerdiktatur« zu charakterisieren.[15]
Das NS-Regime befand sich in der ersten Jahreshälfte 1934 in einer überaus prekären Situation. Erstens war die wirtschaftliche Lage höchst problematisch. Der Mangel an Konsumgütern aller Art sorgte für lautstark geäußerte Unzufriedenheit in der deutschen Bevölkerung. Dazu kam zweitens die innenpolitische Krise um die Ansprüche der SA und ihres machtbewussten Stabschefs Ernst Röhm. Und drittens reagierte Frankreich auf Deutschlands neue außenpolitische Linie unter Hitler ab Frühjahr 1934 mit energischen Gegenmaßnahmen. Die französische »Einkreisungsoffensive« schien zur völligen Isolation Deutschlands zu führen. War in dieser Lage nicht ein Präventivkrieg zu erwarten, um die Aufrüstung zu stoppen und das Wiedererstarken Deutschlands zu verhindern? Genau das war es jedenfalls, was Hitler immer schon gefürchtet hatte. Noch dazu neigte sein Wunschverbündeter, Mussolini, im europäischen Mächtespiel immer stärker Frankreich zu. Grund dafür war die Auseinandersetzung um Österreich.
Mitte Juni 1934 fand in Venedig die erste persönliche Begegnung der beiden Diktatoren Mussolini und Hitler statt. Bei einer langen Aussprache unter vier Augen, geführt in deutscher Sprache, ging es in erster Linie um Österreich. Hitler gewann dabei – höchstwahrscheinlich aufgrund von sprachlichen Missverständnissen – den Eindruck, Mussolini hätte ihm einen »Regierungswechsel« in Österreich zugestanden. Folgerichtig erteilte er in der Woche nach dem Gipfeltreffen seinem Österreich-Beauftragten Theodor Habicht den Befehl zum Putsch in Österreich.
Wie sah Hitlers Plan aus? Dollfuß, immerhin ein persönlicher Freund Mussolinis, sollte »in Ehren kaltgestellt« werden, und der neue Kanzler Anton Rintelen, ein NS-affiner Christlichsozialer, sollte eine Regierung unter Beteiligung von Nationalsozialisten in Schlüsselpositionen bilden. An die Verwirklichung des Anschlusses dachte Hitler zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Vorläufig ging es ihm darum, die lästige Österreich-Frage beizulegen und Italien als Verbündeten zu gewinnen. Österreich sollte, ähnlich wie die Freie Stadt Danzig, als Satellitenstaat bis auf weiteres formal unabhängig bleiben.
Der Putsch am 25. Juli 1934 scheiterte kläglich. Zwar gelang der illegalen Wiener SS-Standarte 89 trotz eines Verrats die Besetzung des Bundeskanzleramtes. Dollfuß wurde bei seiner Festnahme durch einen unabsichtlich abgegebenen Schuss so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später starb. Wenige Stunden danach ergaben sich die Putschisten. Noch im Laufe des Abends marschierten mehrere italienische Divisionen an der Brennergrenze auf. Die Österreichische Legion, die zum Einfall in Österreich bereitstand, musste im letzten Moment zurückgepfiffen werden. In einigen Bundesländern brach trotzdem ein blutiger SA-Aufstand aus, der insgesamt rund 220 Todesopfer forderte.[16]
Neuer Bundeskanzler in Österreich wurde Unterrichtsminister Kurt Schuschnigg. Hitler verstand es geschickt, die Fronten in der Österreich-Frage in den Folgejahren ruhigzustellen. Als neuen Botschafter entsandte er den bisherigen Vizekanzler Franz von Papen nach Wien. Dieser – nationalkonservativ und katholisch, aber kein Nationalsozialist – agierte auf diesem Posten ganz im Sinne von Hitlers Befriedungskurs.
Als Mussolini im Oktober 1935 Abessinien (Äthiopien) angriff, geriet er in unerwartete Schwierigkeiten. Die vom Völkerbund verhängten Handelssanktionen führten dazu, dass er sich Schritt für Schritt Hitler zuwandte. Erstes Opfer dieser Annäherung wurde das außenpolitisch isolierte und ganz von Italien abhängige Österreich. Mussolini legte dem österreichischen Kanzler mehrmals dringend nahe, einen Modus Vivendi mit dem Deutschen Reich zu finden. So blieb Schuschnigg nichts anderes übrig, als sich auf geheime Ausgleichsverhandlungen mit Berlin einzulassen. Am 11. Juli 1936 wurde die völlig überraschte Öffentlichkeit über den Abschluss des »Normalisierungs- und Freundschaftsabkommens« informiert. Deutschland sagte in diesem als »Juliabkommen« bezeichneten Pakt die Aufhebung der Tausendmarksperre, die Anerkennung der österreichischen Souveränität und die Nichteinmischung in die österreichische Innenpolitik zu. Österreich erklärte im Gegenzug, sich in seiner Außenpolitik in Zukunft an Deutschland zu orientieren. Vom vertraulichen Zusatzabkommen erfuhr die Öffentlichkeit nichts. Es führte dazu, dass mehr oder weniger gut getarnte Voll- und Halb-Nazis in hohe staatliche Funktionen aufrücken und hier als »trojanische Pferde« Hitlers agieren konnten.[17]
Die österreichische NSDAP verhielt sich in der Folgezeit nach außen hin tatsächlich weitgehend ruhig. Anschläge und Terrorakte wie 1933/34 kamen praktisch nicht mehr vor. Die »Illegalen« ergingen sich stattdessen in Fraktions- und Flügelkämpfen. Grob gesagt, stand auf der einen Seite eine Gruppe rund um Hubert Klausner, Friedrich Rainer und Odilo Globocnik. (Alle drei stammten aus Kärnten, dem besonders stark nazifizierten südlichsten Bundesland Österreichs.) Diese »Kärntner Gruppe« galt als moderat, weil sie den Anschluss auf »evolutionärem« Weg anstrebte, durch schrittweise Infiltration des herrschenden Politsystems. Im NS-internen Machtgefüge war die Gruppe der SS zuzurechnen. Unterstützung im Deutschen Reich fand sie bei Größen wie Göring, Himmler und Heydrich. Die konkurrierende Clique formierte sich um den NSDAP-Landesleiter Josef Leopold. Dieser war einer der wenigen österreichischen Naziführer, die nach dem Parteiverbot von 1933 im Land verblieben waren. Er hatte dafür viele in Anhaltelagern und Gefängnissen verbrachte Monate in Kauf nehmen müssen. Leopolds Leuten, in der Regel der SA angehörend oder ihr nahestehend, wird eine weniger subtile, »revolutionäre« Taktik für die Machtergreifung in Österreich nachgesagt. Tatsächlich waren die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen unwesentlich. Beide verfolgten das Konzept einer allmählichen »friedlichen Durchdringung«. Umstritten war nur, wer diese Durchdringung durchführen sollte. Wie Leopold meinte, sollte die Initiative bei den österreichischen Nazis liegen, die Kärntner sahen die führende Rolle hingegen bei den Deutschen. Damit lagen sie Hitlers Vorstellung darüber, wie die ganze Sache ablaufen sollte, wesentlich näher.[18]
Als NS-Vertrauensmann trat der ehemalige Generalstabsoffizier Edmund Glaise-Horstenau in die Regierung Schuschnigg ein. Ein Nazi im eigentlichen Sinn war Glaise nicht, sosehr er auch von der »faszinierenden Persönlichkeit des Führers« angetan war. Er gehörte dem kleinen, aber gut vernetzten Zirkel der Katholisch-Nationalen an. Die Mitglieder dieser losen Gruppierung verstanden sich als »Brückenbauer«. Sie meinten, Nationalsozialismus und katholisches Glaubensbekenntnis seien bruchlos miteinander vereinbar. Und sie strebten einen Anschluss an, der auf die österreichische Eigenart und Tradition Rücksicht nehmen sollte. In den Jahren des Ständestaates kam den Katholisch-Nationalen eine wichtige Rolle zu. Zu beiden Seiten pflegten ihre wichtigsten Protagonisten gute Kontakte, beide Seiten sahen in ihnen akzeptable, brauchbare Vermittler. Glaise wurde vorerst Minister ohne Portefeuille. Im November 1936 übernahm er das Innenministerium.[19]
In seinem Windschatten brachte sich ein anderer Katholisch-Nationaler in Stellung: der aus Mähren stammende Rechtsanwalt Arthur Seyß-Inquart. Bereits Bundeskanzler Dollfuß hatte versucht, ihn in seine Regierung einzubinden. Auch Schuschnigg war nach dem Juliabkommen 1936 auf der Suche nach vertrauenswürdigen Vertretern des nationalen Lagers auf ihn gestoßen und hatte ihn in den Staatsrat berufen, ein Gremium von mittlerer Bedeutung. Seyß agierte taktisch geschickter als Glaise. Während jener hauptsächlich Kontakte zur Leopold-Gruppe unterhielt, stieg Seyß zum bevorzugten Ansprechpartner der Kärntner Gruppe auf.[20]
Im Juni 1937 entstand in der Vaterländischen Front ein »Volkspolitisches Referat« zur Integration bislang »abseits stehender nationaler Kreise«. Dieses Referat kann man als Domäne der Kärntner Gruppe bezeichnen. Schon vorher hatte es Bemühungen gegeben, einen »Deutsch-Sozialen Volksbund« zu gründen, im Grunde eine NSDAP-Neugründung unter anderem Namen. Daraus wurde wegen Schuschniggs Widerstand nichts. Was übrig blieb, war ein siebenköpfiges Komitee, bestehend aus Voll-Nazis, naziähnlichen Deutschnationalen und Faschisten. Dieser von Leopold beherrschte »Siebener-Ausschuss« residierte, misstrauisch beäugt vom Ständestaatsregime, in der Wiener Innenstadt.[21]
Im Juli 1936 brach der Spanische Bürgerkrieg aus. Deutschland und Italien engagierten sich gemeinsam auf der Seite Francos gegen die Demokratie. Die demokratische Führungsnation in Europa, England, war hingegen voll und ganz auf »Appeasement« gestimmt. Durch Nachgeben, Beschwichtigen und Deeskalieren wollte man Hitler-Deutschland bei durchaus berechtigt anmutenden Forderungen, die die Revision des Versailler Vertrages und das Selbstbestimmungsrecht der Völker betrafen, so weit entgegenkommen, dass der Ausbruch eines neuerlichen Krieges in Europa verhindert werden konnte. Frankreich versank innenpolitisch in Chaos und orientierte sich außenpolitisch voll an den Briten. Ohne deren Unterstützung waren die Franzosen zu keinem ernsthaften Schritt gegen Hitler bereit. Österreich, international isoliert, hing am Gängelband Mussolinis. Dieser, längst eng an Deutschland gebunden, gab dem NS-Regime bei jeder passenden Gelegenheit zu verstehen, dass ein Satellitendasein Österreichs ihn nicht stören würde, solange es nur formal unabhängig bliebe. Aber man wusste in Deutschland, dass Italien auch diese Rückzugsposition bald würde aufgeben müssen.
Der zweite Mann des Dritten Reichs, Hermann Göring, hatte im Oktober 1936 die Funktion eines »Beauftragten für den Vierjahresplan« übernommen, der die deutsche Wirtschaft in vier Jahren »kriegsfähig« machen sollte. Göring verschärfte die Gangart in der Österreich-Frage entscheidend. Hitlers langjähriger Wirtschaftsberater Wilhelm Keppler wurde zum Sonderbeauftragten für Österreich ernannt. Keineswegs zufällig, denn Keppler war ein enger Vertrauter Görings und Experte für Rohstoffbeschaffung im Rahmen des Vierjahresplans. Das deutlich gesteigerte Interesse an einer raschen Angliederung Österreichs war also in erster Linie strategischer und wirtschaftlicher Natur, weniger ideologisch bedingt. Österreich galt aus der Sicht des Deutschen Reichs als Brücke nach Südosten zur Schaffung einer deutschen Großraumwirtschaft in Mittel- und Südosteuropa. Und Österreich hatte vieles von dem zu bieten, woran es in Deutschland nach Jahren der bis zum Äußersten forcierten Aufrüstung bereits schmerzlich mangelte: Devisen, Rohstoffe (Eisenerz, Erdöl, Wasserkraft, Holz etc.), freie Arbeitskräfte und verfügbare Industriekapazitäten. Ein möglichst bald herbeigeführter Anschluss Österreichs sollte zu einer zumindest vorübergehenden Milderung der wirtschaftlichen Engpässe führen.[22]
Diese waren 1937 bereits beträchtlich. Der akute Stahlmangel brachte die Aufrüstung ins Stocken. Bei einer geheimen Besprechung am 5. November 1937 (»Hoßbach-Konferenz«) gab Hitler den Entscheidungsträgern des Heeres, der Marine, Luftwaffe und Diplomatie zu verstehen, dass der »Entschluss zu Anwendung von Gewalt unter Risiko« gefallen sei. Erstes Ziel sei es nun, »die Tschechei und gleichzeitig Österreich niederzuwerfen«. England und Frankreich, so spekulierte Hitler, hätten die Tschechoslowakei im Stillen ohnehin schon abgeschrieben und würden nicht eingreifen. In Bezug auf Österreich sah Hitler anscheinend nur in der Haltung Italiens ein gewisses, jedoch nicht allzu großes Problem. Auf die deutschen Rüstungsprobleme reagierte Hitler nach der Besprechung vorerst, indem er die deutsche Roheisenproduktion bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten trieb. Machten die beachtlichen Rohstoffvorkommen und Stahlindustrien Österreichs und der Tschechoslowakei eine baldige Eroberung dieser Länder nicht zusätzlich attraktiv?[23]
Tatsächlich verschärfte sich die innere und äußere Lage Österreichs ab Ende 1937 erkennbar. Ein von der Polizei Ende Januar 1938 bei einer Hausdurchsuchung in Wien aufgefundener Umsturzplan der österreichischen Nazis schreckte Bundeskanzler Schuschnigg gehörig auf. Botschafter Papen hatte ihm bereits vorher bei verschiedenen Gelegenheiten eine persönliche Aussprache mit Hitler vorgeschlagen. Nun drängte Schuschnigg selbst darauf, dieses Treffen möglichst bald stattfinden zu lassen.[24]
Vorläufig war Hitler allerdings ganz mit Affären um Kriegsminister Blomberg und den Oberbefehlshaber des Heeres Fritsch befasst. Er löste das Problem, indem er das Amt des Reichskriegsministers ersatzlos strich und sich selbst zum Oberbefehlshaber der gesamten Wehrmacht machte. Zahlreiche Generäle wurden in den Ruhestand geschickt und viele wichtige Führungspositionen neu besetzt. Das Auswärtige Amt übernahm der hundertprozentig hitlerhörige Joachim von Ribbentrop.[25]
Eines der Opfer des großen Revirements vom 4. Februar 1938 war der deutsche Botschafter in Wien, Franz von Papen. Ein kurzer Anruf aus Berlin hatte ihn von seiner Abberufung informiert. Am 5. Februar stand er in Berchtesgaden, um sich persönlich vom »Führer« zu verabschieden. Er fand Hitler zerstreut, fast erschöpft vor, erkennbar mitgenommen von der Aufregung der letzten Tage. Papen erinnerte ihn an das in Aussicht genommene Zusammentreffen mit Schuschnigg. Plötzlich war Hitler ganz Ohr: Das sei eine ausgezeichnete Idee. Er möge sogleich nach Wien zurückfahren und mit Schuschnigg für die nächsten Tage eine Zusammenkunft vereinbaren. Papen: Das sei wohl nicht möglich. Er habe schon in einer Note den Bundeskanzler von seiner Abberufung in Kenntnis gesetzt. Hitler: Das mache nichts. Er bitte ihn, die Geschäfte der Botschaft zu übernehmen, bis die Unterhaltung mit Schuschnigg zustande gekommen sei. So kam es, dass der abberufene Botschafter Papen zum Erstaunen seiner Mitarbeiter am 7. Februar wieder in Wien eintraf. Er setzte sich sogleich mit Bundeskanzler Schuschnigg in Verbindung.[26]
Im Tagebuch Alfred Jodls, Chef der Abteilung Landesverteidigung im Wehrmachtführungsamt, findet sich für den 31. Januar 1938 ein bemerkenswerter Eintrag. Es geht um das Hauptthema jener Tage, die Affäre Blomberg/Fritsch: »Führer will die Scheinwerfer von der Wehrmacht ablenken, Europa in Atem halten u. durch Neubesetzung verschiedener Stellen nicht den Eindruck eines Schwächemoments sondern einer Kraftkonzentration erwecken. Schußnig soll nicht Mut fassen sondern zittern.«[27]
Euphorie und Panik/1938
Berchtesgaden
Abends um zehn verließ der Zug mit dem Sonderwagen des Bundeskanzlers den Wiener Westbahnhof. Kurt Schuschnigg reiste mit kleinem Gefolge. Mit dabei waren neben dem Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten Guido Schmidt einige Beamte und Sekretäre. Schuschniggs Waggon wurde auf dem Salzburger Bahnhof abgekoppelt. Der Kanzler und seine Leute verbrachten die Nacht im unauffällig abgestellten Sonderwagen. Den Salzburger Behörden war die Anwesenheit des Kanzlers nicht mitgeteilt worden.
Samstag, der 12. Februar 1938, war ein grauer Wintertag. Es schneite. Die Temperatur in der Stadt Salzburg lag unter dem Gefrierpunkt. Gegen zehn Uhr bestiegen Schuschnigg, Schmidt und drei Begleiter das Dienstauto des Kanzlers. Etwas früher als Schuschnigg war Botschafter Papen am Vortag per Zug von Wien abgereist und hatte in einem Hotel in Berchtesgaden Logis genommen. Ungefähr um elf Uhr stand Papen beim Schlagbaum an der deutsch-österreichischen Grenze. Schuschnigg und Schmidt schienen ihm in aufgeräumter und zuversichtlicher Stimmung zu sein. Wie um ihnen einen ersten Dämpfer zu versetzen, erwähnte der Botschafter die Anwesenheit von drei Generälen der Wehrmacht auf dem Berghof. Der Kanzler werde wohl nichts dagegen haben? Schuschnigg mit Blick auf Schmidt: Nein, wie könne er? Auf der Weiterfahrt soll Schuschnigg dann zu Schmidt geäußert haben, dass an seiner Stelle eigentlich besser Wagner-Jauregg – der berühmte Psychiater – nach Berchtesgaden fahren solle. Er mochte Schlimmes geahnt haben.[1]
Die in Berchtesgaden auf den Obersalzberg abzweigende Straße war vereist. So verfrachtete man die Gäste in einen bereitgestellten Raupenschlepper. Unterwegs registrierte Schuschnigg ein Areal mit Kasernenbaracken, die Fenster dicht besetzt mit Neugierigen in SS-Uniformen. Hitler empfing die Gäste auf der Freitreppe vor dem Gebäude, freundlich und korrekt, wie Schuschnigg schreibt. In Hitlers Gefolge die erwähnten Generäle: Keitel, Reichenau, Sperrle. Ihre Anwesenheit war Teil von Hitlers psychologischer Kriegsführung. Sie seien, hatte Hitler den drei Generälen erklärt, nur für einen »optischen Zweck« gerufen worden. Er wolle den Österreichern allein durch ihre bloße Anwesenheit zu verstehen geben, dass notfalls auch Soldaten bereitstünden.[2]
Es folgte eine kurze formelle Vorstellungsrunde. Anschließend bat Hitler den österreichischen Kanzler zum Vieraugengespräch in sein Arbeitszimmer in den ersten Stock. In seinem 1946 erschienenen Buch »Ein Requiem in Rot-Weiß-Rot« druckte Schuschnigg die nun folgende Auseinandersetzung mit Hitler auszugsweise auf sechs Seiten wortwörtlich ab. Es handelt sich um ein häufig zitiertes Schlüsseldokument der österreichischen Geschichte. Man mag bezweifeln, dass der Bundeskanzler sich an jedes Wort und jeden Satz derart präzise erinnern konnte,[3] der extrem rüde Ton und Inhalt des Gesprächs ist gewiss authentisch wiedergegeben.
Man sei hier nicht zusammengekommen, um über die schöne Aussicht oder das Wetter zu reden, herrschte Hitler den um ein paar verbindliche Einleitungsfloskeln bemühten Schuschnigg gleich im ersten Satz an. Schuschnigg habe stets alles getan, um eine deutsche Politik zu vermeiden. Die gesamte österreichische Geschichte sei ein ununterbrochener Volksverrat, jede nationale Regung habe von Österreich aus stets nur Prügel zwischen die Füße geworfen bekommen. Er, Hitler, habe einen geschichtlichen Auftrag, und diesen werde er erfüllen. Die sogenannte österreichische Frage werde er lösen, so oder so. Schuschnigg werde doch nicht glauben, dass er ihn, Hitler, auch nur eine halbe Stunde aufhalten könne? Vielleicht werde er über Nacht in Wien sein, wie der Frühlingssturm! Keine Hilfe habe Schuschnigg zu erhoffen, nicht von Italien, nicht von England, nicht von Frankreich. Er, Hitler, sei trotzdem bereit, Schuschnigg eine letzte Chance einzuräumen. Man müsse eine Lösung finden, und zwar bis zum Nachmittag. Sonst sei es zu spät. Er bluffe nicht, er erreiche immer, was er wolle, vielleicht sei er dadurch zum größten Deutschen der Geschichte geworden. – Nach zwei Stunden drückte Hitler auf eine Klingel, die Türen öffneten sich, und man begab sich in den Speisesaal.[4]
Einstweilen hatten Reichsaußenminister Ribbentrop und Staatssekretär Schmidt unter Assistenz Papens im großen Salon mit dem berühmten versenkbaren Panoramafenster die Detailverhandlungen aufgenommen. Ribbentrop war erst seit einer Woche im Amt, von den österreichischen Angelegenheiten wusste er so gut wie nichts. Nach belanglosem Smalltalk legte er Schmidt ein vom Österreich-Sonderbeauftragten Keppler zusammengestelltes Manuskript vor. Es war in anmaßendem Ton abgefasst und glich einem Ultimatum.[5] Der Führer habe diese Punkte gebilligt und werde auf ihrer Annahme unbedingt bestehen. In des Staatssekretärs Zügen habe sich beim Überfliegen des Papiers das »lebhafteste Erstaunen« abgezeichnet, erinnerte sich Papen. Daran anschließend entwickelte sich eine schwierige und unergiebige Diskussion.[6]
Bei Tisch spielte Hitler den höflichen Gastgeber. Schuschnigg saß ihm gegenüber. Die Konversation drehte sich um mehr oder minder belanglose Themen. Der Exil-Österreicher Reinhard Spitzy, Adjutant des Reichsaußenministers Ribbentrop, beobachtete den österreichischen Kanzler aufmerksam. Schuschnigg sei bleich und nachdenklich aus Hitlers Zimmer gekommen, habe an des Führers Tafel stumm vor sich hin gebrütet und sich am Gespräch kaum beteiligt. Beim Kaffee im Wintergarten forderte Hitler die anwesenden Generäle auf, aus ihrem Wirkungsbereich zu berichten. Anschließend zog er sich zurück. Seine Gäste ließ er volle zwei Stunden in einer Art Vorraum warten. Immerhin hatte der Kettenraucher Schuschnigg endlich Gelegenheit zu rauchen. Und er konnte sich mit seinem Staatssekretär abstimmen. Ansonsten plauderte man bei Cocktails und Zigaretten mit Reichspressechef Otto Dietrich und den drei Generälen.[7]
Gegen vier Uhr nachmittags wurden Schuschnigg und Schmidt zu Detailverhandlungen mit Ribbentrop und Papen gerufen. Als Grundlage diente das vorher schon Schmidt präsentierte Keppler-Papier. Ribbentrop: Der Entwurf müsse als Ganzes angenommen werden. Schuschnigg und Schmidt: Man sei bestürzt, mit Herrn von Papen sei anlässlich der Überbringung der Einladung auf den Obersalzberg ganz anderes vereinbart worden. Papen: Er sei selbst völlig überrascht.[8]
Tatsächlich hatte Papen dem österreichischen Kanzler bei der Überbringung der Einladung Hitlers erklärt, es gehe um eine Vertiefung und Bekräftigung des deutsch-österreichischen Abkommens von 1936. Eine Verschlechterung der österreichischen Lage werde sich durch das Treffen bestimmt nicht ergeben.[9] Nun aber forderten die Deutschen ultimativ die Einsetzung des NS-Vertrauensmannes Seyß-Inquart als Innen- und Sicherheitsminister sowie der NS-Vertrauensmänner Glaise-Horstenau und Fischböck als Heeresminister und Finanzminister. Eine allgemeine Amnestie für inhaftierte Nationalsozialisten müsse erlassen, Maßregelungen und wirtschaftliche Diskriminierungen müssten zurückgenommen, ein Offiziersaustausch vereinbart, außenpolitische Fragen abgestimmt und zwei missliebige Elemente im österreichischen Presse- und Propagandawesen entlassen werden. Zudem müsse die österreichische Regierung anerkennen, dass der Nationalsozialismus mit den »Gegebenheiten Österreichs« und dem Bekenntnis zur Vaterländischen Front vereinbar sei.[10]
In einigen Punkten konnten Schuschnigg und Schmidt Korrekturen erreichen: kein nationalsozialistischer Finanzminister, kein nationalsozialistischer Heeresminister, stattdessen Rücktritt des strikt antinationalsozialistischen Generalstabschefs Jansa. Und: Die Amnestie sollte durchgeführt werden, den Nationalsozialisten sollte die Möglichkeit zur legalen Betätigung im Rahmen der Vaterländischen Front geboten werden, und Seyß-Inquart hatte das Sicherheitswesen zu bekommen.[11] Letzteres war der gefährlichste Punkt. Es war die altbewährte Nazi-Strategie aus den Tagen der Machtergreifung 1933.
Zwischendurch ging Ribbentrop immer wieder zu Hitler, um strittige Punkte mit ihm zu besprechen. Schließlich verkündete er ihm, dass man sich so weit einig sei. Aber Schuschnigg weigere sich, Seyß-Inquart zum Sicherheitsminister zu machen. Hitler: »Sagen Sie Schuschnigg, wenn er diese Forderung nicht akzeptiert, so marschiere ich noch in dieser Stunde.« Dieses Argument überzeugte, Schuschnigg lenkte ein.
Beim folgenden Vieraugengespräch zog Hitler alle Register. Schuschnigg habe das Protokoll zu unterschreiben. Wenn nicht, werde er im Laufe der Nacht seine Entschlüsse zu fassen haben. Schuschnigg: Es bleibe ihm nach der gegebenen Sachlage nichts anderes übrig. Er sei zur Unterschrift bereit. Aber nach der österreichischen Verfassung ernenne der Bundespräsident die Regierungsmitglieder. Deshalb könne er die Einhaltung der Punkte nicht garantieren. Daher forderte er drei Tage Bedenkzeit. Hitler stürzte zur Tür, brüllte nach General Keitel, bedeutete Schuschnigg, sich zu entfernen. Keitel, eben noch im Gespräch mit Schmidt, ließ diesen brüsk stehen und eilte zu seinem »Führer«. Papen berichtet, Hitler habe von Keitel gar nichts gewollt, sondern das ganze Theater nur inszeniert, um die Österreicher in Schrecken zu versetzen. Der geschockte Schmidt rechnete nun jedenfalls mit dem Schlimmsten. Nach der Theaterszene mit Keitel wurde Schuschnigg wiederum zu Hitler beschieden. Der »Führer« gab sich großzügig: Zum ersten Mal in seinem Leben werde er von einem einmal gefassten Entschluss abgehen. Innerhalb von drei Tagen erwarte er die Durchführung der Vereinbarung![12]
Während die Reinschriften des Abkommens in die Maschine getippt worden seien, habe sich Hitler allmählich beruhigt, schreibt Schuschnigg. Die Konversation sei in »gebräuchlicheren Formen« verlaufen. Hitler: Mit dem Abkommen sei die Frage Österreich für die nächsten fünf Jahre bereinigt, und danach sehe die Welt ohnehin anders aus. Schuschnigg: Ob der Herr Reichskanzler an eine friedliche Entwicklung in der Welt glaube? Hitler: Wenn man ihm folgen würde, wäre Friede möglich. Aber er wisse nicht, ob ein neuer Weltkrieg zu vermeiden sei, wenn man ihm nicht glaube. Die deutsche Wehrmacht sei in vielen Bereichen heute führend in der Welt, und es wäre vor der deutschen Geschichte nicht vertretbar, ein solches Instrument nicht zu benützen.
Spätabends unterschrieben Hitler, Ribbentrop, Schuschnigg und Schmidt das Protokoll der Besprechung. Die Gäste verabschiedeten sich rasch. Im Raupenschlepper ging es talwärts, per Automobil durch die Nacht heim Richtung Salzburg. Botschafter Papen, ebenfalls mit an Bord, unterbrach irgendwann die im Fond lastende Stille: »Ja, so kann der Führer sein; nun haben Sie es selbst erlebt. Aber, wenn Sie das nächste Mal kommen, werden Sie sich sehr viel leichter sprechen. Der Führer kann ausgesprochen charmant sein« (Version Schuschnigg). Oder aber: »Da haben Sie nun selbst einmal die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, mit diesem unbeherrschten Manne zu verhandeln. Ich sagte Ihnen ja immer, es sei fünf Minuten vor zwölf« (Version Papen).[13]
Die in Salzburg zurückgebliebenen Kanzlerbegleiter hatten ihr Hauptquartier am Sitz der Landesregierung im Chiemseehof aufgeschlagen. Im Laufe des Tages war die Spannung bis ins beinahe Unerträgliche gestiegen. Wo blieben Kanzler und Staatssekretär so lange? Als den ganzen Nachmittag über nichts geschah und es zu dämmern begann, griff eine gewisse Panikstimmung um sich. War Hitler bis zum Äußersten gegangen und hatte die beiden festnehmen lassen? Schuschniggs Sekretär Frölichsthal war beauftragt, um 18 Uhr die Salzburger Bundesheer-Garnison zu alarmieren, sollte bis dahin keine Nachricht aus Berchtesgaden eingetroffen sein. Mit der Uhr in der Hand und dem unruhig auf und ab gehenden Salzburger Bundesheer-Kommandanten im Zimmer wartete Frölichsthal auf ein Lebenszeichen vom Berghof. In letzter Minute ließ Schuschnigg anrufen. Es werde noch verhandelt.
Um 22.45 Uhr trafen Kanzler und Staatssekretär in Salzburg ein. Noch neun Jahre später erinnerte sich der Gesandte Hoffinger lebhaft daran: »Beide befanden sich in einer derart vernichteten Stimmung, wie ich kaum sonst jemanden je gesehen habe.« Schuschnigg und Schmidt zogen sich sofort zum Essen mit Landeshauptmann Rehrl zurück. Was sie diesem berichteten, muss ihn zutiefst geschockt haben. »Entsetzlich! Entsetzlich!«, flüsterte Rehrl Hoffinger anschließend im Vorbeigehen zu. Gegen zwei Uhr nachts nahmen Schuschnigg und seine Begleiter einen Sonderzug nach Wien.[14]
Weltfremd, lehrerhaft, steif, verschlossen, ohne Charisma, so wurde Schuschnigg häufig charakterisiert. Einem Hitler war er jedenfalls nicht gewachsen. Für sein Verhalten oder – wie viele meinten – Versagen in Berchtesgaden ist er oft kritisiert worden. Aber wie hätte sich der Regierungschef eines Kleinstaats ohne jede internationale Rückendeckung angesichts der beinahe schon physisch zu nennenden Bedrohung durch den skrupellosen, unumschränkten Herrscher des Deutschen Reichs verhalten sollen?[15] Schuschnigg spielte auf Zeit. Er hoffte auf eine grundlegende Änderung der europäischen Großwetterlage. Eine Illusion. »Was hat Hitler Schuschnigg gegeben? Die Verlängerung des Führerscheins um ein paar Wochen!«, so fasste ein in den Tagen nach Berchtesgaden in Wien kursierendes Bonmot die Lage zusammen.[16]
Was versprach sich Hitler von der Berchtesgadener Erpressung? Das von Schuschnigg unterzeichnete Protokoll sei so weitgehend, dass die Österreich-Frage bei voller Durchführung »automatisch« gelöst werde, legte er Ende Februar österreichischen Parteiführern dar. Eine gewaltsame Lösung solle, wenn irgend möglich, vermieden werden.[17] Hitler rechnete also, womit er im Laufe seiner politischen Karriere zu rechnen gelernt hatte: dass seine Anhänger ihm »entgegenarbeiten« würden. Mit diesem Zitat aus der Rede eines NS-Funktionärs charakterisierte der Historiker Ian Kershaw eine grundlegende Funktionsweise des Dritten Reichs: »Hitlers personalisierte Herrschaftsform ermutigte seine Anhänger zu radikalen Initiativen von unten und bot solchen Initiativen Rückendeckung, solange sie mit seinen grob definierten Zielen auf einer Linie lagen.«[18] Hitler war zuversichtlich, dass das Abkommen eine für das ständestaatliche Regime nicht mehr zu beherrschende Eigendynamik auslösen würde. Dass sich – so oder so – in absehbarer Zeit eine Situation ergäbe, die ihn gleichsam »automatisch« zum Eingreifen veranlassen würde.[19]
Doppelherrschaft
Die Tage nach Schuschniggs Rückkehr vom Obersalzberg vergingen mit hektischen Beratungen hinter verschlossenen Türen. Bundespräsident Miklas wehrte sich vorerst entschieden dagegen, Seyß-Inquart das Sicherheitsministerium zu überlassen: »Jedes andere Ressort, aber nicht die staatliche Exekutive!« Als Schuschnigg daraufhin seinen Rücktritt in den Raum stellte, blieb Miklas nichts anderes übrig, als auch diese Bedingung des Abkommens zu akzeptieren.[1]
In Berlin blickte man ungeduldig nach Wien. »Großes Rätselraten um Österreich«, notierte Goebbels. »Wir erwarten die Beschlüsse bis abends.«[2] Tatsächlich, am Abend des 15. Februar – exakt bei Ablauf der Schuschnigg eingeräumten Frist – wurden auf reichsdeutschen und österreichischen Sendern gleichlautende amtliche Verlautbarungen verlesen. Inhalt: floskelhaft und nichtssagend. Bis auf die kryptische Ankündigung der »sofortigen Durchführungen von Maßnahmen« freilich.[3]
An diesem Abend fand in Berlin ein Diplomatenempfang statt. (Goebbels: »Sehr langweilig.«) Als gegen 22 Uhr die Meldung eintraf, Schuschnigg habe die deutschen Forderungen angenommen, stieg die Stimmung. Hitler war höchst erfreut. Er ließ den österreichischen Gesandten Tauschitz zu sich rufen: Er sei glücklich, dass die Besprechung zum »beiderseits gewünschten Ergebnis« geführt habe. Die Zeit der Missverständnisse sei damit vorbei, niemand könne mehr auf deutsche Zwietracht bauen. »Besonders warm« drückte Göring die Hand des Gesandten: Nun beginne eine neue Epoche der deutschen Geschichte. Und Goebbels kam lachend auf Tauschitz zu: Beide Seiten könnten sich beglückwünschen. »Es gibt kein gegenseitiges Schießen mehr, alles muss im Keim erstickt werden!«[4]
Den Morgenblättern des 16. Februar war die Ministerliste der neuen Regierung Schuschnigg zu entnehmen. Der Mann der Stunde hieß Arthur Seyß-Inquart, nunmehr Minister für Inneres und Sicherheitswesen. Laut späteren Eigenangaben war er zu diesem Zeitpunkt weder offen noch insgeheim Parteimitglied der NSDAP. Aber den Kennern der österreichischen Szene galt der deutschnational-katholische Rechtsanwalt schlichtweg als Krypto-Nazi. Der bisherige Verbindungsmann der Nationalsozialisten in der österreichischen Regierung Edmund Glaise-Horstenau dürfte sich in Hitlers Augen nicht bewährt haben. (Dessen Urteil: »Weihnachtsmann!«[5]) Da Glaise der Gruppe um NS-Landesleiter Leopold zuneigte, deren Niederlage gegen die Kärntner Gruppe im parteiinternen Machtkampf faktisch bereits besiegelt war, wurde er nun auf ein Nebengleis abgeschoben. Immerhin blieb er als Minister ohne Portefeuille im Kabinett. Der Wiener Polizeipräsident Michael Skubl sollte als Staatssekretär für Sicherheitswesen die Rolle eines Gegengewichts zu Sicherheitsminister Seyß-Inquart spielen.[6]
Das Kabinett Schuschnigg V trat nur zweimal zusammen. Am 16. Februar beschloss man die in Berchtesgaden vereinbarte Amnestie für politische Straftäter und die Rücknahme von diversen Maßregelungen wegen politischer Delikte. Am 21. Februar erledigte man die üblichen Regierungsgeschäfte.[7]
Der erste Weg des neuen Ministers führte zu Hitler. Einige Stunden nach der Regierungssitzung bestieg Seyß-Inquart am Wiener Westbahnhof den Zug nach Berlin. Der Sonderbeauftragte für Österreich Keppler nahm ihn dort am Morgen des 17. Februar in Empfang. Zuerst ging es zu Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Ihr unbedeutender Austausch war bald vorbei. Seyß-Inquart vermutete, Himmler habe ihn einfach einmal persönlich sehen wollen. Dann Hitler. Zwei Stunden und zehn Minuten dauerte das Vieraugengespräch der beiden. Seyß-Inquart will Hitler gegenüber ausgeführt haben, dass er als österreichischer Minister der österreichischen Staatsführung verpflichtet sei, dass die Tätigkeit der vom Reich aus gesteuerten illegalen Nazis in Österreich verderblich gewesen wäre, dass er als gläubiger Katholik einen »Kulturkampf« nicht mittragen werde, dass für sein Land die »Totalität« nicht in Frage komme, dass er in seiner Funktion notfalls auch Nationalsozialisten einsperren müsse und dass er sich im Übrigen nicht dazu hergeben wolle, als »Trojanisches Pferd« zu dienen. Die einzige Information über das Gespräch und seinen Inhalt haben wir aus einer Denkschrift Seyß-Inquarts und seinen Aussagen im Nürnberger Prozess. Man kann das glauben oder nicht. Jedenfalls war Hitler nicht unzufrieden mit seinem neuen Gefolgsmann. Goebbels: »Führer hält Seiß-Inquart [sic] für einen braven, anständigen Deutschen. Aber er ist kein Nazi in unserem Sinne.«[8]
Sein dringlichster Wunsch sollte Seyß-Inquart ein paar Tage später erfüllt werden. Hitler ließ den lästigen österreichischen NS-Landesleiter Josef Leopold nach Berlin zitieren, stauchte ihn nach Strich und Faden zusammen – wie Keppler, der Leopold liebend gern loswurde, genüsslich in einer Aktennotiz beschreibt –, setzte ihn ab und ernannte an seiner Stelle die Galionsfigur der »Kärntner Gruppe« Hubert Klausner zum neuen Landesleiter.[9]
Die Wahrheit über Berchtesgaden war dem österreichischen Publikum im Laufe einer Woche in kleinen Dosen verabreicht worden. Österreich eng an die Kandare Berlins genommen, ein Krypto-Nazi als Polizeiminister, Freilassung aller Nazi-Täter, legale Betätigung der Nazis – dieses Ergebnis war schlichtweg katastrophal. Schuschnigg ging es in dieser kritischen Situation vor allem um eines: um jeden Preis Optimismus markieren, um jeden Preis Panik verhindern.[10]
Er hatte damit nur mäßigen Erfolg. Der Kaffeehausliterat Anton Kuh soll in der letzten seiner publikumswirksamen Stegreifreden in Wien Ende Februar 1938 die rhetorische Frage »Sind die Juden intelligent?« gestellt und gleich selbst beantwortet haben: »Wenn ja, rettet euch! Es ist höchste Zeit!«[11] Kuh selbst pendelte von Anfang Februar bis Mitte März 1938 ruhelos zwischen Wien und Prag hin und her. Die propagierte Selbstrettung gelang ihm erst in letzter Minute.[12] Albert Drach aus Mödling bei Wien, Rechtsanwalt jüdischer Herkunft, hatte in den Tagen nach Berchtesgaden Briefpapier für seine Kanzlei bestellt. Der Druckereiagent, der bei ihm erschien, fragte ihn besorgt, ob er wirklich noch glaube, die bestellte Quantität zu benötigen. »Einige seiner ›Artgenossen‹ hätten die Nachbestellung verweigert, der vielleicht Eingeweihteste von ihnen sei mit all dem, was er schnell noch habe versilbern können, in die Schweiz gereist.«[13]
Joseph Buttinger war Führer der Revolutionären Sozialisten, der illegalen Nachfolgeorganisation der Sozialdemokratischen Partei in Österreich. Mitte Februar hielt er sich unter Decknamen in Paris auf. Knapp vor seiner Rückreise nach Wien erfuhr er von der neuen Ministerliste mit dem Sicherheitsressort für Seyß-Inquart. »Nun ist es aus«, sagte er zu seiner Freundin Muriel, »wir werden bald wieder in Paris sein, aber nach Wien kehren wir dann nicht mehr zurück.« Buttinger begann gleich nach seiner Ankunft in Wien damit, seine Genossen auf eine neue Phase der Illegalität einzuschwören. »Der Amtsantritt des Seyß-Inquart ist die Geburtsstunde der österreichischen Gestapo«, schrieb er im Informationsdienst seiner Bewegung. Mit Österreichs Selbständigkeit werde auch die bisherige Organisation der Revolutionären Sozialisten untergehen. Ihre Mitglieder sollten nun sich selbst so gut als möglich vor der Vernichtung bewahren.[14]
Eine interessante Quelle ist Eugen Lennhoff, Herausgeber des auflagenstarken Telegraf, eines Boulevardblattes von strikt antinazistischer Tendenz.[15] In einem 1938 in New York und London erschienenen Buch beschreibt er die dramatischen Februar- und Märztage in Wien. Die amerikanische Gesandtschaft sei nach Veröffentlichung der neuen Ministerliste am 16. Februar regelrecht belagert worden, hauptsächlich von Juden. Deren dringlicher Wunsch: ein Einreisevisum in die USA. Am 17. Februar seien nicht weniger als fünf gute Bekannte bei ihm vorbeigekommen, um sich zu verabschieden. Sie seien auf dem Weg in die Emigration gewesen. Er persönlich, Lennhoff, habe in jenen Tagen zwischen extremem Pessimismus und wildem Optimismus geschwankt, zwischen Kälte und Hitze, wie bei einer starken fiebrigen Erkältung. Theater, Restaurants und Cafés, schreibt er, seien leer gewesen, die Bridgeclubs ausgestorben. Mietverträge seien gekündigt worden. Friseure, Fleischhauer, Konditoren hätten Umsatzeinbrüche beklagt. Denn die Leute hätten gespart. Für die Flucht.[16]
In jüdischen Kreisen sei man überzeugt, heißt es in einem nationalsozialistischen Lagebericht, dass Österreich in absehbarer Zeit politisch und wirtschaftlich mit dem Deutschen Reich vereinigt werde. Am 17. Februar habe eine starke Kapitalflucht eingesetzt, Schillingnoten würden in großer Menge schwarz über die Grenze gebracht, österreichische Anleihewerte in der Schweiz, in London und im übrigen Ausland stark sinken. Eine für das Deutsche Reich zunächst nicht ungünstige Entwicklung, die man aber sehr genau beobachten müsse. Die Aushöhlung der österreichischen Währung und Wirtschaft dürfe nicht zu weit gehen. Das heißt: Wirtschaftliches Chaos war erwünscht, um so Schuschnigg zu schwächen. Aber dieses Chaos sollte ein gewisses Maß nicht überschreiten, denn das österreichische Wirtschaftspotential musste erhalten bleiben. Schließlich sollte es in absehbarer Zeit für das Deutsche Reich nutzbar gemacht werden.[17]
Optimistisch gaben sich die illegalen Nationalsozialisten: »Österreichs Bevölkerung ist wieder voll Hoffnung, und das Vertrauen in Hitler ist grenzenlos«, notierte Richard Ruffingshofer in sein Tagebuch. Der dreiunddreißigjährige Jurist aus Klosterneuburg bei Wien, Beamter des Postsparkassenamtes, befand sich dieser Tage in Hochstimmung.[18]
Am 20. Februar, einem strahlend schönen Spätwinter-Sonntag, hielt Hitler eine weltweit beachtete Rede vor dem Deutschen Reichstag. Geschlagene drei Stunden. Magere fünf Minuten waren Österreich gewidmet. Wie am Berghof versprochen, äußerte er sich positiv über das Berchtesgadener Abkommen, sprach Kanzler Schuschnigg seinen »aufrichtigen Dank« aus und lobte dessen »warmherzige Bereitwilligkeit« zur Verständigung. (Was sich für Schuschnigg nur zynisch angehört haben kann.) Zuvor hatte Hitler dunkle Drohungen ausgestoßen: Zehn Millionen Deutsche seien durch die Friedensverträge von 1919 gegen ihren Willen an einer Vereinigung mit dem Deutschen Reich gehindert worden. »Es ist auf die Dauer für eine Weltmacht von Selbstbewusstsein unerträglich, an ihrer Seite Volksgenossen zu wissen, denen aus ihrer Sympathie oder Verbundenheit mit dem Gesamtvolk, seinem Schicksal und seiner Weltauffassung fortgesetzt schwerstes Leid zugefügt wird.«[19]
Erstmals wurde eine Rede Hitlers vom österreichischen Rundfunk übertragen. In voller Länge. Sie sei ein »Meisterwerk« gewesen, fand Richard Ruffingshofer. An einigen Stellen habe er geradezu »Herzklopfen« bekommen. Über Österreich habe Hitler nicht viel gesagt, er werde schon wissen, warum. »Besser gehandelt als geredet.« Anschließend fuhr er mit seiner Freundin Elfi nach Wien. Ein bekanntes nationales Lokal in der Innenstadt war so voll, dass man nicht hineinkam. So ließen die beiden »den Adolf« in einer anderen Gaststätte hochleben.[20]
Hitlers Rede markiert den Beginn einer Periode von drei Wochen, die man treffend als »Doppelherrschaft« charakterisiert hat.[21] Die österreichischen Nationalsozialisten traten ab nun massiv öffentlich in Erscheinung. Und ließen sich durch nichts und niemanden davon abhalten. Im ganzen Land, urteilte Joseph Buttinger, hätten sich nun die Nationalsozialisten auch ohne einheitliche organisatorische Weisungen in Bewegung gesetzt. »Sobald sie sich bewegten, handelten sie notwendigerweise im Sinne ihrer Führung. Sie brauchten nur zuzuschlagen, um mit Gewissheit zu treffen.«[22]
Tatsächlich setzten sich die Nazis in Bewegung. Nach Beendigung der Rede formierten sich in Wien lange Kolonnen, die aus allen Richtungen zur Ringstraße zogen. 10000 bis 12000 Kundgebungsteilnehmer sollen es gewesen sein. Es heißt, sie hätten gleichermaßen »Heil Hitler!« und »Heil Schuschnigg!« gerufen. Auf dem Platz vor der Votivkirche – der übrigens Dollfußplatz hieß – fand die Abschlussveranstaltung statt. Dergleichen hatte Wien seit 1933 nicht mehr erlebt. »Eine Wolke der Depression«, so Eugen Lennhoff, »hing über uns.«[23]
In Graz ging es den ganzen Tag rund: Sprechchöre, Heilgeschrei, Nazilieder, Hakenkreuze allenthalben. Ab 13 Uhr lauschten Tausende auf dem weitläufigen Hauptplatz der Hitlerrede. Danach bis spät in den Abend in der schon vorher geübten Manier: Umzüge, Heilgeschrei, Sprechchöre. Für die Straßenbahn gab es zeitweilig kein Durchkommen mehr. Viele Orte der Steiermark erlebten ähnlich begeisterte Kundgebungen.[24] In Linz waren viele Häuser aus Anlass der Hitlerrede beflaggt worden, auch die öffentlichen Gebäude. Am Abend flammten rings um die Stadt und überall im Land Oberösterreich Höhenfeuer auf, »Freudenkundgebungen« fanden statt. Ähnliche Meldungen aus Innsbruck, wo ein Fackelzug mit viertausend Teilnehmern unter »Sieg Heil!«, »Heil Hitler!« und »Heil Schuschnigg!« und den üblichen treudeutschen Gesangsdarbietungen durch die Altstadt und die Maria-Theresien-Straße zog. Fackelzüge auch in Villach und Spittal an der Drau, ein Demonstrationsbummel in Klagenfurt wurde von anscheinend unnötig vorsichtigen NS-Vertrauensleuten aufgelöst. In Salzburg marschierten abends junge Nationalsozialisten durch die Stadt. Sie führten ein Spruchband mit sich: »Österreich ist erwacht!«[25]
Auf den Druck der Straße reagierte das Regime mit einem Verbot aller öffentlichen Versammlungen. Mit Ausnahme von Veranstaltungen der Vaterländischen Front und ihrer Unterorganisationen allerdings. Zu diesen zählten auch die nationalsozialistischen Volkspolitischen Referate. Folgerichtig blieb das Verbot völlig wirkungslos. Die Referatsleiter riefen in den nächsten Tagen keck im Namen der Vaterländischen Front zu nationalsozialistischen Kundgebungen auf. Oder man ignorierte das Verbot einfach. Ernstzunehmende Gegenmaßnahmen der staatlichen Exekutive waren ohnehin auszuschließen. Die Leiter der Volkspolitischen Referate in den Bundesländern – laut Seyß-Inquart zum Teil »recht geschickte« Leute – sollten in den kommenden Wochen der Doppelherrschaft zu den wahren Treibern des Anschlusses von innen werden.[26]
Schuschniggs Antwort auf Hitlers programmatische Rede war – eine programmatische Rede. Zeitpunkt: 24. Februar, 19 Uhr. Ort: der große Sitzungssaal des Parlaments am Dr.-Ignaz-Seipel-Ring, nunmehr »Haus der Bundesgesetzgebung« genannt. Formal gab er seine Erklärung vor dem sogenannten Bundestag ab, dessen Funktion es an sich war, die von der Ständestaatsregierung autoritär gefassten Gesetzesbeschlüsse abzusegnen.
Nichts war von der Vaterländischen Front dem Zufall überlassen worden. Auf zentralen Plätzen in Wien und im ganzen Land, in Versammlungslokalen, Kinos, Privattheatern und Gaststätten fanden allgemein zugängliche Rundfunkübertragungen statt. Die Bundestheater blieben geschlossen, öffentliche Angestellte hatten früher Büroschluss, die Sperrzeit der Geschäfte war per amtlicher Verordnung vorverlegt worden, Hausbesitzer hatten die dringliche Aufforderung erhalten, als Bekenntnis ihrer patriotischen Gesinnung ihre Häuser zu beflaggen. Lange vor 18 Uhr war die Ringstraße ein »wogendes Menschenmeer«, wie es in der ansonsten eher prosaischen Wiener Zeitung heißt. Aus allen Richtungen marschierten ständestaatliche Formationen, vaterländische Jugendgruppen, Musikkapellen, ganze Belegschaften öffentlicher Betriebe, großer Firmen und Fabriken mit Wimpeln und Fahnen Richtung Parlament. Dort nahmen sie Aufstellung, um die Lautsprecherübertragung zu hören.[27]
Als Redner erlebte Schuschnigg an diesem Tag seinen größten Moment. Der trockene Schulmeister zeigte sich – zur Überraschung aller – temperamentvoll und kampfbereit. Drei Sequenzen der Rede sind ins historische Langzeitgedächtnis eingegangen: An das Ende seiner Ausführungen zum Abkommen von Berchtesgaden stellte Schuschnigg die in der gegebenen Situation durchaus mutige Parole »Bis hierher und nicht weiter!«. Betrachtungen zur gesamteuropäischen Lage und zu den Friedensverträgen von 1919 schloss er mit dem Satz: »Maßgeblich bleibt der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss.« Abschließend beschwor Schuschnigg den Herrgott, der freilich nur jenen helfe, die zum Einsatz aller Kräfte entschlossen seien. »Und weil wir entschlossen sind, darum steht der Sieg außer Zweifel. Darum, Kameraden, bis in den Tod Rot-Weiß-Rot!« Dazu schwang er den rechten Arm wild im Takt seiner Worte, die im frenetischen Beifall der von den Sitzen aufspringenden Zuhörer untergingen.[28]
Über seinen Schatten war Kanzler Schuschnigg in der Rede wahrlich nicht gesprungen. Unbeirrbar hielt er an dem seltsam unverständlichen Konstrukt der deutschtümelnden Österreich-Ideologie fest. Und er war selbst angesichts der bedrohlichen Lage nicht dazu bereit, der in die Illegalität gedrängten sozialdemokratischen Arbeiterbewegung ein akzeptables Angebot für einen Schulterschluss gegen Hitler zu machen. Außer ein paar wohlfeilen Phrasen von sozialer Harmonie und Zusammengehörigkeit hatte er nichts zu bieten, ernsthafte Zugeständnisse schloss er kategorisch aus.[29] Im Grunde unbelehrbar, als hätte er noch eine Wahl gehabt. Es ging Schuschnigg in der Rede in erster Linie um die Mobilisierung der eigenen, allzu schmalen Basis. Aber die Rede gab den Bedrohten im Land neue Hoffnung, neue Zuversicht.[30] In ihrer verzweifelten Lage klammerten sie sich an einen Strohhalm. Man wollte mit aller Kraft daran glauben, dass Österreich Österreich bleiben würde, weil man das Ungeheuerliche nicht zu denken wagte: Österreich in Hitlers Händen.
Wie die Dinge wirklich standen, zeigte sich in den Straßen Wiens. Der junge Journalist Robert Breuer sollte seiner Zeitung ein »Stimmungsbild« übermitteln und war daher den ganzen Tag in der Innenstadt unterwegs. Alles habe seit Tagen auf die Schuschnigg-Rede gewartet, schreibt er, »alles vibrierte in ungeheurer Erregung«. Knapp vor 19 Uhr waren die Straßen leergefegt, ausgenommen die Plätze mit öffentlichen Übertragungen. Breuer stand inmitten einer Menge von ungefähr fünfzig Personen vor einem Radioladen am Stephansplatz. Ältere hörten Schuschnigg schweigend zu, hin und wieder zustimmend mit dem Kopf nickend, Jüngere lachten bei signifikanten Passagen demonstrativ höhnisch auf. Kleine Trupps von Burschen in Lederhosen und weißen Stutzen und Mädchen mit langen Zöpfen zogen vorüber, »Heil Hitler!« schreiend. Passanten antworteten mit »Hoch Schuschnigg!«. Im Laufe der Rede wurden die Marschkolonnen zusehends länger. Es ging durch die Kärntner Straße zum »Deutschen Verkehrsbüro« bei der Oper, das mit seinem riesigen Hitlerbild im Schaufenster schon seit längerer Zeit ein Zentrum der Nazi-Aktivitäten war. Als Schuschnigg mit »Bis in den Tod Rot-Weiß-Rot!« geendet hatte, pflanzten sich minutenlange Bravorufe und Händeklatschen durch die Straßen fort. Auf Breuer machten Schuschniggs Schlussworte tiefen Eindruck, nicht wegen des heldenhaften Appells, sondern wegen der »seltsamen Art«, mit der er sie ausgerufen hatte. »Es war darin etwas wie Bestimmung oder Fatum, das ich nicht deuten konnte, aber intensiv aus des Redners Stimme verspürte.«
In der Kärntner Straße herrschte unbeschreibliches Chaos. Auf der rechten Seite riefen Schuschnigg-Anhänger in Sprechchören: »Hoch Schuschnigg!«, »Wir bleiben ein freies Österreich!«, »Nieder mit der braunen Pest!« Links die Nazis: »Ein Volk, ein Reich, ein Führer!«, »Adolf Hitler – unser Führer!« Gesang rechts: »Ihr Jungen, schließt die Reihen gut!« Gesang links: »Die Reihen dicht geschlossen!« Beim Deutschen Verkehrsbüro an der Ecke zur Mahlerstraße war ein Bataillon berittene Polizei aufgezogen, um die Massen im Zaum zu halten. Mittlerweile kam Schuschnigg mit Gefolge zum Abendessen beim Hotel Sacher an, wenige Schritte vom Verkehrsbüro entfernt. Ein paar Dutzend Getreue begrüßten den Kanzler vor dem Hoteleingang mit Hochrufen, von der gegenüberliegenden Seite drang tausendfaches Gebrüll: »Heil Hitler!«[31]
Breuers Darstellung mag unausgewogen sein. Er hatte sich offensichtlich am Brennpunkt der NS-Demonstrationen aufgehalten. Die Ringstraße beim Parlament befand sich an diesem Tag jedenfalls in der Hand der Vaterländischen Front und ihrer Anhänger. Schuschnigg war nach der Rede unter euphorischem Jubel die Parlamentsrampe hinab und die Ringstraße entlang bis zur Hofburg geschritten. In seinen Erinnerungen schreibt er vom Jubel einer »zehntausendköpfigen Menge«, von »leidenschaftlicher Zustimmung« der eigenen Anhänger und der politisch Indifferenten, aber auch von »fanatischer Ablehnung« durch die illegalen NS-Aktivisten.[32] Am Schwarzenbergplatz kam es zu einer Schlägerei zwischen linken und nationalsozialistischen Jugendlichen. Zuvor hatten sie sich Sprechchor-Duelle geliefert, dann waren sie aufeinander losgegangen. Dazwischen ein Kordon Berittener, erfolglos bemüht, die Parteien getrennt zu halten.[33]
In Linz sammelten sich die Vaterländischen im Volksgartensaal, die Nationalsozialisten im Theresiensaal. Nachdem Schuschnigg geendigt hatte, zog zuerst der vaterländische Fackelzug mit einigen tausend Teilnehmern durch die Landstraße und über den Hauptplatz, vorbei an einem dichten Spalier von Zuschauern. Mit zeitlichem Abstand folgte der nationalsozialistische Fackelzug mit ungleich mehr Teilnehmern, die Rede ist von zehntausend und darüber.[34] In Innsbruck dagegen konnte die Vaterländische Front ihren Fackelzug ohne nationalsozialistische Konkurrenz durchführen. Die Tiroler Nationalsozialisten hatten die Parole ausgegeben, von den Straßen fernzubleiben.[35] Auch der vaterländische Fackelzug, der am 25. Februar in Salzburg-Stadt abgehalten wurde, blieb seitens der Nationalsozialisten ungestört.[36]
In Graz wurde Schuschniggs Rede mit Lautsprechern vom Rathaus auf den Hauptplatz übertragen. Schon eine Stunde vor Beginn hatten sich Tausende Nationalsozialisten gesammelt. Sie forderten in Sprechchören vehement das Hissen der Hakenkreuzfahne. So vehement, dass Bürgermeister Schmid schließlich auf den Balkon trat, in einer kurzen Ansprache seine Verbundenheit mit der nationalen Sache erklärte und dann zwei ständestaatliche Kruckenkreuzfahnen einziehen und eine nationalsozialistische Hakenkreuzfahne hissen ließ. (Tags darauf wurde er, wohl auf Geheiß aus Wien, »beurlaubt«.) Während der Kanzlerrede zerrissen NS-Demonstranten die rot-weiß-rote Flagge, sangen das Horst-Wessel-Lied und schlugen insgesamt so gewaltigen Lärm, dass die Übertragung praktisch nicht zu verstehen war.[37]
Die Vorgänge in Graz in diesen und den kommenden Tagen und Wochen sollten beträchtlich zum Kollaps des Schuschnigg-Regimes beitragen. Die steirische Landeshauptstadt erwarb sich damit den Beinamen »Stadt der Volkserhebung«, den sie während der NS-Ära mit (sukzessiv abnehmendem) Stolz trug.
Für Sonntag, den 27. Februar, planten die steirischen Nationalsozialisten einen groß aufgezogenen »Deutschen Tag«. Es ließ sich leicht ausrechnen, dass eine derartige Veranstaltung nur zu einem weiteren Nazi-Exzess führen konnte. Folgerichtig ließ Schuschnigg ein Verbot aussprechen und Bundesheer in beträchtlicher Quantität nach Graz beordern. (Womit er übrigens deutlich zum Ausdruck brachte, dass den steirischen Soldaten nicht zu trauen sei.) Schwerbewaffnete Truppen besetzten neuralgische Punkte, Militärflugzeuge kreisten über der Stadt. Die Nationalsozialisten gaben für das eine Mal nach und sagten die Veranstaltung im letzten Moment ab.[38]
Der Marsch aus dem Wiener Raum nach Graz war für die Soldaten ein Erlebnis eigener Art. In der Wiener Neustadt segnete eine alte Frau die Truppen, ganz so, als ginge es ins Kriegsgebiet. An der steirischen Landesgrenze, am Semmering, kam den Lkw-Kolonnen des Bundesheeres ein Motorradfahrer entgegen, der sie mit ausgestrecktem Arm grüßte. Überall auf dem weiteren Weg durch das Mürz- und Murtal trugen Passanten Hakenkreuzabzeichen, vielerorts wehten Hakenkreuzfahnen. In Graz empfingen NS-Demonstranten die Truppen mit dem Horst-Wessel-Lied, aber ohne Feindseligkeit. Eine derart offen zur Schau gestellte nationalsozialistische Gesinnung war den Soldaten von Wien her nicht geläufig.[39]
Das Sicherheitsministerium, geführt von Seyß-Inquart, erließ in Abstimmung mit der Vaterländischen Front Weisungen zum Verhalten der österreichischen Nationalsozialisten: Das Tragen von Hakenkreuzabzeichen sei verboten, der Hitlergruß und das Tragen von NS-Uniformen ebenso, das Singen des Deutschlandliedes sei nur mit behördlicher Genehmigung gestattet, das Hissen der Hakenkreuzfahne verboten.[40] In den entsprechenden Richtlinien des Ministeriums an die Sicherheitsorgane heißt es, davon durchaus abweichend, dass der Wortgruß »Heil Hitler« stillschweigend hinzunehmen sei, sofern er »nicht demonstrativ« gebraucht werde. Insgesamt möge man bei Verstößen gegen die oben definierten Regeln milde, nämlich mit »Abmahnungen und Verwarnungen« und erst »im Wiederholungs- und Beharrungsfalle« mit Strafen vorgehen.[41] – Im Nachhinein muss man sagen, dass Seyß-Inquart perfekt darin war, den Intentionen Hitlers »entgegenzuarbeiten«.
Am Nachmittag des 1. März reiste der Minister ohne Vorankündigung an die Medien nach Graz. Mission: angebliche Beschwichtigung der dortigen Nationalsozialisten. Im selben Zug saß ein politisch linksgerichteter britischer Journalist namens Gedye, er hatte einen Wink erhalten. Seyß-Inquart verließ den Zug in einem Vorort, um Aufsehen zu vermeiden. Weiterfahrt in die Stadt per Automobil. Schon unterwegs konnte der Minister registrieren, dass viele Häuser zu seiner Begrüßung beflaggt waren, selbstredend mit Hakenkreuzfahnen. Zuerst ging es höflichkeitshalber zum steirischen Landeshauptmann. Dann zu einer Besprechung in die Wohnung des Volkspolitischen Referenten Armin Dadieu. Dieser, ein sechsunddreißigjähriger Universitätsprofessor für Chemie, war neben dem sieben Jahre jüngeren SA-Führer Sigfried Uiberreither die zentrale Figur der Grazer »Volkserhebung«.
Gedye war mittlerweile von einem Grazer Nazi-Journalisten ins Parkhotel dirigiert worden. Es lag unweit der Wohnung des Professors Dadieu und diente als NS-Hauptquartier. Schließlich begab Gedye sich mit seinem Begleiter zum Dadieu-Haus. Der britische Journalist hatte eine Demonstration von Zivilisten erwartet. Zu seiner Überraschung sah er an der Spitze des Zuges von angeblich 20000 Menschen voll uniformierte SA-Kolonnen marschieren. Fünftausend Mann sollen es gewesen sein (nach einer anderen Quelle fünfhundert). Die mitgeführten Fackeln wurden entzündet, die üblichen Nazi-Gesänge angestimmt und eine regelrechte Parade abgehalten. Dadieu trat ans Fenster (nach einer anderen Quelle auf einen Balkon), etwas dahinter Seyß-Inquart. Und der sah seelenruhig all dem zu, was er selbst als Sicherheitsminister verboten hatte. »Sein Gesicht zeigte einen Ausdruck von Genugtuung, gemischt mit einiger Verlegenheit, während seine schweren Hornbrillen das Licht der Fackeln widerspiegelten.« Eine Viertelstunde lang begnügte sich der Minister damit, hin und wieder zu winken. Als dann aber eine besonders stramme SA-Kompanie vorbeimarschierte, hielt ihn nichts mehr. Er trat entschlossen an Dadieus Seite und stieß die rechte Hand halbhoch nach oben zum verbotenen Gruß. Die Marschierenden und Zuschauer auf der Straße erhoben ohrenbetäubendes Triumphgeschrei. Und so verharrte Seyß-Inquart dann bis zum Ende des Aufmarsches. Fast zwei Stunden lang soll der gedauert haben.[42]
Am Folgetag, dem 2. März, hielt Seyß-Inquart in Graz eine Rede vor öffentlichen Angestellten. Der Bundeskanzler habe ihn ermächtigt, ihnen mitzuteilen, dass das Heben der rechten Hand zum deutschen Gruß, der Ruf »Heil Hitler!« und das Tragen des Hakenkreuzabzeichens »selbstverständlich« gestattet seien. »Dieses jedoch nur außer Dienst.«[43] Schuschnigg, der Seyß-Inquart zu gar nichts ermächtigt hatte, war so erzürnt darüber, dass er die Verbreitung der Rede durch den Bundespressedienst verbieten ließ.[44] Was im Übrigen nicht das Geringste am weiteren Fortgang der Dinge änderte.
Wie die Situation unter den steirischen Beamten war, ergab sich aus Listen, die in Ämtern aufgelegt worden waren. Demnach sollten sich in verschiedenen Abteilungen der Landesverwaltung fünfundachtzig bis hundert Prozent aller Beamten zum Nationalsozialismus bekannt haben.[45] Gerade wenn man in dieser Unterschriftensammlung weniger ein Bekenntnis zu einer bestimmten politischen Ideologie erblickt als vielmehr konjunkturbedingtes Umschwenken: Nichts zeigt deutlicher, dass die Autorität des kommenden jene des noch herrschenden Regimes bereits in den Schatten stellte. Ein Ministerialrat des Bundeskanzleramtes berichtete Eugen Lennhoff Anfang März von den zirkulierenden Listen. Nicht nur bekennende Nazis würden in den Ämtern von Büro zu Büro rennen, sondern auch viele Überläufer: Der Anschluss an das Dritte Reich stehe vor der Tür. Wer nicht für die Nationalsozialisten unterschreibe, werde bald ohne Posten dastehen.[46]
Schon unmittelbar nach Bekanntwerden des Berchtesgadener Treffens war in einigen Wiener Großbetrieben kurzfristig die Arbeit eingestellt worden. Die Arbeiter hätten mit diesem Streik gegen »die Auslieferung Österreichs an die Nazis« protestiert, hieß es in einer Aussendung des Auslandsbüros der österreichischen Sozialdemokraten.[47] So musste Schuschnigg sich Ende Februar widerwillig eingestehen, dass er auf die Unterstützung der sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiterbewegung nicht verzichten konnte. Und ganz ohne Zugeständnisse in irgendeiner Form würde es nicht gehen. Persönlichkeiten wie Otto von Habsburg, Bundespräsident Miklas, der Wiener Bürgermeister Schmitz und viele andere hatten mit zunehmender Vehemenz darauf gedrängt.[48] Nach langem Zögern entschloss sich der Kanzler, am 3. März ein vom sozialdemokratischen Gewerkschafter Friedrich Hillegeist geführtes Arbeiterkomitee aus rund zwanzig Personen zu empfangen. Dieses Treffen verlief nicht sonderlich ertragreich. Hillegeist sagte dem Kanzler, wenn Österreichs Arbeiter mit Erfolg für Österreichs Freiheit eintreten sollten, müssten sie zuerst selbst frei sein. Schuschnigg warnte vor »übertriebenen Forderungen«, zeigte sich aber zumindest bereit, Verhandlungen über ein Forderungsprogramm der Gewerkschafter aufzunehmen.[49]
Zu fragen ist, ob nicht bereits viele der ursprünglich sozialdemokratischen Arbeiter im Nationalsozialismus ein wesentlich attraktiveres Modell erblickten als im kleinkarierten, stagnierenden katholischen Ständestaat. Nicht von ungefähr meinte ein aufmerksamer Beobachter, nämlich der britische Gesandte, Schuschnigg müsse sich beeilen, wenn er »das Abdriften der Arbeiter zu den Nazis« aufhalten wolle.[50]
Zur Information von Vertrauensmännern der illegalen Freien Gewerkschaften hatte Schuschnigg für den 7. März einer Konferenz zugestimmt. Ort: das Arbeiterheim im Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf, einer der Schauplätze der Kämpfe vom Februar 1934. Es war die erste derartige Versammlung seit mehr als vier Jahren (und die letzte für mehr als sieben Jahre). Die Begrüßung der rund vierhundert Delegierten mit »Genossinnen und Genossen!« durch den Gewerkschaftsobmann Mantler rief einen Begeisterungssturm hervor. Was Hillegeist dann von der Aussprache mit dem Bundeskanzler zu berichten hatte, regte weniger zur Begeisterung an. Man beschloss nach einiger Diskussion, die Verhandlungen fortzusetzen und zu forcieren. Trotzdem gingen die Gewerkschafter in Hochstimmung auseinander. Sie hatten den Eindruck gewonnen, dass Schuschnigg die Arbeiter brauche, dass er ohne sie zu schwach sei, sich gegen die Nazis zu behaupten.[51]
Schuschniggs Entschluss
Tatsächlich, Schuschnigg und sein Regime waren schwach. Immer mehr in die Enge getrieben, raffte sich der Kanzler Anfang März zu einem verzweifelten Entschluss auf: Eine Volksbefragung über die Unabhängigkeit Österreichs sollte ihm wieder Bewegungsfreiheit schaffen. Schuschnigg selbst meint, dass diese Idee wegen der immer bedrohlicher werdenden Nachrichten aus Graz »um den 3. März« bei ihm gereift sei.[1]
Beim Treffen mit Hillegeist und dem Arbeiterkomitee musste Schuschnigg den Eindruck gewonnen haben, dass das Gros der Arbeiterschaft sich nolens volens zu Österreich bekennen würde. So sandte er als Informant einen hochrangigen Diplomaten zu Mussolini, den unzuverlässigen Schirmherrn Österreichs. Dieser hörte sich alles geduldig an. Die Lage, fand der »Duce«, werde sich schon noch bessern, die Revolten in der Provinz seien nicht beunruhigend, Hauptsache, Wien bleibe fest in der Hand der Regierung. Allein, diese Idee mit der Volksabstimmung, das sei ein Fehler. Schuschnigg fand das nicht, und überhaupt sei es zu spät, noch etwas daran zu ändern. Das ließ er Mussolini mitteilen.[2]
Zu dieser Zeit besuchte Hitlers Sonderbeauftragter Keppler Wien. Dieser hätte, schreibt Schuschnigg, neue Forderungen präsentiert, so etwa die Ernennung des nazistischen Wirtschaftsexperten Fischböck zum Minister und die Verdoppelung des Offiziersaustauschs. Er, Schuschnigg, habe die Forderungen strikt zurückgewiesen und auf weitere Konversation mit Keppler verzichtet. Den Aufzeichnungen Kepplers sind diese Informationen so nicht zu entnehmen. Vielmehr meint er, die Unterredung mit Schuschnigg habe zwar »stürmisch« begonnen, aber »durchaus konziliant« geendet. Ansonsten geben beide Dokumente deutlich darüber Auskunft, wie Hitlers Emissär in Wien auftrat: präpotent, anmaßend, fordernd. Schuschnigg musste spätestens jetzt klargeworden sein, dass von einem »Bis hierher und nicht weiter« für Hitler keine Rede sein konnte.[3]
Und ebenso wenig für die österreichischen Nationalsozialisten. Trotz des Versammlungsverbots versammelten sie sich, trotz des Aufmarschverbots marschierten sie. Unbeirrt, unbeirrbar. Sogar von nationalsozialistischen Exerzier- und Gefechtsübungen in Parteiuniformen ist in polizeilichen Situationsberichten die Rede.[4] Seyß-Inquart setzte seine hinhaltende Taktik trotzdem unverdrossen fort. Nicht umsonst attestierte ihm Wilhelm Keppler anerkennend, »mit außerordentlicher Geschicklichkeit« zu arbeiten.[5]
Robert Breuer beschreibt die Zustände in Wien am 7. und 8. März als »Hexenkessel«. Überall wurden offen Hakenkreuze verkauft, ab den Mittagsstunden durchzogen tobende Gruppen von Nationalsozialisten die Innere Stadt und die großen Einkaufsstraßen, pöbelten Passanten an, bedrohten jüdische Geschäfte, die alle vorsorglich ihre Rollläden halb heruntergezogen hatten, um sie notfalls rasch schließen zu können.[6]