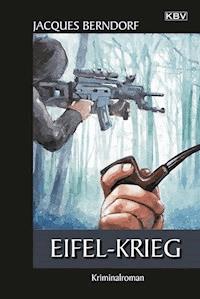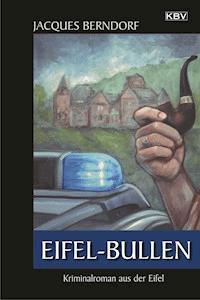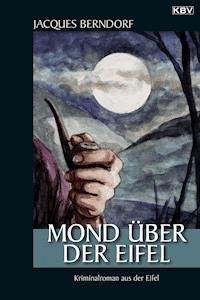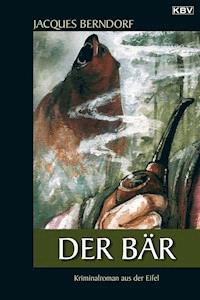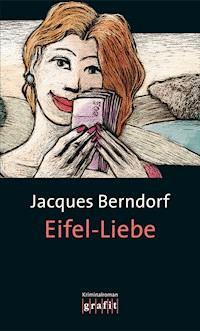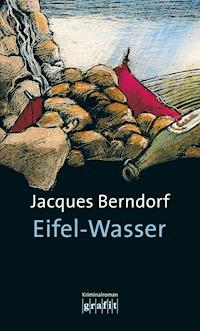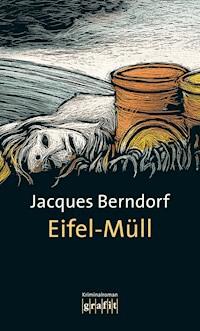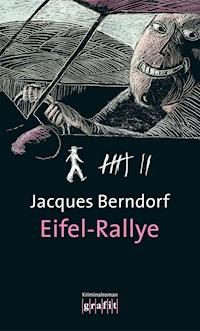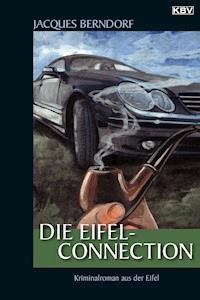
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: KBVHörbuch-Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Eifel-Krimi
- Sprache: Deutsch
Frühmorgens wird auf einem der sanften Eifelhügel der Mercedes des Unternehmers Norbert Bleckmann gefunden. Hinter dem Steuer sitzt sein Besitzer - tot. Bleckmann war als knallharter Geschäftsmann bekannt, als einer, der sich den Satz "Die Welt ist Krieg, wenn du Rücksicht nimmst, bist du tot" zu eigen gemacht hat. An seinem Ableben gibt es zunächst nichts Verdächtiges, er hat sich allem Anschein nach schlicht überarbeitet. Naturgemäß wittert der Journalist Siggi Baumeister dennoch mehr hinter diesem Szenario, und tatsächlich wird es mysteriös, als sich herausstellt, dass der Beifahrersitz an Bleckmanns Seite penibel gereinigt wurde. Die Staatsanwaltschaft in Trier will trotzdem nicht ermitteln, und Baumeister macht sich gemeinsam mit Emma und Rodenstock auf eigene Faust an die Recherche. Eine erste Spur führt zu Markus Glatt, einem Eifeler Fabrikanten, einem Selfmademan, der es mit Schuhen, Lampen, Madonnenfiguren und einer ansonsten kaum zu entwirrenden Ansammlung verschiedener Geschäftszweige zum größten Arbeitgeber der Region gebracht hat. Glatt ist ein Choleriker, ein Ekel, und Glatt scheint ein Mann zu sein, der zu allem fähig ist. Baumeister entdeckt zudem, dass auch heute, über sechzig Jahre nach Ende des Krieges, der Schmuggel in der grenznahen Eifel eine große Rolle spielt. Während er noch versucht, die zwielichtigen Geschäftsbeziehungen zwischen Bleckmann und Glatt zu entwirren, führt eine neue Spur zu den Prostituierten, die am Ende der A1 bei Blankenheim ihren Geschäften im Wohnmobil nachgehen. Ausgerechnet in einem der fahrbaren Liebesnester wird eine weitere Leiche gefunden ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Jacques Berndorf
Die Eifel-Connection
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Mords-Eifel (Hg.)Der letzte AgentRequiem für einen HenkerDer BärTatort Eifel (Hg.)Mond über der EifelDer Monat vor dem MordTatort Eifel 2 (Hg.)Die Nürburg-PapiereDie Eifel-Connection
Jacques Berndorf ist das Pseudonym des 1936 in Duisburg geborenen Journalisten, Sachbuch- und Romanautors Michael Preute.
Sein erster Eifel-Krimi, Eifel-Blues, erschien 1989. In den Folgejahren entwickelte sich daraus eine deutschlandweit überaus populäre Romanserie mit Berndorfs Hauptfigur, dem Journalisten Siggi Baumeister. Dessen bislang jüngster Fall, Die Nürburg-Papiere, erschien 2010 als Originalausgabe bei KBV.
Berndorf setzte mit seinen Romanen nicht nur die Eifel auf die bundesweite Krimi-Landkarte, er avancierte auch zum erfolgreichsten deutschen Kriminalschriftsteller mit mehrfacher Millionen-Auflage. Sein Roman Eifel-Schnee wurde im Jahr 2000 für das ZDF verfilmt. Drei Jahre später erhielt er vom »Syndikat«, der Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Autoren, den »Ehren-Glauser« für sein Lebenswerk.
Jacques Berndorf
Die Eifel-Connection
1. Auflage Juni 20112. Auflage Juli 20113. Auflage August 20114. Auflage November 20115. Auflage November 2012
© KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Fax: 0 65 93 - 998 96-20Umschlagillustration: Ralf Krampunter Verwendung von: © Petr Nad – www.fotolia.deRedaktion: Volker Maria Neumann, KölnDruck: Aalexx Buchproduktion GmbH, GroßburgwedelPrinted in GermanyPrint-ISBN 978-3-942446-13-6E-Book-ISBN 978-3-95441-006-4
Meiner Frau gewidmetFür Ernst Müller
»Sie sahen haargenau so aus wie eine Bande von erstklassigen Chicago-Gangstern, die einziehen, um das Todesurteil über einen geschlagenen Konkurrenten zu lesen. Wie ein Blitz ging mir auf, welche sonderbare psychologische und geistige Verwandtschaft zwischen den Operationen der Geldwirtschaft und denen der Syndikate besteht. Dieselben Gesichter, derselbe Ausdruck darauf, dieselben Manieren. Dieselbe Art sich zu kleiden und auch dieselbe überzogene Lässigkeit in den Bewegungen.«
Raymond Chandlerüber eine Gruppe junger Manageram 5. Mai 1949in einem Brief an denWerbefachmann Dale Warren
1. Kapitel
Die Sache mit dem Dr. Christian Schaad aus Mainz begann an einem Donnerstag im März, präzise am 3. März, ungefähr um 11 Uhr. Und sie konnte nur beginnen, weil er tot war, sehr tot.
Das wirkte zunächst sehr verwirrend und machte hilflos, weil niemand wusste, wer er eigentlich war und wie er in den Lavabruch in Walsdorf gekommen war. Denn Papiere hatte er keine bei sich. Sein sehr junges Gesicht war im Tod von namenlosem Schrecken verzerrt. Das sollte nicht verwundern, denn das Lebensende mit zweiundvierzig Jahren ist nun einmal etwas ungeheuer Brutales. Der Pathologe in der Rechtsmedizin in Mainz bescheinigte Schaad leicht burschikos, er sei alles in allem »fit wie ein Turnschuh« gewesen und von »außerordentlich guter Gesundheit«. Der Gesteinsbrocken aus Basalt, an dem er sich den Schädel eingeschlagen habe, sei unter den Hunderten von Brocken aus dem Deckgestein am Fuß der Steilwand einwandfrei herauszufinden gewesen, schließlich seien sowohl Blut als auch kleinste Knochensplitter und Hirnmasse an dem Stein gefunden worden. Menschliche Einwirkung, so der Wissenschaftler am Stahltisch, sei nahezu auszuschließen, also niemand habe erkennbar Schaad geschubst. Der Mann habe oben an der Kante gestanden, sich wahrscheinlich weit vorgebeugt, dann das Gleichgewicht verloren. Er sei zwölf Meter in die Tiefe gestürzt, niemand könne so etwas überleben. Während des Falls sei er mehrfach auf Vorsprünge geschlagen. Beide Oberschenkel seien gebrochen und sechs Rippen, sowie das linke Handgelenk – von all den massiven Blutergüssen am ganzen Körper nicht zu reden.
Emma schäumte vor Entrüstung und kommentierte: »Da würde ich aber genauer hinschauen, das glaube ich nicht! Ein junger Mann fällt nicht so einfach zwölf Meter tief, nicht, wenn er durchtrainiert ist und keinerlei Höhenangst hat. Nicht, wenn er als Wanderer die Eifel in sämtlichen Richtungen durchstreift hat. Schwachsinn, diese Beurteilung. Vollkommener Schwachsinn!«
Ich kann formulieren, dass ein leises Unbehagen blieb.
Wie auch immer, der Frühling war gekommen, in den Buchenwäldern und unter den Haselnusssträuchern blühten die ersten Buschwindröschen, an den Bachläufen färbten sich die Weiden. Die Erlen und Hartriegelgewächse waren in einen Rotschimmer getaucht, die Natur war aufgewacht und räkelte sich ausgiebig. In meinem Garten schickten die Narzissen und Tulpen die ersten grünen Spitzen ins Licht, und ich war gezwungen, die Ausscheidungen meines Katers Satchmo über die eiskalten Monate Häufchen für Häufchen mit der Schaufel abzuräumen. Während der Schneeplage nämlich war er zur Erledigung seiner Geschäfte jeweils exakt bis zum Schneerand gelaufen, um sofort wieder bibbernd um Einlass zu bitten. Auf diese Weise kam ich an eine perfekte Umrandung meiner Terrasse mit Scheißhaufen. Der wahre Kater von Welt kackt niemals im Schnee, der Arme könnte sich ja verkühlen.
Ja – und Schneewittchen tauchte kurz vor Weihnachten auf; eine kleine, rabenschwarze Katze, die aus irgendeinem Grund jeden Morgen beim ersten Licht die Dorfstraße locker hinuntertrudelte, um zielgenau meinen Hof anzulaufen. Der Name Schneewittchen kann möglicherweise irreführend sein, weil ich gar nicht weiß, ob sie ein weibliches Wesen ist, aber sie wirkt so. Anscheinend war sie gekommen, um meinen Kater zu knacken. Und der benahm sich äußerst kindisch, wahrscheinlich wird er jetzt senil.
Die Kleine schlüpfte unter dem Gartentor durch und näherte sich heiter. Sie wirkte so, als singe sie ein Kinderlied. Das hielt sie auch durch, als sie an Satchmo vorbeilief, der auf einem der Stühle auf der Terrasse vor sich hindöste. Die Kleine machte erst halt, als sie am Fressnapf angelangt war.
Aber sie fraß nicht. Stattdessen drehte sie ihren kleinen Kopf zu Satchmo, gelassen und ruhig, weil ein gut erzogenes Mädchen schließlich weiß, wie man sich zu benehmen hat.
Von Satchmo kam keinerlei Einwand.
Dann haute sie richtig rein, sie kannte keine Hemmungen. Plötzlich aber verschluckte sie sich und keuchte ein bisschen.
Satchmo bewegte sich jetzt, stellte sich auf die Beine, drückte den ganzen Körper in einen Bogen nach oben, leckte sich ausgiebig die rechte Pfote, machte sich sehr schön und eindrucksvoll, hüpfte von seinem Stuhl und schritt majestätisch auf die Kleine zu. Er haute ihr nicht eine runter, er blinzelte nur. Er fauchte nicht, er verteidigte sein Futter nicht, er setzte sich nur schön zurecht und drapierte sich mit dem eigenen Schwanz.
Schneewittchen fraß schleunigst weiter, weil man schließlich unter Eifler Scheunenkatzen weiß, dass schnelles Fressen sicheres Fressen ist.
Als der Napf leer war, machte sich eine Art peinliches Schweigen breit, wobei ich nicht sicher bin, ob die Kleine leise rülpste.
Satchmo jedenfalls bewegte sich träge in mein Wohnzimmer und hüpfte auf seinen Sessel, in dem ein Schaffell liegt. Dort rollte er sich zusammen, um weiterzudösen.
Die Kleine folgte ihm, hüpfte aber nicht auf den Sessel, stattdessen auf das benachbarte Sofa.
In diesem Moment erhob sich mein Kater zu seiner ganzen bedrohlichen Größe, sprang auf den Teppich, von dort weiter auf das Sofa und prügelte augenblicklich und wild auf die Kleine ein. Kein Wunder: Satchmo darf ausschließlich auf den Sessel mit dem Fell, die Besteigung aller anderen Möbel im Wohnzimmer ist ihm strengstens verboten. Schneewittchen hatte seine Schmerzgrenze überschritten.
Seitdem übrigens bleibt sie immer am Fuß des Sessels von Satchmo hocken und legt sich erst dann lang und entspannt auf den Teppich vor seinem Schaffell, wenn er eingeschlafen ist. Ich finde alte Kerle zuweilen schon ziemlich widerlich.
Wie auch immer, der März neigte sich seinem Ende zu, Dr. Schaad war seit vierzehn Tagen tot und schon fast vergessen.
Nur Emma grummelte immer noch und fauchte voller Zynismus: »Da kommt ein Fachmann für Geologie in die Eifel und stürzt ausgerechnet in einem Steinbruch zu Tode. Es gibt Zeugen, die behaupten, er habe mit dem Gedanken gespielt, beim Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz die Brocken hinzuwerfen. Er war angeblich stinksauer auf seinen Arbeitgeber. Es gibt sogar Zeugen, die bekunden, er habe privat behauptet, dass man der Vulkaneifel die wichtigsten Berge und vulkanischen Erhebungen stehle. Dass die gesamte Landschaft verschwindet, weil ihre Berge verschwinden. Nur, weil bestimmte Leute den Hals nicht voll kriegen. Die Vulkaneifel, so soll er wörtlich formuliert haben, wird ihr Gesicht verlieren. Und niemand kommt auf die naheliegende Idee, es könnte Mord gewesen sein. Und obendrauf noch die Tatsache, dass die Gemeinden von den Unternehmern, die Steine und Vulkanaschen fördern und verkaufen, nicht mehr als sechzig Cent bis einen Euro pro Tonne bekommen. Das ist so beschämend wenig, dass man darüber in Depressionen fallen kann, verdammt noch mal! Und es gibt Andeutungen, dass Ortsbürgermeister und andere einflussreiche Leute dabei um viele Ecken mitverdienen. Ich will damit sagen: Das riecht auch unsauber nach Betrug, Bestechung und Vorteilnahme!«
Ich weiß nicht mehr, was ich Emma antwortete, ich weiß nur, dass ich ahnte, sie hatte recht. Und ich hatte ein mieses Gefühl im Bauch.
Aber es gab keine Spur zu einem Mord, nichts deutete auf menschliche Einwirkung hin, nichts auf Erpressung, nichts auf dunkle Zahlungen. Die Staatsanwaltschaft in Trier hatte sofort Todesermittlungsbeamte geschickt und beugte sich deren Spruch: Kein Fremdeinwirken feststellbar! Suizid nicht auszuschließen, aber sehr unwahrscheinlich. Bei telefonischen Befragungen im Kollegenkreis mehrfach als »völlig unmöglich« bezeichnet.
Es war der letzte Freitag im März, ich hockte nach zwei Scheiben Leberkäse mit zwei Spiegeleiern zum Mittagessen träge und bequem auf meinem Sofa herum, die beiden Katzen schliefen fest, im Haus war es ruhig, und ich war rüde gewillt, die nächsten Tage einfach vor mich hinzugammeln. Niemand wollte etwas von mir, nicht einmal ich selbst.
Ich las in der Goebbels-Biografie von Peter Longerich und fragte mich nicht allzu intensiv, ob dieser Goebbels nun ein geistiges Flachwasser gewesen war oder einfach abgrundtief böse – oder beides. Auf jeden Fall ein Ego von geradezu gigantischen Ausmaßen.
Dann rauschte der schwarze Volvo von Emma auf den Hof, und ich ahnte sofort Unheil, fand es aber idiotisch, so zu tun, als sei ich nicht da. Außerdem hatte es noch nie Sinn gemacht, ihr auszuweichen, weil sie selbst den schmalsten Notausgang immer sofort entdeckte und verschloss.
Sie knutschte mich sehr flüchtig im Hereinkommen und eroberte das erste Sofa im Wohnzimmer. Sie sagte: »Ich muss dir von Rodenstock erzählen, am liebsten hätte ich einen Schnaps, und zwar einen großen Schnaps mit einer Scheibe Schwarzbrot ohne alles, und einen Schluck Leitungswasser.«
»Treibst du es jetzt wie die Russen?«
Sie strahlte und nickte. Sie hatte ihre Haare von Rot auf Nachtschwarz umgefärbt mit zwei strahlend blauen Strähnen auf der linken Kopfseite. Angepasst an die Kühle des Wetters trug sie einen schwarzen Rollkragenpullover, dazu blaue Jeans und schwere, hellbraune Wintertreter, geschnürt mit leuchtend roten Bändern. Sie hatte blanke, große, strahlende Augen und sie sah nicht älter aus als Anfang vierzig, wenngleich sie weit über die Fünfzig war.
Ich goss ihr also einen Obstler von Liz Treis unten an der Mosel ein, holte ihr eine Scheibe Schwarzbrot und das Glas Wasser. »Was ist mit Rodenstock?«, fragte ich.
»Er macht eine Therapie!«, stellte sie fest. Das kam wie ein Fanfarenstoß.
»Heißt das, er hat nachgedacht?«
»Ja, genau das. Aber er war fast soweit, sich umzubringen.« Dann setzte sie vorwurfsvoll hinzu: »Du warst fast vier Wochen nicht mehr da.«
»Das ist richtig«, sagte ich. »Aber ich will mich von diesem Mann nicht mehr an die Wand quetschen lassen. Er ist mies drauf, benimmt sich unhöflich, bellt mich an, als hätte ich ihm was getan. Dein Mann ist unausstehlich, Emma, ein richtiges Ekel.«
»Es ist so, dass er sechs Tage lang im Rollstuhl saß, nicht ins Bett ging, sich nicht wusch, einfach da hockte und die Elefantenpille anstarrte.«
»Was, zum Teufel, ist eine Elefantenpille?«
»Ein Medikament, mit dem Tierärzte einen Elefanten umlegen, wenn sie ihn gründlich untersuchen wollen.«
»Woher hatte er die?«
»Das weiß ich nicht.« Dann begann sie unvermittelt zu weinen. »Und er hat gesagt, ich bräuchte mir keine Gedanken zu machen, das Zeug wirke sehr verlässlich. Er würde einfach ruckartig einschlafen und fertig.« Dann griff sie entschlossen zu dem Wasserglas mit dem Schnaps und trank ihn aus. »Also bin ich ... also, ich bin durchgedreht. Ausgerastet. Aber richtig! Hast du noch einen?«
»Mehrere«, nickte ich und goss ihr erneut ein.
»Scheißschnaps«, sagte sie in dem Versuch, tapfer zu sein.
»Wie bist du denn durchgedreht? Ich meine, was ...?«
»Na ja, ich habe seinen Rollstuhl genommen und ihn vor mir hergeschoben. So mit Schmackes, verstehst du? Ich habe geschrien, er könne mich sonst wo besuchen, und ähnliche Sachen. Ich habe die Haustür aufgemacht und ihn weitergeschoben, die Straße entlang. Bis zu der Kurve, du weißt schon.« Jetzt sah sie plötzlich zehn Jahre älter aus, sie war völlig erschöpft. »Und es regnete ja wie aus Eimern«, fuhr sie mit einer plötzlich veränderten Stimme fort, dumpf und hoffnungslos im Elend versunken.
Dann schwieg sie. Sie weinte still vor sich hin, sie trank nicht mehr von dem Schnaps.
»Wann war denn das?«
»Heute Morgen. So gegen acht.«
»Und?«
»Na, ja ...«
»Emma, ich bin kein Profiler!«
»Na, ja, er ist da in der Kurve im Wald runter ...« Dann weinte sie nicht mehr, dann fing sie unvermittelt an zu lachen, kicherte etwas blöd vor sich hin und schüttelte dazu den Kopf, als könne sie sich selbst nicht fassen.
»Gut, dein Ehemann ist also mit seinem Rollstuhl aus der Steilkurve in den Wald geflogen. Was hat er sich gebrochen?«
Es dauerte ziemlich lange. »Nichts, aber ...«
»Emma, ich kann nicht herumraten, ich weiß nichts.«
»Na ja, einer der Schulbusfahrer von Hens kam mit einem leeren Bus vorbei und muss an der Stelle ja langsam fahren ...«
»Und da hat er Rodenstock gesehen, und ihn aufgelesen.«
Sie sah mich augenblicklich vorwurfsvoll an. »Das geht an der Stelle doch gar nicht, Rodenstock lag mit seinem Rollstuhl doch gut vierzig Meter im Wald runter.«
Ich reagierte gar nicht, sie musste das erst einmal ordnen, und sie war sehr verwirrt.
»Also, der Busfahrer hat nur die Reifenspuren vom Rollstuhl im Matsch gesehen, im Gras und so.«
»Erzähl mir jetzt bloß nicht, dass er Rodenstock mit seinem Bus nachgefahren ist.«
»Wie bitte?« Ihr Gesicht verkrampfte sich etwas. »Du bist unmöglich, Baumeister. Nein, der Busfahrer hat angehalten, ist ausgestiegen. Dann hat er nachgeguckt und Rodenstock gesehen. Der brabbelte irgendetwas, und das konnte der Busfahrer nicht verstehen. Jedenfalls hat er versucht, ihm zu helfen. Aber er konnte nichts machen, Rodenstock war zu schwer, und Rodenstock hat nur rumgemotzt, und der Rollstuhl lag noch zwanzig Meter weiter. Dann haben sie den Notarzt und das DRK gerufen. Rodenstock hat dauernd rumgebrüllt, bis der Arzt ihm einfach eine Beruhigungsspritze gesetzt hat. Dann haben sie ihn in die Psychiatrie nach Wittlich gefahren. Und da ist er jetzt und musste erst mal körperlich untersucht werden. Da komme ich gerade her. Also, ich bin hinter dem Krankenwagen her, und habe Rodenstock nur noch einmal gesehen, als er auf einer Trage lag, in einem richtig miesen, grün gekachelten Raum mit einer traurigen Zimmerpalme und zwei sechs Wochen alten Illustrierten. Wahrscheinlich hatte er drei Kilo Diazepame im Bauch. Natürlich habe ich geheult. Er hat mich lange angeguckt, dann hat er schallend gelacht, dann hat er richtig boshaft geflüstert: ›Das war einwandfrei eine Tötungsabsicht!‹«
»Und? War es das?«
»Ein bisschen schon«, murmelte sie. »Und er hat mir gesagt, dass er in eine Therapie geht.« Dann trank sie ihren zweiten Schnaps.
»Aber eigentlich wollte ich ihm nichts Böses.« Sie fing an zu kichern: »Du hättest sein Gesicht sehen sollen, Baumeister. Blöd wie ein Karpfen.«
»Emma, die Wunderheilerin.«
»Na ja«, sagte sie, um dann schnell und angriffslustig zu fragen: »Wo ist eigentlich Gabi?«
»Die ist seit zehn Tagen in Stuttgart und verhandelt ihre Scheidung. Sie muss aus Versicherungsverträgen herausgeschrieben werden, aus Erbschaftsbestimmungen, aus Besitzunterlagen, sie muss die alten Verbindungen kappen, und wahrscheinlich auch ein bisschen mit ihrem Ex reden, damit die Stimmung friedlich bleibt.«
Sie verzog das Gesicht, als bereite ihr meine Antwort Schmerzen. »Das glaubst du doch selbst nicht.«
»Warum denn nicht?«
»Zehn Tage, Baumeister? Ruft sie dich wenigstens an?«
»Warum soll sie das denn tun?«
»Wann will sie denn hier wieder eintrudeln?«
»Herrgott, Emma!«
Sie sah mich sehr eindringlich an, dann flüsterte sie: »Ach, du verdammte Scheiße!«
Schneewittchen räkelte sich, wurde wach und strich um Emmas Beine.
»Fang bloß nicht an, dich wie mein Mann zu benehmen.«
»Es ist gut, Emma, es ist jetzt gut.«
Sie stand auf und nickte grimmig. Dann ging sie hinaus, setzte sich in ihr Auto und fuhr wie immer mit viel zu viel Gas vom Hof.
Der Buntspecht, der den ganzen Winter über mein Vogelhäuschen angeflogen hatte, hockte am Stamm des dicken Holunders und bearbeitete etwas verbissen die grüne, raue, schrundige Rinde. Das Dompfaffpärchen suchte im schmuddeligen Gras nach letzten körnigen Herrlichkeiten aus meinem Winterstreu. Es war alles so verdammt schnuckelig und niedlich, so richtig romantisch und aufgeräumt und rundum heiter und bis zum Erbrechen erbaulich.
Eine Stunde später war alles ganz anders.
Emma rief an und flötete aufgeräumt: »Wir haben eine Leiche, und Kischkewitz sagt, er kann im Moment nicht hin. Er steckt fest an der Mosel. Und die Kollegen feiern mehrheitlich krank. Also, Land unter auf ganzer Linie. Er flucht wie wild, aber er meint, dass es wichtig sei, dass sich jemand die Sache schnell ansieht. Jemand, auf den er sich verlassen kann. Kurzum: Er fragt, ob wir uns die Leiche ansehen können, er hat den Beamten vor Ort schon Bescheid gegeben. Offenbar war er sich sehr sicher, dass wir zusagen würden.« Sie unterdrückte ein Lachen. »Kischkewitz kennt dich und deine Neugierde sehr gut. Kommst du?«
»Jetzt? Am helllichten Tag?«
»Ja, am helllichten Tag.«
Ich machte mich sehr schnell auf den Weg, weil ich damit der Frage ausweichen konnte, ob ich Gabi anrufen sollte oder nicht. Ich scheuchte die Katzen ins Freie, damit sie gesund blieben.
Emma stand in Heyroth vor dem Haus, stieg zu und sagte mit einem Seitenblick: »Ich entschuldige mich für mein schlimmes Benehmen von wegen Gabi. Geht mich ja nichts an.«
»Es geht dich durchaus etwas an, aber ich kann es nicht ändern.«
»Oder so«, nickte sie. »Kennst du einen gewissen Norbert Bleckmann?«
»Wer ist das?«
»Der Tote.«
»Und wo ist er?«
»Sitzt in seinem Auto. Das Ermittlungsteam ist unterwegs. Kischkewitz schimpft wie ein Rohrspatz, weil er keine Leute hat. Zwei Selbstmorde, ein Bankraub, ein Verdacht auf Vergewaltigung, ein unbekannter Toter an der Mosel. Wittlich ist überlastet, Trier ist überlastet, Mayen hat selbst genug am Hut. Und es ist Sonnabend, die Welt findet nicht statt. Also nach Hillesheim.«
»Hillesheim?«
»Ja. Dieses Auto steht irgendwo auf einem Hügel, die Straße heißt Am Wegrain und ist eigentlich keine Straße. Na ja, wir werden sehen. Also Hillesheim, dann raus Richtung Jünkerath und Stadtkyll, dann irgendwo rechts. Da muss ein Streifenfahrzeug stehen.«
Ich tippte die Straße in mein Navi, und die freundliche Frau sagte: »In siebenhundert Metern links abbiegen.«
»Das ist schon mal falsch«, widersprach ich. »Da ist eine Baustelle mit Umleitung. Wer ist dieser Norbert Bleckmann?«
»Weiß ich nicht. Beruf Kaufmann.«
»Wann hat man ihn gefunden?«
»Ist noch nicht lange her. Da wollte ein Bauer mit seinem Traktor vorbei, und Bleckmann stand im Weg. Vor anderthalb Stunden.« Dann löste sie ihren Sicherheitsgurt, streckte sich nach vorn durch, atmete erleichtert auf und sagte: »Ich tu das mal in dein Handschuhfach. Das zwickt so am Hintern.« Dann klappte sie das Handschuhfach auf, legte ihre Achtunddreißiger hinein und klappte es wieder zu.
»Sag mal, bist du verrückt?« Ich wurde wütend. »Ich denke, der Kerl ist schon tot.«
»Ja, ja, die Macht der Gewohnheit«, murmelte sie demütig.
»Das fängt ja richtig gut an.«
»Schon gut, schon gut. Warum bist du so nervös?«
»Tut mir leid. Wir sind im Augenblick wohl beide nicht ganz alltagstauglich.«
Nach etwa dreißig Minuten befahl mir die Frau nach rechts abzubiegen. Es ging in eine kleine Neubausiedlung, an deren Ende ein Feldweg begann, der Am Wegrain hieß und eine braune Fahrspur für die Trecker hatte, in der Mitte eine Rippe aus grünem Gras. Es ging ungefähr zweihundert Meter geradeaus, dann in einem rechten Winkel nach links.
»Da sind die Polizisten«, sagte Emma. »Fahr nicht zu nahe heran.«
»Ich fotografiere«, sagte ich drohend.
»Ja, gut, aber bitte unauffällig.« Sie stieg aus und ging zu den Uniformierten, die neben ihrem Fahrzeug standen. Sie reichte ihnen die Hand, und sie sprachen miteinander. Es war klar, die kannten sich. Von früher, von weiß Gott woher. Wahrscheinlich von früheren Einsätzen. Als Frau von Kriminalrat a. D. Rodenstock war Emma jedem Eifeler Polizisten ein Begriff. Immerhin ist sie drüben in Holland selbst mal Polizeichefin gewesen. In einem anderen Leben.
Ich nahm die kleine Leica und trottete hinter ihr her.
Etwa fünfzig Meter entfernt stand eine überdimensionierte, schwarze Mercedes-Limousine, die Fahrertür stand offen.
Ich hörte, wie einer der Uniformierten sagte: »Wir haben nicht abgesperrt, weil hier nichts abzusperren ist. Am Ende der Welt.«
»Ich soll mich nur umsehen, hat Kriminalrat Kischkewitz gesagt. Was sagt Ihre Erfahrung?«
»Also, nach der Hautfarbe zu schließen, würde ich sagen, der Mann ist bestimmt zwölf Stunden tot. Die Haut ist grau bis leicht bläulich«, sagte der Polizist freundlich. »Keine Verletzung oder so was. Sieht so aus, als wäre er hierher gefahren und dann gestorben.«
»Und Sie haben ihm die Papiere abgenommen?«, fragte Emma.
»Ja, hier ist die Brieftasche. Alles drin. Personalausweis, Führerschein, Bankkarten und was man sonst so braucht. Sie steckte in der Innentasche des Jacketts links. Er ist aus Köln, fünfzig Jahre alt. Ein Paar hundert Euro in bar in einer silbernen Klammer in der linken Hosentasche. Kein Kleingeld. Es sieht nicht so aus, als habe ihn jemand durchsucht, die Kleidung ganz locker und normal. Also, wenn man von zwölf Stunden seit dem Exitus ausgeht, dann ist er hier gegen drei Uhr nachts gestorben, denke ich mal. Und er war allein. Es herrschte Nebel heute Nacht. Seine Tür, die offen stand, ist im Innenbereich ziemlich feucht. Der Schlüssel steckt.«
»Irgendeine Ahnung, warum er ausgerechnet hier geparkt hat?«, fragte Emma.
»Also, gleich vor dem Fahrzeug bricht das Gelände steil nach unten ab. Da liegt fünfzehn bis zwanzig Meter tiefer der Milchbetrieb von Sebastian Jaax, ungefähr neunzig Tiere. Mit dem kann dieser Mann nichts zu tun haben, ich habe den Bauern schon angerufen, der kann sich nicht vorstellen, was der Tote hier gewollt haben kann. Das hat man ja manchmal in der Eifel. Die Leute rauschen über die Bundesstraßen, sind müde, wollen mal ausspannen, mal was anderes sehen als das Licht vom Auto. Dann stellen sie sich irgendwohin, dösen, schlafen ein. Der hier ist gleich gestorben.«
Emma nickte und sagte etwas lauter zu mir gewandt: »Siggi, kannst du den Toten mal für mich aufnehmen? Nichts Besonderes, von beiden Seiten und so. Für den Fall, dass Kischkewitz eine spezielle Frage hat.«
»Das mache ich«, murmelte ich und lächelte die Polizisten an, die natürlich genau wussten, dass ich der Baumeister war, dass ich mit der Polizei eigentlich wenig zu tun hatte, aber den Kriminalrat Kischkewitz duzte. »Dann hätte ich aber noch eine Frage an die Fachleute«, murmelte ich »Was ist das denn für ein Schiff?«
»Genau das habe ich auch gefragt«, nickte der Polizist lächelnd.
Sein jüngerer Kollege strahlte ohne jeden Neid: »Das ist ein S 600, ich habe nachgeguckt. Langer Radstand, zwölf Zylinder, 517 PS. Der kostet ohne jedes Extra genau 156.580 Euro. Es gibt aber noch eine Version, die ein paar PS mehr hat und runde zehntausend mehr kostet. Aber der hier würde mir schon reichen.«
»Dann schauen wir mal«, bestimmte Emma.
Ich fotografierte. Der Tote sah gut und gepflegt aus, trug ein schwarzes T-Shirt zu einem grauen Anzug. Eine Breitling mit einem hellbraunen Lederarmband am rechten Handgelenk. Er war schlank, das Gesicht war schmal und energisch, der Kopf mit den graumelierten, kurzen Haaren war nach rechts auf die Schulter gefallen, eine Lehne rechts von ihm hatte verhindert, dass er wegrutschte.
Der jüngere Polizist murmelte: »Der sieht doch eigentlich friedlich aus.« Es klang so, als wolle er sich beruhigen.
»Er riecht ein bisschen streng, er ist natürlich ausgelaufen«, murmelte der ältere Beamte.
»Haben Sie in den Kofferraum geguckt?«, fragte Emma.
»Haben wir nicht, wir hatten ja keinen Anlass«, antwortete der Jüngere. »Wir wollten auch nichts verändern. Wollen Sie reinsehen?«
»Ja, bitte«, nickte ich. »Wenn’s geht.«
Er kam an die rechte Wagenseite, beugte sich vor dem Toten nach vorne und drückte irgendeinen Knopf. Die Heckklappe hob sich langsam.
Ein Handy meldete sich, Emma sagte: »Ja?« Und dann nach einer kleinen Weile: »Alles klar, bis gleich.« Sie sah die beiden Uniformierten an. »Die Spurensicherung ist im Anflug. Da kommen zwei Kollegen von Ihnen aus Wittlich. Sie sind gleich erlöst.«
Ich fotografierte den Kofferraum. Er war leer. »Was denkst du?«, fragte ich Emma.
»Nichts Besonderes«, murmelte sie. »Das sieht mir nicht nach einer unklaren Sache aus. Herzversagen oder so etwas. Vielleicht Infarkt.«
»Aber sein Gesicht ist so friedlich.«
»Das Gesicht hatte Zeit, sich zu entspannen. Hast du diesen Bauernhof da unten fotografiert?«
»Habe ich. Das Übliche. Ein relativ kleines Wohnhaus, ein großer, teils offener Stall. Ein drittes Gebäude für die Maschinen, Traktoren und so weiter. Eine abgetrennte Garage für zwei, drei Autos. Ein Riesenplatz für den Mist mit der ganzen Automatik. Nichts Besonderes, nichts außerhalb des Gewöhnlichen.«
»Kennst du die Leute?«
»Nein, keine Ahnung. Was sollte dieser Bleckmann auch mit denen zu tun haben?«
»Weiß ich nicht«, sagte sie gleichgültig. Dann stellten wir uns ein paar Schritte abseits außer Hörweite, und Emma war plötzlich ganz kleinlaut: »Glaubst du, dass Rodenstock es schafft?«
»Ja, glaube ich. Wenn er es will, schafft er es. Du wirst also jeden Tag nach Wittlich fahren?«
»Nein. Die erste Woche darf ich nur mit ihm telefonieren. Abends gegen 19 Uhr, fünf Minuten. Sie checken ihn durch, sie verordnen irgendwelche Mittel, sie bringen ihn irgendwie körperlich in Schuss. Dann kommt die Therapie, jedenfalls der Anfang davon. Dann geht es in eine stationäre Therapie. Irgendwo. Sie sagen, dass es besonders wichtig sei, ihn erst einmal zu isolieren. Auch wenn er lange Zeit ein Ekel war, ich weiß überhaupt nicht, wie ich ohne ihn leben soll.«
»Wenn er es schafft, schaffst du es auch.«
»Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Was ist mit Gabi?«
»Ich weiß es nicht. Im Augenblick weiß ich nichts.«
»Du bist entweder gottjämmerlich friedlich, oder du hast die Hosen voll.«
»Ich bin für volle Hose.«
»Auch das noch. Ich möchte rauchen.«
Emma sprach noch kurz mit den Beamten, dann setzten wir uns in mein Auto und rauchten.
Es tuckerte ein uralter kleiner Fiat heran, aus dem zwei Männer stiegen, der eine sehr dünn und lang, der andere klein und rundlich. Wir gingen auf die Beamten zu.
Der Lange sagte zu Emma: »Sind Sie eigentlich noch immer im Dienst bei den holländischen Kollegen?«
»Nein«, antwortete sie. »Ich stehe auf einer Liste mit Beamten, die im Notfall berufen werden können. Aber meine aktive Zeit ist zu Ende. Das ist Baumeister, ein Freund. Er hat mich gefahren. Das da vorne ist der Tote samt Fahrzeug. Wir haben nichts Auffälliges festgestellt. Wir würden auf Sie im Ort warten. Das Lokal heißt Sherlock, da kriegen wir einen Kaffee.«
»Das geht in Ordnung«, nickte der kleine Dicke. »Wir sehen uns.«
Also fuhren wir wieder nach Hillesheim hinein und hockten uns im Sherlock in den Raum für die Anhänger von Tabak, um uns herum eine unglaubliche Ansammlung von Trödel und Verzichtbarem. Mein Vater hätte wahrscheinlich gesagt: »Alles Dinge, auf deren Anwesenheit die Welt in stiller Ergebenheit gewartet hat, damit die Einsamkeit vergeht.«
»Ich muss mich ablenken, ich lese«, sagte Emma, als die Kaffeetassen vor uns dampften. Sie griff neben sich nach einem Buch in einem kleinen Regal und war augenblicklich versunken, obwohl ich den Verdacht hegte, dass sie keineswegs las, sondern an ihren Rodenstock dachte. Sie brauchte für eine Doppelseite immerhin eine Stunde, so lange dauerte es, bis die Kriminalbeamten auftauchten.
Ich legte die Illustrierte beiseite, mit der ich mich gelangweilt hatte.
»Tja«, sagte der kleine Dicke aufgeräumt. »Also, der Tote geht gewissermaßen in Ordnung, aber sein Auto weniger.«
»Es ist so«, murmelte der Lange mit traurigem Gesicht, »dass das Auto etwas ganz Besonderes bietet. Es ist alles ganz normal, nur mit dem Beifahrersitz stimmt etwas nicht. Auf der Seite ist das Fahrzeug klinisch sauber. Irgendjemand, vielleicht der Fahrer, hat alle mit den Händen erreichbare Flächen systematisch saubergewischt, es ist so, als hätte auf dem Beifahrersitz niemals irgendeine Person gesessen. Nicht der Hauch eines Fingerabdrucks, keine erkennbaren Flusen auf dem Sitz. Das Fahrzeug hat einen Kilometerstand von rund 40.000. Das erscheint uns sonderbar, sehr sonderbar. Ein Bergefahrzeug des ADAC kommt gleich, wir lassen es in die kriminaltechnische Untersuchung bringen. Irgendetwas stimmt da nicht. Der Staatsanwalt muss entscheiden.«
»Das ist also der zweite sehr komische Tote!«, stellte Emma ruppig fest.
»Aber das wissen wir doch gar nicht«, murmelte ich besänftigend.
Sie starrte mich aus kugelrunden Augen wütend an. »Ausgerechnet du hast es nötig, höflich und zurückhaltend zu sein!«
Was das sollte, war mir schleierhaft. Ich schwieg jedenfalls.
2. Kapitel
Ich fuhr sie nach Hause nach Heyroth, sie stieg aus und äußerte muffig: »Ich werde einen ausgedehnten Frühjahrsputz machen, das zerstört den Rest meines Selbstwertgefühls immer am gründlichsten.«
»Wo ist eigentlich euer Hund?«
»Den habe ich an andere Leute verschenkt. Hättest du ihn gern gehabt?«
»Eher nein. Grüß mir den Rodenstock, bitte.«
»Ja, ja. Falls er überhaupt mit mir redet.«
»Du bist richtig mies drauf.«
»Korrekt.«
»Warum denn eigentlich?«
Sie kam um das Auto herum auf meine Seite. Sie war blass, ihre Augen wirkten leer, und sie sah mich nicht an. »Ich habe mehr als zwei Jahre mit einem hochdepressiven Mann gelebt. Es war eine ständige Achterbahnfahrt, weißt du, auf nichts war Verlass, am wenigsten auf ihn. Und manchmal packte es mich zu den unmöglichsten Zeiten, morgens um zehn oder nachts um drei. Und ich dachte zittrig: Der wird doch nicht? Dann rannte ich los, um ihn irgendwo im Haus zu suchen. Und er hockte in seinem Rollstuhl und sagte kein Wort, er war, ja ... ein widerliches Gespenst. Ich bin auch der Meinung, dass er kein Recht hatte, mir das alles anzutun.«
»Vielleicht schafft er es jetzt.«
»Ich kann kein Vielleicht mehr ertragen, meine Batterien sind leer. Mach’s gut, und komm mal vorbei, wenn du dich an mich erinnerst.«
Ich war also nicht gerade in Hochstimmung, als ich auf meinen Hof rollte, und ich hatte nicht die geringste Lust, meine eigenen Unsicherheiten anzuschauen. Der Tag war gelaufen, die Unwägbarkeiten blieben, wahrscheinlich hatte ich sogar Angst vor der Nacht, Angst vor meinem leeren Haus.
Der tote Geologe Dr. Christian Schaad war mir ebenso gleichgültig wie der tote Kaufmann Norbert Bleckmann, der nachts in seinem Luxusgefährt gänzlich unspektakulär aus dem Leben geschieden war, und der seinen Nebensitz so gründlich sauber gewischt hatte, dass das Kriminalbeamten nicht gefiel.
»Ja und?!«, hätte ich am liebsten gebrüllt, aber wer brüllt schon so undiszipliniert, wenn niemand ihm zuhört?
Satchmo erzählte mir lebhaft irgendein großes Abenteuer seines Tages, während Schneewittchen um meine Beine strich, als würde sie dafür bezahlt. Ich richtete ihnen etwas Nassfutter an und stellte es auf die Terrasse, damit sie eine Ahnung von frischer Luft bekamen.
Longerichs Goebbels-Biografie interessierte mich um diese Zeit auch nicht so recht, ich hatte kein Manuskript in der Maschine, das wirklich drängte, und spielte durchaus mit dem Gedanken, ins Bett zu gehen. Aber es war erst acht Uhr am Abend, und ich war ganz sicher, dass ich dann gegen Mitternacht im Haus herumlaufen würde, um mich bei den Katzen zu beschweren, dass ich nicht schlafen konnte.
Mit einem Wort: Ich war mir selbst zu viel. Ich dachte sogar daran, zurückzufahren zu Emma und ihr mit der Absicht auf die Nerven zu gehen, uns wieder zu vertragen und uns halbwegs wie zivilisierte Menschen zu benehmen.
Bis Nina klingelte und eindeutig scheu mit gesenktem Kopf fragte: »Ich hoffe, ich störe Sie nicht allzu sehr.«
»Wer immer Sie sind, kommen Sie einfach herein. Was kann ich für Sie tun?« Über ihre Schulter hinweg sah ich einen schwarzen Porsche Targa, und ich dachte automatisch: Ein verheultes, reiches Mädchen.
»Das weiß ich noch nicht«, antwortete sie trocken.
»Nehmen Sie Platz. Auf dem Sofa, wenn Sie mögen. Wollen Sie irgendetwas trinken?«
»Kaffee vielleicht«, sagte sie und setzte sich brav.
»Ich mache einen«, nickte ich und ging in die Küche.
Ich schätzte sie auf etwa fünfunddreißig. Sie war eine kleine, zierliche Frau, schlank gewachsen mit einem sehr fraulichen, weichen Gesicht unter kurzen, schwarzen Haaren. Sie trug eine schwarze, weiche Winterjacke über einem weißen Rollkragenpullover und darunter schwarze Jeans und schwere, dunkelbraune Wanderschuhe. Sie wirkte ruhig und sehr entschlossen, aber ihr Gesicht hatte sich verkantet, als habe sie Mühe, ihre Aufregung zu beherrschen.
Satchmo ging sie beschnuppern, auch Schneewittchen wollte ausprobieren, ob sie zu erobern war.
Sie streichelte die Tiere. Dann hob sie den Kopf und sagte: »Tja.« Und sah mich an. Ihre Augen waren von einem freundlichen Braun. »Also, es ist irgendwie schwierig, weil ich nicht weiß, wie ich anfangen soll.«
»Fangen Sie einfach mit dem Anfang an. Es wird einen geben.«
»Ja, es gibt einen. Da ist ein Mann in einem Steinbruch abgestürzt. Er ist tot, er wurde beerdigt, er hieß Dr. Christian Schaad, er war zweiundvierzig Jahre alt. Er war mein Mann.«
Sie griff zu dem Becher mit Kaffee vor sich und wollte ihn zum Mund führen. Das misslang, weil sie zittrig war, etwas von dem Gebräu lief über ihre schwarze Jacke.
»Kein Problem«, sagte ich schnell und fummelte ein Papiertaschentuch aus einem Paket. Ich reichte es ihr. »Ich wusste nicht, dass er verheiratet war.«
»Wir waren nicht verheiratet. Wir wollten heiraten. Im nächsten Monat. Oder gar nicht. Ich bin im vierten Monat schwanger.« Sie wischte flüchtig über die Flecken auf ihrer Jacke.
Plötzlich hatte ich den Eindruck, als sei sie kurz davor, in Tränen auszubrechen.
»Seien Sie ganz ruhig. Ich weiß zwar nicht, wie ich Ihnen helfen kann, aber würden Sie mir erklären, weshalb Sie ausgerechnet zu mir kommen?«
Sie trank etwas von dem Kaffee. »Ich glaube, dass jemand Christian umgebracht hat. Er fällt niemals so eine lächerliche Steilwand hinunter. Niemals! Außerdem wollte er hier jemanden treffen.«
»Sind Sie sicher?«
»Ganz sicher. Er hat es mir gesagt, bevor er hierher fuhr.«
»Hat er erwähnt, wen er treffen wollte?«
»Das hat er nicht, nein.«
»Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich eine Freundin anrufen, damit sie hören kann, was Sie erzählen.«
»Ich habe nichts dagegen«, nickte sie.
Ich rief Emma an und sagte, was zu sagen war. Sie zögerte nicht einen Augenblick und machte sich sofort auf den Weg.
Ich wandte mich wieder meinem Besuch zu: »Weshalb kommen Sie hierher?«, fragte ich erneut.
»Das ist ganz einfach«, sagte sie leise. »Alle Zeitungen haben über das Unglück berichtet. Merkwürdig ist nur, dass sein Name nicht genannt wurde, und auch nicht seine Bedeutung für diese Landschaft. Es hieß nur, er sei ein zweiundvierzigjähriger Geologe gewesen, aus Mainz, unterwegs auf einer Wandertour. Kein Wort davon, dass er für diese Landschaft zuständig war. Also, für den Abbau von Basalt und Vulkangestein. Es wurde von einem Unglücksfall gesprochen und von einem Touristen aus Mainz, der einen Unfall hatte. Und zwei Zeitungen erwähnten noch seinen grauen Golf, in dem seine Papiere gefunden wurden. Keine Meldung war länger als fünfzehn Zeilen. Ich habe mit den Redaktionen gesprochen, die sagten mir, ich könnte vielleicht mit Ihnen sprechen, weil Sie hier gut vernetzt seien.«
»Das ist richtig. Aber ich habe von dem Unfall auch nur in der Zeitung gelesen. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Entschuldigung, wie heißen Sie eigentlich?«
»Nina Brandt«, antwortete sie.
»Wann haben Sie das letzte Mal etwas gegessen?«
Sie sah mich erstaunt an, dann lächelte sie. »Heute Morgen. Ein Brötchen. Und unterwegs in Gerolstein bei McDonalds eine Kleinigkeit. Aber das war Pappe.«
»Pappe reicht nicht bei Schwangerschaft, das ist entschieden zu wenig«, entschied ich. »Was wird es denn?«
»Ein Junge«, schniefte sie. »Haben Sie Gurken?«
Ich hatte Gurken. Ein Glas Cornichons und ein Glas Senfgurken. Ich öffnete beide, legte eine Kuchengabel daneben und transportierte alles auf den Esstisch.
»Sie können schon mal zulangen. Was mögen Sie denn? Rohen Schinken? Leberwurst, ein paar heiße Würstchen, Käse, Salami? Ich kann sogar Spiegeleier.«
Emma rauschte auf den Hof.
»Ein Brot reicht mir völlig.«
Ich machte also ein paar Schnittchen, während Emma munter mit ihr sprach und wie üblich nicht die geringste Unsicherheit aufkommen ließ.
»Sie sagen, Sie waren mit dem Christian seit fünf Jahren zusammen. Und Sie wollten heiraten?«
»Er wollte heiraten. Ich nicht, für mich wäre das nicht nötig gewesen. Aber für meine Familie.«
»Was ist das für eine Familie?«
»Meine Eltern haben eine kleine Pharma-Fabrik, in Ludwigshafen. Wir stellen Medikamente her. Schon in der vierten Generation.«
»Also wohlhabend?«
»Ja, es reicht«, lächelte sie.
Emma wagte ein verschmitztes Lächeln, das trotz der Situation noch angemessen war. »Eine elitäre Familie? Eine etwas arrogante Familie?«
»Ja, kann man so sagen.« Sie errötete leicht.
»Dann passte also Christian nicht ganz in das elterliche Konzept«, stellte Emma kühl fest. »Sie hätten einen Chemiker anschleppen müssen, keinen Geologen.«
»Das ist richtig.«
»Kam es zu Streit?«
»Was spielt das jetzt für eine Rolle?«, fragte sie erstaunt.
Emma war mies drauf, sie war einfach schlecht gelaunt, keine Frage. Es klang schon patzig, als sie sagte: »Wir müssen doch herausfinden, Kindchen, ob Sie uns nicht eine wilde Geschichte auftischen, an der nichts stimmt. Ich wiederhole also: Kam es in Ihrer Familie wegen Christian Schaad zu Streit?«
Nina Brandt schien Emmas Tonfall nichts auszumachen. »Ja, kam es«, antwortete sie. »Mein Vater ist sehr jähzornig, mein Vater behauptete, Christian wäre auf unseren Betrieb scharf. Aber das gab sich.«
»Wie kann sich so etwas geben?«, fragte ich schnell.
»Meine Mutter entschied letztlich: Christian hat einen Doktortitel, kein Mensch will wissen, in welchem Fach. Also ist er gut für den Betrieb.« Sie lächelte schmal. »Außerdem sah er so aus wie der Traumschwiegersohn, einfach umwerfend.«
»Haben Sie ein Foto?«, fragte ich dazwischen.
»Ja, habe ich.« Sie stand auf, ging zum Sofa, wo ihre Handtasche lag, und kam zurück an den Esstisch. Sie legte das Foto vor mich hin. Der Mann sah aus, als sei er der Werbung für einen Männerduft entsprungen.
»Moment«, unterbrach Emma, griff nach dem Foto und sah es an. »Es gab also einen Krach? Einen Krach zwischen Ihrem Vater und dem Christian?«
Sie war verunsichert, sie murmelte: »Das kann doch jetzt nicht wichtig sein.«
»Das ist sehr wichtig«, berichtigte Emma erneut. »Schließlich wollen Sie doch, dass wir Ihnen glauben, oder? Also, es gab einen Krach.«
»Ja, gab es. Vor drei Jahren. Christian sagte: ›Ich bin nicht käuflich, ich brauche deinen elterlichen Betrieb nicht.‹ Also, Sie müssen wissen, ich bin das einzige Kind, meine Eltern halten mich ununterbrochen für kostbar.«
»Wollte der Christian also in den elterlichen Betrieb einsteigen oder nicht?«, fragte Emma.
»Ja, er hat gesagt, dass er das überlegen will.«
»Kommen wir jetzt zur Eifel«, bestimmte Emma energisch. »Was wollte Christian hier, ehe er verunglückte?«
»Wir waren oft hier, meistens an den Wochenenden. Wir haben den Lieserpfad gemacht und den Eifelsteig, wir waren überall, wo man gut wandern kann. Er kannte die meisten Pflanzen mit lateinischem Namen. Er war aus Manderscheid, er sagte von sich selbst, er sei ein Naturfreak. Er hat sich das Studium selbst erarbeitet – und den Doktor auch. Und er hatte mit der Eifel beruflich zu tun.«
»Das genau brauche ich jetzt ganz exakt«, bestimmte Emma.
Nina überlegte eine Weile und nickte dann. »Also gut. Christian war Beamter in der Behörde für Geologie und Bergbau. Die sitzt in Mainz und ist dem Wirtschaftsministerium angegliedert. Die regelt und schreibt vor, wo genau Basalt und Lava abgebaut werden dürfen. Es ist so, dass zwischen Gerolstein, Hillesheim und Daun die Steinbrüche, in denen das passiert, sehr, sehr zahlreich sind. Da wird an sage und schreibe sechsunddreißig Stellen abgebaut, die Flächen sind vierhundert Hektar groß. Das ist ein richtiger Flickenteppich, stört die Landschaft brutal. Jetzt hat die Behörde die Vorranggebiete für Rohstoffsicherung festgelegt, also festgeschrieben, wo weiter abgebaut werden darf. Und da ist Christian geplatzt, und hätte fast fristlos gekündigt. Es stellte sich nämlich heraus, dass bisher auf vierhundert Hektar abgebaut wurde, dass diese Fläche aber um das Fünffache erweitert wird. Das heißt, es darf in Zukunft auf zweitausend Hektar abgebaut werden. Bei einem Hektar reden wir von zehntausend Quadratmetern. Alle Naturschützer laufen Sturm, der NABU, der BUND, der Eifelverein, der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Landesjagdverband, alle eben.«
»Und wer soll nun deinen Mann umgebracht haben?«, fragte Emma beinahe schrill.
Nina überlegte wieder eine Weile und starrte dabei auf ihren Teller. »Alle, die daran interessiert sind, Vulkangestein in Ruhe und ungestört abzubauen und damit ein großes Geschäft zu machen. Es läuft darauf hinaus, dass der Vulkaneifelkreis, der seinen Namen von den Vulkanen hat, eines Tages keine Vulkane mehr hat, wenn das so weitergeht. Die Berge werden verschwunden sein, und also können sämtliche Touristen dahin fahren, wo der Pfeffer wächst, hier wird es nichts mehr zu sehen geben. Sagte Christian. Und ich fürchte, er hat recht.«
»Der Radersberg«, nickte ich. »Wenn du aus dem Fenster hinter dir siehst, siehst du den Radersberg über Brück. Der war noch vor dreißig Jahren so hoch, dass im Winter die Kinder von da oben bis hier unten an die Kirche rodeln konnten. Der Berg ist jetzt weg, es gibt ihn nicht mehr.«
»Es geht also um Geld«, murmelte Emma leise.
»Um ziemlich viel Geld«, nickte Nina. »Und Christian sagte, die Bevölkerung sei nicht genügend aufgeklärt ...«
»Moment, junge Frau«, Emma zündete sich einen ihrer schrecklich stinkenden holländischen Zigarillos an. »Wie weit ist dein Mann denn in diesem Konflikt gegangen?«
»Er hat seinen Chef um ein Gespräch gebeten. Das hat er auch gekriegt. Er hat gesagt, er könne diese riesigen Ausweitungen der Abbauflächen nicht mittragen. Der Chef hat erwidert, diese Flächen seien ja nur für einen möglichen Bedarf in der Zukunft ausgewiesen, niemand rechne damit, dass jemand auftaucht, der das durchzieht. Christian hat erwidert, dass sich immer jemand finden würde, der das logistisch auf die Reihe bringt und die Berge komplett klaut. Der Chef hat erwidert, genau das sei aber die Aufgabe der Behörde: festzulegen, wo in Zukunft abgebaut werden darf. Christian hat gesagt: Genau das könne es nicht sein, alle Gemeinden seien zur Nachhaltigkeit verpflichtet, sie müssten die Landschaft erhalten. Christian hat geschrien: Sie klauen den Eiflern die Berge! Er hat mir gesagt, sie hätten sich fast geprügelt.«
»Sie haben sich also nicht geprügelt. Was machte dein Mann denn anschließend?« Emma war hochkonzentriert.
»Sie haben sich geeinigt, dass er erst einmal einen anderen Aufgabenbereich bekommen sollte, bis sich der Zorn bei beiden gelegt haben würde.«
»Dein Mann kam trotzdem in die Eifel. Was wollte er hier?« Emma zerdrückte ihren Zigarillo im Aschenbecher.
»Er wollte jemanden treffen. Das hat er mir gesagt. Er hat gesagt, eine wichtige Figur aus der Opposition, das weiß ich noch.«
Emma war schnell. »Mann oder Frau?«
»Ich nehme an, einen Mann. Aber das weiß ich nicht genau. Er hat dazu nichts gesagt, und ich habe auch nicht gefragt.«
»Stand er mit irgendjemandem in der Eifel in telefonischer Verbindung?«
»Das nehme ich an, aber ich weiß es nicht.«
»Hast du sein Handy nicht abgefragt? Wo ist dieses Handy?«
»Bei seinen Sachen. Nein, halt, stopp! Sein Chef hat mich darum gebeten. Er wollte nachsehen, ob Christian irgendwelche Absprachen bei anderen Themen mit anderen Behörden getroffen hatte.«
»Sieh mal einer an«, murmelte ich.
Einen Augenblick herrschte Schweigen.
Dann räusperte sich Nina und sagte kleinlaut: »Das war wohl dumm.«
»Muss nicht sein«, erklärte Emma großzügig. »Ich würde mir das Handy aber geben lassen. Und ich würde fragen, ob irgendetwas an der Liste der eingetragenen Rufnummern geändert wurde. Hast du irgendeine Vorstellung davon, was er hier in dem Steinbruch in Walsdorf wollte?«
»Es gab einen Grund, weshalb er sich immer wieder um Walsdorf kümmerte. Das war die Westdrift.«
»Was heißt das?«, fragte ich.
»Der Abbau in Walsdorf ist weit vorangeschritten, der Berg ist fast nicht mehr da. Und er liegt genau vor dem Dorf in der Westdrift, er schützt das Dorf. Hier in der Eifel kommen die Atlantikwinde sehr direkt und heftig an. Der Berg ist fast verschwunden, die Winde treffen ungehindert auf das Dorf. Das macht einen Riesenunterschied. Das kann so weit gehen, dass Hausbesitzer ihre Häuser nicht mehr verkaufen können, und auch im Jahresdurchschnitt mit anderen Temperaturen rechnen müssen. Und die Leute müssen in den Gärten und auf den Wiesen und Feldern mit anderen Wachstumsrhythmen rechnen.« Sie fischte sich ein Stück Senfgurke aus dem Glas und schnitt es in kleine Stückchen.
»Ich gehe mal telefonieren«, sagte ich. »Da gefällt mir einiges nicht.«
Ich ging hinauf in mein Büro und hoffte, dass ich Stephan Sartoris vom Trierischen Volksfreund privat erwischen konnte. Ich hatte Glück.
Nach einigen einleitenden Erklärungen kam ich direkt zum Punkt: »Hör mal, da ist ein Geologe namens Christian Schaad in Walsdorf im Steinbruch zu Tode gestürzt. Niemand hat seinen Namen veröffentlicht, obwohl der bekannt war. Seine Funktion wurde auch verschwiegen. Warum?«
»Weil jemand von deren Pressestelle am gleichen Tag händeringend angerufen hat, wir sollten bitte den Namen nicht nennen und auch die Funktion nicht. Der Grund war, dass sämtliche Naturschützer sowieso auf den Barrikaden sind und dieses Amt in Mainz anstinken. Eine Art Dauerkrieg. Das ist so was wie ein Eifeler Stuttgart 21. Das hätte einen unnötigen Wirbel geben können. Sie versicherten mir, dass er rein privat in Walsdorf gewesen sei, auf einer Wanderung. Ich habe mit den anderen gesprochen, also mit der Eifelzeitung, dem Wochenspiegel, der Rheinzeitung in Koblenz und so weiter.« Dann stockte er und hüstelte. »Hat da etwa jemand nachgeholfen? War das mit der Wanderung gelogen? Bist du an der Geschichte dran?«
»Das weiß ich, ehrlich gestanden, noch nicht. Ich danke dir jedenfalls für die Auskunft.«
»Gerne. Aber ruf mich an, bitte, wenn es in der Sache etwas Neues gibt.«
»Das mache ich«, versprach ich und trennte die Verbindung.
Ich ging wieder hinunter zu den Frauen und sagte ihnen, was ich erfahren hatte. »Es gibt also einen guten Grund, weshalb sie nichts daraus gemacht haben.«
»Aber jetzt riecht die Sache ziemlich säuerlich«, murmelte Emma. Dann wandte sie sich an Nina Brandt: »Und du bleibst dabei: Er hatte einen beruflichen Grund, hier zu sein?«
»Hatte er. Er hat gesagt, er müsse irgendetwas klarziehen. Und er hat gesagt, er treffe jemanden.«
Mein Handy meldete sich, ich nahm das Gespräch an und hörte eine wohlvertraute Stimme: »Ich muss mit dir sprechen.«
»Ja«, murmelte ich. »Wo bist du denn?«
»Bei meinen Eltern, ich bin eben aus Stuttgart gekommen.« Sie schnaufte. »Ich denke mal, es ist dringend.«
»Ja, ja, ich bin hier«, sagte ich und drückte auf den roten Knopf des Gerätes.
»Gabi?«, fragte Emma.
»Ja, sie kommt gleich her.«
»Ich brauche auch noch ein Hotel«, sagte Nina. »Ich will nicht nach Mainz fahren, nicht in unsere leere Wohnung.«
»Du kommst zu mir«, entschied Emma.
»Hast du mit Rodenstock telefoniert?«, fragte ich.
»Habe ich. Er hat angefangen mit dem Satz: ›Ich muss ziemlich verrückt gewesen sein‹.«
»Das ist doch schon mal etwas.«
Dann meldete sich mein Handy erneut, und eine Männerstimme sagte: »Kann ich bei Ihnen die Lebensgefährtin von Rat Rodenstock erreichen?«
»Ja, können Sie.« Ich reichte Emma das Gerät.
Sie hörte eine Weile zu, beendete das sehr einseitige Gespräch und erklärte uns dann: »Einen Fall Norbert Bleckmann wird es nicht geben. Der Staatsanwalt hat entschieden, dass bei einem so teuren Auto die blankgeputzte Beifahrerseite wahrscheinlich nichts anderes bedeutet, als dass irgendjemand im Auftrag Bleckmanns den Wagen gründlich saubermachte. Eine Tankstelle etwa.«
»Das kann man so sehen«, nickte ich.
3. Kapitel
Es regnete leicht, und es war 22 Uhr, als sie auf meinen Hof rollte.
»Ich bin müde«, sagte sie leise, als sie an mir vorbei in das Wohnzimmer ging. Sie berührte mich nicht, sie ging steifbeinig zum Sofa und setzte sich so entrückt, als habe sie diesen Raum niemals vorher betreten.
»Ich hoffe, du hast in Stuttgart alles erledigen können.« Ich dachte: Ich komme dir nicht entgegen. Nicht einen Zentimeter.
»Ja, habe ich. Hier riecht es nach Emmas Zigarillos.«
»Ja, sie war bis eben hier.« Ich stopfte mir eine gebogene Radford’s, die ideale Konferenz-Pfeife mit einer edlen Straight-Grain-Maserung unter Schiffslack, die ideale Waffe gegen Stress. Ich setzte mich in den Sessel ihr gegenüber und zündete die Pfeife an.
»Also, wir haben viel geredet.« Sie sah mich nicht an, sie spulte ein Programm ab, das sie sich zurechtgelegt hatte. »Da kamen viele Sachen zur Sprache. Er hat gesagt, dass er immer noch nicht versteht, weshalb ich ihn verlassen habe. Da kam dann eines zum anderen.«
»Du musst es dir nicht so schwer machen«, sagte ich.
»Aber ich will es erklären.« Sie wurde heftig. »Du musst mich ausreden lassen.«
»Natürlich. Entschuldige.« Die Pfeife zog nicht, ich fummelte den Tabak mit dem Pfeifenmesser heraus und stopfte sie neu. Ich dachte: Sie ist eine sehr hübsche Frau, aber nicht mehr für mich.
»Also, wir haben viel geredet, und er sagte, er müsse unbedingt darüber sprechen, weshalb ich denn gegangen bin. So fing das alles an. Jedenfalls waren wir sehr fair und haben das alles durchgesprochen, und ich habe in einem Hotel gewohnt.«
Die Katzen kamen von irgendwoher und maunzten sie an.
»Er hat nicht verstanden, weshalb ich gegangen bin, und seine Eltern auch nicht. Und sie haben mir keine Vorwürfe gemacht, und alles verlief sehr harmonisch. Ich habe jedenfalls verstanden, was sie eigentlich wollten.«
»Und jetzt gehst du zu ihm zurück«, sagte ich.
»Doch nicht so einfach«, fauchte sie heftig.
Diesmal zog die Pfeife. »Es ist aber sehr einfach«, nickte ich. »Wir sind seit einem Jahr ein Paar. Irgendwann hast du angefangen, mit deinem Exmann zu telefonieren. Sag jetzt nicht nein, es war einfach so. Besonders um Weihnachten herum. Du hast viel mit ihm gesprochen. Dann bist du zu ihm gefahren. Vor ungefähr zehn Tagen. Angeblich um Erbschaften zu korrigieren und Versicherungen umzuschreiben. Jetzt willst du zu ihm zurück, und ich will dir nicht im Weg stehen. Ich sage also: Fahr zu ihm, wenn du das so willst. Und das ist wirklich sehr einfach, und du musst mir nicht alle deine Gedankengänge verraten, und alles das, was du willst und nicht willst. Du musst auch keine Gespräche schildern. Es hat keinen Sinn, hier zu hocken und darüber zu grübeln, weshalb das so gekommen ist.«
»Du hast das alles aber nicht gewusst!«, stellte sie sehr scharf fest, als sei es wichtig, dass ihr die Überraschung gelungen war. Sie war tatsächlich beleidigt.
Das war die Sekunde, in der ich sauer werden wollte, aber auch die verging. »Nicht alles, nein, aber ich habe schon seit einer Weile verstanden, dass es keinen Zweck hat, um jemanden zu kämpfen, den man ohnehin nicht besitzen kann. Es ist der ewige Sieg des ungeheuerlich Banalen in dieser Welt. Und ich hatte genügend Zeit, das zu verstehen.«
»Du hast es also geahnt?«
»Das ist jetzt doch ganz gleichgültig. Du verlangst die Absolution, ich erteile sie dir.«
»Jaah«, murmelte sie sehr gedehnt. Dann fummelte sie ein Päckchen Zigaretten aus ihrer Handtasche und zündete sich eine an. »Meine Eltern verstehen das alles natürlich nicht, natürlich denken sie, ich sei total bescheuert, mein Vater hat nur rumgebrüllt, meine Mutter weint dauernd und weiß gar nicht, wohin mit sich selbst.«
»Eltern sind so«, sagte ich beruhigend.
Dann war da ein peinliches Schweigen.
»Tja«, sagte sie und drückte die Zigarette im Aschenbecher aus.
»Da ist noch etwas«, sagte ich. »Du hast noch einen Hausschlüssel, und oben ist ein Kleiderschrank voll mit deinen Sachen. Überall im Haus liegt irgendetwas herum. Das könntest du vielleicht abholen, und mir vorher Bescheid geben, damit ich dir nicht im Weg bin.«
Sie sah mich an und nickte, und eine Träne war unter ihrem linken Auge.
»Mach’s gut«, sagte ich.
»Vielleicht sieht man sich noch mal bei Gelegenheit«, murmelte sie.
»Ja, ja, schon gut«, murmelte ich. »Du weißt ja, wie man hier rauskommt.« Ich ging hinaus, die Treppe hinauf in mein Schlafzimmer, blieb vor dem Fenster stehen und starrte in die Nacht. Nach einer Weile hörte ich die Haustür zuklacken, dann startete sie ihr Auto.
Ich war nur ein wenig wütend, es reichte nicht, eine Fensterscheibe einzuschlagen. Das erstaunte mich.
Ich konnte nicht schlafen, ich setzte mich in mein Auto und rollte langsam und betulich nach Hillesheim, querte die schlafende Stadt in Richtung Jünkerath und bog dann nach rechts in die kleine Siedlung ab. Ich erreichte den Wiesenweg, der Am Wegrain hieß, und fuhr weiter geradeaus, bis die Biegung nach links kam, dann weiter bis dorthin, wo der Mercedes mit dem Toten gestanden hatte.
Dort blieb ich eine Weile stehen, sah mir den Bauernhof der Jaaxens zu meinen Füßen an. Ich hörte die dumpf-friedlichen Geräusche der Rinder in dem großen Stall, ansonsten war es totenstill.
Nach einer Weile zog ich wieder ab, fuhr auf die Bundesstraße in Richtung Jünkerath.
Ich wollte wissen, wo Bleckmann sich hätte ausruhen können. Ich fand nur eine als Rastplatz ausgewiesene Stelle auf der linken Seite der Straße, gute drei Kilometer weiter. Dazwischen aber die sehr breiten Einmündungen von mindestens sechs Waldwegen.
Ein Regenschauer ging nieder, ich nahm den Rückweg über Walsdorf und Zilsdorf nach Dreis und blieb zehn Kilometer lang hinter einem Lkw, der erstaunlich schnell fuhr und seinen Weg genau zu kennen schien.
Longerichs Goebbels-Biografie lenkte mich nicht ab, ich löschte das Licht und wartete auf Schlaf. Gegen vier Uhr morgens döste ich ein und wurde erst wach, als das Telefon neben mir unerträglich laut schrillte. Es war sieben Uhr.
Emma meldete sich, sie sagte heiter: »Guten Morgen. Wir haben jetzt noch eine Leiche. Wenn du magst, kannst du mich abholen.«
»Hat die Mordkommission angerufen?«
»Ja, hat sie. Ich stehe bei denen offenbar wieder ganz oben auf der Liste. Seit der Sache mit Bleckmann.« Jetzt feixte sie sogar: »Oder es hat doch mit Rodenstock zu tun. Als wollten die mich beschäftigen. Wenn die wüssten! Sie schicken jedenfalls erst einmal eine Notmannschaft raus zum Fundort, das dauert. Ich soll nur absichern, hat Kischkewitz gesagt, er kann so schnell nicht kommen. Also, was ist, Baumeister? Möchtest du lieber in Ruhe ausschlafen?«
»Bis gleich.«
Fünf Minuten später war ich unterwegs, und froh abgelenkt zu sein.
Emma stand schon in der Haustür und rutschte auf den Platz neben mir.
»Wir müssen zu Rosi eins vor der Autobahnauffahrt auf die A1.«
»Etwa eine Nutte?«
»Nein. Es ist eine alte Frau, sagte er.«
»Schläft die Kleine wenigstens?«
»Die Kleine ist achtunddreißig. Ja, sie schläft. Wie war Gabi?«
»Ende, aus und vorbei.«
Sie schwieg einen Moment, dann fragte sie: »Tut es weh?«
»Ziemlich.«
»Das kommt bei dir in der letzten Zeit häufig vor.«
»Ja, das ist der Teil in mir, der niemals erwachsen wird.«
»Wir werden das schon schaffen«, murmelte sie tapfer. »Hat es lange gedauert?«
»Nur ein paar Minuten. Sind Bullen dort?«
»Ja, eine Streife.«
Unwillkürlich wurde ich so schnell, dass ich in einer Kurve vor Kerpen die Reifen zum Quietschen brachte.
»Langsam!«, mahnte Emma.
»Wir sollten übrigens von der Vorstellung Abstand nehmen, dass Bleckmann zufällig auf den Wiesenstreifen oberhalb des Hofes von Jaax gefahren ist«, sagte ich. »Ich traue der Geschichte nicht mehr, ich habe die Begebenheiten vor Ort ausgemessen. Also, egal aus welcher Richtung du kommst und wo du hin willst, du biegst von der Bundesstraße ab in die kleine Siedlung. Die ist exakt 380 Meter lang. Dann beginnt der Feldweg, der Am Wegrain heißt. Wahrscheinlich ist der Weg als Straße ausgewiesen, weil er bereits zum Bauland erklärt wurde. Es geht zweihundert Meter geradeaus. Dann biegt der Feldweg scharf links ab. Bis zu der Stelle, an der Bleckmanns Mercedes stand, sind es weitere 220 Meter. Es sind alles in allem achthundert Meter. Nehmen wir an, er war müde und wollte eine Weile ausruhen. Dann ist der Weg durch die Siedlung auf die Wiesen hoch nicht zu erklären, viel zu lang und viel zu kompliziert. Und du kannst damit auch nicht erklären, wieso Bleckmann am Ende der kleinen Siedlung den Asphalt der Straße verlässt und den Feldweg nimmt. Wenn er aus Richtung Jünkerath kam, ist er an einem Parkplatz drei Kilometer vorher vorbeigefahren, aber auch an sechs sehr breiten Einmündungen von Waldwegen. Kam er aus Hillesheim, konnte er mitten in der Nacht in jeder Nebenstraße ausruhen, sowie auf mindestens drei große ausgewiesene Parkplätze fahren. Ich nehme also an, er hatte einen Grund, genau diesen Punkt anzufahren. Er kannte diesen Punkt.«