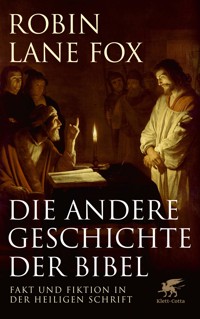31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Nominiert in der Shortlist zum »Besten Wissenschaftsbuch des Jahres« »Robin Lane Fox' neues meisterhaftes Buch kommt gerade im rechten Augenblick: eine lebendig geschriebene Geschichte der Medizin im antiken Griechenland.« Edith Hall, Literary Review Eindrucksvoll schildert Robin Lane Fox in seinem elegant geschriebenen Buch die bahnbrechenden Leistungen der antiken Griechen in der Medizin und zeigt, wie sie unsere moderne Heilkunst begründeten – mit packenden Schilderungen der Lebenswirklichkeit der Ärzte und der Erfahrungen der Patienten entfaltet er ein großes und noch wenig bekanntes kultur- und geistesgeschichtliches Panorama der Antike. Die antiken Griechen haben bedeutende Leistungen im Bereich der Medizin erbracht. Weltweit wird bis heute der »Hippokratische Eid« von Ärzten und Patienten gleicherweise bewundert: als Gründungsdokument für ethisches Verhalten und ärztliche Ideale. Scharfsinnig untersucht Robin Lane Fox, was wir wirklich über den Eid des Hippokrates wissen, und stellt die faszinierenden Schriften vor, die unter dem Namen dieses Arztes überliefert sind. Seine spannende Darstellung führt uns in die Welt der ersten Ärzte, die in Griechenland und in der ganzen Mittelmeerwelt tätig waren. Auf überraschende Weise erschließt der Autor die Bedeutung der Medizin für die griechischen Geschichtsschreiber (Herodot und Thukydides) und für die großen Dramatiker der attischen Bühne. Dieses anschaulich, lebendig geschriebene und packende Buch eröffnet viele unbekannte und neue Aspekte der Welt des Altertums – die Themen reichen von Frauen-Medizin, Herrschaft, Kunst, Sport bis hin zu Sex und Botanik. Eine außergewöhnliche Reise in die antike Kultur von Homer bis zu den dankbaren Erben in der islamischen Welt und der beginnenden westlichen Moderne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 847
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ROBIN LANE FOX
Die Entdeckung der Medizin
Eine Kulturgeschichte von Homer bis Hippokrates
Aus dem Englischen übersetzt von Susanne Held
KLETT-COTTA
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Invention of Medicine: From Homer to Hippocrates«
im Verlag Allen Lane, London
© Robin Lane Fox, 2020
Für die deutsche Ausgabe
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © bpk / Antikensammlung, SMB / Johannes Laurentius
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-96479-0
E-Book ISBN 978-3-608-11679-3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Karten
Vorwort
Einführung
Teil Eins
Von den Heroen zu Hippokrates
1
Homerisches Heilen
2
Poetische Krankheit
3
Reisende Ärzte
4
Von Italien nach Susa
5
Die Asklepiaden
6
Hippokrates: Fakten und Fiktionen
7
Das Corpus Hippocraticum
8
Die Erfindung der Medizin
Teil Zwei
Die Insel des Arztes
9
Die Epidemischen Bücher
10
»Auf Thasos, im Herbst …«
11
Der Hintergrund: Thasos
12
Bausteine der Geschichte
13
Kunst, Sport und Amtsausübung
14
Müll und Prostitution: Verhaltensregeln für das Leben auf der Straße
15
Patienten aus den besten Kreisen
Teil Drei
Die Denkweise des Arztes
16
Am Krankenlager
17
Gefilterte Realität
18
Retrospektive Diagnose
19
Philosophen und Dramatiker
20
Epidemien und Geschichtsschreibung
21
Hippokratischer Einfluss
22
Von Thasos nach Teheran
Tafelteil
Anhang
Endnote 1
Endnote 2
Endnote 3
Anmerkungen
Liste der Abbildungen
Abbildungsnachweise
Bibliographie
Register
Für Leo Lane Fox
ἐν τοῖς παθήμασιν ἀνδρειοτάτῳ
Die Medizin ist nicht nur eine Wissenschaft und eine Kunst: Sie ist außerdem eine Weise, mit anteilnehmender Objektivität auf den Menschen zu schauen. Warum sollte man sich andernorts umschauen, wenn man über die moralische Natur des Menschen nachdenkt?
Owsei Temkin, The Double Face of Janus (1977), 37
Der Arzt sieht schreckliche Dinge, berührt Unerfreuliches und bringt eine Ernte persönlicher Qualen aus den Missgeschicken anderer Menschen ein, wohingegen die Kranken aus den schlimmsten Notlagen, Krankheiten, Qualen, Schmerzen, und vom Tod dank des [Medizin-]Handwerks erlöst werden.
Hippokratischer Text Über die Lüfte, um 400 v. Chr., 1.1
Karten
Vorwort
»Medizin« und »Doktor« sind Wörter, die aus dem Lateinischen stammen, aber sie haben praktische, ethische und intellektuelle Wurzeln im Griechischen, die zu den bemerkenswertesten Vermächtnissen der antiken Welt gehören. Ich nähere mich ihnen als Historiker. Ausgezeichnete Untersuchungen von Koryphäen auf dem Gebiet der Antiken Medizin haben in einer langen Tradition fast jeden Text und jedes Thema beleuchtet, die dieses Buch enthält. Historiker ziehen ebenfalls mit großem Gewinn medizinische Texte zurate, die sie direkt neben die großen Historiker Herodot(1) und Thukydides(1) stellen können. Diese beiden Zweige der Gelehrsamkeit – der historische und der medizinische – haben sich in parallelen Bahnen bewegt und dabei nicht immer Kontakt miteinander aufgenommen. Ich hoffe zu zeigen, wie beide selbst heute noch davon profitieren können, wenn sie in einen engen Zusammenhang gebracht werden.
Mein Titel enthält eine spezifische Anspielung. Die Begriffe Doktor, Heiler und Medizin haben moderne Obertöne, die auf die antike Welt nicht immer passen, doch gab es fähige Ärzte in vielen ihrer Kulturen, einschließlich von Babylon(1) und Ägypten(1), die beide innerhalb der Reichweite der Griechen lagen. Auch waren die Heilkunst und die Verwendung von Heilmitteln(1) auf Pflanzenbasis schon lange vor Homer(1) oder jedem erhaltenen griechischen medizinischen Text weit verbreitet. Fachleute auf diesem Gebiet wehren sich wie ich gegen die Vorstellung einer in sich abgeschlossenen Entdeckung oder Erfindung der Heilkunst im 5. Jahrhundert v. Chr. Allerdings gab es nur bei den Griechen Autoren, die eine neue Methode und also ein neues Handwerk der Medizin verkündeten. In diesem spezifischen Sinn ist der Buchtitel zu verstehen.
Zu diesem breit untersuchten Feld habe ich neue Dinge beizutragen. Ich habe durchweg mit den zugrundeliegenden antiken Quellen gearbeitet, die es mir ermöglichten, Positionen auszuwählen und teils auch zurückzuweisen, die in modernen Untersuchungen meiner Themenfelder vertreten werden. Außerdem habe ich ausgewählt, was ich von den antiken Belegen anführe. Auswahl und Ablehnung geben meinem Buch eine charakteristische Struktur und Stoßrichtung. Ich präsentiere außerdem eine neue Datierung für die Texte, auf die ich im zweiten und dritten Teil zu sprechen komme, und ich stelle sie infolgedessen in einen neuen sozialen, kulturellen und intellektuellen Zusammenhang. Das hat weitreichende Folgen.
Meine Hauptthemen sind Epidemische Ärzte, Personen, die, während ich dieses Buch beende, eine beklemmende Bedeutung gewonnen haben. Mein Interesse an ihnen stammt jedoch aus ganz anderen Wurzeln, von denen einige zeitlich weit zurückreichen. Hippokratische Medizin war eines der ersten Themen meines späteren Tutors in Oxford, Geoffrey de Sainte Croix(1), die er mit mir während unseres ersten prä-tutorialen Treffens im Jahr 1967 besprach. Schon damals packte er das Thema mit seiner Energie und seinem außerordentlichen weiten Horizont an. Ich stelle erfreut fest, dass mein Kapitel über Thukydides und Medizinschriftsteller in einem entscheidenden Punkt mit seinen tiefschürfenden, 1972 veröffentlichten Seiten über dieses Thema übereinstimmt. Ich hatte diese Überschneidung vergessen, als ich meinen Text abfasste. Seinem inspirierenden Verständnis griechischer Wissenschaft, einem manchmal vergessenen Aspekt seiner Gelehrsamkeit, verdanke ich mein fortgesetztes Interesse an diesem Gegenstand.
Zehn Jahre später sah ich mich zu seinem Nachfolger als Tutor ernannt. Während ich neue Vorlesungen über das Zeitalter von König Philipp und Demosthenes vorbereitete, entdeckte ich, dass die ersten Erwähnungen von Philipps(1) Katapulten sich weitgehend unbeachtet in einem der medizinischen Epidemie-Bücher versteckten. In ständiger Rebellion gegen einen vorgegebenen Lehrplan bog ich also vom offiziellen Pfad ab, um die anderen Epidemischen Bücher zu lesen, und fragte mich anschließend, wie moderne Fachleute dazu kamen, sie mit so großer Zuversicht zu datieren. Schnell fand ich heraus, dass sie die beiden frühesten Bücher auf die monumentalen Inschriften städtischer Magistrate auf Thasos(1) bezogen. Aber als ich dann die vorherrschenden Begründungen für die Datierung der Namen auf diesen Listen näher in Augenschein nahm, fiel mir das erste der beiden gravierenden Probleme auf, die Thema des dreizehnten Kapitels dieses Buchs sind. Die fragmentarischen Listen, so meine spontane Schlussfolgerung, mussten in eine andere Ordnung gebracht werden.
Mit einer amateurhaften Neuanordnung der wichtigsten Inschrift in der Hand suchte ich David Lewis(1), den großen Fachmann für Epigraphik am Christ Church College in Oxford auf. Er hörte sich meine Ausführungen bis zu Ende an, dann sagte er, er habe seit 1955 in eine ähnliche Richtung gearbeitet, und ich müsse mehr Mut haben; offenbar müsse er über das Thema eines Tages einen Vortrag halten. Ich zog mich erst einmal diskret zurück, doch im Herbst 1993 löste er sein Versprechen ein – in einer Einzelveranstaltung in Oxford, die noch von zwei anderen Personen besucht wurde, an deren Identität ich mich nicht mehr erinnere und die ich bisher auch nicht klären konnte. Nach einem langsamen Beginn stellte er uns seine eigene zwar komprimierte, doch detailreiche Neuordnung der beiden wichtigsten Listen der Magistrate von Thasos(2) vor und schloss freundlicherweise mit den Worten, dass diese Neuordnung eine Person aus seiner Zuhörerschaft nicht überraschen werde. Notizen, die er zu diesem Vortrag anfertigte, befinden sich nicht unter den nach seinem frühen Tod im Jahr 1994 aufbewahrten Schriften. Der Verwalter seines literarischen Nachlasses, Peter Rhodes(1), klärte mich auf, er habe keine Anweisung gehabt, etwas mit diesem Thema Zusammenhängendes aufzuheben, und er habe auch nicht gewusst, dass Lewis sich damit eingehend beschäftigt hatte.
Seit 1994 hat das Studium der thasischen(3) Inschriften weitere Fortschritte gemacht, und neue Stücke wurden veröffentlicht. Meine Erinnerung an die allgemeine Form der Rekonstruktion von Lewis(2) lässt mich vermuten, dass er sie zweifellos überarbeitet hätte. Allerdings glaube ich, dass ich während der Abfassung dieses Buches ein weiteres Hindernis entdeckt habe, das der gängigen Datierung im Wege steht, einen Umstand, den er im Jahr 1993 angeführt haben muss. Unterstützt wurde ich außerdem durch seine Zustimmung zu dem Umstand, dass das Datum der medizinischen Texte, die üblicherweise auf die Datierung der Magistrate in den Inschriften bezogen wird, viel früher liegt, als Fachleute es bislang annahmen.
Jeder, der sich auf die herausfordernde Inschriftenkunde von Thasos(4) einlässt, steht in der Schuld früherer Interpreten der Funde. Mein Bewusstsein der Relevanz dieses Bereichs für medizinische Studien wurde bald durch zwei brillante Studien von Karl Deichgräber(1) aus den Jahren 1933 und 1982 verwandelt, so kühn einige der dort angestellten Konjekturen auch sind. Eine weitere Schuld reicht tiefer. Das Studienobjekt gäbe es überhaupt nicht ohne die jahrzehntelange hingebungsvolle Arbeit von Mitgliedern der Französischen Schule in Athen auf Thasos. Ihre Veröffentlichungen liegen meinen Kapiteln über die Archäologie, Topographie und Epigraphik der Insel zugrunde und bleiben die maßgebliche Ressource für jeden Wissenschaftler, der sich mit dem Thema befasst. Die Arbeit von unter anderem Jean Pouilloux(1), François Salviat(1) und Patrice Hamon(1) ist entscheidend für die noch unabgeschlossene Restauration und Interpretation der wichtigsten Inschriften. Ohne sie würde ich keinen der damit zusammenhängenden Aspekte verstehen.
Patrice Hamon(2) hat sie mit aller Klarheit durchdrungen, nicht nur in zwei hervorragenden, 2015/16 und 2018 veröffentlichten Artikeln, sondern auch in der Diskussion und in den Bemerkungen, die er mit mir im Jahr 2019 freundlicherweise teilte. Ich bin ihm überaus dankbar für seine Zeit und seine Großzügigkeit. Als ich fertig war, erschien sein dritter Band des Corpus der thasischen(5) Inschriften, eine hinsichtlich ihres sicheren Urteils, ihres Ausmaßes und ihrer Gelehrsamkeit exemplarische Arbeit. Ich hatte Zeit, meinen Text mit seiner Hilfe noch einmal zu überprüfen, und in einer Endnote 1 bin ich auf einige der darin angeregten Beziehungen, die sich auf den Inhalt meiner Kapitel 12 und 13 beziehen, eingegangen. Sie werden sich deutlicher herauskristallisieren, wenn die Listen der thasischen(6) Magistrate in künftigen Bänden des Corpus einmal publiziert sind. Sein Verständnis der Prosopographie der Listen, der Buchstabenformen der Inschriften und der wahrscheinlichen Form der Listen insgesamt ist ein entscheidender Beitrag zu den Fragen der zugrunde liegenden Chronologie, doch die Antworten beruhen nach wie vor auf Wahrscheinlichkeiten, nicht auf Gewissheiten. Ich möchte betonen, dass meine Neudatierung der medizinischen Texte nicht von meiner hier vorgeschlagenen Neudatierung der Spalten dieser Listen abhängt. Dafür gibt es unabhängige triftige Gründe, auch falls die Neudatierung der Spalten irgendwann aufgrund anderweitiger zwingender Beweise ausgeschlossen werden sollte.
Eingehendes Wissen über Thasos(7) aus erster Hand erhielt ich mit Alexandra Kasseri, einer idealen Begleiterin selbst in extremen Umständen wie Waldbränden und nächtlichen, wie von Zeus gesandten Blitzen. Ihre detaillierte Kenntnis der Topographie und Archäologie des Festlands prägten und verwandelten meinen Eindruck von dem, was ich vor mir sah. Später teilte auch Yangos Chalazonitis seine Fachkenntnisse mit mir, indem er mir dankenswerterweise einschlägige Auszüge aus seiner Oxforder Doktorarbeit zukommen ließ. Auf Thasos war Konstantina Panoussi eine unschätzbare Führerin durch das Museum und seinen Bestand sowie zum Umfeld und zu den Altertümern der Insel, und sie ließ mich an ihrem umfangreichen lokalen Wissen Anteil haben. Dann las sie freundlicherweise einen Entwurf meines vierzehnten Kapitels und gab hilfreiche Kommentare dazu ab. Ich danke ihr – ebenso wie auch Tony und Manuela Wurch Kŏzelj – für ihre Zeit, ihre Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit. Weitere Unterstützung erhielt ich von Leah Lazar.
Als Gefolgsmann zu Fuß hinter den umfangreichen Bataillonen der Experten aus dem Fach Alte Medizin verdanke ich sowohl ihren früheren wie ihren heutigen Gelehrten sehr viel. Die Werke von Emile Littré sind nach wie vor aufgrund ihrer Reichweite und ihrer Vielfalt ehrfurchtgebietend, und nach wie vor lerne ich daraus Neues. Die Arbeiten von Ludwig Edelstein und Owsei Temkin sind immer bereichernd, ebenso die englischen Übersetzungen und Anmerkungen von W. H. S. Jones, der, so hoffe ich, die Rolle zu schätzen weiß, die Malaria in meinem Text spielt. Geoffrey Lloyd und Helen King schärfen das Denken und die Begriffe aller, die im Windschatten ihrer enormen Leistungen arbeiten. Ann E. Hansons zahlreiche Texte haben mein Bewusstsein für die Rolle der Frauen in diesem Zusammenhang und auch für die medizinischen Papyri erweitert. Besonders dankbar bin ich zwei Hochgeschwindigkeits-Lesern meines ersten Textentwurfs: John Wilkins und Vivian Nutton, dem großen Experten für antike Medizin, der schnell die schwachen Punkte aufspürte und mich dazu bewegte, diese noch einmal zu überdenken. Catherine Darbo Peschanski stellte mir freundlicherweise einen Text zu Verfügung, den sie in Oxford zum Thema des impliziten Denkens der hippokratischen Ärzte über Hitze und Fieber vortrug, später steuerte sie noch hilfreiche Kommentare zu verwandten Fragen bei. Robert Arnott lud mich ein, an der Tagung teilzunehmen, bei der sie und andere sich sehr hilfreich über antike und moderne Arten der Krankheitsdiagnose äußerten. Elizabeth Craik war mir sowohl mit ihren Texten als auch persönlich eine freundliche Führerin; sie organisierte einen Kongress in St. Andrews im Juli 2018, eine für mich immens hilfreiche Versammlung von Experten auf diesem Gebiet. Tomas Alusik und Matthias Witt haben mir mit ihren Sonderdrucken geholfen. Besonders danke ich Laurence Totelin für ihre Arbeit über Heilpflanzen, ein Gebiet, in dem ich auch selbst lange tätig war. Alain Touwaide verwandelte dann mein Verständnis dieses Themas, indem er mich an den Jahren der Forschung teilhaben ließ, die er in seinem Institute for the Preservation of Medical Traditions angestellt hatte, ein essentieller Beitrag zum Wissen um dieses Thema von Hippokrates bis Dioskourides und später. Meine Darstellung des Themas »Retrospektive Diagnose« im 18. Kapitel verdankt vieles meiner Freundin Annelieke Oerlemans in Leiden, Lutz Graumann in Gießen, der freundlicherweise das Kapitel vorab las, und vor allem Penelope Frith vom New College, die mein vages Medizinverständnis verwandelte und mit einschüchternder Geschwindigkeit antwortete.
Was die Epidemischen Bücher betrifft, so bin ich Robert Alessi überaus dankbar, dem Experten vor allem für die schwierigen Bücher 2, 4 und 6 und ihre Verwendung sowie die der anderen Epidemischen Bücher in der islamischen Welt. Freundlicherweise las er akribisch meine Seiten über diese beiden Themen und schickte mir seine Kommentare und Erkenntnisse, wozu Korrekturen meines Arabisch gehörten, am Vorabend des Brexit – ein unvergessliches letztes Geschenk an ein ehemaliges EU-Mitglied. Am tiefsten stehe ich bei Jacques Jouanna in der Schuld, der das internationale Studium der Hippokratiker in den vergangenen fünfzig Jahren verwandelt hat. Im Frühjahr 2017 hatte ich zwei Jahre Arbeit an diesem Buch hinter mir und kämpfte mit den zahlreichen Problemen des griechischen Textes der Epidemien, was dazu führte, dass meine Übersetzungen aussahen wie ein Minenfeld aus eckigen Klammern und Fragezeichen. Dann erstand ich in Paris seine meisterhafte Neuedition samt Kommentar zu den Büchern 1 und 3, das entscheidende Werk zu diesem Thema. Wo ich bereits Auffassungen formuliert hatte, die den seinen entsprachen, ließ ich die meinen stehen; eigens anzumerken waren diejenigen, die ich ihm verdanke oder die er differenzierter und klarer formulierte. Ich stimme nicht immer mit ihm überein, vor allem was Fragen der Datierung und Topographie betrifft, doch muss ich kaum betonen, wie viel ich und jeder, der auf diesem Gebiet arbeitet, seiner Edition verdankt, einem philologischen Meisterwerk, sowie seinen vielen Aufsätzen zu verwandten hippokratischen Fragen.
In Oxford ist es eine Freude und ein Gewinn für mich, mich täglich mit meinen Kollegen und Kolleginnen im New College austauschen zu können, mit William Poole, vor allem über frühmoderne Wissenschaftsprosa; mit Andy Meadows, vor allem über das Münzwesen; mit Paolo Fait über Platon, mit Jane Lightfoot über griechische Literatur und so vieles mehr, mit Robert Parker über griechische Religion und die Gefahren, die es mit sich bringt, wenn ich mir meiner Spekulationen zu sicher bin; mit Stephen Anderson über Feinheiten der griechischen Sprache, und mit David Raeburn über die griechische Tragödie, ein Thema, zu dem er, der Maestro, und die in seinem College entstandenen Arbeiten mein Verständnis verwandelt haben. Ich danke auch Yana Sistovari und ihrer Thasos Company für ihre faszinierende Aufführung der Bakchen in den College Gardens im Sommer 2017, der sich im Jahr 2018 eine Einladung nach Polen zu einer erneuten Aufführung anschloss, die mich dazu anregte, die Beziehung zwischen Euripides und medizinischem Wissen zu thematisieren. Besonderen Dank schulde ich Anna Blomley dafür, dass sie ihr intensives topographisches Wissen, vor allem über Thessalien, mit mir teilte, sowie für viele hilfreiche Ratschläge und Ermutigungen in Bezug auf verwandte Themen. Aus meinem weiteren Oxforder Kreis wurde ich freundlicherweise bei unterschiedlichen Fragen unterstützt von Peter Rhodes, Peter Thonemann, Aneurin Ellis-Evans, Alexy Karenowksa, Danuta Shanzer, heute in Wien, David Potter, heute in Ann Arbor, Peter Wilson, jetzt in Sydney, und einem meiner frühesten ehemaligen Schüler, Andrew Erskine, jetzt in Edinburgh.
Meine Verleger Stuart Proffitt und Lara Heimert äußerten sich sehr detailliert zu Form, Dunkel- und Einzelheiten meines Texts, was mich dazu brachte, in größeren Zusammenhängen und exakter nachzudenken. Dankbar bin ich auch Alice Skinner für Lektüre und Beistand, Mark Handsley für fachkundiges Lektorat, und Claudia Wagner für ihre Unterstützung beim Aussuchen von Bildern. Estella Kessler, Daniel Etches und Charlie Baker nahmen sich sehr geschickt des Tippens und Koordinierens meiner Bibliographie an.
Gerade als ich die Arbeit an diesem Buch beendet hatte, brach in China eine Epidemie aus und machte sich auf den Weg nach Westen, was den Themen Ansteckung, Beobachtung und Prognose – zentralen Themen meines Textes – eine zeitgemäße Wucht verleiht. Das führte dazu, dass ich darüber nachdachte, wie der Arzt, meine Hauptperson, damit umgegangen wäre. Die Ausbreitung einer Epidemie durch Reisende oder durch Menschen, die in anderen Ländern Zuflucht suchen, kommt in seinem Text nicht vor. Gleichzeitig möchte ich den Ärzten danken, die Mitglieder meiner Familie in anderen Umständen gerettet haben: John Sichel und John Ledingham für ihre Hilfe, Tom Cadoux Hudson, Richard Keys und seinem Oxforder Team für die Rettung meiner Tochter, James Ng für die Rettung der Hälfte meines Augenlichts, und Vesna Pavosevic und ihrem Team in der Great Ormond Street für die Rettung meines Enkels, dessen exemplarischer Tapferkeit dieses Buch gewidmet ist.
Robin Lane Fox
Einführung
Im 5. Jahrhundert v. Chr. gab es einzelne Griechen – lauter Männer –, die begannen, auf eine Weise zu denken und zu schreiben, wie es noch keiner zuvor versucht hatte. Nicht alle Griechen taten das, doch die Gedanken und Texte dieser Minderheit prägen noch heute die Art, wie auch wir denken und schreiben. Zu ihnen gehören Männer, die über Medizin, das Thema dieses Buchs, nachgedacht und geschrieben haben.
Ihre »Entdeckung der Medizin« war ein Element in einer breiteren Bewegung neuen Denkens. Im 5. Jahrhundert v. Chr. fingen die Griechen an, über Geschichte zu schreiben und dabei das Pronomen »ich« zu verwenden, also ihre eigenen Auffassungen auszudrücken. Im Nahen Osten waren Berichte über die Vergangenheit immer anonym und unpersönlich gewesen, als handle es sich um »den« Bericht, »das« Narrativ, und nicht die subjektive Darstellung einer Einzelperson.[1] In Babylon(2) und Ägypten(2) gab es viele Texte, die Gebrauch von Zahlen und Berechnungen machten, doch war es dann ein Grieche, Hippokrates von Chios(1) (um 440 v. Chr.), der erstmals theoretisch über Mathematik schrieb.[2] Philosophen, auch sie eine griechische Erfindung, begannen damit, die Unterschiede zwischen Wissen und Glauben zu erkunden und das Natürliche mit dem Herkömmlichen zu vergleichen. In der Mitte des Jahrhunderts erfanden einige von ihnen die politische Philosophie, ein entscheidender konzeptioneller Wandel in der politischen Auseinandersetzung seither.[3] Ende des Jahrhunderts gab es sogar einige, die argumentierten, es existiere kein naturgegebener Unterschied zwischen Sklaven und freien Männern, und Herr über einen Sklaven zu sein sei sogar ein Widerspruch zur Natur und daher ungerecht: die erste belegte Herausforderung dieses Grundelements altgriechischer Gesellschaften.[4] Andere leiteten ungefähr zur selben Zeit die Unterschiede in menschlichen Gemeinschaften von Unterschieden in Klima und Umwelt ab. Sie handelten erstmals über die Natur des Menschen als solche.[5]
Außerdem kam es zu Veränderungen im Sprech- und Schreibstil. Redner fingen damit an, sich von Fachleuten in einer neuen Fähigkeit unterrichten zu lassen, der Rhetorik, die anhaltenden Einfluss auf die Art ausübte, wie seither Prosa und Poesie geschrieben werden. In Athen(1) verfassten seit den 430er Jahren Bühnendichter, unter ihnen Aristophanes(1), die weltweit ersten politischen Komödien: Einige ihrer Stücke formulieren das erste, allerdings bei weitem nicht das letzte Wort über Populismus und über Demagogen, ein Begriff, den diese Komödiendichter erfanden.[6] Auch in Prosatexten wurden neue Themen angeschnitten. Gegen Ende des Jahrhunderts verfasste Simon(1) von Athen den ersten Text über die Reitkunst: ein entscheidender Moment für den »zentaurischen Pakt« des Menschen, seine Übereinkunft mit dem Pferd – als seien der Reiter und sein Ross theoretisch eine Einheit.[7] Gleichzeitig verfasste im griechischen Sizilien(1) Mithaikos(1) das erste Kochbuch der Welt, was dem puritanischen Platon(1) Pein bereitete, nicht jedoch der Nachwelt – denn keines seiner Rezepte blieb erhalten.[8]
Für dergleichen Veränderungen gibt es keine Parallelen in den benachbarten Kulturen, seien es Ägypter, Babylonier, Juden oder Perser(1): zunächst einmal hatten sie keine Philosophen. Doch die Griechen machten hier noch nicht Halt. Während des 5. Jahrhunderts verfassten sie Texte über Malerei und über die Anfertigung von Skulpturen – Künste, die griechische Künstler ebenfalls veränderten, womit sie die gesamte westliche Kunstgeschichte beeinflussten und sie markant von Kulturen des Ostens und, als er schließlich entdeckt wurde, des Westens abhoben.[9] Auch die Szenen, die auf dekorativer griechischer Töpferware gemalt waren, erfuhren eine Stilerneuerung und eine neue Bandbreite an Themen. Im letzten Viertel des Jahrhunderts eigneten sich die Maler die Vermischung und Abschattierung von Farben an, womit sie ihren Figuren Kontur und Tiefe verliehen. Apollodoros(1) wurde später als derjenige bezeichnet, der »als erster Objekte abbildete, wie sie erscheinen«, wobei er »Schattenmalerei« benutzte, um den lebensnahen Effekt zu erhöhen.[10] Mehr wissen wir nicht über diesen vergessenen Meister.
Auch die frei stehende Skulptur wurde revolutioniert. Vor dem 5. Jahrhundert v. Chr. hatten griechische Bildhauer den männlichen Körper bereits nackt dargestellt, aber in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts zeigten sie ihn in neuen Haltungen, sie stellten eine idealisierte Schönheit vor und einen Gesichtsausdruck innerer Versunkenheit, der sich von dem fixierten Lächeln der früheren griechischen Statuen deutlich unterschied. Die Künstler des 5. Jahrhunderts stilisierten die Konturen des männlichen Körpers auf neue Weise und veränderten die Gewichtsverteilung bei ihren Figuren. Möglicherweise wurden sie dabei durch eine neue Technik unterstützt, die vorbereitende Modellierung, bei der sie den Körper von innen her aufbauen, »Muskulatur und Fleisch in Ton …« hinzufügen konnten – so die Auffassung des Fachmanns, dessen Lebensthema sie sind –, und dann das lebensgroße Modell in Stein übersetzten: »Die archaische Skulptur war im Wesentlichen gemeißelt; die klassische Skulptur ist im Wesentlichen modelliert.«[11] Einer der klassischen Meister, Polyklet(1) von Argos, verfasste um 450 v. Chr. einen Text, den sogenannten Kanon, der erstmals die Maße und Proportionen des idealen männlichen Körpers definierte. Der Text hat nicht überlebt, ebensowenig Polyklets Meisterwerk in Bronze, der Doryphoros (Speerträger), den wir nur aufgrund späterer römischer Versionen in Marmor kennen. In ihnen hat der männliche Körper eine breitschultrige Massigkeit, die heutzutage nicht jedermanns Ideal von männlicher Schönheit entspricht.[12]
Diese Veränderungen in Denken und Techniken gingen einher mit Veränderungen in der politischen Praxis. Im weiteren Verlauf des 5. Jahrhunderts gab es immer mehr Griechen, die das von den Athenern(2) im Jahr 508 v. Chr. erfundene System der Demokratie praktizierten. Es war nicht ihr blassere moderner Schatten, die »repräsentative« Demokratie mit ihren politischen Parteien und Abgeordneten. Es war Regierung aufgrund der Mehrheitsentscheidung sämtlicher – männlicher – Bürger, zum Ausdruck gebracht durch persönliche Wahl bei öffentlichen Zusammenkünften zu jedem wichtigeren Thema. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts wurde der kulturelle Einfluss der Demokratie offensichtlich, nicht zuletzt, wenn große Mengen von Theaterzuschauern die übermütige Unverblümtheit der athenischen politischen Komödie genossen, was ohne einen demokratischen Kontext undenkbar wäre.
Das andere Wunder des griechischen Theaters, die Tragödie, verdankte der Demokratie ein weniger offensichtliches Element. Es gab keinen zwingenden Bezug zwischen der Demokratie und der Gattung Tragödie als solcher. Einige der bedeutendsten Tragödien des 5. Jahrhunderts wurden für Monarchien jenseits der Grenzen Athens(3) verfasst und dort auch uraufgeführt.[13] Allmählich erhielten jedoch die Diskussions- und Debattenszenen eine neue, für viele Handlungsabläufe entscheidende Note. Die Protagonisten diskutierten über Richtig und Falsch von Entscheidungen und Handlungen, ließen sich ausführlich über Schuld und Verantwortung aus, das Beabsichtigte und das Unbeabsichtigte. Seit 462 v. Chr. waren in Athen Reden über diese Themen vor großen, demokratisch bestimmten Geschworenengerichten gehalten worden, die als erste und letzte Instanz für die meisten Kriminalfälle der Stadt neu eingerichtet worden waren. Viele der Geschworenen, männliche Bürger, gehörten auch zu den gewaltigen Zuschauermassen, für welche die Dramatiker im Zentrum ihrer Stücke ähnliche Themen untersuchten.[14]
Die athenische Demokratie gab einige der herrlichsten Bauwerke des Jahrhunderts in Auftrag, darunter auch den in den 440er Jahren begonnenen ikonischen Parthenon; hier brachte die Demokratie jedoch keinen neuen Stil hervor. Die grundlegenden architektonischen Strukturen waren alle bereits zuvor erfunden worden. Und was die politische Philosophie betraf, so geschah auch hier durch die Demokratie keine Monopolisierung der Diskussion. Theoretiker dachten über die Ursprünge einer politischen Gesellschaft nach, erwogen sogar die Hypothese, dass allem ein Gesellschaftsvertrag zugrunde liege, doch der wichtigste theoretische Einfluss der Demokratie bestand darin, die Formulierung entgegengesetzter Theorien durch jene zu provozieren, welche die Demokratie verabscheuten.[15] Pamphletisten vertraten Auffassungen, die man in einer demokratischen Volksversammlung nicht hätte vorbringen können. Sie schrieben über Oligarchie, nicht Demokratie.
Diese unglaubliche Bandbreite an Leistungen war nicht das Ergebnis einer technischen Revolution. Dergleichen gab es nicht. Die zugrundeliegende Revolution war konzeptioneller Natur. In seiner schönen, sehr wahrscheinlich in den 440er Jahren entstandenen Tragödie Antigone legte Sophokles(1) seinem Chor mitreißende Worte über den Einfallsreichtum und den Fortschritt des Menschen in den Mund. Sein krönendes Beispiel war nicht die Kunst oder die Politik, sondern die Medizin. »Nur dem Tod zu entrinnen wird er kein Mittel erlangen, gegen schwere Krankheiten jedoch ersann er Hilfe.«[16]
Die Worte seines Chors klingen noch heute nach, und nie mit größerem Nachdruck, als wenn die Fähigkeit des Menschen, »Hilfe zu ersinnen«, zu einem entscheidenden Faktor in einer globalen Pandemie wird, gegen die Widerstand tatsächlich nur schwer möglich ist. Im Unterschied zu unseren Begriffen für die meisten Wissenschaften beruht »Medizin« nicht auf einem griechischen Wort. Es wurzelt im Lateinischen, aber weil die Römer griechische Medizinkenntnisse übernahmen, sind seine historischen Wurzeln dennoch griechisch. Im Unterschied zur Philosophie war die Medizin kein griechisches Monopol. Ärzte waren in anderen, älteren Gesellschaften schon seit Langem berühmt, vor allem in Ägypten(3), Indien(1) und Babylon(3); im 5. Jahrhundert v. Chr. jedoch gab es Griechen, die sich einer neuen Methode bewusst waren: Sie betrachteten Medizin als ein Handwerk, das sie erfunden hatten. Die »Entdeckung der Medizin« kann insofern ihnen zugeschrieben werden. An ihrer Spitze steht der große Name des Hippokrates(1), der auf der Insel Kos(1) geboren wurde und nach wie vor auf der ganzen Welt bewundert wird. Er wird allgemein als Gründungsvater einer auf Vernunft beruhenden Medizin und Medizinethik angesehen. Seine genauen Lebens- und Schaffensdaten sind jedoch nach wie vor Thema gelehrter Dispute.
Diese neuen griechischen Denker betrachteten den Körper des Menschen, den weiblichen wie den männlichen, als natürliche Einheit und erörterten Umgebung und Lebensstil, die für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit am zuträglichsten waren. Auch hier gab es keine technische Revolution, keine Wunderdroge, keinen Durchbruch in der Behandlung von Krankheiten. Der Wandel war auch hier konzeptioneller Natur. Nicht jeder, der medizinische Theorien vortrug, war notwendig Arzt. Da der Mensch Teil der natürlichen Welt war, bildete das Studium des Menschen und seiner Verfassung einen Teil der Naturphilosophie, das auch in diesem Kontext diskutiert wurde. Es äußerten sich also Philosophen zu dem Thema, während Ärzte mit – oder auch gegen – Ideen arbeiteten, die zuerst von Philosophen formuliert worden waren.[17] In Ägypten(4) oder Babylon(4) gab es ein vergleichbares Wechselspiel nicht.
Da die neue griechische Medizin nicht auf die Behandlungsräume der Ärzte beschränkt war, wurde auch in anderen Ausdrucksbereichen des 5. Jahrhunderts nach Auswirkungen ihrer Theorien geforscht. Sie wurde auf den neuen Skulpturenstil bezogen: »Balance, Rhythmus, Proportion, Harmonie und Symmetrie«, so eine recht optimistische Deutung, »sind die Sprache der griechischen Medizin, jedoch auch der darstellenden Kunst«, wie sie besonders bei männlichen Statuen seit der Mitte des 5. Jahrhunderts sichtbar sind.[18] Ein erweitertes medizinisches Verständnis von Adern(1) und Muskeln(1) ist außerdem, wenn auch nicht unbestritten, hinter der Darstellung nackter männlicher Körper in Statuen aus dem 5. Jahrhundert vermutet worden.[19] Für das Drama ist die »hippokratische Medizin«, ebenfalls nicht unangefochten, als prägendes Element bei der Entstehung der Tragödien des Euripides(1) angenommen worden.[20] Die medizinische Darstellung von Wahnsinn und seelischer Belastung, so wurde erwogen, liege der Darstellung ähnlicher Gemütszustände in den Stücken seit den 430er Jahren zugrunde, sei dies der Wahnsinn des Herakles(1) oder die Trance, aus der die arme, verblendete Agaue(1) in den (406 v. Chr. entstandenen) Bakchen, dem späten Meisterwerk des Euripides, erwacht.
Die neuen medizinischen Texte hat man auf einen demokratischen Kontext bezogen, als würden auch sie sich der Kultur offener und wetteifernder Diskussion in öffentlichen Versammlungen verdanken. Sogar mit dem neuen Feld der Geschichtsschreibung wurden sie in Verbindung gebracht. Auf den ersten Blick scheint das Interesse für medizinische Fragen für den Gründungstext der Geschichtsschreibung, Herodots(2) in den 420er Jahren fertiggestellte Historien, nicht bezeichnend zu sein, doch liefern seine neun langen Bücher zahlreiche Beispiele und Geschichten der ärztlichen Kunst. In den grandiosen Historien des Thukydides(2), die zwei Jahrzehnte später noch im Entstehen begriffen waren, ist die Anwesenheit der Heilkunde unübersehbar, sowohl in seiner Beschreibung der tödlichen Seuche, welche die Athener(4) ab 430 v. Chr. heimsuchte, wie als implizite Parallele für die Vorstellung von Wert des Geschichtsstudiums für die Nachwelt überhaupt. Außerdem präsentiert er eine führende politische Figur, die sich in einer öffentlichen Rede für die Heilkunst ausspricht. Fünfzehn Jahre nach dem Ausbruch der Pest beschlossen die Athener(5) im Jahr 415 v. Chr., eine Militärexpedition nach Sizilien(2) zu entsenden, allerdings wurde die Entscheidung ihrer Volksversammlung noch einmal vorgelegt. Thukydides erzählt, wie General Nikias(1), der wünschte, dass die Idee aufgegeben wurde, das vorsitzende Mitglied des Rats aufforderte, die Angelegenheit ein zweites Mal zur öffentlichen Abstimmung vorzulegen: Wenn er zögere, das zu tun, möge er erwägen, dass er in diesem Fall handeln würde wie der »Arzt der Stadt, wenn sie schlecht beratschlagt hat«. Dieser nach wie vor relevante Rat wird dann erweitert. Eine gute Regierung, so Nikias, sei dann gegeben, wenn »jemand seinem Land so viel wie möglich nützt oder nicht willentlich schadet«. Diese selbe Regel – »Gutes tun oder zumindest keinen Schaden anrichten« – war Ärzten in mindestens einem der heilkundlichen Texte im neuen Stil bereits anempfohlen worden.[21] Sie hatte ein langes Leben in der Medizinethik vor sich, aber ein weniger langes in der politischen Praxis.
Ein Problem bei der Beurteilung des Einflusses der neuen Medizin ist die schwierige Frage, wo und wann die erhaltenen griechischen heilkundlichen Texte verfasst wurden. Sie wurden letztlich alle in einer Sammlung zusammengefasst, im sogenannten »Corpus Hippocraticum«, allerdings sind sie undatiert, und der berühmte Name des Hippokrates ist für ihre nähere Bestimmung nicht hilfreich. Nicht genug damit, dass sich Fachleute darüber streiten, welche dieser Texte, wenn überhaupt einer, von Hippokrates(2) selbst verfasst wurde. Seine erste erhaltene Erwähnung findet sich in einem philosophischen Dialog Platons(2) aus der Zeit um 433 v. Chr., sie ist jedoch wenig informativ.[22] Schon in der Antike unternahmen Biographen und Erzähler den Versuch, die Lücke aufzufüllen, aber sie schrieben erst lange nach dem Tod des Hippokrates(3).
Ich will diese Fragen nochmals erwägen und mich dafür auf zwei berühmte medizinische Bücher im Corpus Hippocraticum konzentrieren, die ursprünglich ein einziges Buch waren. Ich werde erklären, weshalb sie zu Recht als Höhepunkte der neuen Medizin eingestuft werden, aber ich werde dafür argumentieren, dass sie aus einer Zeit stammen, die bislang noch niemand in Betracht gezogen hat. Sie sind allgemein ins späte 5. Jahrhundert v. Chr. datiert worden, in die Zeit des Sokrates(1) und anderer großer Denker und Autoren, deren rationale Argumentationsmethoden den natürlichen Kontext für das Denken ihres Autors zu bilden scheinen. Ich möchte diese Meinung widerlegen und damit die vorherrschende Auffassung über ihre Beziehung zum Denken des 5. Jahrhunderts.
Ich werde in drei Schritten vorgehen. Zuerst untersuche ich die Vorläufer dieser Texte, um herauszufinden, wie weit sie etwas Neues darstellten: Aus diesem Grund untersuche ich, was wir von Ärzten und der Heilkunst von den homerischen Gedichten bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts wissen. Dann möchte ich, ausgehend von der großen Sammlung griechischer medizinischer Schriften, dem sogenannten Corpus Hippocraticum, die Entdeckung der Medizin skizzieren, auf die sich diese beiden Bücher beziehen. Ich werde sodann das Blickfeld einengen und mich konzentriert mit einem Stück Lokalgeschichte befassen, um sie in Raum und Zeit zu verorten. Der überwiegende Teil ihres Inhalts verbindet sie mit einer bestimmten griechischen Insel-Stadt, die auch von der Archäologie her bekannt ist und aufgrund der vielen Inschriften, vor allem auf Steinquadern. Historiker des 5. Jahrhunderts konzentrieren sich nach wie vor auf Athen(6) und Sparta(1), die dominierenden Mächte in Griechenland nach 480 v. Chr. In meiner Darstellung stellt sich die »Ärzte-Insel« als der griechische Ort heraus, den wir ganz zu Beginn dieser Periode am genauesten in den Blick nehmen können – ein Ort, wo Athen nur am Rande vorkommt.
Anschließend werde ich die Denkweise der beiden Texte untersuchen. Ich werde – soweit es sie gibt – ihre Beziehungen zu Demokratie und Philosophie, zu Drama und Geschichtsschreibung beleuchten: Im 5. Jahrhundert bewegten sich Innovationen nicht alle gleichzeitig in eine Richtung. Außerdem werde ich untersuchen, wie diese heilkundlichen Texte sich von denen unterscheiden, die aus angrenzenden Kulturen überliefert sind: Etruskern(1), Ägyptern oder Babyloniern. Schließlich vergleiche ich sie mit ihren offensichtlichsten Erben, von denen einer, ein Grieche, ein ebenfalls vernachlässigtes Genie des späteren 5. Jahrhunderts ist. Er erkennt sie als Vorläufer an, doch unterscheidet sich seine Herangehensweise verblüffend von der ihren. Ein anderer Erbe ist kein Grieche. Es handelt sich um eines der Genies der islamischen Welt, rund 1400 Jahre später, der auf diese Bücher über einen indirekten Weg aufmerksam wurde. Die Art, wie er von ihnen Gebrauch macht, ist ebenso auf aufschlussreiche Weise anders – eine Weise, die ihre Qualitäten betont.
Diese dreiteilige Studie ist darüber hinaus implizit eine Erkundung dessen, was wir über die ferne griechische Welt wissen können, und wie und in welchen Grenzen wir das können. Der erste Teil, von Homer(2) bis zum Corpus Hippocraticum, stützt sich auf reizvolle, allerdings nur zufällig erhaltene Informationsbruchstücke: Texte, vor allem Epen; Objekte und Inschriften mit medizinischen Bezügen. Es handelt sich um bemerkenswerte Lichtstrahlen, aber jenseits von ihnen bleibt unserem Blick so viel verborgen. Der zweite Teil beruht auf offensichtlich verheißungsvolleren Überresten: nicht nur den heilkundlichen Texten selbst, sondern auch den archäologischen Erkenntnissen zu einer bestimmten griechischen Stadt aus über 150 Jahren, und vor allem zu ihren Inschriften, die an Umfang und zeitlicher Breite detaillierter sind als die Funde aus anderen Städten dieser Periode. Doch auch hier gibt es Grenzen für das, was scheinbar bombensichere Belege auszusagen scheinen. Der dritte Teil stützt sich auf gut erhaltene Texte, doch sie bedürfen ebenso einer Interpretation wie jedes neu in der Erde gefundene Objekt.
Im Zusammenspiel dieser Arten von Belegen mit der Realität, die sie früher umgab, liegt ein Teil der Faszination des Studiums der Alten Geschichte. Wir sollten diese ferne Vergangenheit nicht als etwas Selbstverständliches ansehen, als sei sie so gut bezeugt wie unsere Gegenwart. Ein Weiteres kommt hinzu: die Erkenntnis, dass selbst nach 2500 Jahren neue Orte und Datierungen stichhaltig sehr alten Gegenständen zugeschrieben werden können, die bislang falsch platziert wurden. Sie verändern unsere Wahrnehmung der griechischen Vergangenheit, ihren Übergang von dem, was wir das archaische Zeitalter nennen, zur Klassik; und zu dem Denken und den Ausdrucksweisen, die damit zusammenhängen. Sie haben außerdem einen Bezug zu unserem Blick auf die rätselhafte Figur des Hippokrates(4), den Vater der Medizin.
Teil Eins
Von den Heroen zu Hippokrates
Keines der Dinge, die [von der Medizin] gefunden wurden, kann dadurch gewusst werden, dass man nur mit den Augen schaut: Deshalb habe ich sie »nicht evident« genannt, und deshalb werden sie auch vom Handwerk [der Medizin] so erklärt. Es ist keineswegs, dass das, was »nicht evident« ist, überwiegen würde, aber es hat [bislang] dominiert: Dass es überwiegt ist möglich, insofern als die Naturen der Kranken Untersuchung erlauben, und diejenigen der Forscher sind naturgemäß auf Forschen ausgerichtet.
Über die Kunst, 11 (ca. 430–400 v. Chr.)
Sie [die Griechen] haben unter sich einen Eid geschworen, sämtliche Barbaren durch Medizin umzubringen, und genau das machen sie gegen Bezahlung, sodass man ihnen vertraut und sie ihr Zerstörungswerk ganz leicht vollbringen können.
Cato der Ältere, An seinen Sohn, in den 170er Jahren v. Chr., zitiert von Plinius dem Älteren, Naturkunde, 29.1–28.Hierin hat man einen impliziten Verweis auf den »Hippokratischen Eid« griechischer Ärzte entdeckt.
1
Homerisches Heilen
I
Lange bevor die ersten Texte über Heilkunst im 5. Jahrhundert v. Chr. verfasst wurden, waren Heiler und Ärzte in der griechischen Welt tätig. Es gab sie in der Palastgesellschaft der frühen mykenischen Periode (ca. 1400–1200 v. Chr.), aber die ersten uns namentlich bekannten Ärzte sind diejenigen, die rund fünfhundert Jahre später in Homers(3) Epen tätig sind (ca. 760–730 v. Chr.). Dann werden Ärzte in Herodots(3) »Historien« (verfasst ca. 440–425 v. Chr.) erwähnt. In diesen klassischen Werken spielen sie in zwei zentralen Momenten eine entscheidende Rolle. Ohne das Auftreten eines Arztes wäre Homers Achilles(1) nicht in den Kampf um Troja(1) zurückgekehrt; und – so Herodot(4) – der persische(2) König Dareios(1) hätte nicht angefangen, sich für einen Angriff auf die griechische Welt zu interessieren. Bevor überhaupt Texte über die neue Heilkunst entstehen, haben Ärzte in der griechischen Literatur eine Menge zu verantworten.[1]
In Homers(4)Ilias bedrängen die Trojaner die Griechen hart, und einer der beiden Spitzenärzte auf griechischer Seite, Machaon(1), wird im Kampf verwundet und im Streitwagen des älteren Nestor(1) weggebracht. Achilles(2), der beste Krieger der Griechen, ist abwesend, weil er sich zu kämpfen weigert. Aber er schaut von seinem am Ufer liegenden Schiff aus zu und meint, den verwundeten Mann zu erkennen, als dieser vorbeitransportiert wird. Wenn ein so großer Heiler selbst einen »tadellosen Heiler« benötigt, dann – so die Einschätzung des Achilles – sieht es für die Griechen wirklich finster aus. Er ruft daher nach seinem geliebten Gefährten Patroklos(1), der aus dem Zelt tritt: »für ihn des Unheils Anfang«; Worte, die denen sehr ähnlich sind, die Herodot(5) dreihundert Jahre später benutzt für die erste und ähnlich schicksalhafte Hilfeleistung der Athener für griechische Rebellen gegen den persischen König(7). Achilles schickt Patroklos los, um Näheres zu erfahren – der Beginn seiner eigenen Rückkehr zum griechischen Heer. Das hat die mitfühlende Aufmerksamkeit des Patroklos für die Verwundeten zur Folge und dann seine schicksalhafte Bitte an Achilles, doch die Erlaubnis zu erhalten, sich am Kampf zu beteiligen.
Damit, dass ein Arzt eine entscheidende Rolle für den Handlungsverlauf der Ilias spielt, hat es noch nicht sein Bewenden. Nach der Auffassung Galens(1), dem bedeutendsten Arzt des 2. Jahrhunderts n. Chr., war Homer(5) der Begründer und Schutzherr der Medizin.[2] Diese ungewöhnliche Würdigung eines epischen Dichters stützt sich auf ein Charakteristikum seiner Ilias: die Beschreibung von rund dreihundert Wunden. Der größte Teil davon wird kurz als tödliche Wunde durch die Brust oder den Schädel eines Helden erwähnt, rund dreißig Fälle jedoch werden mit inneren und äußeren, den ganzen Körper betreffenden Details ergänzt. Homers Bandbreite körperlicher Einzelheiten überragt bei Weitem diejenige anderer epischer Traditionen. Anders als die meisten modernen Leser waren seine griechischen Zuhörer dazu in der Lage, einen positiven Zugang zu dichterischer Darstellung von Speeren zu gewinnen, die in Eingeweide, den Unterbauch oder am grauenhaftesten in das Gesicht eindringen: »Hektor(1) traf ihn unter dem Kiefer und dem Ohr, und die Zähne(1) stieß hinaus das Ende des Speers und schnitt mitten durch die Zunge …«[3]
Der Akzent bei diesen detaillierten Darstellungen liegt auf dem Töten, nicht auf dem Sterben.[4] Im ersten Publikum des Gedichts saßen mit Sicherheit Krieger, die sehr wohl wussten, was eine Wunde im Nahkampf bedeuten konnte. Die Details wurden nicht zum Amüsement geliefert. Sie sind leidenschaftslos und präzise, und wenn eine gewisse innere Emphase mitschwingt, dann gilt diese weniger dem ergreifenden Leid des Opfers als vielmehr der Macht des Angreifers.[5] Nie werden Verwundungen moralisch als Gewalt verurteilt, obwohl einige der extremen Wunden mit Sicherheit grauenhaft wirken sollen – in Phasen, wenn die Gewalt des Kampfs im Gedicht sich steigert. Drei der schlimmsten Wunden werden von ein und demselben Krieger verursacht, Meriones(1), der selbst ein grausiger Typ ist. Die meisten Wunden werden dennoch jenen zugefügt, deren vergangenes oder gegenwärtiges Verhalten eine Rolle spielt für das, was ihnen widerfährt.[6]
Diese Verwundungsszenen zeigen Ärzte, die Waffen herausschneiden und Medikamente verabreichen. Lange vor medizinischen Texten über Wunden und ärztliche Eingriffe leiten sie sich offenbar von einer genauen Beobachtung von Teilen des männlichen Körpers ab. Außerdem haben sie mit zwei entscheidenden Fragen für die Zukunft der Medizin zu tun: das Ausmaß, in welchem Traumata und Krankheiten dem Eingreifen der Götter zuzuschreiben waren; und mit dem gesellschaftlichen Status der Ärzte.
II
Leser mit medizinischen Kenntnissen bewundern noch heute, was sie als Homers(6) »anatomische Topographie« bezeichnen, und sie fühlen sich bemüßigt, sie klinisch zu analysieren. Diese Studienrichtung nahm ihren Anfang im Italien des frühen 17. Jahrhunderts, und 1879 kam Hermann Frölich(1), seines Zeichens ein Militärarzt, zu dem Schluss, Homer selbst müsse seiner Zunft angehört haben; vielleicht nicht als Spitzenarzt im Lager des Agamemnon(1), aber vielleicht doch der Stellvertreter, der einen Überblick über das Geschehen hatte.[7] Auch heute noch wird »Doktor Homer« von Chirurgen(1) und Pathologen immer wieder entdeckt. Sie machen Aufzählungen und Tabellen homerischer Wunden (53 in Köpfe und Hälse oder 54 in Lungen(1), von denen 70,37 % tödlich sind …) und behaupten nach wie vor, Homer sei ein Chirurg gewesen wie sie selbst.[8] Ihre Zählergebnisse sind unterschiedlich – aber schon die Voraussetzung solcher Studien ist nicht stichhaltig. Homers Beschreibung von Wunden verdankt vieles dem, was er von seinen schriftstellerischen Vorgängern übernommen hat. Nichts davon muss auf seiner Augenzeugenschaft oder seinem Können als Wundarzt beruhen.
Seine(7) Wahrnehmung der inneren und äußeren Funktionsweisen des Körpers entspricht natürlich nicht der unseren, auch wenn sich eine moderne Annahme, er habe keine Vorstellung gehabt von einem in sich geschlossenen Körper und auch kein Wort dafür, als wissenschaftlich unhaltbar erwiesen hat.[9] Seine Benennung der Körperteile ist jedoch konkret. Er bezieht sich auf Wirbel(1) und auf eine Membran, welche die Leber(1) bedeckt. Einige seiner Begriffe für Körperteile sind so präzise, dass sie noch heute Übersetzer vor Probleme stellen. Was genau ist das inion (wahrscheinlich das Occiput(1) [Hinterhauptbein], das kleine Stück oberhalb des Nackens)? Mehrere solcher Worte werden lediglich ein- oder zweimal in der homerischen Dichtung erwähnt und bleiben auch später selten, aber es gibt keinen Grund, sie als homerische Prägungen einzuordnen. An einer Stelle erwähnt er, »was die Menschen kotyle nennen«: Er benutzt den beschreibenden Ausdruck »Schale« für das Hüftgelenk und zeigt, dass diese Bezeichnung außerhalb seines Gedichts im Gebrauch war.[10] Wenn spätere Ärzte eines dieser seltenen Wörter benutzten, dann kannten sie es womöglich ebenfalls aus dem allgemeinen griechischen Wortschatz. Tatsächlich kommen homerische Wörter für einzelne Körperteile selten in griechischen heilkundlichen Texten vor, vor allem in den im 5. Jahrhundert v. Chr. abgefassten, auf, und einige der erstaunlichsten Wörter kommen gar nicht vor. Homer(8) verwendet das griechische Wort laukanie für Hektors(2) Kehle, die vom todbringenden Speer des Achilles(3) durchbohrt wird.[11] Keine Passage aus Homer war berühmter, aber das Wort erscheint in keinem medizinischen Text. Und selbst wenn ein Medizinschriftsteller dasselbe Wort wie Homer benutzt, verwendet er es womöglich in einem anderen Sinn: »inion« bedeutet für einen Medizinschriftsteller nicht mehr »Occiput«. Ähnliches gilt für phlegma, das bei Homer lediglich einmal vorkommt und »Feuer« bedeutet.[12] Für die Ärzte der klassischen Zeit bedeutet phlegma(1) »Schleim«, ein kaltes, nasses Element im Innern des Körpers. Homers Vermächtnis an spätere Ärzte war kein fix und fertiges Lexikon.
Wieviel verstand er tatsächlich von den inneren Organen des Körpers und ihrem Zusammenwirken? Er weiß, dass sich um die Nieren(1) herum Fett befindet, und dass ein heftiger Schlag auf das Schlüsselbein(1) dazu führt, dass eine Hand bis zum Handgelenk betäubt ist (eine »Brachialgie(1)«).[13] Auch in der Tötung Hektors(3) durch Achilles(4) sind genaue Einzelheiten enthalten. Als Superheld wirft Achilles zuerst seinen massiven Eschenspeer und benutzt dann dieselbe Waffe als Stichwaffe, ein Doppelgebrauch, der gewöhnlichen Sterblichen und Speeren heutzutage nicht mehr möglich ist. Doch auch er kommt in Kontakt mit körperlicher Realität, wenn er auf Hektors Kehle zielt, die nicht von der Rüstung geschützte Stelle, von der es heißt, sie befinde sich genau oberhalb des Schlüsselbeins. Er stößt die Spitze seines Speers ganz durch, doch es wird eigens erwähnt, dass die Luftröhre(1) nicht durchtrennt ist. So kann Hektor(4) in den letzten Augenblicken vor seinem Tod seine letzte ergreifende Bitte um Gnade äußern.[14] Die Luftröhre wäre tatsächlich von einer solchen Wunde nicht tangiert gewesen, die moderne Ärzte als eine Durchtrennung der Halsschlagader und der Halsvene interpretieren, eine letzte Äußerung wäre Hektor also möglich gewesen.
Als Hektor(5) tot ist, zieht Achilles(5) Lederriemen durch den unteren Teil seiner Unterschenkel, um ihn hinter seinem Streitwagen herzuziehen. Er durchbohrt ihn von der »Ferse bis zum Fußknöchel« durch die Sehnen hindurch.[15] Er durchsticht also den einen Punkt oberhalb der Ferse, wo eine solche Durchbohrung ohne Weiteres möglich ist. Wenn Homers(9) verwundete Helden zu Boden gehen, dann fallen sie im Allgemeinen nach vorne oder nach hinten, und diese Richtung »stimmt immer mit dem überein, was ein heutiger Arzt angesichts der Lokalisierung der Wunde vorhersagen würde«.[16] Das lebhafte Detail, dass ein Speer nicht aufhört, in seiner ganzen Länge zu zittern, nachdem er ins Herz des Alkathoos(1) getrieben wurde, mag unglaublich scheinen, doch das Herz(1) würde kurz weiter pulsieren und könnte auch einen Speer vibrieren lassen.[17] Jemand hatte ein solches Vibrieren tatsächlich gesehen, woraufhin es in das Repertoire des mündlichen Epos überging, wo es dann, da es keine Allerweltsvorstellung war, überlebte. Dasselbe geschah mit dem Blutnebel, der aus Nase und Mund eines Mannes kommt, wenn er schwer verwundet wird und – wie Homers Erymas(1) – ausatmet.[18] Bis zum 8. Jahrhundert v. Chr. hatten die Griechen einige dramatische Körpereffekte in Schlachten bemerkt.
Allerdings übertrieben die mündlichen Dichter, und als ihr Erbe veranschaulicht Homer(10). In der Wirbelsäule(2) gibt es Knochenmark(1), doch würde es heraussickern und nicht in einem homerischen Strahl »herausspritzen«.[19] Augäpfel(1) können durch einen Speerhieb, der den umgebenden Knochen(1) zerschmetterte, verdrängt worden sein, aber sie sind sicher nicht dramatisch auf den Boden gefallen.[20] Der allgemeine Kontext der homerischen Körperwunden ist gespickt mit Unwissen. Homer hatte wie alle Griechen keine Vorstellung vom Blutkreislauf(1) oder von der Rolle, die das Herz(2) dabei spielt – beides war der Antike unbekannt. Und er wusste nichts von der Rolle des Gehirns(1) in unserem Denken und Fühlen; beides schreibt er den phrenes(1) zu. Diese von modernen Fachleuten viel diskutierten phrenes sind die Lungen(2), nicht das Zwerchfell(1).[21] Homer unterscheidet Arterien(2) nicht von Venen und hat keine Vorstellung von den Nerven(1). Wenn er den Tod des Thoon(1) beschreibt, spricht er von der dicken Vene, die »über den ganzen Rücken bis zum Nacken« verläuft. Ein moderner Medizinkritiker bemerkt kurz und bündig: »Eine solche Vene(3) gibt es nicht.«[22]
Wenn dichterische Versatzstücke durch die Generationen von einem mündlichen Dichter zum nächsten weitergegeben wurden, dann wurden sie auf Situationen ausgedehnt, auf die sie nicht genau passten. Diese Entwicklung zeigt sich ganz deutlich an den Auswirkungen von Waffen. Die fürchterlichen Wirkungen von Schwertstichen wurden auf diejenigen von Speerverwundungen übertragen, und der Winkel von Speerverwundungen wurde auf Pfeilverwundungen übertragen. Als in der Ilias der Zimmermann Phereklos(1) zu fliehen versucht, holt Meriones(2) ihn ein und stößt seinen Speer durch die rechte Gesäßbacke des Phereklos, und zwar mit solcher Kraft, dass der Speer die Blase durchbohrt und an der Vorderseite des Körpers wieder herauskommt. Ein Speer kann nur dann so bewegt werden, wenn er durch die schmale Vertiefung hindurchsticht, die heute als Incisura ischiadica major(1) bezeichnet wird, doch es ist nicht nötig, Homer(11) ein genaues Verständnis dieses intimen Details zuzuschreiben.[23] Ependichter mussten nur gesehen oder gehört haben, dass Speere am Rücken eintreten und vorne wieder herauskommen, was zur Folge hatte, dass ihre Opfer urinierten, als ihre Blase aufgestochen wurde. Diese Details wurden zu einer Abfolge dichterischer Phrasen, und bezeichnenderweise macht Homer erneut davon Gebrauch. Ein Pfeil, wiederum von Meriones(3) dem Schrecklichen, folgt demselben Weg durch die rechte Gesäßbacke des Opfers, doch in diesem Fall wird einem horizontal abgeschossenen Pfeil poetischer- und unmöglicherweise der Verlauf eines von oben gestoßenen Speers zugeschrieben.[24] In keinem dieser Fälle wurde das Skelett(2) in allen Einzelheiten untersucht. Angesichts des blutigen Durcheinanders eines zerschmetterten Leichnams ist es nicht verwunderlich, dass Griechen die inneren Komplexitäten der Leichenmasse vor ihnen nicht nachvollzogen. Außerdem befürchteten sie eine Verunreinigung durch Leichen, ein mächtiges Abschreckungsmittel gegen die Untersuchung der Toten, obwohl Homer sich darauf nie bezieht.
Ganz allgemein wird im griechischen Epos das Gemeine ausgelassen, wozu auch der Gestank des Todes nach einer Schlacht gehört, den Homer(12) ebenfalls nie erwähnt. Häufig hebt er hervor, wie weiß die Haut des Helden ist, allerdings meistens lediglich um sie von dem Blut und den Verletzungen abzuheben, die ihr von Waffen zugefügt werden.[25] Wegen solcher Auslassungen und stilisierten Emphasen hat man seine Verletzungen als filmisch bezeichnet. Im Unterschied zu einem Fotoapparat können die Zeilen der Dichtung unter die Haut gehen, aber wenn Homer(13) sich dorthin begibt, dann sind sie nicht sonderlich genau. Dennoch stehen sie neben Annahmen über Heilen und Krankheit, die für Medizinhistoriker wichtig sind.
III
Eine dieser Annahmen ist die Rolle der Götter. In der Ilias(14), einer Dichtung über heroische Krieger, werden Ärzte beschrieben, die Wunden versorgen, keine Alltagskrankheiten. Die Ursprünge dieser Wunden waren offensichtlich: Speerspitzen und Schwertklingen oder massive Felsbrocken, wie derjenige, der Hektor(6) betäubte und seine Gefährten dazu veranlasste, ihn mit kaltem Wasser zu übergießen, um ihn wiederzubeleben. Man brauchte keinen Arzt, der vom Sichtbaren auf das Unsichtbare schließen konnte, um den Zustand eines verwundeten Patienten zu diagnostizieren. Der Grund war offensichtlich; diejenigen, die dem Verwundeten beistehen, beten daher nie zuerst ratlos zu den Göttern oder bitten um ihre Hilfe. Einmal wendet sich ein verwundeter Held an einen Gott, doch selbst dann kennt er den Grund seiner Qual genau: Sie rührt von einer Pfeilwunde in seiner Schulter her, über die rund 2600 Gedichtzeilen früher erzählt wird und die jetzt bewirkt, dass seine Schulter »schwer« ist.[26] Er braucht schnelle Hilfe, und es ist kein Heiler in der Nähe. Er wendet sich an den Gott, wo auch immer er sich befinden möge – ein offengelassener Ort, der in griechischen Gebeten üblich ist: »Höre mich, Herr (Apollon(1)), der du irgendwo im reichen Land Lykien oder in Troja(2) bist; du kannst überall den Bedrängten hören, und ich befinde mich in Bedrängnis.« Der alles hörende Apollon befand sich auf den Gipfeln des Ida. Mittels Fernheilung gebot er den Schmerzen und dem Fluss des dunklen Blutes(1) Einhalt und pflanzte bei Troja(3) Stärke in das Herz des Glaukos(1).
Was bei den Helden üblich ist, gilt auch für die Götter: Man heilt sich gegenseitig.[27] Erst stillen sie das Blut(2) oder waschen es ab; dann legen sie schmerzlindernde, aus Pflanzen gewonnene pharmaka(2) (»Drogen« oder »Heilmittel«) auf. Die Ähnlichkeit zwischen ihrer Praxis und derjenigen sterblicher Heiler soll nicht komisch wirken: Sie ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der Dichter und sein Publikum sich ihre Götter als überhöhte Aristokraten vorstellten und auf sie das projizierten, was zu einem geringeren Grad von den Sterblichen bekannt war. Wenn menschliche Heiler handeln, waschen auch sie das Blut aus einer Wunde oder saugen die Wunde aus. Auch sie legen »milde« Heilmittel auf, doch im Unterschied zu Göttern schneiden manchmal mit einem Messer um die Wunde herum. Die offensichtliche Ursache der Verletzung – die Waffe – wird herausgeschnitten, herausgezogen oder hin und wieder durchgestoßen.[28] Eine Wunde kann auch verbunden werden, nie jedoch kommt es dazu, dass die Wunde offen gelassen wird, damit Eiter austreten kann, was Ärzte der klassischen Zeit empfahlen und worum auch Ärzte im Mittelalter wussten.
Homers(15) Repertoire an Formulierungen für Heilprozesse enthält nicht die Schmerzen, die damit verbunden gewesen sein dürften. Patroklos(2) schneidet eine Wunde aus, doch ebenso wie seine pflanzlichen Heilmittel(3) ist er selbst »mild«.[29] Er beweist seine Milde, indem er bei einem verwundeten griechischen Helden bleibt und nach der Behandlung mit ihm spricht. Die Qualen, die das Schneiden und Ausbrennen(1) durch einen realen Arzt verursachen, bleiben unerwähnt. Die Milde griechischer Ärzte sollte ein immer wiederkehrendes literarisches Thema werden, das mit Homer beginnt.
In der Ilias wurde der Gebrauch milder Heilmittel(4) den großen Helden von übermenschlichen Lehrern beigebracht – wiederholt wird der Zentaur Chiron(1) erwähnt, nicht zuletzt als Lehrer des Achilles(6). Allerdings waren die meisten dieser Drogen keine göttlichen Gaben. Schon Jahrhunderte vor Homer(16) hatten die Menschen die heilenden Eigenschaften von Pflanzen, ihren Wurzeln und Blättern entdeckt. Schon die Wendung »milde Drogen« verweist darauf, dass es ein Bewusstsein von anderen Drogen gab, die ganz und gar nicht mild waren. Homer identifiziert die Pflanzen nicht, die seine Krieger-Helden verwenden; in der Odyssee hingegen verweilt er länger bei einer sehr besonderen Pflanze, die Helena(1) in Ägypten(5) erhalten hatte, einen mächtigen, nicht identifizierbaren Tränenstiller. Im wirklichen Leben gehörte zu den von den Griechen benutzten Drogen auch Opium(1), das rund hundert Jahre vor Entstehung der Ilias im östlichen Ägäis-Raum in kleinen, mohnblumenförmigen Fläschchen gehandelt wurde. Homer erwähnt Mohnblüten, nie jedoch als Mittel zur Schmerzlinderung.[30]
Da eine Wunde in der Ilias normalerweise von Menschen mit Menschen zur Verfügung stehenden Mitteln behandelt wird, wurde die homerische Wundheilung dafür gepriesen, dass sie in einem »nicht theologischen Raum« stattfindet, in den hinein sich die spätere Chirurgie(2) und Wundversorgung(1) entwickeln konnte.[31] Allerdings befindet sich ein solcher Raum in einem sonderbaren Widerspruch zu den allgegenwärtigen göttlichen Interventionen in der homerischen Dichtung: Selbst bei Verwundungen wurde er nicht durchgehend aufrecht erhalten. Die Odyssee beschreibt, wie Odysseus(1) einmal von einem Wildschwein angegriffen wurde, woraufhin seine Jagdgefährten das Bein auf zweierlei Weise behandelten. Sie waren keine ausgebildeten Ärzte, doch sie verbanden die Wunde »fachkundig« und sprachen außerdem »Beschwörungsformeln« darüber.[32] Menschliches Erfahrungswissen und Appelle an göttliches Eingreifen schlossen sich nicht aus. In kritischen Situationen machten Ärzte ebenso wie Jagdgefährten mit Sicherheit Gebrauch von beidem gleichzeitig.
Wie wurde mit Krankheiten umgegangen? Der große Kulturhistoriker Jacob Burckhardt(1) staunte darüber, wie abgehärtet die homerischen Helden waren: »Nestor(2) (der Greis) stellt sich mit Machaon(2) (dem Feldarzt), als sie verschwitzt von der Schlacht zurückgekehrt sind, zum Schrecken aller heutigen Rheumatiker an den Strand, um sich dem Winde auszusetzen.« Er schrieb das einer »staunenswerten Kraft« der Griechen zu: »Es ist eine erlaubte Frage, ob überhaupt die Alten für Zugluft empfänglich gewesen seien.«[33] Allerdings hatte ein Epos über heldenhafte Krieger keine Veranlassung, sich mit Allerwelts-Wehwehchen zu befassen. Die von ihnen erwähnten Krankheiten bedurften ihrer Meinung nach eines anderen Fachwissens.
Das griechische Wort, das wir mit »Krankheit« übersetzen, ist nicht aus einer griechischen, sondern aus einer anatolischen Wurzel mit der Bedeutung »ohne Wohlbefinden, ohne (göttliches) Wohlwollen« abgeleitet. Zunächst bedeutete es mehr als Krankheit; die Götter waren direkt mitgemeint, und das ist auch in der Ilias noch so.[34] Das Gedicht beginnt mit der ersten Epidemie in der westlichen Literatur. Sie befiel zuerst Tiere, tötete Maulesel und Hunde, und setzte sich dann fort bei Menschen – während zehn Tagen, in denen »die Scheiterhaufen der Toten in Mengen brannten«. Niemand sah darin eine Infektion oder ein Virus. Ein Seher, nicht ein Arzt, wurde herbeigerufen, um den Grund dafür herauszufinden; er diagnostizierte den Gott Apollon(2), der wegen der Missachtung seines Priesters verärgert war. Daraufhin wich die Seuche – nicht durch Medikamente oder Social Distancing, sondern indem Apollon das Gebet seines Priesters erhörte, der darum bat, der Seuche Einhalt zu gebieten, und als das griechische Heer gereinigt und der Gott durch Opfergaben besänftigt war. Die Ursprünge der Seuche wurden ausdrücklich mit Apollon in Verbindung gebracht – er, der Sonnengott, kam herab »wie die Nacht«. Dieser Vergleich, der erste in der Ilias, ist einer der kürzesten, doch die durch ihn bewirkte Umkehrung – Nacht anstatt Tag – macht ihn zugleich zum schrecklichsten. Apollons(3) unsichtbare Pfeile treffen, ohne dass man sie sieht – genau wie Bakterien oder Viren in einer Pandemie.
In der Odyssee erwähnt Homer(17) ein weiteres außergewöhnliches Leiden, eines, von dem ein Individuum heimgesucht wird. Der Zyklop(1) wird von Odysseus(2) verwundet und fleht die anderen Zyklopen in den umgebenden Hügeln heulend um Hilfe gegen das an, was »Niemand« (das listige Pseudonym des Odysseus) ihm angetan hat. Sie interpretieren seine gequälten Schreie als diejenigen eines schwer kranken Mannes, denn offenbar ruft er ja, dass ihn kein Sterblicher gequält habe, seine Krankheit muss also von Göttern gesandt sein: Sie antworten, eine Krankheit, die Zeus(1) gesandt habe, könne nicht abgewendet werden, und empfehlen ihm, zu seinem Vater Poseidon(1), ebenfalls einem Gott, zu beten.[35] Sowohl ihre Diagnose wie ihr Heilmittel haben mit göttlichem Eingreifen zu tun.
Die Qual des Zyklopen und die Seuche in den Eröffnungsversen der Ilias sind extreme Heimsuchungen, doch Homer(18) erwähnt auch Menschen, deren Leiden weniger außergewöhnlich ist. Bezeichnenderweise kommen sie in zwei Vergleichen vor, in Abschnitten also, die den Zuhörern Vertrautes präsentieren, um ihnen dabei zu helfen, sich abstrakte Eigenschaften besser vorzustellen. In der Ilias wird der heftige Schmerz einer Speerwunde im Arm des Agamemnon(2) mit den Schmerzen einer Frau verglichen, wenn die Göttinnen der Geburtswehen(1), die Eileithyiai(1), ein »scharf durchdringendes Geschoss« senden.[36] Die menschliche Dimension der Geburtswehen war natürlich bekannt, doch wurde auch mit dem Mitwirken von Göttinnen gerechnet, so extrem waren die Schmerzen und so unsicher der Ausgang für das Leben der Mutter. Auch hinter anhaltendem starken Schmerz wirkte womöglich eine göttliche Gewalt. In der Odyssee führt ein herrliches Gleichnis eine »hasserfüllte« Gottheit vor, einen daimon, der einem schon lange leidenden Vater Krankheit zufügt und ihm schlimme Schmerzen verursacht, bis die Götter ihn – zur Freude seiner Kinder – von seinen Qualen erlösen.[37] Seine Erholung von einer chronischen Krankheit ist die erste in der Literatur des Westens, und sowohl der Beginn als auch das Ende der Krankheit haben eine übernatürliche Dimension.
Einmal scheint Odysseus(3) eine andere Ansicht zu vertreten. Während seines Besuchs in der Unterwelt fragt er seine tote Mutter, ob eine »lange Krankheit« oder »Artemis(1) mit ihren sanften Pfeilen« sie getötet habe.[38] Das übliche Schlachtfeld der Artemis war der Geburtsvorgang(1); offenbar hält Odysseus das auch bei seiner Mutter für möglich. Sie erwidert, es sei weder Artemis gewesen noch Apollon(4) noch »eine Krankheit, die sehr häufig den Geist den Gliedern entreißt mit verzehrendem Schmerz«. Mit berührenden Worten erklärt sie, es sei nicht weniger als »das Verlangen nach Odysseus mit seinen Ratschlägen und seiner Sanftmut, … das ihr das honigsüßes Leben raubte«. Hier werden sie und Odysseus manchmal so interpretiert, dass sie einen natürlichen Tod und einem Tod aufgrund der Pfeile einer Gottheit voneinander abheben. Doch im Zusammenhang geht es ihnen nicht darum, sondern vielmehr um die Frage, ob der Tod langsam oder schnell eintraf. Der schnelle Tod wurde einer Gottheit zugeschrieben, doch auch der langsame Tod könnte von einer Gottheit verursacht sein, wobei keiner der Sprechenden das eigens formulieren musste.
Ein dritter Vergleich – in der Ilias – scheint anders zu sein. Als der alte Priamos(1) schließlich sieht, wie Achilles(7) seinen Sohn Hektor(7) überwältigt, vergleicht Homer(19) den Glanz der bronzenen Rüstung mit dem hellen Stern der Erntezeit, welche die Menschen den Hund Orions nennen – wir nennen ihn auch heute noch den Hundsstern, Sirius. Er ist der hellste Stern in der »Finsternis der Nacht« und »wurde als böses Zeichen geschaffen und bringt viel Gluthitze den elenden Sterblichen«.[39] Das Wort für diese »Hitze«, pyretos(1), wurde in heilkundlichen Texten des 5. Jahrhunderts v. Chr. zum gebräuchlichen Wort für die Hitze eines Fiebers, und infolgedessen verstand ein späterer Grammatiker zu Beginn unserer Ära das Wort hier in diesem Sinne. Er irrte sich. Für Homer bedeutete ebenso wie für andere archaische Poeten pyretos eine jahreszeitlich bedingte Hitze, die extreme Hitze ab Mitte Juli. Homer will hier nicht sagen, dass Fieber von einem Stern oder einer Jahreszeit verursacht wird, auch nicht, dass Fieber(1) etwas Natürliches sein könnte. Er hat keine Vorstellung von einer abstrakten »Natur«.
Experten für griechisches Denken tendieren dazu, rationale Medizin als etwas darzustellen, das sich nach einer bei Homer(20)