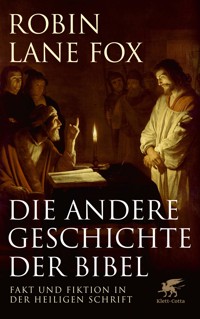14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Zentrum des Buches stehen die reisenden Zeitgenossen Homers: euböische Griechen des 8. Jahrhunderts, die als Seefahrer und Piraten rund um das Mittelmeer unterwegs waren, Handel trieben und neue Welten entdeckten. Fundstück für Fundstück trägt der Autor zusammen, was sich über diese frühen Griechen herausfinden lässt. Reisende Helden, das sind auch die Figuren des Mythos, die weit herumkamen: etwa Dädalus, der sogar fliegen konnte, Herkules, der kreuz und quer im Mittelmeerraum seine Arbeiten verrichtete, oder die unglückliche Io, die von Zeus erst verführt und dann in eine Kuh verwandelt wurde. Indem Robin Lane Fox den unendlichen Schatz der griechischen Mythen mit der Sachwelt der archäologischen Funde verknüpft, lässt er vor unseren Augen ein lebendiges Bild dieser Zeit entstehen. Robin Lane Fox' reisende Helden sind verwegene griechische Seefahrer aus dem 8. Jahrhundert v. Chr., die ferne Länder und Küsten entdeckten. Das Wissen und die Geschichten aus der Fremde integrierten sie in ihre Vorstellungswelt und legten so den Grundstein für die griechische Kultur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1031
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
ROBIN LANE FOX
REISENDE HELDEN
DIE ANFÄNGE DER GRIECHISCHEN KULTUR IM HOMERISCHEN ZEITALTER
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta Die Originalausgabe erschien unter dem Titel "Travelling Heroes" im Verlag Allen Lane, London 2008 © 2008 by Robin Lane Fox Für die deutsche Ausgabe © 2011 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg Abbildung: akg images/Erich Lessing Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell
Für: H. J. L. F.
T. L. F.
M. J. L. F.
C. M. J. G. B.
M. L. F.
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Vorwort
I Heras Flug
1 Heras Flug
2 Von China nach Cadiz
3 Reisende Helden
II Ost und West
4 Daheim und in der Ferne
5 Reisende Siedler
6 Nach Unqi
7 Potamoi Karon
8 Jenseits von Ithaka
9 Die Affeninseln
10 Daheim in Euböa
III Reisende Mythen
11 Auf der Suche nach Nimmerland
12 Lost in Translation
13 Ein reisender Prophet
14 Reisende Liebhaber
15 Ein reisender Berg
16 Der Große Kastrator
17 Reisende Monster
18 Schlachtfelder und Basislager
IV Just So Stories
19 Homerische Horizonte
20 Der Blick von Askra
21 Just So Stories
Anmerkungen
Bibliographie
Verzeichnis der Karten
Bildnachweis
Endnoten
Bildteil
Über den Autor
Fakten werden zu Kunst durch Liebe: Sie ist es, die die Fakten verbindet und sie auf eine höhere Realitätsebene hebt.
Kenneth Clark, Landscape into Art (1949)
Ich mag es, wenn sich einer in was reinsteigert. Das ist schön. Sie haben diesen Lehrer, Mr. Vinson, einfach nicht gekannt. Der konnte einen manchmal wahnsinnig machen, der und die verfluchte Klasse. Also, der sagte einem ständig, man soll vereinheitlichen und vereinfachen. Aber bei manchen Sachen geht das einfach nicht. Also, man kann doch nicht einfach vereinheitlichen und vereinfachen, bloß weil einer das will. Sie haben diesen Typen, diesen Mr. Vinson, eben nicht gekannt. Also, der war schon sehr intelligent und so, aber man sah gleich, dass er nicht besonders viel im Kopf hatte.
J. D. Salinger, Der Fänger im Roggen (1951;
VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
Dieses Buch ist die Frucht jahrelangen Nachdenkens, Reisens und Forschens, und es freut mich sehr, dass es nun auch in deutscher Übersetzung vorliegt. In England wurden die »Reisenden Helden« im letzten November als 90-minütige Fernsehdokumentation ausgestrahlt. Obwohl BBC4 ein Digitalfernsehkanal ist, hatte die Sendung fast 1,5 Millionen Zuschauer, viermal so viele wie für diese Tageszeit üblich. Nun darf sich Deutschland diesem Interesse anschließen, zumal das Thema des Buches tief in der deutschen Gelehrtengeschichte wurzelt.
Meine leidenschaftliche Liebe zu Homer ist der Grund, warum ich mein Leben dem Studium der griechischen Welt gewidmet habe. Es gibt einen Deutschen, für den Homer eine ähnliche Inspirationsquelle gewesen ist: Heinrich Schliemann, den Ausgräber von Troja und Mykene. Auch wenn es mittlerweile zum guten Ton gehört, seine Zuordnungen und Forschungsmethoden kleinzureden, bewundere ich ihn nach wie vor nicht nur für die Leidenschaft, die ihn antrieb, sondern auch für seine spektakulären Funde.
Für mich galt schon immer: Wer auch nur einen bislang unverstandenen Vers von Homer zu erklären vermag, hat nicht umsonst gelebt. Ich glaube, mit Hilfe der Funde und Texte eine bislang ungeklärte Stelle in der Ilias aufhellen zu können; mit dem argumentativen Hauptstrang dieses Buches hängt meine Entdeckung jedoch nicht notwendig zusammen. Homer möchte uns am Ende des zweiten Buches einen akustischen Eindruck vom Vormarsch des griechischen Heeres geben, als es sich zum ersten Mal über die Ebene auf Troja zubewegt. Die Anspielung des Dichters, bislang noch nie richtig verstanden, bezieht sich auf einen Klang im fernen Westen. Den Auftakt der Schlachtszenen in Homers Epos bildet also ein buchstäblich weit hergeholter Vergleich. So darf ich jetzt das Gefühl haben, mein Leben nicht vergeudet zu haben.
In Deutschland gibt es viele Menschen, so vermute ich, die dieses Gefühl nachvollziehen können. Dafür sprechen die aktuellen Diskussionen unter deutschen Gelehrten über die Lage von Homers Troja. Darauf deutet auch der Erfolg eines populärwissenschaftlichen Buches, des 2008 erschienenen Bestsellers Homers Heimat. Der Kampf um Troia und seine realen Hintergründe von Raoul Schrott. Die Thesen Schrotts, der aus Homer einen griechischen Schreiber in assyrischen Diensten macht und den Schauplatz der Ilias von Troja in die Kilikische Ebene um Karatepe verlegt – die auch in meinem Buch eine Rolle spielt –, vermochten allerdings keinen Homerfachmann wirklich zu überzeugen. Mit fundierten Argumenten ist ihnen Joachim Latacz entgegengetreten. Doch auch Latacz, der sich immer für die Thesen des letzten großen Ausgräbers von Troja, Manfred Korfmann, stark gemacht und dessen Meinung von der Historizität des Trojanischen Krieges gestützt hat, stößt auf Widerspruch: Korfmanns Tübinger Kollege, der Althistoriker Frank Kolb, einer der Kontrahenten im deutschen »Troja-Streit«, vertritt in seinem kürzlich erschienenen Buch Tatort »Troia«. Geschichte, Mythen, Politik die Meinung, dass Homer sich die dichterische Freiheit nahm, Ereignisse vom mittelgriechischen Festland an die kleinasiatische Küste zu verlegen. Ich hege die Hoffnung, dass mein Blick von außen Bewegung in die festgefahrenen deutschen Positionen zu bringen vermag.
Gegen Ende meines Buches äußere ich ebenfalls – wenn auch sehr anders geartete – Gedanken zu einer »Heimat« Homers. Sie sind, so hoffe ich, überzeugend, auch wenn wir über das Leben des Dichters kaum etwas wissen. Homer beschreibt in seinen Epen Griechen, die in den Osten reisten, ebenso wie ich es versucht habe, und ich habe diese bekannten Geschichten mit gebührender Zuneigung analysiert. Sie sind natürlich fiktional – im Gegensatz zu meiner Historiographie reisender Helden in Homers Welt. Allerdings bin ich verblüfft, wie sehr sich einige Details mit Aspekten der von mir beschriebenen Reisen zur Deckung bringen lassen.
Außerdem erstaunt es mich – wie schon andere vor mir –, dass die Mythen, die ich behandle, in der Dichtung Hesiods – im Gegensatz zu derjenigen Homers – eine so große Rolle spielen. Ich meine erklären zu können, wie Hesiod, selbst weder Händler noch Reisender, mit diesen Mythen in Berührung kam und wie er sie vor meinen real existierenden reisenden Griechen vortrug.
Homer dagegen gehört in einen anderen Kontext. In letzter Zeit gab es einen Trend, Homers Kontakte mit dem Vorderen Orient zu betonen, sogar mit Dichtern aus dieser Region, und seine Hauptwerke in die Zeit zwischen 680 und 650 v. Chr. zu datieren. Ich vertrete in dieser Frage einen ganz anderen Standpunkt und in Verbindung damit auch eine andere Vorstellung von der Zeit, in der Homer wirkte, von der Region, aus der er vermutlich stammte, und von seinen Leistungen. Was er dem damaligen Osten verdankte, ist minimal. Für mich ereignete sich mit Homer das erste »griechische Wunder«, dem so viele weitere folgten: von der Idealisierung des menschlichen Körpers in der frühen Skulptur und dem Schönheitskult bis hin zum Sport, zur Demokratie, zur Mathematik, zum Drama, zu den unübertroffenen Komödien des Aristophanes und vor allem zur Philosophie und zum logischen Denken. Ich kann nicht glauben, dass Homer und all die späteren »Wunder« in irgendeiner der Gesellschaften des Vorderen Orients, und sei es in Judäa, möglich gewesen wären. Denn – um nur einen Punkt zu nennen – diese Gesellschaften wurden von Priestern und Königen dominiert und geprägt. »Weisheit« und schmeichelnder Fürstenpreis sind etwas anderes als vernunftbestimmte, logische Philosophie.
Daher sind die Helden meines Buches Griechen. Zu den rhetorischen Versatzstücken unseres multikulturellen, postkolonialen Denkens gehört es, die »alten Griechen«, auch bereits die des 8. Jahrhunderts v. Chr., auf eine Kultur unter vielen anderen zu reduzieren, und diese Reduzierung geht häufig einher mit der kritischen Unterströmung, diese Griechen seien schon viel zu lange zu Ikonen des westlichen Imperialismus hochstilisiert worden. Wenn ich mich auf die Griechen konzentriere, dann schließt das den Blick auf ihre Nachbarn nicht aus, seien es nun die sogenannten Phönizier, die Neohethiter oder die Aramäer.
Seit der Abfassung dieses Buches wurden in der Levante einige weitere Stücke aufschlussreicher griechischer Keramik gefunden. Sie sind noch nicht veröffentlicht, aber man kann jetzt schon feststellen, dass sie genau in den Kontext und die Entstehungsbedingungen passen, die ich in den ersten Kapiteln umreiße. Besonders spannend ist der Beginn von Ausgrabungen an der bis vor Kurzem unerschlossenen Grabungsstätte Sabouni in der südlichen Türkei, im Landesinneren hinter Al Mina, dem Ort, der für meine Argumente eine so große Rolle spielt. Im Oktober 2009 durfte ich Sabouni mit der türkischen Archäologin Dr. Hatice Pamir besuchen und die Funde in Augenschein nehmen, die bislang in Schichten ausgegraben wurden, die bis ins 5. Jahrhundert v. Chr. reichen. Es war ein überwältigendes Gefühl, zu wissen, dass vieles, was in dieses Buch hineingehört, noch unter meinen Füßen ruht.
Im Osten ordnet sich dieser archäologische Befund in den Zusammenhang einer Route ein, deren dort gefundene Objekte meine Argumente zu den fraglichen Reisenden und Transporteuren untermauern. In schriftlichen Quellen finden sie keine Erwähnung, weil Texte dieser Art nicht existieren. Im Westen dagegen gibt es neben den reisenden Objekten auch schriftliche Belege, und diese deuten in dieselbe Richtung wie die sich ständig erweiternden archäologischen Zeugnisse.
Bereits 1910, als man archäologisch noch kaum lokales Belegmaterial hatte, haben Frederik Poulsen und Bernhard Schweizer, die großen Kenner der archaischen Kunst der Griechen, den Einfluss von nordsyrischer Handwerkskunst auf griechische Objekte nachgewiesen. Dabei handelte es sich um einen Stil, der sich vom als phönizisch bezeichneten deutlich unterscheidet. Da dennoch in der Forschungsliteratur über die Griechen in der Levante nur zu oft die beiden unterschiedlichen Stile und Kulturen vermischt wurden, konnte der Eindruck entstehen, lediglich der phönizische Einfluss spiele eine Rolle. Doch seit den 1930er-Jahren wissen wir von Al Mina, einem nordsyrischen Missing Link in der Kette, die von deutschen Forschern bereits zuvor erkannt worden war. Als Gegenstand meiner »Reisenden Helden« hätten die Reisen der Phönizier und ihre Mythen ohnehin nicht getaugt: Es gibt keine verwertbaren Zeugnisse, keinen phönizischen Homer, Hesiod, Aristoteles oder Strabon.
Ich habe über das geschrieben, was ich verfolgen kann: einen griechischen roten Faden im uns vorliegenden Material. Meine Studien über den Westen verdanken viel den deutschen und italienischen Forschungen zu Pithekoussai und verwandten Orten. Im Osten stützen sie sich auf die zuerst von dänischen und deutschen Archäologen erkannte Verbindung zu Nordsyrien. Es ist mir eine Ehre, mein Buch jetzt auch auf Deutsch erscheinen zu sehen, und ich hoffe, die Leser, die dem Argumentationsgang bis zum Schluss folgen, werden zu schätzen wissen, was alles in dieses Buch Eingang gefunden hat.
New College, Oxford, Frühjahr 2011
Robin Lane Fox
VORWORT
Die reisenden Helden dieses Buches sind ganz bestimmte Griechen in einer ganz bestimmten Phase der antiken Welt, die mit mythischen Geschichten von Göttern und Helden in ihrem geistigen Gepäck unterwegs waren. Das Buch handelt von Entdeckungen und Kontakt mit dem Fremden, von kreativem Missverstehen und brillant-unorthodoxem Denken, das unterfüttert ist mit den großen Meisterwerken: den Epen Homers und der fast zeitgleich entstandenen Dichtung Hesiods. Es zielt darauf, deren Publikum, Quellen und Bezüge in ein neues Licht zu setzen. Außerdem glaube ich, für das 8. Jahrhundert eine spezifische Weise des Denkens ausgemacht zu haben, die sich von Israel bis Sizilien bemerkbar macht. Vor allem die Griechen zeichnen sich durch diese Denkungsart aus – die ersten, bislang unerkannten Vertreter in einer Linie, die ich auch durch ihre späteren Erben, den Geschichtsschreiber Herodot oder Alexander und seine Soldaten – die ständigen Begleiter meines Geistes – erhellen werde.
Die zentralen Gedanken dieses Buches haben mich auf meinen Reisen zu fast allen Orten, die darin vorkommen, begleitet. Während ich nachdachte, reiste und schrieb, wurden die Zusammenhänge zwischen meinen Schwerpunkten immer klarer, und ich bin froh, dass ich mir mit der Abfassung des Buches Zeit gelassen habe. Es war ein ganz besonderer Augenblick, als ich am Strand bei Al Mina stand, in der heutigen türkischen Provinz Hatay, und dann die Al Mina-Diskothek besuchte, die sich ganz in der Nähe befindet – und übrigens bislang in der Wissenschaft keine Erwähnung fand. Im Innern sind die Wände mit einem Fries von Figuren aus der ägyptischen, griechischen und levantinische Mythologie überzogen, wobei mir der türkische Besitzer jedoch versicherte, dass er die Originale nie gesehen hatte. Er habe sie alle erfunden, sagte er, denn »immerhin ist das die Al Mina-Disko. In der Al Mino-Disko sind sämtliche Geschichten der Welt willkommen.« Dieses Buch möchte zeigen, dass diese Offenheit bereits die Proto-Disko des 8. Jahrhunderts v. Chr. auszeichnete.
Ich habe mit sehr unterschiedlichen Quellen und Materialien gearbeitet und bin Fachleuten unterschiedlicher Forschungsgebiete zu Dank verpflichtet. Ich bin kein Archäologe, aber mir ist bewusst, welch einen Wert die Fertigkeiten der Archäologen haben sowie ihre Fähigkeit, die jeweiligen Funde in einen präzisen Kontext zu stellen. Viele Funde lassen sich von denen am besten verstehen, die sie ausgegraben haben, und ich bin den Forschern besonders dankbar, die ihre Bedenken und ihre Erkenntnisse mit mir geteilt haben. Viel gelernt habe ich von Irene Lemos, die mich viele Jahre lang mit Publikationen versorgte und so freundlich war, ihre Ausgrabungen in Lefkandi mit mir zu diskutieren und mich dorthin einzuladen. Sie ist mit ihrem Team ein Paradebeispiel für die Feldforschungskompetenzen, die ich zuvor schon bei ihrem Vorgänger Mervyn Popham bewunderte. Auf Zypern war mir die Ortskenntnis von Joan B. Conelly von großem Nutzen, die mich auch auf einen wichtigen Punkt im Zusammenhang mit dem 14. Kapitel aufmerksam machte. Nicola Schreiber eröffnete mir den Zugang zu den vielschichtigen Ausgrabungen in der Levante; ihre grundlegende Untersuchung der zypro-phönizischen Keramik bietet detaillierten Kontext und reiches Material. Jan Paul Crielaard hat mit einer ganzen Reihe von anders kaum greifbaren Hinweisen meinen Horizont in vielerlei Hinsicht erweitert, sowohl durch seine Bücher als auch im persönlichen Austausch. Mit ganz unverdienter Herzlichkeit wurde ich schließlich in Eretria willkommen geheißen und erhielt unschätzbare Hinweise und Aufschlüsse von der dort tätigen Schweizer Archäologischen Schule. Claude Léderrey trug entscheidend zur Erweiterung meines bis dato lückenhaften Verständnisses der Formen, Stile und Probleme euböischer Keramik bei, und Sylvian Fachard unternahm mit mir eine – in meinen Augen ungewöhnlich ertragreiche – Ortsbegehung, während der er mich an seinem fundierten Wissen über Euböa und seine Geschichte teilhaben ließ. Im Norden unterstützte mich anfänglich die mittlerweile verstorbene Julia Vokotopoulou; in der zentralen Frage nach prähistorischen Tieren half mir schnell und großzügig Evangelia Tsoukala in Thessaloniki, die Entscheidendes zu den Grundlagen des 18. Kapitels beitrug. Wie die anderen Fachleute, die sich mit dieser Epoche befassten, verdanke ich unendlich vieles den jahrelangen Feldforschungen von Giorgio Buchner und David Ridgway auf Ischia, den vielen Teams in Lefkandi, den Forschern, die jetzt in Oropos graben, und der Arbeit in den Friedhöfen von Torone, die nun von J. K. Papadopoulos vollendet wurde. Auf Zypern und im antiken Unqi sind zwei echte Titanen – Vassos Karageorghis sowie mein Vorgänger am New College, Leonard Wolley – tätig. Für den Mittelmeerraum während der gesamten Epoche wurden zahlreiche Objekte von zwei anderen Titanen, Nicolas Coldstream und Sir John Boardman, klassifiziert und interpretiert. Es geht mir so wie all ihren Lesern: Ich verdanke ihrem sicheren Urteil sehr viel; und ich bin sehr dankbar, dass Sir John Boardman mit seinem untrüglichen Gespür für Schwächen und Irtümer Teile meines Textes gelesen hat.
Ich zitiere assyrische und sogar luwische Quellen, bin allerdings selbst nicht bewandert in diesen Sprachen. Ich bin daher Stephanie Dalley dankbar, dass sie mir über viele Jahre immer wieder geholfen hat, sowie dem verstorbenen Jeremy Black für wichtige Hinweise und Richtigstellungen vor allem im Zusammenhang mit dem 14. Kapitel. Vieles verdanke ich Ian Rutherford, einem Bibliothekskollegen, dessen Kenntnisse des Hethitischen und der damit zusammenhängenden Forschungsprobleme mir an mehreren Stellen entscheidend weiterhalfen. Der 2001 verstorbene O. R. Gurney hat mich viele Jahre lang kritisch unterstützt; selbst als er bereits über 80 Jahre alt war, nahm er noch den langen Weg nach Oxford auf sich, um mir mitzuteilen, dass er eine meiner diffizilsten Vorstellungen nachvollziehen konnte. Von H. C. Melchert erhielt ich schnelle und eingehende Antworten auf die philologischen Fragen des 13. Kapitels. Außerdem war mir J. D. Hawkins’ großartiges Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions eine große Hilfe – eines der hervorragendsten Monumente von Gelehrsamkeit, die ich kenne. Um der besseren Verständlichkeit willen – nicht um die Unterschiedlichkeit dieser sehr verschiedenen Gesellschaften zu nivellieren – habe ich vom »Nahen Osten« oder vom »Osten« geschrieben.
Auf meinen heimischen Weidegründen – dem griechischen, dem lateinischen und dem in Oxford – profitierte ich von den Arbeiten, die mir Nicholas Richardson zur Verfügung stellte, sowie von Jane Lightfoots großartigen Untersuchungen. Robert Parker, Denis Feeney, Peter Wilson, John Ma, Peter Thonemann, Angelos Chaniotis und Bryan Hainsworth sorgten dafür, dass mein Wissen immer auf dem neuesten Stand blieb. Die stets liebenswürdige Maria Stamatopoulou schlug die unverzichtbare Brücke zur Archäologie in Nordgriechenland. Ich habe unendlich viel von den Veröffentlichungen Walter Burkerts profitiert, der mir auch immer wieder wichtige Sonderdrucke zukommen ließ. Vor allem stehe ich in der Schuld von M. L. West, dessen brillanter Kommentar zu Hesiods Theogonie mir erste Anstöße für dieses Buch gab und dessen East Face of Helicon eine unübertroffene Arbeit im Bereich der vergleichenden Literaturwissenschaft darstellt: Er vergleicht Texte, die er – im Gegensatz zu mir – im Original lesen kann. Am Anfang stand für mich der Gedanke, dass Wests Forschungen durch eine Verknüpfung mit den Euböa-Theorien John Boardmans sehr gewinnen könnten. West selbst hat sich mittlerweile schon wieder anderen Forschungsgebieten zugewandt.
In mir hatte sich die Idee jedoch festgesetzt, und ich ging ihr weiträumig-global in Begleitung verschiedener Personen nach: Im westlichen Kleinasien begleitete mich mein Sohn Henry; meine Tochter Martha hatte doch tatsächlich die Stirn, mich auf den Dschabal al-Aqra zu schleppen und dort die türkischen Soldaten zu bezirzen; und Lord Michael Pratt chauffierte mich, ohne uns umzubringen, durch viele Regionen der Colline Metallifere, wo wir das Glück hatten, von seiner Frau Janet hervorragend bewirtet und beherbergt zu werden. Diverse Linien meines Lebens liefen auf Ischia an den Abenden im herrlichen Garten von Lady Walton zusammen, in unmittelbarer Nähe der Siedlung Pithekoussai und in Hörweite von einem meiner Hauptakteure. Lord Charles Fitzroy und Jane Rae, Caroline Badger und Aurélia Abate gehören zu den vielen, die es mir ermöglichten, an wichtigen Stationen meines Weges Halt zu machen, was mir bewusster war als ihnen. William Poole stöberte Bücher auf, die weder in einer britischen Bibliothek noch im Handel erhältlich waren.
Ohne die Fertigkeiten von Schülern, die Texte niederschreiben können, gäbe es nichts zu lesen – hier ist an erster Stelle Robert Colborn zu nennen, dessen Genauigkeit und Sachkenntnis eine unabdingbare Voraussetzung dieses Buches waren. Des Weiteren danke ich Jane Goodenough, Jane Anderson und vor allem Christopher Walton für ihr professionelles Erfassen der Fußnoten; außerdem der großzügigen Unterstützung von Gene Ludwig. Claudia Wagner begab sich mit großer Geduld und schönen Resultaten auf die Suche nach den Illustrationen, die ich am nötigsten brauchte, und der Fachkenntnis von Alison Wilkins verdanken sich die im Buch enthaltenen Karten. Titel und Umschlag gehen auf die Entscheidung des Verlags zurück. Besonders danke ich den Lektoren Stuart Proffitt und Charles Elliott, Meistern ihres Faches, für ihren sicheren Zugriff und ihre wichtigen Hinweise. Elizabeth Stratford war eine sehr gewissenhafte und hilfreiche Korrektorin. Phillip Birch unterzog die ersten Kapitel einem sorgfältigen Lektorat und stieß auf ein entscheidendes Problem. Wie immer war Jonathan Keates mein stilistischer Berater, er las dieses Mal den gesamten Text. Eine Zeitlang brauchten wir für das Manuskript einen oder sogar zwei Plätze in der Bibliothek des New College, was die Bibliothekarin Naomi van Loo mit großer Nachsicht zuließ; ihr Vorgänger, Tony Nuttall, bleibt mir ein ständiger Begleiter, auch wenn er nicht mehr unter uns weilt.
Ich fing mit den Arbeiten zu diesem Buch in den Jahren an, als ich als Dozent, später als Fellow Griechische Geschichte und Literatur am Worcester College in Oxford unterrichtete und Arabisch lernte. Es gehörte damals zu meinem Alltag, täglich zwischen Asien und der Welt Homers hin- und herzureisen. Der Erste, der Teile davon zu lesen bekam, war Martin Frederiksen; sein bemerkenswert sicheres Urteil und zudem seine außergewöhnliche Fähigkeit, Texte und Archäologie zusammenzubringen, prägte mich und die Studenten, die wir unterrichteten, nachhaltig. Eine der ersten Gelegenheiten, bei denen ich mich mit meinen Ideen an die Öffentlichkeit wagte, war ein Vortrag in Oxford vor einer Hörerschaft, in der auch viele der alten Götter saßen. Einige von ihnen waren des Hörens glücklicherweise nicht mehr mächtig. Abwesende forderten den Text meines Vortrags an, der in schriftlicher Form nicht existierte – sie wollten ihn verbessern oder in ihrem Sinne umschreiben. Einer der Anwesenden äußerte sich lediglich zu den Bewegungen meiner linken Hand. Ein anderer jedoch stellte – mein Verständnis stillschweigend voraussetzend – eine höchst anspruchsvoll formulierte Frage und veränderte damit die Grundausrichtung meines Buches. Zu jener Zeit kannte ich George Forrest kaum, doch in den folgenden zwanzig Jahren am New College lehrte er mich Entscheidendes im Bereich griechischer Geschichte, nicht zuletzt dadurch, dass er es verstand, klare, neue Fragen zu stellen, die zu überraschenden neuen Erkenntnissen führten. Ich hoffe, dieses Buch bleibt dem treu, was auch er liebte.
TEIL I
HERAS FLUG
Ihr Brief hat mich, wie Sie wünschen, bei der Ilias angetroffen, wohin ich immer lieber zurückkehre, denn man wird doch immer, gleich wie in einer Montgolfiere, über alles Irdische hinausgehoben und befindet sich wahrhaft in dem Zwischenraume, in welchem die Götter hin und her schwebten.
Goethe an Schiller, 12. Mai 1798
Die Art aber, in der der Mensch lernt, seine Mythen zu bändigen, in der seine Fähigkeit, zwischen den einzelnen Bereichen seines Verhaltens zu unterscheiden, zunimmt, der Grad, bis zu dem es ihm gelingt, seine wirkenden Kräfte mehr und mehr unter die Herrschaft der Vernunft zu bringen, ist ein Maßstab für die Beurteilung des menschlichen Fortschritts von seinen primitivsten Anfängen zu dem, was wir Kultur nennen. Bei diesem Fortschritt nun waren die Griechen allen anderen voraus.
M. I. Finley, Die Welt des Odysseus (1954, dt. 1968)
1 HERAS FLUG
Im 15. Buch der Ilias fliegt die Göttin Hera zum Olymp, und der Dichter vergleicht ihren Flug mit einer Bewegung des menschlichen Geistes. Wenn ein Mann lang und weit gereist ist, so erzählt Homer, wird sein Geist hin und her springen, und er wird bei sich denken: »Dort möchte ich sein oder dort!«, während er »nach vielem trachtet«. Heras Flug, als sie sich vom einen Berggipfel zum andern bewegt, ist so geschwind wie diese sprunghaften Gedanken.1
2700 Jahre später können wir aufgrund unserer eigenen Erfahrung immer noch nachvollziehen, wovon Homer spricht. Wir verbinden derartige Gedanken nicht mit der Geschwindigkeit einer vorüberfliegenden Gottheit, uns kommt eher die unsichtbare Geschwindigkeit des Lichtes in den Sinn. Homers Vorstellung ist im Vergleich dazu unendlich viel genauer. Wenn eine Göttin von oben auf die Erde herabkommt, vergleicht er ihren Abstieg mit einem Hagelschauer.2 Wenn sie sich seitwärts durch die Luft bewegt, evoziert Homer die schweifenden Phantasien, in denen sich unser Bewusstsein ausdrückt, dass das Leben nicht notwendig so sein muss, wie es ist.
2700 Jahre stellen einen gewaltigen Abstand zwischen Homer und unserer Welt her, und über diese Kluft hinweg wurde die Psychologie seiner Helden von so manchem seiner modernen Leser für primitiv gehalten. Homers Helden denken mit ihrem »Herzen«, nicht mit dem Gehirn; sie können sich wie wir von Ideen oder Impulsen distanzieren, doch tun sie das häufig, als ob die entsprechende Idee oder der Impuls von außen gekommen wäre oder von einer unabhängigen Quelle; sie kennen kein Wort für eine Entscheidung, und weil sie noch keine Philosophen sind, haben sie kein Wort für das Selbst. Heras Flug aber erinnert uns daran, dass Homers Vorstellung des Geistes nicht durch die Wörter begrenzt wird, die er zufällig benutzt.3 Die unzusammenhängenden Gedanken seiner Helden stammen wie bei uns aus einem sie einenden Geist; seine Helden treffen Entscheidungen bezüglich ihres Handelns; sie wissen manchmal, wie etwa Hektor vor den Mauern von Troja, was das Beste wäre, ohne dass es ihnen gelingt, ihr Wissen in die Tat umzusetzen. Vor allem aber haben sie mit uns das spezifische Kennzeichen unseres Menschseins gemein, das Wissen darum, dass unser Leben auch ganz anders aussehen könnte und dass Menschen, die wir einst geliebt und dann verloren haben, im Vergleich zu dem, was uns gegenwärtig umgibt, tatsächlich in der Irrealität verschwinden können.
»Dort möchte ich sein oder dort …« In unserem Zeitalter globalen Reisens sind wir alle potentielle Erben von Heras Flug. Unter den Verfassern von Texten scheint diese Beschreibung vor allem auf die Romanciers, die idealisierten Helden unserer Lesegewohnheiten, zuzutreffen. Romanschriftsteller haben offensichtlich das Recht und die Pflicht, sich Dinge auszudenken, während bodenständige Historiker sich an die banalen Informationen halten müssen, die bis in unsere Zeit überlebt haben. Andererseits sind Romanciers durch ihre Erfindungen und durch die Notwendigkeit, diese kohärent weiterzuentwickeln, auch wieder eingeschränkt. Historiker müssen sammeln und ordnen, dann aber haben auch sie gewisse Freiheiten. Es ist ihre Aufgabe, die Zeugnisse zu gewichten, die Fragen zu stellen, auf die die Zeugnisse eine Antwort geben, und zu prüfen, ob es nicht andere Hinweise gibt, die gegen eine einmal gefundene Antwort sprechen und die nicht erklärt werden können. Wenn sie eine Lebensweise, eine Tätigkeit, eine soziale Gruppe rekonstruieren, bestimmen ihre Quellen das Bild, das sie sich jeweils machen, doch sie müssen auch in der Lage sein, sich vorzustellen, was unter der Oberfläche liegt: die offenbaren Lücken, die verborgenen Kräfte. Wenn sie über diese Leerstellen nachdenken, müssen sie sich vorstellen, wie die Realität jenseits ihrer eigenen Existenz ausgesehen haben mag. »Dort möchte ich sein oder dort …«: Solche Gedanken tauchen auch im Geist von Reisenden auf, die in den Zeugnissen anderer Zeiten und Orte intensiv unterwegs waren.
Philosophen werden nicht müde, uns zu versichern, dass das eine Illusion ist, dass Historiker nicht gleichzeitig in zwei verschiedenen Zeiten existieren oder in die Vergangenheit reisen und gleichzeitig sie selbst bleiben können. Wir aber »trachten nach vielem«: Vielleicht danach, im neuen Zeitalter des ersten christlichen Kaisers Konstantin ein moralisch makelloses Leben zu führen, oder unter Alexander dem Großen herrlich wild zu sein, oder im Athen des Sokrates die herkömmlichen Sitten zu hinterfragen, oder diese Sitten im Gegenteil im spätrömischen Nordafrika auf einem Landgut enormen Ausmaßes hochzuhalten, wo die Namen und Bilder der Lieblingspferde auf dem Bodenmosaik der Familienvilla auftauchen, wo sich auf dem Gebiet des Hofes für die Gebete verschuldeter Pächter eine einem christlichen Heiligen geweihte Kapelle befindet; und sich stark zu dieser so wenig christianisierten Gemeinschaft von Christen hingezogen zu fühlen, die der Gemeinde des Augustinus benachbart sind.
Wir können uns das nur wünschen, indem wir Heras Flug simulieren; nachdem ich nun aber im Lauf der Jahre lang und weit im Bereich zwischen Homer und Mohammed gereist bin, ist in mir immer noch der Wunsch lebendig, die griechische Welt des 8. Jahrhunderts v. Chr. noch einmal aufzusuchen – keine Welt mit berühmten Namen, die exakt datierbar und aus Biographien bekannt wären. Man kennt diese Periode nicht einmal durch Geschichten oder Erinnerungen, die in ihr aufgezeichnet worden wären: Die Geschichtsschreibung war noch nicht erfunden. Die Hauptquellen – Dichtung und archäologische Funde – stellen die Interpretation vor besonders schwierige Probleme. Vor allem von Letzteren ausgehend, haben Archäologen diese Zeit als »griechische Renaissance« bezeichnet, auch als Zeitalter eines deutlichen »Strukturwandels«, der möglicherweise durch Bevölkerungswachstum angestoßen wurde, vielleicht auch durch die Zunahme an kultivierbarer Agrarfläche und durch eine neue Bereitschaft der Dorfoberhäupter, sich zu Stadtstaaten zusammenzuschließen. Ein Zeichen dieser Veränderungen lässt sich im Aufkommen von deutlich definierten Begräbnisstätten ablesen.4 Andere entdeckten die Ursprünge bestimmter Leitvorstellungen unserer »abendländischen Welt«: die Geburt des »freien Marktes« nach der Phase des Tausches, die auf wechselseitig erwiesenen Gefälligkeiten beruhte; oder den unbelasteten Besitz kleiner Familienhöfe, das Geburtsrecht jener »anderen Griechen«, der kleinen Bauern, die in unseren modernen historischen Darstellungen, in denen Krieger und Gesetzgeber die Hauptrolle spielen, so oft übersehen werden.5
Es wäre natürlich reizvoll, diese Theorien auf den Prüfstand zu stellen, indem man ihre Realität im 8. Jahrhundert aufsucht, doch mein eigenes Vorgehen sieht anders aus. Ich möchte ein Muster verfolgen, das mir schon seit Längerem aufgefallen ist, eine Reise- und Mythenspur, die von Griechen des 8. Jahrhunderts gezogen wurde. Diese Spur bewegt sich quer über den gesamten Mittelmeerraum, und sie ist das Thema dieses Buches. Bislang noch unbemerkt erstreckt sie sich auf weitere zentrale Elemente des antiken Lebens, die uns auch heute noch präsent sind: Aspekte der Landschaft, Lieder und Orakel, und die unübertroffene Dichtung Homers und seiner Zeitgenossen. Außerdem zielt sie auf eine Weise des Denkens und Weltverstehens, die in aktuellen historischen Darstellungen dieser frühen Periode keine Rolle spielt, die jedoch von Israel bis zu den entlegensten Orten griechischer Präsenz ihre Wirksamkeit entfaltete, und das zu einer Zeit, als es noch keine Philosophie gab und keinen abgrenzbaren Bereich, den man als »westliches Denken« hätte bezeichnen können.
Heutige Realisten werden sogleich Einwände erheben gegen den Wunsch, sich an die Grenzen eines Zeitalters zurückzubegeben, das uns so dunkel vorkommt. Die Lebenserwartung im 8. Jahrhundert war niedrig; die Massen wurden von einigen wenigen ausgenützt; nicht zu vergessen die unsichtbaren Begleitumstände der Vergangenheit, beißender Gestank und Schmerz, verursacht durch das Fehlen von Wasserspülungen und Toiletten. Sexismus stand in voller Blüte, was sich am besten am Mythos von Pandora ablesen lässt, dem Ursprung aller menschlicher Leiden, und »von Homer bis zum Ende der griechischen Literatur gab es keine Wörter mit der spezifischen Bedeutung ›Ehemann‹ und ›Ehefrau‹«.6 Es fehlten außerdem die kleinen Dinge, die unser Leben erleichtern: Es gab keinen Zucker, keine Schokolade, keine Klaviere. Und lebten in der karstigen griechischen Landschaft überhaupt Pferde, auf denen man reiten konnte? Auf Keramiken aus dieser Zeit sind die Männer nackt, ohne Kleidung dargestellt, also mussten die Griechen, die sich in sportlichen Wettkämpfen miteinander maßen, das wohl unbekleidet tun? Wir können uns glücklich schätzen, dass wir nicht mehr in solchen Zeiten leben …
Ganz unberechtigt sind derartige Einwände nicht. Ausgrabungen in zwei der am besten erforschten Friedhöfe in der griechischen Welt aus der Zeit zwischen 1000 und 750 v. Chr. lassen wenig Raum für Optimismus. In Lefkandi, auf der Insel Euböa, »ließen die am besten erhaltenen Bestattungen darauf schließen, dass die Erwachsenen in recht jungem Alter starben […] in der Blüte ihres Lebens, zwischen 17 und 40. Die Skelette junger Menschen, die man in allen drei Friedhöfen fand, weisen ferner darauf hin, dass wahrscheinlich auch die Kindersterblichkeit sehr hoch war.«7 In San Montano auf Ischia, wo Griechen seit 770 v. Chr. siedelten, »verteilte sich die Belegung des Friedhofs auf ungefähr ein Drittel Erwachsene und zwei Drittel Kinder und Jugendliche«, von den Letzteren waren 27 Prozent Babys, »häufig Neugeborene oder Totgeburten«.8 Bei der Untersuchung der Knochen, Zähne und Skelette an diesen und anderen griechischen Grabungsorten aus jener Zeit stieß man auf ein erschütterndes Ausmaß an Verletzungen, Krankheiten und Behinderungen. In Pydna an der Küste von Süd-Ost-Makedonien ergab der Fund von vierzig Skeletten, dass »degenerative Gelenkerkrankungen bereits sehr früh ausbrachen, zwischen dem 13. und dem 24. Lebensjahr, und bei Männern und Frauen auftraten […] Mindestens neun Personen der von uns untersuchten Gruppe litten unter arthritischen Veränderungen, hauptsächlich solchen der Wirbelsäule […] die beiden Personen, die älter waren als 45 Jahre, zeigten gravierende arthritische Veränderungen.«9
Für diejenigen, die das alles überlebten, gab es keine Menschenrechte, die Herrschaft der wenigen Mächtigen über die vielen war noch unhinterfragt. Bedenkenlos versklavten diese »happy few« ihre Mitmenschen, verwendeten sie als Arbeitskräfte in ihren Häusern und Höfen. Lästige Domestiken konnten sogar ins Ausland verkauft werden, worauf die Freier in der Odyssee anspielen, als sie dem Sohn des Odysseus empfehlen, zwei aufsässige Bettler für teures Geld an »die Sikelen im Westen« (in unser heutiges Sizilien) zu verkaufen; dass einer von den beiden der edle Odysseus war, wussten sie nicht.10 Dabei war die Sklaverei nur die extremste Form der Profitmacherei. In Attika nahmen die Adligen den anderen attischen Landbesitzern ein Sechstel ihres Ertrags ab. In Sparta zogen die Spartaner im späten 8. Jahrhundert die Hälfte der Erzeugnisse ihrer griechischen Nachbarn ein, die sie besiegt und zu »Leibeigenen« gemacht hatten.
Betrübliche Fakten wie diese überschatten meinen Wunsch, mich auf diese Epoche einzulassen, es sei denn, man tut es von vornherein differenziert und kritisch, angefangen bei der hohen Sterblichkeitsrate bis hin zur öffentlichen Nacktheit. Das einzige Gegengewicht zu einem frühen Tod war ein großes Los in der Lotterie des Lebens. Im 8. Jahrhundert war ein solches Los durchaus möglich, obwohl die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer war als heute. Die »durchschnittliche« Länge eines Lebens im 8. Jahrhundert, wie sie in manchen modernen Tabellen auftaucht, repräsentiert all die vielen Unterprivilegierten, bringt die Höhen und Tiefen eines individuellen Lebens jedoch zum Verschwinden. Die Lebenserwartung derer, die das Risiko der Kindersterblichkeit überlebt hatten, war höher. Einzelne Männer, die diesem Schicksal entgingen und auch vom Tod auf dem Schlachtfeld verschont blieben, konnten weit über 60 Jahre alt werden. Aristoteles berichtet von ihrer politischen Bedeutung in den frühen griechischen Gemeinden; ein Rat aus über 60-jährigen Männern verfügte in Sparta über beträchtliche Macht; und in den homerischen Epen ist der alte Nestor eine Verkörperung von Weisheit. Den Frauen, die die Strapazen mehrerer Geburten überlebten, bot sich, wenn sie aus reichen Familien stammten, die Funktion von Priesterinnen in den Tempeln der Götter an.11 Eine kleine Minderheit scherte also aus der durchschnittlichen Lebenserwartung aus, diese Minderheit wurde angetrieben, so die aktuelle Darstellung eines älteren Althistorikers, »von gespannter kreativer Aktivität, der der Lohn des Gelingens, der Ehre und des Ruhms winkte […] Es handelte sich also um eine ganz andere Spannung als den unausgesetzten Stress, unter dem diejenigen standen, die täglich um ihr nacktes Überleben kämpfen mussten, was ihre an sich schon schlechten Lebensumstände noch verschlimmerte.«12
Diese »gespannte kreative Aktivität« machte sich am deutlichsten in der Gruppe der männlichen Adligen bemerkbar, die in ihren Gemeinschaften dominierten. Als Mann in eine adlige Familie hineingeboren zu werden war ein sicherer Schutz gegen soziale Ausbeutung. Aristokraten, vor allem Aristokratinnen, konnten zwar versklavt werden, aber nur, wenn ihre Gemeinschaft überfallen und besiegt wurde. Freundschaftsbande zwischen Familien, Gastgebern und Gastfreunden trugen dazu bei, die Risiken zu reduzieren, die von adligen Außenseitern ausgehen konnten. In ihren eigenen Gemeinschaften wurden Adlige von Standesgenossen sicher nicht versklavt.
Und wie ging man mit Gestank und Schmerz um, die auch vor dieser kleinen Gruppe der Oberschicht nicht haltmachten? Hier müssen wir vorsichtig sein. Homer beschreibt in seinen Epen fürchterliche Wunden, die im Kampf entstehen – insgesamt 148 –, und manchmal auch die mit ihnen verbundenen Todesqualen (drei Viertel der Verwundungen sind tödlich).13 Man sollte jedoch nicht den Schluss ziehen, dass die Schmerzgrenze für die Griechen des 8. Jahrhunderts v. Chr. höher lag als für uns, weil Schmerzen so weit verbreitet waren oder weil sie in den Texten einen anderen Stellenwert haben. Bereits Homer erwähnt einen Umstand, der uns auch heute bekannt ist, dass nämlich eine gewisse Zeit verstreicht zwischen einer schweren Verwundung und der Schmerzempfindung des Verwundeten. Er führt das nicht auf Mechanismen des Gehirns zurück, wie wir das zu tun pflegen; er stellt vielmehr einen Zusammenhang mit dem von der Wunde wegführenden Blutfluss her, als wäre es dessen Geschwindigkeit, die die Verzögerung der Schmerzempfindung verursacht.14 Über die Schmerzen, die einem natürlichen Tod vorausgehen, berichtet Homer kaum; er gibt nicht zu erkennen, ob er sich darüber im Klaren ist, dass diese so schlimm sein können wie die Schmerzen im Zusammenhang mit einer Verwundung. Dieses Schweigen ist jedoch kein Beweis dafür, dass die Schmerzerfahrung zur Zeit Homers sich von unserer unterschieden hätte: Vielleicht deutet es ja nur auf die Aspekte von Schmerz hin, die ein Dichter üblicherweise zu beschreiben hatte. Sieht man von unserer modernen Schmerz-Überempfindlichkeit ab, kannten auch die Griechen des 8. Jahrhunderts das, was wir fühlen: den »schwarzen Schmerz« von Wunden und Verletzungen des Körpers. Das Gegenmittel war nicht geringere Schmerzempfindlichkeit, sondern wie heute auch der Einsatz von Schmerzmitteln. Wunden konnten »geschickt« verbunden werden, obwohl wir bei Homer lediglich an zwei Stellen von speziellen Verbänden erfahren (einer davon wird »Schlinge« genannt).15 Schmerzlinderung zählt in den Epen Homers auch zu den weiblichen Fähigkeiten. In Nestors Zelt bietet die junge Sklavin und Gefangene Hekamede (in deren Namen das Wort »Klugheit« anklingt) den verwundeten, kriegsmüden Männern Wein an, vermischt mit Gerste und gewürzt mit Zwiebeln und geriebenem Ziegenkäse. Das klingt für uns wie ein Rezept für schnellen Tod, doch damals glaubte man an die schmerzlindernde, kräftigende Wirkung dieses Getränks: Käsereiben wurden bereits in einigen vorhomerischen griechischen Gräbern gefunden, was darauf hinweist, dass reiche Griechen auch tatsächlich an den Wert dieser Mischung aus »Käse und Wein« glaubten.16
Hekamedes Zwiebel war noch vergleichsweise harmlos unter den Heilpflanzen, die Homer erwähnt. Sie sind Vorläufer vieler heutiger Schmerzmittel, die ebenfalls aus Pflanzen gewonnen werden. Kurz nach Hekamede begegnen wir einer anderen homerischen Frau, der freigeborenen, blonden Agamede (»äußerst klug«), die »alle Heilkräuter kannte, die die weite Erde trägt«.17 In der Odyssee mischt Helena den Männern ein Mittel in den Wein, als die Geschichte, die sie erzählt, diese zu Tränen zu rühren droht: »Wer diesen Trank trinkt«, so erklärt sie, »dem wird einen Tag lang keine Träne die Wangen herabrinnen, selbst dann nicht, wenn seine Mutter und sein Vater beide sterben würden.«18 Helenas Tränen-Stopper stammte bezeichnenderweise aus Ägypten, einer bei den Griechen allgemein anerkannten Quelle ausgezeichneter medizinischer Heilmittel. In der Natur war dieses Mittel nicht zu finden, so wenig wie das Kraut »Moly«, das Hermes Odysseus als Gegengift gab, eine Pflanze mit schwarzer Wurzel und milchweißer Blüte.19 Wir wissen allerdings, dass der Dichter reale Gebräuche beschrieb und stilisierte. Tatsächlich wurden Pflanzen, darunter auch Opium, als Schmerzmittel eingesetzt. Keramik in der Form von Samenkapseln der Mohnpflanze wurde zwischen 850 und 800 v. Chr. auf Zypern hergestellt und auf die Nachbarinseln, unter anderem auch nach Kreta, exportiert. Im 8. Jahrhundert v. Chr. wurde Opium möglicherweise in kleinen, handgemachten Krügen zu den Griechen gebracht, die sich westlich von Italien auf der fernen Insel Ischia niedergelassen hatten.20
Medikamente also, nicht aber anders gelagerte Schmerzgrenzen, waren das Mittel der Alten gegen Schmerz. Was diese Medikamente allerdings nicht vertreiben konnten, waren die Gerüche des Alltags. In den homerischen Epen wird der Gestank der Toten auf einem Schlachtfeld nicht sonderlich hervorgehoben, obwohl die Menschen ihn mit Sicherheit als außergewöhnlich empfunden haben müssen: Der Gestank der Toten, der auch Krankheiten hervorrufen konnte, wurde später als ein Grund dafür angeführt, dass Alexander sich so schnell von Gaugamela zurückzog, dem Ort seines großen Sieges in Asien.21 Im Unterschied zu akutem Schmerz nehmen wir Geruch nach einiger Zeit nicht mehr so deutlich wahr, und in weniger extremen Umständen, als es ein Schlachtfeld ist, würden wir uns wahrscheinlich relativ schnell daran gewöhnen. Homerische Helden sind lediglich gegen extrem schlechte Gerüche empfindlich, wie etwa das in der Sonne trocknende Fell von getöteten Seehunden. Weniger aufdringliche Gerüche wurden durch den weitverbreiteten Einsatz von Parfums und Duftölen erträglich gemacht. Wie in vielen anderen vormodernen Zeitaltern dienten Duftstoffe, ihre Herstellung und der Handel damit im 8. Jahrhundert nicht nur der Befriedigung der Luxusbedürfnisse von Frauen oder auch Männern, vielmehr erleichterten sie das tägliche Leben wesentlich und wurden aus vielerlei Pflanzen des Mittelmeerraums hergestellt: Wir kennen sie aus den stabilen Flakons, in denen diese Produkte vertrieben und verkauft wurden.22 Die Menschen des 8. Jahrhunderts kannten die Pflanzen ihrer Zeit um einiges besser als die meisten ihrer modernen Historiker. Öle aus Madonnen-Lilien, Rosen oder Safran-Krokus zählten zu den Mitteln, mit denen sie sich gegen unsichtbare Feinde wappneten.
Die Tatsache, dass Frauen Parfums verwendeten, war nicht unumstritten. Parfums waren unter Umständen teuer und gehörten zu den Luxusgütern, was bei den Männern Furcht, ja Abneigung gegenüber müßiggängerischen, dem Luxus frönenden Frauen hervorrufen konnte. In den Gedichten Hesiods, der nur wenig später schrieb als Homer, wird dieser sexistische Groll deutlich ausgesprochen. In einem der Gedichte Hesiods setzt die erste Frau Pandora zahlreiche Übel frei und beendet damit die Phase einer ausschließlich männlich geprägten Epoche, in der die Männer in glücklicher maskuliner Gemeinschaft mit den Göttern lebten. In einem anderen Gedicht tritt Pandora als faules Luxusgeschöpf auf; sie sei, so Hesiod, der Ursprung des »bösen Geschlechts« der Frauen, mit dem sich die Männer dennoch in der Ehe zusammentun müssen, um Erben zu zeugen und im Alter versorgt zu sein.23 Aber dieser Groll ist lediglich ein Aspekt der damaligen griechischen Vorstellungen. Bei Homer gibt es zwar kein Wort mit der spezifischen Bedeutung »Ehefrau«, doch fehlt ein solcher Ausdruck auch in der höfischen Sprache Frankreichs. Aus der Abwesenheit eines Wortes folgt nicht notwendig die Abwesenheit von Liebe zwischen Ehefrauen und Ehemännern. Sensible Leser der Odyssee wissen, dass die Beziehung zwischen Penelope und Odysseus mehr ist als nur die eines Mannes zu seiner »Bettgespielin« oder zu einem Objekt, das er besitzt oder vorübergehend begehrt.
Neben der ehelichen Liebe gab es noch andere Dinge, die das Leben verschönerten. Es gab zwar keinen Zucker, aber die zahlreichen Bienenkörbe, die in manchen Gegenden Griechenlands in großer Zahl aufgestellt waren, lieferten reichlich Honig. Es gab keine Klaviere, aber Musik war allgegenwärtig – durch die Saiten der Lyra, die Erntegesänge im Herbst, die Trompete oder die Schildkrötenleier. Außerdem kannte man den Reiz und Luxus von Pferden. Pferde gehörten zu den beliebtesten Statussymbolen jener Zeit, sie wurden auf den großen griechischen Tongefäßen im »geometrischen« Stil abgebildet, auf runden Tonbehältern für Trankopfer an die Toten, sie wurden eingeritzt in Bronzegürtel und vor allem in Bronze gegossen als Bestandteil großer Kessel und als Statuetten, die in Heiligtümern dargebracht wurden; sie waren das am weitesten verbreitete Votivobjekt jener Zeit und verweisen auch auf die soziale Klasse und den Geschmack derer, die sie darbrachten.24 Unter den Adligen in Griechenland war das 8. Jahrhundert eine Hoch-Zeit der Pferdehaltung. Pferde weideten auf den Besitztümern griechischer, Pferde züchtender Aristokraten und beeinflussten sogar die Wahl der Namen, die man den Neugeborenen gab. Auf den Zeichnungen sind sie mit sehr dünnen Beinen und schematisch gebogenem Hals dargestellt, doch wurden Pferde auch geritten, ein Umstand, den Homer lediglich zweimal erwähnt.25 Eine schöne Schale mit flachem Boden aus Athen aus der Zeit um 740 – 720 v. Chr. zeigt auf dem Fries an der Innenseite vier Pferde, auf deren Hinterteil jeweils ein Reiter steht, der die Zügel in der rechten Hand hält (Abb. 8). Jedes Mal, wenn der Besitzer aus dieser Schale trank, bot sich ihm dieser außerordentliche Balance-Akt dar. Und es handelte sich durchaus nicht um eine symbolische Darstellung, vielmehr zeigte sie die Reitkunst des 8. Jahrhunderts in ihrer vollendeten Form. »Als Züchter und Dresseur von Pferden verkörpert der Adlige der geometrischen Periode eine neue Art der Herrschaft über Tiere. Die Botschaft der […] Schale könnte nicht klarer sein.«26
Pferde waren im Griechenland des 8. Jahrhunderts sowohl in der Kunst als auch im Leben ein Gegenstand der Bewunderung und wurden daher häufig dargestellt. Später nahm man sogar an, dass ein Pferd am Beginn der Kunst des Zeichnens stand: Als Saurias von Samos, ein Grieche des 8. Jahrhunderts, ein Pferd in der Sonne stehen sah, soll er den Umriss seines Schattens gezeichnet und so die erste Skizze angefertigt haben.27 Und wie steht es um die Nacktheit, die in der Vasenmalerei und anderen gegenständlichen Darstellungen so eine große Rolle spielt? Müssten wir, wenn wir ins 8. Jahrhundert v. Chr. zurückkehren wollten, unbekleidet miteinander verkehren, herumspazieren, Sport treiben? Hier bildet die künstlerische Darstellung das wirkliche Leben nicht einfach ab, außerdem verändert sich im Lauf des Jahrhunderts ihr Gegenstandsbereich. Nacktheit war die übliche Darstellungsweise und wurde zunächst unterschiedslos sowohl bei der Darstellung von Männern wie von Frauen angewendet. Um das Jahr 750 v. Chr. werden auf den in Attika entstandenen großen Tongefäßen trauernde Frauen nackt dargestellt, was keine Entsprechung in der Realität hatte. Elfenbeinerne Statuetten nackter Frauen sind in großer Zahl bekannt, überwiegend aus Stätten am östlichen Mittelmeer und in der Levante, ursprünglich entstanden sie als Votivgaben an die Götter.28 Um das Jahr 740 v. Chr. werden in der griechischen Vasenmalerei Frauen bekleidet dargestellt, ebenso wie Männer, die reiten oder Streitwagen lenken. Die in der Kunst noch nackt dargestellten Männer lassen nicht darauf schließen, dass Männer in der Tat nackt jagten, kämpften oder um ihre Toten trauerten.29
Und wie steht es um die männlichen Athleten – waren sie die Ausnahme? Ihre Gewohnheiten sind Gegenstand von Geschichten, die im 8. Jahrhundert angesiedelt sind, dem Zeitalter, in dem die Olympischen Spiele zu neuer Bedeutung kamen. Es gibt mehrere Geschichten von den ersten Griechen, die – wie es später in Griechenland dann üblich war – zu öffentlichen Wettkämpfen nackt antraten, aber da diese Berichte erst in den Texten späterer Jahrhunderte auftauchen, stellen sie keinen zuverlässigen Beleg für frühere Gebräuche dar. Am ehesten sollte man in ihnen großsprecherische Erfindungen späterer Epochen sehen. Als sich das Training ohne Bekleidung durchgesetzt hatte, wurde es ins 8. Jahrhundert zurückprojiziert und den Wettkämpfern jener Zeit als deren Erfindung zugeschrieben; bei den Konkurrenten handelte es sich um Athener, Spartaner oder sogar um Megarer, deren Meisterathlet Orsippos als Erster bei Olympischen Spielen das Rennen nackt bestritten haben soll, und zwar wahrscheinlich im Jahr 724.30 Auf Vasenbildern werden griechische Athleten beim Rennen allerdings noch lange nach 720 in Lendenschurzen dargestellt; homerische Helden tragen bei Boxkämpfen Lendenschurze, und an keiner Stelle wird erwähnt, dass sie nackt Rennen ausgetragen hätten. Die Serie von Siegen des Orsippos ist womöglich eine Fiktion, die die Megarer (die ihn verehrten) erfunden hatten, um den Spartanern etwas entgegenzusetzen, die ihrerseits behaupteten, dass sie als Erste nackt zu Wettkämpfen angetreten seien. Sittsame Zeitreisende brauchen sich lediglich hinter den Schild der großen Autorität des Historikers Thukydides im späten 5. Jahrhundert v. Chr. zurückzuziehen. Dieser berichtet nämlich, dass die Spartaner die Ersten waren, die nackt trainierten, und dass deren Nacktheit die Lendenschurze – auch bei den Olympischen Spielen – »erst vor wenigen Jahren« abgelöst hatte.31
Man brauchte im Griechenland des 8. Jahrhunderts als Mann eine ordentliche Portion Glück, um nicht früh zu sterben, um überhaupt in eine der herrschenden adligen Klassen hineingeboren zu werden. Anschließend konnte man dann auch andere Hindernisse bewältigen. Schmerz konnte fallweise durch Drogen betäubt werden, Parfums überlagerten den Gestank. Musik gab es genug, und als Ehemann konnte man auf eine epische Erzählung zurückgreifen, die die Liebe eines Mannes zu seiner Frau zum Ausdruck brachte. Es gab keine Sättel, Steigbügel oder Hufeisen, doch es standen mehr als genug Pferde zum Reiten zur Verfügung; und man musste als Mann an Wettrennen und Boxkämpfen nicht nackt teilnehmen, auch nackt zu tanzen blieb einem erspart. Das Leben war schwer, aber für einen Mann des 21. Jahrhunderts nicht unvorstellbar. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, diese Zeit auf meiner Wanderung ins 8. Jahrhundert wieder zu besuchen; da jedoch ein wirklicher Besuch ausgeschlossen ist, muss ich mich sukzessive annähern, anhand von Zeugnissen, die auf uns gekommen sind, zunächst auf den Spuren einzelner Reisender, dann auf den Spuren einzelner Mythen, die diese mit sich führten. Die Reisenden waren Griechen, allerdings waren die Griechen – wie wir im Zeitalter multikultureller Geschichtsschreibung nicht müde werden zu betonen – weder das bedeutendste noch das reichste Volk ihres Zeitalters. Da das 8. Jahrhundert v. Chr. uns so weit entfernt erscheint, möchte ich zunächst einzelne Orte im weiten Horizont dieser Zeit markieren, eine Reihe von Ausgangspunkten und berühmten Namen, die sich von China bis Cadiz erstrecken. Diese bringen uns in Kontakt zu bestimmten Personen, mit denen auch die Griechen in Verbindung standen und von denen sie neue, wichtige Impulse erhielten. Als Griechen hatten sie allerdings einen Vorteil, den niemand sonst damals oder später hatte. Der geographische Verlauf ihrer Reisen und Mythen bewegt sich parallel zu diesem einen immensen Trumpf der Griechen: den epischen Gedichten Homers, und er präsentiert sie in einem neuen und aufregend anderen Licht. Das Licht fällt auf die schwer fassbaren Ursprünge der homerischen Dichtung, aber auch unmittelbar auf einen schwer zu fassenden homerischen Ton, den seine Leser in der Antike später nicht mehr verstehen konnten. Er ist in unserer Welt noch immer vernehmbar: Wenn wir der Spur folgen, die von den griechischen Zeitgenossen gelegt wurde, können wir endlich begreifen, was Homer eigentlich sagen wollte.
2 VON CHINA NACH CADIZ
Es versteht sich von selbst, dass die Menschen der damaligen Zeit nicht in dem Bewusstsein lebten, dass ihre Existenz ins 8. Jahrhundert v. Chr. fiel. Diese Zeitbestimmung gehört zu einer Chronologie, die wir ihnen überstülpen. Die Menschen jener Epoche berechneten ihre Zeit nach Generationen oder, wenn sie einen weiteren Horizont hatten und bei Hof verkehrten, nach den Jahren des gerade regierenden Königs. Wir dagegen platzieren im 8. Jahrhundert v. Chr. eine ganze Reihe von bedeutsamen Jahreszahlen: »776 v. Chr.« (bei den Griechen), »771 v. Chr.« (für die chinesische Geschichte), »753 v. Chr.« (für die Römer), »745/4« bzw. »705 v. Chr.« (für die assyrischen Könige) oder »722/1« (für das Königreich Israel). Bei den Griechen hängt das Datum »776 v. Chr.« mit einem bestimmten kulturellen Ereignis zusammen: dem Beginn der Olympischen Spiele. In China oder Assyrien oder Israel gab es niemanden, der regelmäßigen Pferderennen oder Wettläufen und Ringer-Wettkämpfen unter frei geborenen, erwachsenen Männern zuschaute. Das Datum »776 v. Chr.« entspringt unserer modernen Berechnung, doch es geht auf die Untersuchungen des griechischen Gelehrten Hippias zurück und auf seine Liste der olympischen Sieger, die er um 400 v. Chr. zusammenstellte. Wahrscheinlich gab es in Olympia auch vor dem Anfangsdatum der Liste des Hippias Wettkämpfe, »776« ist also ein zufälliges Datum. Allerdings fand es später in jüdischen und christlichen Polemiken Anwendung, um zu zeigen, dass die griechische Geschichtsschreibung und die damit verbundene genaue Chronologie in der Weltgeschichte noch relativ neu waren, vor allem verglichen mit Ereignissen in den heiligen Schriften der Juden und Christen.1
In einem von derart markanten Daten geprägten Jahrhundert waren die Menschen an vielerlei verschiedenen Plätzen auf dem Globus unterwegs, in China, im Mittleren Osten oder im Mittelmeerraum bis in den äußersten Süden Spaniens. Die Aktivitäten der Griechen im 8. Jahrhundert bilden somit einen Bestandteil in einem größeren Bild, von dem ihnen weite Gebiete unbekannt blieben. Sie hatten sicher keinerlei Kenntnis von dem großen Ereignis des Jahres 771 v. Chr. In jenem Jahr wurde die in Nordchina regierende Zhou-Dynastie nach drei Jahrhunderten an der Macht von Angreifern in Richtung Osten vertrieben und gezwungen, sich in ihrem zweiten Siedlungsgebiet, dem heutigen Luoyang am Gelben Fluss, niederzulassen. Das führte zu gewaltigen Veränderungen, weil Nordchina danach in kleine Staaten zerfiel und ein prekäres Vakuum entstand, in dem sich dann allmählich die Qin-Dynastie festsetzte. Diese eroberte die alte westliche Hauptstadt der Zhou, das heutige Xi’an, und Jahrhunderte später ging aus der Qin-Dynastie der erste Kaiser der chinesischen Geschichte hervor.2
Aus Indien gibt es keine schriftlichen Zeugnisse aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. Wir haben lediglich religiöse Texte, die Veden, und Epen, die älter sind als ihre ersten Niederschriften; sie gehen zurück auf eine Zeit, bevor sich in der Ganges-Ebene Staaten herauszubilden begannen. Sie vermitteln uns den Eindruck von kriegerischen Reiter-Gesellschaften, in denen »die Mußestunden hauptsächlich mit Musik, Gesang, Tanz und Spiel zugebracht wurden, und mit Wagenrennen für die Starken […] Die Spieler beklagten das, spielten aber weiter […].«3 Große Namen sind aus dem Indien des 8. Jahrhunderts nicht überliefert; die Archäologie des Subkontinents fand eine große Vielzahl verschiedener archäologischer Kulturen vor.
Auch für den Nordwesten, die Region des modernen Afghanistan, setzen die schriftlichen Quellen erst viel später ein. Allerdings gehen sie auf mündliche Überlieferungen zurück, die teilweise bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen: Ich spreche von den Hymnen und dem Avesta der Zoroastrier, die als religiöse Texte weitergegeben wurden. In ihnen werden eindrucksvolle Ansiedlungen erwähnt, »schöne« Orte »mit wehenden Bannern« oder Standarten, also wahrscheinlich Orte für Zusammenkünfte, möglicherweise von Truppenversammlungen oder Festen. Diese »schönen« Orte befinden sich auf beiden Seiten des Hindukusch-Gebirges, in Baktrien, wo eine solche Siedlung im antiken Balch gefunden wurde, und in »Arachosien« am Fluss Helmand, wo ein weiterer »schöner« Ort die alte Stätte in der Nähe Kandahars sein muss, eine Siedlung, die bereits um 700 v. Chr. rund 81 Hektar umschloss.4
Im Westen des heutigen Iran treffen wir – wenn auch nur in den Texten ihrer Angreifer aus dem Süden – auf ein weiteres bedeutendes Volk des 8. Jahrhunderts: die Meder. Diese Meder, so erfahren wir, haben Hunderte von »Städten«, die allerdings noch nicht gefunden worden sind: »Stadtherren« herrschen über eine Gesellschaft, die wir uns ohne diese schriftlichen Zeugnisse wohl eher als eine Gesellschaft aus Nomaden und Hirten vorgestellt hätten. Die »nahen Meder« des Zagros-Gebirges werden unterschieden von den »fernen Medern«, auf die man in so entlegenen Gebieten wie dem »Bikni-Berg« stieß, womit wohl der schneebedeckte Demawend an der Südküste des Kaspischen Meeres gemeint ist. Diese Meder waren vor allem Reiter, echte Reiter, nicht »nur« Wagenlenker. Sie waren schon außerordentlich »mächtig«, allerdings sollten ihre eigentlichen Eroberungsjahre erst eineinhalb Jahrhunderte später einsetzen.5
Karte 1: Khorsabad bis Cadiz
Die gebildeten Angreifer, deren schriftliche Zeugnisse von den Medern berichten, sind die assyrischen Könige in Mesopotamien (im Nord-Irak) in der Gegend des Tigris. Die zentrale Gestalt im 8. Jahrhundert war der Eroberer-König Tiglath Pileser III. Zunächst befestigte er 745/4 die Macht der Assyrer gegen die Feinde an den Nord-, Süd- und Ostgrenzen des Königreichs. Er gewann für Assur die Herrschaft über die große alte Stadt Babylon; und er führte sein Heer Richtung Nordwesten in das gebirgige Königreich Urartu in der Nähe des Urmia- und des Van-Sees im Osten der heutigen Türkei.6 Auch hier stießen die Assyrer auf Reiter und Pferde, die ihre Bewunderung hervorriefen: Sie schrieben von einem »Volk, wie es keines gibt in ganz Urartu hinsichtlich ihrer Kenntnis von Reitpferden. Über Jahre hinweg haben sie die Fohlen von wilden Pferden gefangen. Sie legen ihnen [nicht von vornherein] Sättel an, [wenn sie es dann tun] […], brechen die Pferde nicht mehr aus dem Geschirr aus.«7 Diese Pferde übten auf die assyrischen Angreifer eine magnetische Anziehungskraft aus: Sie brauchten sie für ihre eigenen Streitwagen und außerdem, wie den Darstellungen zu entnehmen ist, für die Begleiter, die neben den Wagenlenkern herritten.
In den Jahren 740 und 738 v. Chr. überschritt Tiglath Pileser den Euphrat und zog weiter in den Südwesten nach Nordsyrien. Er eroberte das Königreich »Patina« in Nordsyrien, das seine Schreiber auch »Unqi« nannten. Der Name ist abgeleitet vom westsemitischen Wort für eine Tiefebene. Wie die Könige vor ihm zog er weiter zum nahegelegenen Amanos-Gebirge, das die Ebene im Norden begrenzt. Dies war das »Gebirge der Buchsbäume«, deren helles Holz von den Handwerkern am assyrischen Hof sehr geschätzt wurde.8 Von hier hatte man dann einen Ausblick auf das »Große Meer«, unser östliches Mittelmeer, das für die Assyrer, die keine Seefahrer waren, eine Grenze bildete. Ihre Eroberungsmacht erstreckte sich bis zum Rand des Meeres, auf dem Schiffe aus vielen unterschiedlichen Häfen, darunter auch griechische, unterwegs waren.
»Ich bin Tiglath Pileser«, so der zeitgenössische Text auf einem Denkmal, das der König im Nordwesten des Iran für sich errichten ließ, »der König von Assur, der höchstselbst vom Osten bis zum Westen all diese Gebiete erobert hat. Vom großen Meer im Osten […] bis zu den Gestaden des großen Meeres im Westen bin ich hin und her gezogen, und ich habe die Welt regiert.«9 Dabei waren die Siege Tiglath Pilesers letztlich beeindruckender als die geographische Ausdehnung seines Reiches. Er breitete die assyrische Macht bis in die Gegend des modernen Bahrain aus; er stieß auch bis zum Mittelmeer vor, allerdings eroberte er kein Land, über das nicht auch schon seine Vorgänger geherrscht hätten. In der Levante hatte es schon in der Mitte und am Ende des 9. Jahrhunderts assyrische Könige gegeben. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts v. Chr. wandten sich die lokalen Herrscher Nordsyriens noch immer an assyrische Beamte, wenn es um die Schlichtung ihrer Streitigkeiten ging.10 Tiglath Pilesers Leistung bestand darin, die bereits seit Längerem bestehende assyrische Präsenz in Nordsyrien als expliziten Gebietsanspruch durchzusetzen.
An der Westgrenze berührten diese Eroberungen griechisches Gebiet, aber es sind keine griechischen Quellen, durch die wir von ihnen erfahren. Sie haben vielmehr im Alten Testament, den Büchern der Könige und Propheten, überlebt, was uns daran erinnert, dass es einschneidende religiöse Folgen hatte, als die Assyrer »wie der Wolf über die Herde« hereinbrachen. Im Alten Testament warnt ein assyrischer Gesandter die verstockten Bewohner Jerusalems: »Wo sind die Götter von Hamat und Arpad?«11 Nach Ansicht der Assyrer hatten diese Götter ihre großen Städte in Nordsyrien verlassen und sich den Assyrern angeschlossen. Arpad fiel im Jahr 740, Hamath nicht lange danach. »Fünfhundert und einundneunzig Städte der sechzehn Gebiete von Damaskus«, so die Annalen des Königs, »verwüstete ich wie die Berge von Trümmern nach der großen Flut.« Danach vermehrten die assyrischen Eroberer die Sprachenvielfalt der Region entscheidend. Im Zuge der assyrischen Eroberungen kamen mehrere zehntausend neue Siedler ins Land; Menschen aus Assur, Babylon und aus anderen östlichen Gebieten wurden nach Kilikien (die heutige südliche Türkei), nach Syrien und in den Norden Israels umgesiedelt.12
Sie brachten auch ihre eigenen Götter mit. Einige kann man heute noch an einem einzigartigen Denkmal neben einer alten Straße südlich von Unqi durch das heutige Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien sehen. Außerhalb des Dorfes Senkoy führt ein Weg durch die Tabakfelder zu einem Wiesental, er verläuft entlang eines nicht erfassten Gemäuers, wahrscheinlich einem römischen Wachtposten, und vorbei an den Fassaden von aus dem Fels gehauenen christlichen Gräbern. Bei Karabur erheben sich mächtige Felsen aus den Feldern, auf ihre Oberfläche meißelten assyrische Steinmetze vier Gottheiten, eine davon empfängt Huldigungen von einem kostbar gekleideten Würdenträger. Er hat keinen Bart und trägt keine Kopfbedeckung; mit Sicherheit handelt es sich um einen hohen assyrischen Beamten des späten 8. Jahrhunderts, möglicherweise um einen Eunuchen, der hier zu seinen Göttern betet – Zeuge für die Bedeutung, die Assyrien für diese vernachlässigte Straße in den Süden spielte.13
Weiter im Süden, an der Straße nach Ägypten, musste auch Gaza einen Neuankömmling in den Reihen seiner Götter verkraften: »Eine Statue, die das Bild der großen Götter, meiner Herren, trug, und mein eigenes königliches Bild aus Gold, das ich anfertigen ließ. Im Palast von Gaza stellte ich es auf.« (Wahrscheinlich handelt es sich lediglich um eine Statue von König Tiglath Pileser selbst, auf dessen Gürtel und Gewand die Götter abgebildet sind.) »Ich reihte sie [die Statue] unter die Götter ihres Landes ein.«14 Lange vor Alexander dem Großen stellte der neue Gott von Gaza den ersten Kult um die Person eines lebenden Herrschers in dieser Region dar. Sein Abbild hinterließ eine Spur in Geschichten, die später auf König Nebukadnezar übertragen wurden, auf die Verehrung des »goldenen Standbilds« im alttestamentlichen Buch Daniel.15
In den Königreichen Israel und Juda lässt sich das Ausmaß dieser Umbrüche im 8. Jahrhundert am besten studieren. Durch einen glücklichen Zufall stellen die alttestamentlichen Bücher der Könige und des Propheten Jesaja die eine Seite von Ereignissen dar, die durch assyrische Texte von der anderen Seite beleuchtet werden. Im Alten Testament sind die Assyrer die Frevler, nach Auffassung der Assyrer jedoch schließen sich die Götter ihrer Feinde lediglich dem assyrischen Eroberungsfortschritt an: Jahwe, der Gott Israels, stellte dabei keine Ausnahme dar. Könige, die sich der Macht Assurs unterwarfen, legten quasi routinemäßig einen Treueeid vor den assyrischen Göttern ab, und wenn sie diesen Eid brachen, dann setzten sie sich damit automatisch ins Unrecht.16 Als Hosea, der König von Israel, den Eid ohne Zögern brach, stand für die Assyrer fest, dass ihr Angriff die gerechte Strafe für sein frevelhaftes Tun war. So waren sie auch schon mit dem Herrscher von Unqi verfahren. In den späten 720er-Jahren wurde Hoseas von starken Mauern umgebene Hauptstadt Samaria gestürmt, und zahlreiche Untertanen wurden nach Nordmesopotamien deportiert. Wagenlenker und Pferdeknechte des nördlichen israelischen Königreichs fügten sich in das Unvermeidliche und begaben sich in den Dienst der Assyrer. Sie tauchen in zeitgenössischen Texten auf als Mitglieder der Militärhierarchie im Heimatland der Eroberer.17 An ihrer Stelle siedelten die Assyrer Menschen aus dem südlichen Babylon neu an, die sich in Israel niederließen und »Samarien größer machten, als es zuvor gewesen war«. Sie verehrten neben ihrem eigenen Gott Jahwe eine Lokalgottheit, allerdings währte es nicht lang, bis sie Jahwe als einzigen Gott anbeteten. Jahwe triumphierte hier in einem Ausmaß, das der Prophet Jesaja nicht vorhergesehen hatte. Die Götter der assyrischen Eroberer sind schon lang tot, doch in einem Getto in der Nähe von Nablus halten die selbsternannten Erben der alten Siedler, die heutigen Samaritaner, an der Verehrung Jahwes in ihren eigenen Traditionen fest.18
Seit den 920er-Jahren waren die Israeliten in zwei Königreiche gespalten, Israel im Norden und Juda mit Jerusalem im Süden. Im Jahr 722/1 löste die Zerstörung des nördlichen Königreichs Schockwellen in Juda, dem südlichen Königreich, aus, und die Anhänger Jahwes sahen sich gezwungen, eine Erklärung für diese Katastrophe zu finden. Propheten in Jerusalem, unter ihnen auch Jesaja, formulierten eine Sicht der Dinge, die sich von den Äußerungen der Assyrer stark unterschied. Jahwe war nicht zu den Eroberern übergelaufen: Er hatte vielmehr, so die Überzeugung der Israeliten, sein auserwähltes Volk aus Empörung über dessen Sünden bestraft. In den folgenden zwanzig Jahren rückte die Bedrohung durch die Assyrer immer näher an Juda heran, sie kulminierte in der Belagerung von Jerusalem. Es gelang der Stadt jedoch, sich zu befreien. Ihr König Hiskia wurde lediglich »wie ein Vogel im Käfig eingesperrt«, so die Interpretation der fehlgeschlagenen Eroberung in den Annalen der Assyrer.19