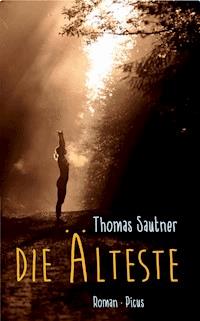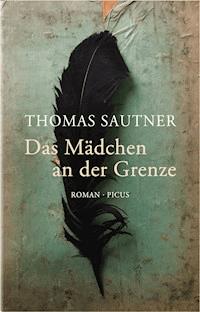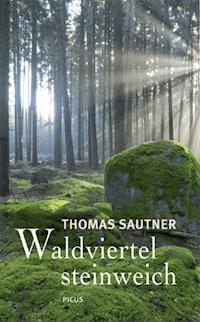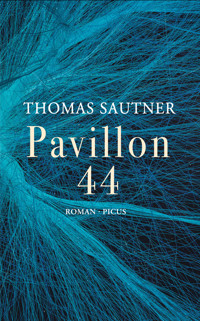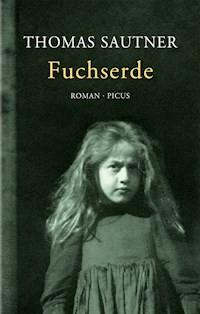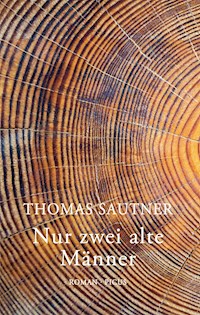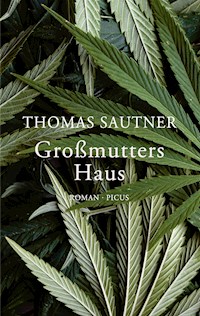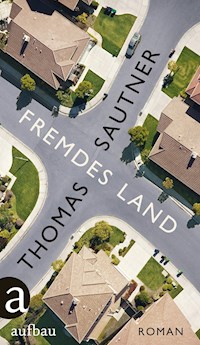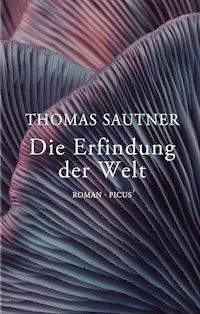
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Schriftstellerin Aliza Berg erhält einen anonymen Brief mit dem großzügig honorierten Auftrag, einen Roman zu schreiben, mit keinem geringeren Thema als dem Leben. Sie soll es mit frischem Blick neu entdecken und unvoreingenommen davon erzählen – am Beispiel einer vorgegebenen Gegend und all ihrer Bewohner. Auf der beigelegten Landkarte scheint das markierte Gebiet allerdings gänzlich unbewohnt zu sein. Aliza reist also nach Litstein, findet Logis bei Gräfin und Graf Hohensinn und beginnt mit ihren Recherchen. Dabei begegnet sie der eigensinnigen Kristyna in ihrem Haus im Wald ebenso wie dem Eigenbrötler Jakob und dem Trafikanten Peter. Aber vor allem eröffnen sich ihr die wesentlichen Dinge: die Unendlichkeit der Gedanken, die Zartheit und Wucht der Natur und die Kraft der Liebe. Was macht das Leben aus? Thomas Sautner entführt eine Autorin ins unendliche Labyrinth der Gedanken und lässt sie zwischen den ganz großen Fragen der Existenz wandern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Gefördert von der Stadt Wien Kultur.
Copyright © 2021 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
Umschlagabbildung:
© Bushko Oleksandr/shutterstock
ISBN 978-3-7117-2103-7
eISBN 978-3-7117-5439-4
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
Thomas Sautner wurde 1970 in Gmünd geboren, heute lebt er im nördlichen Waldviertel sowie in Wien. Neben zahlreichen Essays und Erzählungen erschienen im Picus Verlag seine Romane »Fuchserde«, »Milchblume«, »Die Älteste«, »Das Mädchen an der Grenze« und 2019 »Großmutters Haus«. www.thomas-sautner.at
THOMAS SAUTNER
Die Erfindungder Welt
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
immerwährend sei das Leben
immerwährend euch ein Vielleicht
und nur nachts werdet ihr
Augen haben
und nur wenn ein Stern steht, es sehen
TARIMOKO SON
Wir vergessen, dass das,
was wir nicht getan haben,
wir auch nicht gewesen sind.
FERNANDO PESSOA
Inhalt
Über den Autor
PROLOG
ERSTER TEIL
- Kapitel 1 -
- Kapitel 2 -
- Kapitel 3 -
- Kapitel 4 -
- Kapitel 5 -
ZWEITER TEIL
- Kapitel 1 -
- Kapitel 2 -
- Kapitel 3 -
- Kapitel 4 -
- Kapitel 5 -
- Kapitel 6 -
- Kapitel 7 -
- Kapitel 8 -
- Kapitel 9 -
- Kapitel 10 -
DRITTER TEIL
- Kapitel 1 -
- Kapitel 2 -
- Kapitel 3 -
- Kapitel 4 -
- Kapitel 5 -
- Kapitel 6 -
VIERTER TEIL
- Kapitel 1 -
- Kapitel 2 -
- Kapitel 3 -
- Kapitel 4 -
- Kapitel 5 -
- Kapitel 6 -
- Kapitel 7 -
- Kapitel 8 -
FÜNFTER TEIL
- Kapitel 1 -
- Kapitel 2 -
- Kapitel 3 -
- Kapitel 4 -
- Kapitel 5 -
- Kapitel 6 -
- Kapitel 7 -
- Kapitel 8 -
Danksagungen
PROLOG
- G -
Das Leben ist ein fremder Ort, weit aus der Zeit. Bis es dich unversehens packt, mitreißt und in eine Gegenwärtigkeit schießt, die dein Innerstes nach außen kehrt, dein Herz rasen lässt, dich an Neuland schwemmt.
»An Neuland wie einen Lurch?«
»Oh ja, wie einen Lurch. Einen, der japsend froschig erwacht und um sich blickt und staunt, als wär’s sein erster Tag, und der die neue Welt vor lauter Glück gar nicht glauben kann.«
So blödelten wir, doch das war später, als wir einander schon besser kannten. Zuvor steckten wir noch in einer anderen Atmosphäre fest, lief es noch so: »Ein Froschmännchen denkt vierundsechzigmal am Tag an Sex, ein Froschweibchen einmal öfter.« Wie beiläufig sagte er das so dahin. Als hätte er zufällig einmal mitgezählt! Ich beließ den Blick auf dem Spiegel des Teichs, umschlang meine zur Brust gezogenen Knie und überlegte einen Konter.
»Der Mensch«, sagte ich und sah ihn an, »ist die einzige Tierart, die so tut, als dächte sie überhaupt nicht daran. Ein Menschenweibchen trifft auf ein Menschenmännchen, denkt an Sinnlichkeit und beginnt in der Sekunde danach ein Gespräch übers Wetter. Oder ein Menschenmännchen: trifft auf ein Menschenweibchen und erzählt irgendwelche Fantasiegeschichten über Frösche.«
Die Parade saß. Er blickte mich stutzig an, machte »hm« und schwang sich auf die Beine.
Lange saß ich allein. Über mir stand der zunehmende Halbmond und wunderte sich kein bisschen.
An jenem Abend war ich seit etwa zwei Wochen in der Gegend. Seit zwei Wochen auf Recherche für einen Roman, von dem ich noch nicht wusste, ob ich ihn schreiben würde. Begonnen hatte es mit diesem Brief.
Sehr geschätzte Aliza Berg!
Erlauben Sie, dass ich sofort zu meinem Anliegen komme. Mein Wunsch ist, Sie mögen in meinem Auftrag, doch in völliger literarischer Freiheit, einen Roman schreiben. Zwei Bitten erlaube ich mir zu äußern. Der Roman soll das Leben zum Thema haben. Ist das nicht ohnehin das Größtmögliche, das sich eine Schriftstellerin vornehmen kann, liebe Aliza Berg? Und ist es nicht auch so, dass Literatur geradezu die Pflicht hat, aufs Ganze und gegen jede Vernunft immer nur aufs Ganze zu gehen? Die höchsten Gipfel, die hellsten Himmel? Das Leben – seine Geheimnisse, die offenkundigen und die verborgenen.
Ich kenne und liebe Ihren Roman »Selatura«, daher bin ich gewiss, dass Sie, geschätzte Aliza Berg, mehr als nur ausreichend Verstand und Gefühl mitbringen für dieses Vorhaben, und darüber hinaus etwas Entscheidendes: einen frischen, unvoreingenommenen Blick.
Beiliegend finden Sie eine Landkarte, und damit komme ich zu meiner zweiten Bitte. Mein Wunsch ist, dass Sie das Leben exemplarisch anhand der auf dieser Karte markierten Region und aller ihrer Bewohner beschreiben, dass Sie dem Leben hinter die Kulissen blicken, es erforschen, gleichsam mit Mikroskop und Teleskop, es mit unbestechlichen Augen wie neu entdecken – und damit womöglich erstmals wahrhaftig.
Sehr geschätzte Aliza Berg, Geld spielt in dieser wichtigen Sache keine Rolle, es wäre mir eine Ehre, die Sie mir hoffentlich gewähren, mich gebührend für Ihre Arbeit zu bedanken. Vorerst habe ich mir erlaubt, einen fünfstelligen Geldbetrag auf Ihr Konto zu überweisen. Sie alleine entscheiden, ob es sich dabei um eine erste Anzahlung handelt oder – sollten Sie zu meinem Bedauern kein Interesse für dieses Romanprojekt hegen – um ein Geschenk, eine symbolische Wertschätzung Ihres bisherigen literarischen Werkes.
Zuletzt verzeihen Sie bitte, dass ich meinen Namen nicht nenne. Er spielt keine Rolle, nie spielen Namen eine Rolle, nur das Werk zählt, nur das Leben. Doch das, liebe Aliza Berg, wissen Sie wohl besser als jede andere.
Hochachtungsvoll!
G.
Zuerst reagierte mein Körper. Ein Schauer strich über meinen Nacken, meine Arme. Ich duckte mich.
Dieser Brief war ein Überfall, eine Grenzübertretung und: eine verführerische Möglichkeit. Der Mensch mag aus tausend widersprüchlichen Teilchen bestehen, mein draufgängerischstes war drauf und dran, die Sache im Alleingang für mich zu entscheiden. Spring! Zögere nicht! Nimm die Einladung an! Ohne Geldsorgen und Zeitdruck tun, was du ohnehin tun willst: dem Leben ins Innerste schauen, es dir schreibend unter die Haut jagen. Spring!
Dann reagierte mein Verstand: Das Ganze ist ein Scherz, irgendein Schriftstellerkollege versucht, dich zum Narren zu halten!
Ich stieg ins Onlinebanking ein.
Der Kontostand betrug zwanzigtausendsiebenhundertfünfzehn Komma zwölf. Nach dem Eingang von zwanzigtausend. Jemand hatte mir, einfach so, zwanzigtausend überwiesen!
Wie ich mich freute! Wie es mich erleichterte! Und: welchen Schauer es mir versetzte.
Wer war dieser Mensch?
Ich griff nach dem zweifach gefalteten Brief. Wer schrieb überhaupt noch Briefe? Diesmal las ich die Zeilen langsam. Erlauben Sie, dass ich sofort zu meinem Anliegen komme. Mein Wunsch ist, Sie mögen in meinem Auftrag, doch in völliger literarischer Freiheit, einen Roman schreiben. Wie direkt, wie selbstsicher! Und das in diesem altmodisch höflichen Ton: Mein Wunsch ist, Sie mögen in meinem Auftrag … Ich stellte mir den Schreiber als älteren Herrn vor. Schon beim ersten Mal, als ich die Zeilen nur überflogen hatte, war vor meinem inneren Auge das Bild dieses sonoren Herrn mit Weste und Lesebrille aufgetaucht. Und er saß in einem Ohrensessel, ja, einem Ohrensessel wie in diesen alten Krimis, und vor ihm, das musste sein, loderte Feuer im offenen Kamin. Den Brief hatte er seinem Sekretär diktiert, der ihn auf einer museumsreifen Schreibmaschine getippt hatte, mit seinen knochigen Fingern hatte er auf die Tasten eingeklopft. Tack. Tack tack, tack.
Weil das freilich Unsinn war, beschloss ich, den Text möglichst unvoreingenommen zu lesen, in der Hoffnung, herauszufinden, wer sich dahinter verbergen mochte. Abgeklärt wie eine Forensikerin wollte ich vorgehen, wie eine Profilerin, um dahinterzukommen, was dieser Mensch tatsächlich von mir wollte, abgesehen von einem Roman, und ob ich ihm über den Weg trauen konnte. An Stil, Wortwahl und Satzmelodie wäre abzulesen, was von ihm zu halten war. Ich würde das Schreiben röntgen, Satz für Satz, Wort für Wort, und dahinter käme, nach und nach, er zum Vorschein. An seinen Worten würde ich ihn erkennen.
Zwei Bitten erlaube ich mir zu äußern. Welch zurückhaltende Höflichkeit! War sie aufgesetzt oder echt?
Gleich danach der unmissverständliche, fast gebieterisch erteilte Auftrag: Der Roman soll das Leben zum Thema haben. Ist dies nicht ohnehin das Größtmögliche, das sich eine Schriftstellerin vornehmen kann? Natürlich war es das Größtmögliche. Es abzulehnen, vom Leben zu schreiben, wäre absurd gewesen, noch dazu, weil sich unter dem Arbeitstitel Leben ohnehin über alles schreiben ließe, jede Autorin musste da zustimmen. Wo war also der Haken an der Sache?
Und dann, im ersten Absatz schon diese freundschaftliche Anrede: Nicht mehr wie zu Beginn sehr geschätzte, sondern mit einem Mal liebe Aliza Berg – was für eine Handreichung, was für eine zuckersüße Einladung. Hier schrieb jemand, der mit Worten und Stimmungen umzugehen verstand. Wozu aber brauchte er dann mich? Wieso schrieb er seinen Roman nicht selbst?
Und weshalb die nächste Passage, warum diese Moralpredigt: Und ist es nicht auch so, dass Literatur geradezu die Pflicht hat, aufs Ganze und gegen jede Vernunft immer nur aufs Ganze zu gehen? Die höchsten Gipfel, die hellsten Himmel? Das Leben – seine Geheimnisse, die offenkundigen und die verborgenen.
Worauf spielte er an? Wollte er sichergehen, dass ich ausreichend motiviert war, um aufs Ganze zu gehen? Welche Neugier sollte bei mir geweckt werden mit der Anspielung von wegen Geheimnisse, die offenkundigen und die verborgenen?
Darauf folgte, dramaturgisch schlau, eine Mischung aus Besänftigen, Ablenken und Honig-ums-Maul-Schmieren: Ich kenne und liebe Ihren Roman »Selatura«, daher bin ich gewiss, dass Sie, geschätzte Aliza Berg, mehr als nur ausreichend Verstand und Gefühl mitbringen für dieses Vorhaben, und darüber hinaus etwas Entscheidendes: einen frischen, unvoreingenommenen Blick.
Der neuralgische Moment in diesem Absatz war die als Kompliment kaschierte Ermahnung: Etwas Entscheidendes also hatte ich mitzubringen, einen frischen, unvoreingenommenen Blick. Als ob das nicht bei jeder ernst zu nehmenden Schriftstellerin vorausgesetzt werden dürfte. Die Botschaft musste also eine andere sein: Hatte der Briefschreiber Sorge, ich könnte die Szenerie vor Ort ebenso voreingenommen sehen wie alle anderen? Wovor warnte er mich?
Danach kam, der Absender machte es deutlich, die wichtigste Passage. Sie enthielt das einzige Wort im Brief, das er für nötig befunden hatte zu unterstreichen: Beiliegend finden Sie eine Landkarte, und damit komme ich zu meiner zweiten Bitte. Mein Wunsch ist, dass Sie das Leben exemplarisch anhand der auf dieser Karte markierten Region und aller ihrer Bewohner beschreiben.
Aller ihrer Bewohner. Er hatte Sorge, ich könnte jemanden übersehen. Jemand für ihn Besonderen. War es das, worauf er es abgesehen hatte? Ging es ihm im Grunde nur um einen besonderen Menschen? Wollte er mich als Spionin einschleusen? War es das, was er meinte, wenn er schrieb: … dass Sie dem Leben hinter die Kulissen blicken, es erforschen, gleichsam mit Mikroskop und Teleskop, es mit unbestechlichen Augen wie neu entdecken – und damit womöglich erstmals wahrhaftig.
Ich legte das Schreiben zur Seite und griff nach der beigelegten Kopie eines Landkartenausschnitts. Das mit Rotstift umrandete Gebiet schien unbewohntes Grenzland zu sein. Wenn ich die Schraffierungen richtig deutete, bestand die Gegend neben Wald aus nichts als Teichen und Wiesen. Großartig, der Typ war ein Spinner.
Wie als Provokation lag unmittelbar außerhalb der roten Markierung eine Ortschaft, innerhalb der von Hand gezogenen Grenze der Romanhandlung aber: nichts. Nichts als Pampagrün in verschiedenen Nuancen.
Ich nahm meine neue Hornbrille. Ich brauchte sie nicht, sah ohne sie sehr wohl noch ausreichend, hatte sie mir auch nur zugelegt, weil mir mein Augenarzt damit auf die Nerven gegangen war, aber meinetwegen, wenn es um Feinheiten ging, machte sie vielleicht einen Unterschied. Als ich mich erneut über die Karte beugte und diesmal genauer hinsah, konzentrierter, war da doch Leben. Mitten im Forst lag ein Haus und, vielversprechender, mein Möchtegern-Auftraggeber hatte mit seiner Linienziehung zwar den benachbarten Ort ausgenommen, etwas am Übergang von Wald und Ortschaft aber verschont. Auf der Landkarte war es mit Kreis und senkrechtem Fähnchen eingezeichnet. Ich brauchte keine Kartenlegende, um das Symbol zu deuten, bei dem Ding handelte es sich um eine Burg oder um ein Schloss.
Zurück zum Brief. Formvollendet wurde mir darin versichert, dass ich mir um Geld fortan keine Gedanken zu machen brauchte und nicht etwa mir, sondern diesem Briefschreiber einen Riesengefallen täte, es reichlich anzunehmen. Eine Ehre wäre es ihm, dürfte er sich für meine Arbeit gebührend bedanken. Vorerst habe er sich erlaubt, eine erste Anzahlung zu überweisen. Er tat alles, um sich als ergeben und mich als souverän darzustellen. Es war Taktik, sollte mich milde stimmen für das, was nun folgte: Dieser Mensch kannte mich mit Vor- und Nachnamen, hatte über mich recherchiert, wusste meine Adresse, meine Kontonummer, nicht auszudenken, was noch alles, doch selbst verheimlichte er seinen Namen – und rechtfertigte sich mit einem Argument, das er bei mir gestohlen hatte: Nie spielen Namen eine Rolle, nur das Werk zählt. Ja, das waren meine Worte, sie standen auf der Homepage einer Schriftstellerin, die nicht unter ihrem eigenen Namen schrieb, sondern unter dem Pseudonym Aliza Berg.
Ich weiß nicht, ob das zu verstehen ist, aber mein wirklicher Name würde mich von meiner Arbeit ähnlich ablenken wie Lärm, markantes Parfum oder auffällige Kleidung. Alle Aufmerksamkeit sollte ungeteilt der Literatur gelten. Deshalb hatte ich mir auch angewöhnt, wie Bühnenarbeiter in Opern- und Theaterhäusern ausschließlich Schwarz zu tragen. Hell im Licht stehen sollte nur das Werk.
Mit den Jahren gewährte selbst das Pseudonym Aliza Berg zu wenig Freiheit. Es war zur Marke geworden, machte sich wichtig. Meinen jüngsten Roman hatte ich deshalb ganz abgenabelt von mir, von Beginn an war vereinbart, dass er unter der Obhut und dem Tarnnamen eines befreundeten Schriftstellers erscheinen sollte, niemand außer uns und unserem Verleger wusste davon. Der Freund übernahm es sogar, Lesungen aus dem Roman zu halten und Interviews zu geben. Wir hatten kindischen Spaß daran, unser Geheimnis als Innovation zu feiern, als neue literarische Freiheit, nämlich der Freiheit des Buches von seiner Autorin.
Nie spielen Namen eine Rolle, nur das Werk zählt, nur das Leben. Doch das, liebe Aliza Berg, wissen Sie wohl besser als jede andere.
Hochachtungsvoll!
G.
Kein Absender also, das war unangenehm genug. Doch weshalb auch noch dieser provokante Buchstabe G? Was sollte das denn? G wie Gott? Hielt er sich für allmächtig? Am Anfang war das Wort? Und das Wort erschuf das Leben, erschuf einen Roman? Hochachtungsvoll G?
Oder hieß der Typ einfach Gustav? Nannte sich G wie Gönner? War ein mir unbekannter Großonkel, Großcousin? G.
Ich traute ihm nicht. Er versteckte sich zwischen den Zeilen. Dieser ältere, vermögende Herr (mit Kaschmirsakko und Schalkrawatte, im Ohrensessel vor dem offenen Kamin sitzend), dieser Bildungsbürger, Großindustrielle, Schlossherr, Burggraf, dieser wer auch immer, er führte etwas im Schilde. Es war nicht nur der Roman, der ihn interessierte. Er hatte eine versteckte Absicht. Das war meine Analyse. Und diese Analyse ergab: Nein, tu es nicht. Und unmittelbar nachdem meine Analyse das ergeben hatte, stand fest: Ich mach’s.
Sämtliche Zweifel, Argumente, Unwägbarkeiten – sie waren nebensächlich. Ich konnte einen Roman schreiben, in völliger literarischer Freiheit. Und Geld gäbe es mehr als genug.
Ich würde mich nicht von diesem Typen beeinflussen lassen. Ich war unabhängig. Ich war erfahren. Ich würde einen Roman schreiben, ein Werk. Nur das zählte.
Fahrig wie eine Getriebene, wie eine von unbekannter Macht Gehetzte, sah ich mich in der Wohnung um. Und begann zu packen. Ich würde hinfahren, einfach einmal hinfahren, mir ein Bild machen, es verpflichtete mich ja zu nichts, wo war das Risiko? Hatte ich denn groß etwas zu verlieren? Ach, was!
G, ich komme.
ERSTER TEIL
- 1 -
Ich hatte mich so weit im Griff, dass ich nicht Hals über Kopf noch am selben Tag losfuhr. Stattdessen recherchierte ich über die auf der Landkarte eingezeichnete Burg, ihre Besitzer und das vom Briefschreiber rot umrandete Gebiet. Weil ich für den nächsten Tag fit sein wollte, ging ich abends früh ins Bett, wälzte mich von einer Seite auf die andere, fand auch mit Atemübungen und Baldriantropfen nicht in den Schlaf, sah um ein Uhr dreiundvierzig zum x-ten Mal auf den Radiowecker, fuhr hoch, nachdem ich endlich eingeschlafen war, träumte Verrücktheiten und brach schließlich in aller Herrgottsfrüh auf, um zwei Stunden später, nach einer Autofahrt wie in Trance, aschbleich und zittrig in der Gegend anzukommen. Welker Weberknecht. Gekleidet in Schwarz. Großartig.
Schloss Litstein war seit 1717 im Besitz der Familie Hohensinn, eines böhmisch-österreichisch-deutsch-niederländischen Adelsgeschlechts, dem es als Wohnsitz diente, weshalb es nicht öffentlich zugänglich war, wie ich bei Wikipedia erfuhr. Das Anwesen lag am Rand der Zweitausend-Einwohner-Gemeinde Litstein auf einem Felsbuckel und bestand neben dem Neuen Schloss aus einer mittelalterlichen Burg sowie einem am Fuß des Felsens errichteten Meierhof und mehreren Wirtschaftsbauten.
Zum Besitz gehörten zwölftausend Hektar Wald samt einem Dutzend teils seegroßer Fischteiche. Nur die drei kleinsten lagen innerhalb der roten Markierung, der große Rest außerhalb und zudem jenseits der Grenze, wo die Familie Hohensinn ebenfalls menschenleeres Land besaß. Natur so weit das Auge reichte. Das einzige Gebäude diesseits der Grenze, das ich auf der Landkarte entdeckt hatte, erwies sich als altes Forsthaus.
Die Burg Litstein tauchte bereits auf, als ich noch etliche Kilometer entfernt war. Wie ein einsamer Finger ragte ihr Turm aus dem Meer des Waldes. Ihr Turm ragte wie der Finger eines Ertrinkenden aus dem Meer des Waldes, so hätte ich es auch schreiben können, aber die Schriftstellerin in mir befand, dass das dem Ort der Romanhandlung eine zu düstere Stimmung verpasst hätte. Da sehen Sie wieder: Selbst wenn Romane auf wahren Begebenheiten beruhen, heißt das gar nichts. Auf die Wahrheit ist kein Verlass. Warum sollte es bei Romanen anders sein als im übrigen Leben. Schließlich hat schon ein Staubkorn mehr als zwei Seiten. Was soll als Wahrheit gelten? Die, betrachtet von oben, unten, rechts oder links? Die gestrige, heutige, übermorgige? Man müsste sich schon wie ein Quantenteilchen herzkopfüber hineinstürzen können in die Menschen, die Dinge und die Ereignisse, um zu erleben, was sie ausmacht. Dann wüsste man mehr über die Welt als sie selbst.
Ich reduzierte das Tempo. In einer breiten, den Horizont einnehmenden Welle rollte eine bewaldete Hügelkette hinterrücks an die Burg heran. Darüber standen aufgefädelt Wölkchen. Sie verrieten, dass in Litstein an diesem Tag der Himmel nach unten gerutscht sein musste, so viele Etagen tief, dass die Wölkchen bäuchlings bereits von den Wipfeln der Fichten und Tannen geneckt wurden. Erde und Himmel berührten einander. Wie lange würde es dauern, bis die Wölkchen es nicht mehr aushielten, sich ganz hingeben würden, völlig aufgelöst?
Eine Weile noch rollte mein Auto hügelab dem Tal entgegen. Während zur Rechten der Wald immer näher rückte, lagen zur Linken einzelne Höfe, glitzernde Teiche, Weideland. Ich genoss es, talwärts zu gleiten. Als flöge ich dem Himmel zu. Erst ganz zuletzt fiel das Gelände stärker ab. Anstatt wie bisher leicht Gas zu geben, war es nötig, dem Wagen Geschwindigkeit zu nehmen. Ich bremste gegen die Gravitation, fuhr auf Litstein zu.
Beim Passieren der Ortstafel irritierte mich etwas. Irgendetwas Befremdliches, oder war es etwas Vertrautes, war mich angesprungen von der Seite her. Von der Wiese über den Straßengraben war es zu mir gehuscht, dann blitzte ein morgendlicher Sonnenstrahl, der sich an der Scheibe brach, und schon war ich zu weit, um zu sehen, was es gewesen war.
Zuerst einmal würde ich zum Marktplatz fahren, dort lag Litsteins einziges Hotel, ich hatte ein Zimmer reserviert. Einfach ausrasten, ankommen, einen Kaffee trinken, mich frisch machen. Das alles in einer halbwegs sinnvollen Reihenfolge, am besten mit dem Kaffee zu Beginn, ja, zuallererst brauchte ich einen Kaffee. Ich parkte den Wagen direkt vor dem Hotel zur Post, nahm es als gutes Omen, dass exakt vor dem Eingangsportal eine Parklücke frei war. Das mochte ich auf dem Land, die freien Parklücken.
»Jo do schau her! Grüß Gott!« Und die Freundlichkeit der Leute, die mochte ich auch. Kaum war ich aus dem Auto draußen und schon gegrüßt. Eine ältere Dame mit Hund.
»Guten Morgen!«, antwortete ich und sie blieb stehen, strahlte mich an wie eine gelungene Überraschung, schüttelte, als könnte sie so viel Glück kaum fassen, die blaustichig dauergewellte Frisur, zerrte ihr Hündchen zur Seite, um mir Platz zu machen, und ließ ihrer Stimmung freien Lauf, indem sie mir ein weiteres »Grüß Gott« wünschte, das ich höflich nickend entgegennahm, wie es sich gehörte für eine so herzlich empfangene Fremde, und ich wiederholte dieses Lächeln und Nicken gerne, wenn auch etwas irritiert, als sie, da war ich an ihr vorbei und hatte die Hand schon an der Hoteltür, mir nachrief: »Willkommen, herzlich willkommen!«
»Ah, Frau Berg!«, begrüßte mich, ich war kaum eingetreten, ein stattlich runder Mann, und sein Schnauzbart vibrierte, als hätte auch er an diesem Morgen nichts anderes herbeigesehnt als mich.
»Lisi kum, na kum scho, d’ Frau Berg is do!« Er flüsterte es zischend Richtung Nebenraum, aus dem auch gleich Lisi herausgeschossen kam, mit glühenden Backen. Nebeneinander standen sie hinter der Rezeption. Und betrachteten mich. Erwartungsvoll.
Ich mache nie auf Diva, es liegt mir wirklich nicht, aber diese Szene schien mir den Verstand zu vernebeln und so fragte ich, freundlich aber doch nachdrücklicher, als es nötig gewesen wäre, ob ich auf der Stelle, gleich mit dem Beziehen des Zimmers, zwei große Tassen Mocca nach oben serviert bekommen könnte.
»Oje«, sagten die Lippen unter dem Schnauzbart, ich sah es wie in Zeitlupe, vielleicht, weil mein Kreislauf noch nicht so recht wollte an diesem Morgen. »Z…i…m…m…m…m…e…e…r«, sagten die Lippen unter dem Schnauzbart, und nun beschleunigten sie: »ist leider keines frei.« Schließlich sei Frühsommer, Hochsaison. Alles voll.
»Owa an Kaffee kennan S’ scho haum.« Lisi nickte aufmunternd. Ergänzte, weil ich nicht reagierte, »einen Kaffee kann ich Ihna schon machen.« Wie rührend, sie sprach eigens Hochdeutsch mit mir.
»Aber ich habe doch reserviert«, sagte ich. (Der Gastauftritt der Diva war vorbei, ich war wieder ganz ich.) »Wie kann es sein, dass kein Zimmer frei ist, ich habe reserviert, gestern, telefonisch.«
Der Schnauzer schien ebenso ratlos wie ich.
»Sie müssen bitte verzeihen«, sagte Lisi, »weil wissen S’, wir haben uns so gefreut, Ihna kennenzulernen, da wollten wir, wissen S’, Ihna nicht absagen. Aber Zimmer haben wir keins mehr frei.«
…
»Das macht aber nix«, sagte der Schnauzer Sekunden später.
»Genau«, sagte Lisi, »das macht nix, weil es gibt eh ein Zimmer für Ihna, viel schöner noch als bei uns. Drüman«, sie hob ihren Arm, als zeigte sie nur ums Eck, »drüben halt, gleich derüben gibt’s eh a Zimmer für Ihna, im Schloss.«
»Wissen Sie, Frau Berg, wir wollten Sie nur kennenlernen«, wiederholte der Patron des Hauses, als hätte er einen Teil des vorangegangenen Gesprächs träumend verschlafen. »Das war halt unser Wunsch, Sie kennenzulernen, Frau Berg.« Und dann, als betonte er es, um den ungläubigen Teil von sich zu beeindrucken: »Frau! … Aliza! … Berg!«
Ich hatte vier Romane unter diesem Namen veröffentlicht. Ich fragte, welches meiner Bücher sie gelesen hätten. Die Reaktion der beiden war eine Melange aus Verblüffung und grundehrlicher Heiterkeit. Nein, nein, Buch hätten sie keines gelesen von mir, sie, Lisi, lese nur Krimis, früher auch Liebesromane, aber nun nur noch Krimis, und Hubert, gell Hubert?, Hubert habe es überhaupt nicht so mit dem Lesen. Nein, aber in der Zeitung, da sei die Frau Schriftstellerin drinnen.
»In welcher Zeitung?«
… Na im Heimatblatt. Da sei sie drinnen.
Im Heimatblatt. Und was sei da gestanden?
Na eben dass sie komme, die bekannte Schriftstellerin eben, sie eben, Aliza Berg, und dass sie herkomme, um einen schönen Roman zu schreiben, über die Gegend und die Leut.
Einen Roman? Einen schönen? Über die Gegend? Und die Leut?
Lisi und Hubert nickten.
Hubert griff beidhändig nach unten, seinen Bauch als Rampe nutzend. Das Kleinformat musste die ganze Zeit aufgeschlagen vor ihm gelegen sein. Sachte hob er es nach oben aufs Pult der Rezeption und drehte es in meine Richtung.
Lisi und Hubert hatten kein Wort erfunden. Ich besah die Doppelseite der Zeitung, das riesige Aufmacherfoto von mir und die fette Schlagzeile.
Ich kann nicht beschreiben, wie sauer ich war.
G!
Er hatte es nicht für nötig empfunden, meine Entscheidung abzuwarten. Hatte das lokale Tratschblatt über meine bevorstehende Ankunft informiert, meine Rechercheabsichten, meine Romanpläne! Bevor ich eingewilligt hatte!
Vor mir, lange vor mir hatte G sich angemaßt zu wissen, wie ich mich entscheiden würde. Hatte es schon zu wissen geglaubt, als ich noch nicht einmal von seiner Idee und seinem Brief ahnte, ja besaß bereits Sicherheit über mich, als ich noch nicht einmal von seiner Existenz wusste. Von Anbeginn war G im Besitz dieser unheimlichen Gewissheit gewesen: dass ich gar nicht anders konnte, als ihm … aufs Wort zu folgen.
Ich starrte noch immer in die Zeitung, starrte auf das Foto von mir, auf die Zeilen, die beschrieben, was ich tun würde. Mein Impuls war, grußlos hinauszurennen, ins Auto zu springen und zurück in die Stadt zu flüchten. Hätte sich mir in diesem Moment jemand in den Weg gestellt und prophezeit, dass ich nicht nur die folgenden Stunden hier in der Gegend verbringen würde, sondern fast ein Jahr, ich hätte ihm ein großkalibriges »Ha!« ins Gesicht gefeuert und mitgeteilt, das könne er dem beschissenen Heimatblatt erzählen.
Als ich im Stechschritt das Hotel zur Post verließ (eigens nicht rennend, eigens darauf achtend, nicht gar zu aufgebracht zu wirken) und ins Auto steigen wollte, um (im Finale eigens mit quietschenden Reifen) zurück in die Stadt zu rasen, fiel mein Blick auf das Tabak-Trafik-Schild an der gegenüberliegenden Hausfassade. Zigaretten. Zigaretten würde ich mir noch rasch kaufen. Ich kreuzte den Marktplatz. Der Stechschritt muss hier besonders entschlossen gewirkt haben, meine Absätze schossen nur so gegen das Kopfsteinpflaster.
Und dann: dieses Schaufenster, dieses Schaufenster der Tabak-Trafik. Flankiert von einfältigen Billetts für Geburten, Taufen, Hochzeiten waren: Bücher ausgebreitet. Romane! Vorwiegend: meine Romane.
»Außergewöhnlich«, sagte ich beim Eintreten, »Literatur in einer Trafik.«
Der Trafikant sah auf. »Die Leute lesen ja sonst nur so was«, antwortete er und sein Zeigefinger zuckte Richtung der illustrierten Magazine und Schundheftchen. Aber wer weiß, meinte er, vielleicht entschlössen sich die Litsteiner ja, Literatur zumindest einmal zu versuchen. »Wenigstens einmal kosten«, sagte er und lächelte zurückhaltend, über seine Augenringe hinweg. So allgemein lächelte er, nicht eigens meinetwegen, oder gar mich an. Nun, vielleicht, vielleicht doch.
Falls er mich als Autorin der Bücher in seiner Auslage erkannt hatte, ließ er es sich nicht anmerken. Ich mochte diese Ungewissheit, sie schuf zwei Varianten von Gegenwart. Ich konnte mir eine aussuchen. Und gleich drauf die andere.
Der Trafikant. Eine seiner grau melierten Haarsträhnen hing zwischen mir und seinem Blick. Beiläufig rieb er sich übers Kinn, seinen Sechstagebart.
Er werde jedenfalls nicht aufhören, Bücher in die Auslage zu stellen. Und wie ich sehen könne, er breitete über dem Kassapult die Arme aus, reibe er den Kunden gute Literatur buchstäblich unter die Nase.
Sieben Bücher lagen vor mir.
Sie streckte den Arm aus und ihre Hand strich mit einem Hauch von Abstand über die Bücher, den ich zu fühlen glaubte, als Luftpolster zwischen ihr und mir.
»Wie wählen Sie die Romane aus?«, fragte ich. Sechs der sieben Titel, die in einer Reihe dicht nebeneinander auf dem Pult lagen, hatte ich gelesen, fünf davon gelungen bis großartig empfunden, über das sechste Buch konnte ich schwer urteilen, es war eines der meinen. Erschienen war es nicht unter meinem Pseudonym Aliza Berg, auf dem Buchdeckel stand der Name meines Schriftstellerfreundes.
Der Trafikant schien meine Frage nicht gehört zu haben, gedankenverloren sah er vor sich aufs Pult.
»Wie wählen Sie sie aus?«, wiederholte ich.
»Lieblingsbücher«, sagte er. »Das da sind alles Lieblingsbücher von mir. Ein Ausschnitt meines Kanons.«
»Wir scheinen einen ähnlichen Geschmack zu haben.« Ich strich abermals über die Romane, berührte sie diesmal vorsichtig mit den Knöcheln meines Zeige- und meines Mittelfingers. »Diese sechs Bücher kenne ich. Das hier nicht, ich nehme es. Und eine Schachtel Smart.«
Er schmunzelte. Diesmal war es eindeutig, er schmunzelte mich an.
»Sie wissen es, stimmt’s?« sagte er. »Smart gibt’s nicht mehr, sind schon lange aus dem Sortiment genommen worden. Waren die besten, wurden aber zu wenig gekauft.«
Ja, ich wusste es. Doch nach meiner Lieblingsmarke zu fragen, immer wieder aufs Neue, in jeder Trafik, bei jeder Gelegenheit, war meine Art des Protests.
»Man darf das Beste nicht aufgeben«, sagte er. »Nie darf man es aufgeben, selbst wenn es nicht mehr existiert.«
Selbst wenn es nicht mehr existiert. Der Satz klang nach in mir. Oder tut er es jetzt erst, beim Schreiben?
Er bückte sich, hantierte hinter dem Verkaufspult. Nur sein Haarschopf war noch zu sehen. Als er auftauchte, hielt er mir ein schmales Tablett entgegen, darauf lag eine einzelne Zigarette.
Es gab sie noch. Bei diesem Trafikanten gab es sie noch! Meine Lieblingsmarke! Er musste sie gehortet haben. Einen ganzen Vorrat unter seinem Pult versteckt halten. Ich sah ihn an. Schelmischer Blick. Dunkle Augenringe.
Ich war schon draußen und einige Schritte gegangen, da kam mir der Gedanke, ob ich umdrehen und es ihm sagen sollte, es ihm einfach sagen sollte. Dass ich vorgehabt hatte, aus Litstein abzureisen, zu flüchten aus dieser Enge, zu flüchten vor diesem G. Dass ich seinetwegen, des Trafikanten wegen aber vorerst bleiben würde. Seinetwegen und seiner Art wegen, Romane in die Auslage einer Trafik eines Zweitausend-Einwohner-Nests zu stellen. Seinetwegen und seiner Vorliebe wegen, Zigaretten und anderes hoffnungslos aus der Mode Gekommenes anzubieten. Seiner Schwäche wegen, Unvernünftiges zu tun, seiner Neigung wegen, an Verlorenem festzuhalten.
Aber das wäre doch komisch gewesen, oder? Wäre es nicht komisch gewesen, ihm das so zu sagen?
Ich ging nicht zurück in seine Trafik, sagte es ihm nicht. Und auch er hatte mir etwas bei unserem ersten Zusammentreffen verschwiegen. Nachdem er mir die Smart aus seinem Geheimvorrat geschenkt hatte, plauderten wir noch eine Weile. Währenddessen rauchte ich, genoss den Geschmack des Tabaks und das Gefühl, das ich damit verband, genoss diese Zigarette, die es draußen in der Welt nicht mehr gab. Hier aber, hier gab es sie. Mein neuer Bekannter, der Trafikant, er hatte einen Vorrat kleinen Glücks angelegt.
Damals kam ich nicht auf die Idee, erst bei meinem nächsten Besuch erkundigte ich mich, weshalb er mir beim Rauchen zugesehen hatte, ohne sich selbst auch eine zu gönnen. Und er sagte: »Die, die ich dir gegeben habe, war meine letzte.«
Die Menschen außerhalb der von G gewählten Grenze, jener roten Markierung auf der Karte, sind irrelevant für den Roman, sind zu vernachlässigen. Sie liegen, befand G, jenseits der literarischen Wichtigkeit. Wie Sie sehen, habe ich mich nicht daran gehalten. G kann mich einmal! Der Trafikant übrigens heißt Peter. Peter Rosenberg. Die Frau mit dem Hund Hedwig Klein. Lisi vom Hotel heißt mit Nachnamen Čerlak, ebenso wie ihr Ehemann Hubert. Sie haben Namen, sie existieren. Sie sind! Die rote Linie, die ziehe ich. Ich bin hier der Diktator. Was ich den Figuren an Gedanken und Gefühlen einschreibe, wird ihnen zur Wahrheit. Und G? … G?! Kann mir den Buckel runterrutschen!
- 2 -
Sie war mir vom ersten Moment an sympathisch. Sie war blond, hübsch und ungefähr fünfzig. Mit einem offenen Lächeln begrüßte sie mich, als freute sie sich, eine gute Freundin zu treffen. Für gewöhnlich macht mich so etwas stutzig. Mein Verstand riet mir auch unmittelbar zu Vorsicht, behauptete, derlei unverdiente Freundlichkeit könne nicht echt sein, mein Gefühl hingegen, völlig entspannt, sagte: doch, kann echt sein. Mein Gefühl hat mich nicht betrogen, bis heute.
Ihr Name war Elisabeth. Elisabeth von Hohensinn, Gräfin auf Schloss Litstein.
Welche Wirkung Kleinigkeiten haben. Kleinigkeiten verändern mitunter alles, kehren Bedeutungen ins Gegenteil. Nur weil ich nach Mein Gefühl hat mich nicht betrogen ergänzte bis heute, sind Sie misstrauisch geworden, ob ihr wirklich zu trauen ist. Wäre die Satzstellung ein wenig anders, hätten Sie bedenkenlos weitergelesen und die Sache wäre Ihnen so erschienen: Elisabeth war grundehrlich, mein Gefühl hat mich bis heute nicht betrogen.
Sie sind gar nicht misstrauisch geworden? Haben sich gar nichts gedacht dabei? Es geht mich ja nichts an, aber lesen Sie Ihr Leben auch so flüchtig, so an der Oberfläche entlang?
Burg und Schloss Litstein waren schon vom Marktplatz aus zu sehen, beide dem Erdboden enthoben auf einem Felsmassiv, nebeneinander wie ein ungleiches Geschwisterpaar. Ich blickte zu ihnen nach oben, über die Dächer der Bürgerhäuser hinweg. Links reckte trotzig die Burg ihren Turm in den Himmel, rechts machte sich das schönbrunnergelbe Schloss breit.
Die gepflasterte Auffahrt war steil, als ginge es hinauf zu einer Alpenfestung. Ich schaltete zurück in den zweiten Gang, dennoch soff mir beinahe der Motor ab, also wechselte ich in den ersten Gang, woraufhin der Fiat aufjaulte, als wäre es das jetzt gewesen mit der Motorisierung. Wie um sich Luft zu verschaffen, drehten die Räder des Cinquecento durch. Schließlich entschied mein kleiner Italiener, die Auffahrt im Schritttempo emporzujammern, mit quietschendem Keilriemen.
Der kreisrunde Wehrturm der Burg blickte nachlässig wachend auf mich herab. Um etwas wichtiger zu erscheinen und auch etwas höher, trug er über seinen Zinnen ein kegelförmiges Schindeldach samt Fahnenmast. An dem hing, schlapp, ein Fetzen Stoff.
Nachdem mein Fiat und ich die hundert Meter der Auffahrt überwunden hatten, nahm der Weg eine scharfe Rechtskurve und ein Plateau eröffnete sich uns. Schloss Litstein lag nun, adrett und nicht wenig stolz auf seine betonte Unaufdringlichkeit, entfernt links, die gedrungene Burg unmittelbar rechts von uns. Also gut: rechts von mir, nicht von uns. Ja, es ist zu kindisch, meinem alten Auto eine Persönlichkeit zuzugestehen, bloß weil es lebensanfällig ist wie wir alle.
Ich widerstand meinem Entdeckerdrang auszusteigen und nachzusehen, ob die grün-weiß gestrichene Holzpforte der Burg verschlossen war. Alles in allem wirkte das Gemäuer auf mich, als wäre es seit Jahrhunderten nicht mehr betreten worden. Einladend hell hingegen das zweigeschossige Schloss, zu dem eine geschotterte Zufahrt führte, von Rosensträuchern flankiert wie in einem dieser vorhersehbaren englischen Liebesfilme.
Als ich im Schritttempo über die gekieste Zufahrt rollte und ein Rauschen unter mir spürte, als glitte ich durch goldene Dukaten, besaß ich augenblicklich die Wahrheit über die zweite Bedeutung der Wörter Schotter und Kies: Wer seine Zufahrt nicht profan asphaltierte oder mit staubigem Sand anschüttete, sondern mit geschmeidigen Steinchen auslegen ließ und darin fahrend klimperte, wann immer es ihn danach verlangte, hatte ordentlich Schotter, jede Menge Kies, bei dem lag das Geld auf der Straße.
Das Geräusch des Reifenprofils auf luftigem Stein, das hatte schon was. Und noch mehr das Gefühl des rauschenden Einsinkens und dennoch sicher Gehaltenwerdens. Ja, unbestreitbar hatte das was.
Ich hielt an – bedauernd, dass ich schon da war – und sah durchs Autofenster zum Eingangsportal des Schlosses. Nur noch aussteigen müsste ich, die drei Stufen nehmen und läuten. Da stieg mein Fuß aufs Gaspedal. Der Kies spritzte unter den Rädern davon, prasselte gegen die Bodenplatte. Und schon badete ich wieder im Vollen, drehte eine Runde im Hof, umkreiste die kleine Rasenfläche, die Rosensträucher, die auf Podesten stehenden Skulpturen, schotterte durch den Kies. Als wäre mein kleiner Fiat kein kleiner Fiat, sondern eine Jacht; eine Jacht, die in das Meer eindrang, es teilte unter ihrem Bug.
Erst als ich anlegte, der Jacht entstieg und sie sich in einen Fiat zurückverwandelte, erst als mein Zeigefinger den Messingknopf der Türglocke niederdrückte, sodass er in der Hauswand verschwand und ein melodiöses Dong-Dong-Döng zu hören war, kam mir der Gedanke, bei meiner infantilen Runde durch den Schotter womöglich beobachtet worden zu sein. Doch dann ging die Tür auf und alles war gut, sie strahlte mich an.
»Aliza Berg! Wie schön! Ich freue mich so!« Nichts musste ich sagen, nichts erklären, weder wer ich war noch dass ich im Hotel zur Post kein Zimmer bekommen hatte und von dort hierher geschickt worden war, sie nahm mir alles ab, machte es mir ganz leicht.
»Ich bin Elli«, sagte sie, »wollen wir per Du sein?«
»Gerne«, sagte ich, »sehr gerne, Elli … Ich bin Aliza.«
Sie habe sich schon den ganzen Vormittag auf mich gefreut, sagte Elli. Seit dem Aufwachen schon, den ganzen Vormittag!
Unmittelbar erlebte ich, was gemeint ist mit: ein Herz im Sturm erobern. Im Licht ihrer Freundlichkeit, ihrer Unmittelbarkeit, die auf Konventionen pfiff, schmolz die Maske, die ich für gewöhnlich bei ersten Begegnungen trage, und nicht nur bei ersten. Meine Gesichtsmuskulatur entspannte sich, meine Schilder fuhren nach unten. Ich durfte einfach sein; sein, wie ich war; musste hier nichts darstellen, mich nicht konzentrieren, um nur ja keinen Fehler zu machen. Nichts würde mir hier passieren, niemand den Kopf schütteln über mich, niemand mich sonderbar finden.
»Ich hab dich gesehen, wie du im Hof eine Runde gefahren bist«, sagte Elli.
Begeistert ergänzte sie: »Das muss ich unbedingt auch einmal machen. Ich bin bisher gar nicht auf die Idee gekommen.«
Sie sei dreiundfünfzig. »Drei-und-fünfzig! Stell dir das vor!« Und bis vor Kurzem habe sie nur gemacht, was man von einer Gräfin so erwarte, nichts Verrücktes. Aber genau das sei doch verrückt, nicht wahr? Gerade das sei doch völlig verrückt, »weil wir haben ja nur ein Leben, nicht wahr«? Und sollten wir auch mehrere haben, wer weiß, auszuschließen sei das ja nicht, aber selbst wenn, dann hätten wir ja dennoch unser jetziges Leben nur einmal. Und da sei es doch verrückt, ja verrückt, nicht die Dinge zu tun, die in einem steckten und nur darauf warteten, rauszudürfen, um wahr zu sein und wirklich. Denn dürften sie nicht raus, wäre das doch, als ob … als ob … ein Maler die aufregendsten Farben vor sich hätte und nicht wagte, sie auszuprobieren!
Sie hielt inne, bemerkte, dass es mit ihr durchgegangen war. Vor Aufregung standen ihr rotscheckige Flecken an Wangen und Hals. Sähe ich – Sorge in ihren Augen – sähe ich das denn anders?
»Elli«, sagte ich. »Ich sag dir was: Ich sehe es: genau! so!«
Sie lachte auf, griff dabei erleichtert nach meiner Hand und behielt sie für Momente in ihrer.
- 3 -
Entspricht etwas im Inneren nicht dem, was es nach außen zu sein vorgibt, ist es eine Enttäuschung. Offenbart sich etwas, ist es eine Überraschung. Und bietet etwas gänzlich neue Perspektiven, gilt es als Attraktion. Drei Sichtweisen auf ein und dieselbe Sache – dreierlei Sachen. Klar, die alte Geschichte: Gott schuf unsere Gedanken und unsere Gedanken schaffen die Welt.
Es sagt also wenig über Schloss Litstein und viel über mich, dass ich beim Eintreten enttäuscht war. Das Schloss sah innen nicht aus wie ein Schloss.
Außen hatte ich es noch als Schloss gedeutet. Schlicht, doch ein Schloss. Innen waren die Räume hoch und die Decken mit Stuck verziert, doch die Einrichtung, und darauf kam es schließlich an, wirkte bürgerlich. Eine Mischung aus hellen, modernen Möbeln und alten Einzelstücken. Im großzügigen Wohnraum ein Teppich, der von Ikea hätte sein können, Eschenparkett, das im einfallenden Licht der Spätvormittagssonne glänzte, als wäre es eben verlegt worden. Eine Sitzgarnitur, die risikoscheu gemustert war, zeitgemäß zeitlos; dazu ein niedriger Chromtisch mit gläserner Platte, hohe Bücherregale in Weiß, eine Eleganz von Steinway-Flügel.
»Während des Zweiten Weltkriegs schlugen die Russen hier alles kurz und klein, selbst den alten Dielenboden haben sie rausgerissen und in den Kachelöfen verheizt.« Ich hatte nicht danach gefragt, aber Elli, Elisabeth von Hohensinn, hatte meinen Blick richtig zu deuten gewusst. »Du bist nicht die Erste, die sich das Schloss prunkvoller vorgestellt hat«, sagte sie und schenkte mir von ihrer selbst gemischten Zitronenlimonade nach. Die Minzblätter drehten eine stürmische Runde, tauchten im Sog des Strudels ab und – Äonen später – taumelnd gegen die Glaswand auf.
»Aber der Ausblick ist nach wie vor erhaben, nicht wahr?« Sie sog am Strohhalm. »Den Ausblick haben sie uns nicht genommen. Und der ist schließlich das Wichtigste … dieser weite Horizont.« Wir standen, die Limonadengläser in Händen, beim Flügelfenster. Der Burgturm hielt ernst und steinern Wache, alles andere schien umso lichter: der Vorplatz mit seiner kleinen Grünfläche, den Rosensträuchern, den Stelen mit den Zwergenfiguren, dahinter der frisch gemähte samtene Rasen, von dem drei Wege in unterschiedliche Himmelsrichtungen wiesen. Jäh fiel dort das Gelände ab und der Wald begann. Nahe und fern war er, forderte unsere Blicke ein, schien unendlich, wogte in Wellen. Ein fliegender Teppich. Um aufzuspringen, wäre es nur nötig gewesen, das hohe Flügelfenster zu öffnen, auf den Sims zu steigen, die Arme auszubreiten und einen weiten Satz zu machen.
Als sie erfahren habe, sagte Elli, dass ich nach Litstein käme, um hier für einen neuen Roman zu recherchieren, habe sie sich gedacht: was für ein Glücksfall, das müsse sie ausnutzen! Ihre Mädchenaugen, gebettet in die Fältchen und Krähenfüßchen der reifen Frau, blitzten mich an, als spräche Elli nicht über mich, sondern als wären wir zwei Freundinnen, die anlässlich des Eintreffens einer Autorin etwas ausheckten.
Sie habe alle meine Bücher gelesen und schon öfters überlegt, mich zu einer Lesung, einer literarischen Soiree einzuladen, aber na ja, wie das so sei, »man tut’s dann nicht«. Vielleicht habe ihr der Mut gefehlt, mich einfach aus heiterem Himmel anzuschreiben. Umso größer sei nun die Freude. Und was für ein Glück, dass im Hotel zur Post kein Zimmer frei gewesen sei. Sofort habe sie – sie wisse, es sei egoistisch, aber manchmal dürfe man das doch sein, nicht wahr? –, sogleich habe sie die Gelegenheit beim Schopf gepackt und den Čerlaks, den Eigentümern des Hotels, aufgetragen, mich nach meinem Eintreffen sofort und unbedingt zum Schloss zu schicken.
»Wir haben genug Platz, Aliza. Ich bin sicher, du wirst dich wohlfühlen! Und keine Sorge, wir lassen dich in Ruhe, du kannst das Schloss so ungezwungen nutzen, als wäre es ein Hotel, wir werden dich nicht bedrängen. Es ist uns einfach eine Freude, meinem Mann Leopold und mir, dich als Gast bei uns zu haben so lange du auch immer möchtest. Verzeih, ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen, aber ich freue mich so. Es ist blöd, ich weiß, aber ich rede mir ein, dich irgendwie zu kennen, und das nur, weil ich deine Romane gelesen habe. Ich weiß schon, es ist naiv. Naiv zu glauben, einer Autorin nahe zu sein, nur weil man ihre Bücher gelesen hat.«
»Wenn dir meine Romane so viel gegeben haben, Elli, wird alles, was du nach und nach an mir kennenlernst, unweigerlich eine Enttäuschung sein.«
Sie überlegte.
Das fand ich gut: Sie überlegte, anstatt reflexartig abzuwiegeln.
»Vielleicht«, sagte sie, »vielleicht ist es so. Aber mir ist es das Risiko wert.«
»Und«, ergänzte sie, »mir ist bewusst, dass deine Romane und das Gefühl, das sie vermitteln, nicht mit dir gleichzusetzen sind, dass du privat womöglich anders bist. Vielleicht … vielleicht ist es so wie mit den zwei Seiten einer Medaille.«
Das Bild gefiel mir. Ich – die Medaille. Meine Romane die sichtbare Seite, mein übriges Leben die abgewandte; jene, die ich gerne bedeckt hielt.