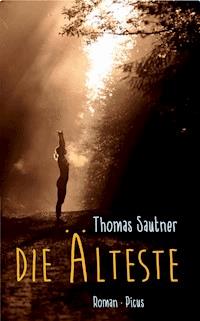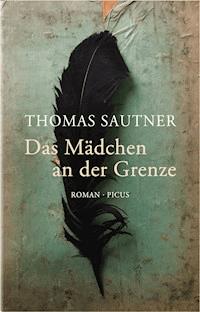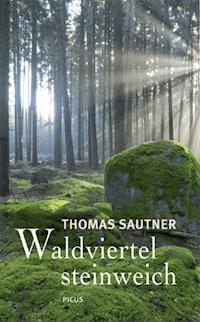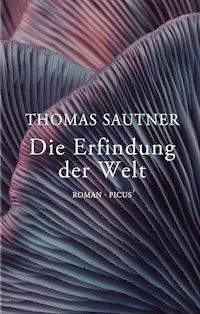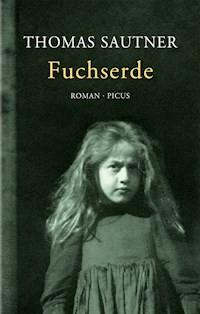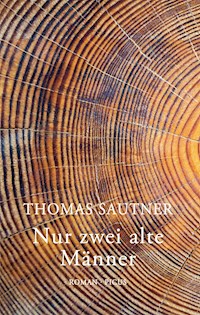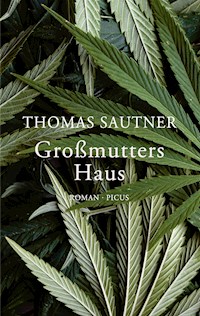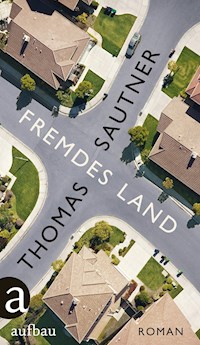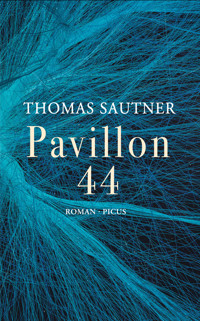
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer psychiatrischen Anstalt am Rande Wiens sammelt Primar Siegfried Lobell die spannendsten Fälle. Von seinen Patientinnen und Patienten in Pavillon 44 erhofft er sich Erkenntnisse über das Rätsel Mensch, den eigenartigen Zustand der Welt und über das obskurste Mysterium von allen – sich selbst. Als zwei seiner Patienten verschwinden, macht sich auch Lobell auf in die Wiener Innenstadt. Was er findet, sind jede Menge Verrückte, aber nicht die beiden. Der Besuch Schriftstellerin, die sich in Lobells Pavillon 44 als Gast für eine Rechereche einquartiert, macht die Sache nicht besser …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Copyright © 2024 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © Marcos Osorio/Stocksy
ISBN 978-3-7117-2149-5
eISBN 978-3-7117-5515-5
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter www.picus.at
Thomas Sautner
Pavillon44
Roman
Picus Verlag Wien
Für Julie und Johny
Die Menschen und Vorkommnisse in diesem Roman sind fiktiv. Namen real existierender Personen, Orte, Firmen, Marken und Institutionen beziehen sich ausschließlich auf erfundenen Stoff, nicht auf die andere Wirklichkeit.
Die Welt, sagt Dimsch, ist eine Irrenanstalt, denn alle Menschen irren. Aber in diesem Buch, sagt Dimsch, steht die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und noch viel mehr.
Inhalt
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Danksagung und Epilog
Der Autor
Erster Teil
- 1 -
Am Morgen des 14. April saß auf dem höchsten Punkt der Grenzstadt Gmünd, auf dem First des alten Friedhofmausoleums, ein nackter Mann. Sein rasierter Schädel lag im Nacken und sein Oberkörper schaukelte in einer leisen Bewegung vor und zurück, als folgte er dem Takt der Unendlichkeit. Wie ein federloser Vogel kauerte er da oben. Ein absonderliches, gänsehäutiges Etwas, das den Flug in den Süden verpasst hatte und nun auf den fernen Sommer wartete, unfähig, den Blick vom Himmel zu lösen.
Nachts zuvor hatte er, bekleidet noch, das Flügeltor des Mausoleums mit einer Eisenstange bearbeitet. Ächzend bogen sich die Planken.
»Bscht … leise.« Nahezu zart setzte er das Brecheisen an.
Quiiiiietsch!
»Bscht!«, zischte er und riss am Brecheisen. Das Holzkrachen war die Toten erweckend. Aber immerhin, die Tür stand offen.
Dimsch atmete durch.
»Bscht! Ich hab doch bscht gesagt!«
Mittels Streichhölzern, die nur widerwillig Feuer fingen, aber umso zügiger abbrannten und ihm die Fingerkuppen versengten, entfachte er Kerzen. Zuerst auf dem Altar, dann auf dem Steinboden. In tiefer Hocke – sein Hintern bekam die Kälte des Granits zu spüren – platzierte er die Grablichter. Platzierte sie so, dass es ihm später möglich sein sollte, inmitten der Flammen hindurchzuspazieren, ohne an den Hosenbeinen gleich Feuer zu fangen. Dimsch beabsichtigte, alle mitgebrachten Kerzen anzuzünden, der Feierlichkeit wegen. Zudem sollte es behaglich werden. Noch nämlich war kein Unterschied zu draußen. Wenn Dimsch ausatmete, kondensierten Kumuluswolken vor seinem Gesicht.
Längere Zündhölzer hätte ich kaufen sollen! Verdammt! Er schüttelte den britzelnden Schmerz ab.
Im Supermarkt hatte die Kassiererin ihren müden Acht-Stunden-Schicht-Blick verloren, als ihr das Förderband den kompletten Lagerbestand an Friedhofskerzen herangeschoben hatte. Hinter dem Stapel Kerzen war eine Bohnenstange im gestreiften selbst gestrickten Pullover gestanden und hatte sich am Ohr gekratzt.
»Da kommen Sie ein Weilchen aus.«
»Nicht so lange, wie Sie denken«, hatte die Bohnenstange geantwortet.
»Sind Sie Pfarrer?«
Pfarrer, hatte Dimsch gedacht. Ja, irgendwie war er Pfarrer, aber waren das nicht alle hin und wieder?
Zur Begrüßung küsste Dimsch seinem Freund die Stirn, sagte »Servus«. Begann dann zu trinken, rasch zu trinken, gegen die Rührseligkeit. Eine Kiste Bier hatte er angeschleppt für sie beide, ihr letztes Fest. Für jede Flasche, die er leerte, stellte er dem Freund eine in den Sarg.
Der Leichnam war im Zentrum des Mausoleums aufgebahrt, über der Grabplatte des Erzherzogs von Österreich. Den Sarg aus schlichtem Fichtenholz hatten die Träger so auf den Katafalk gehoben, dass der Tote Angesicht zu Angesicht mit Jesus Christus ruhte. Gottes Sohn hing an der Stirnseite des Raums, in Stein gemeißelt, ans Kreuz geschlagen und mit Dübeln fixiert. Darunter, auf dem wuchtigen Altar, stand eine Vase aus Ton mit einem Strauß Margeriten.
Als stünde er an einer Bar, lehnte sich Dimsch mit den Unterarmen gegen die Sargkante, umfasste mit beiden Händen die dritte Flasche Bier und betrachtete seinen Freund. Unvermittelt drehte er ab, fuhr sich energisch über die Wangen und streifte erneut im Raum umher.
Minuten später hielt er inne, besah den Leichnam und schritt mit nach oben gehaltener Bierflasche eine Ehrenrunde. Es war als kindische Geste gegenüber dem Freund gedacht, der doch gewiss nun lächelte irgendwo.
Das Leben dauert nur einen Funkenschlag. Oft hatten sie es behauptet und nie geahnt, wie richtig sie damit lagen.
»Prost! Prost, alter Freund!«
Dimsch stieg über die auf dem Boden ja doch zu eng verteilten Kerzen.
Zwei Biere später beendete er das Tempelhüpfen von einem Steinquader zum nächsten. »Dass du nicht brunzen musst! Mich drückt’s schon wieder.« Er stieß das Tor auf.
Vor dem Portal zitterten zwei flammenförmige Eichen im Mitternachtswind. Dimsch wählte die rechte, warf erleichtert den Kopf zurück, kreiste beim Wasserlassen elliptisch mit der Hüfte, verlor das Gleichgewicht und torkelte zur Seite. Über ihm lächelten die Engel und in der Mitte des Säulenportals wiegte die Jungfrau Maria ihr Kindlein.
»Grausliches Wetter draußen!« Dimsch schlüpfte ins Innere, zog das Tor hinter sich zu. »Kannst froh sein, dass du nicht rausmusst!«
Bis auf vier Flaschen war die Bierkiste geschafft, entsprechend schwer fiel schon das Trinken. Und das Reden. »Was? – Sicher! Sicher hab ich an die Mohnzelten gedacht!« Dimsch nahm Anlauf, seine Füße stießen zwei, drei Kerzen um. Ungestüm sprang er aufs Bahrgestell, das laut knarzend einige Zentimeter nachgab. Sekunden später saß Dimsch auf der Sargkante, die Füße rechts und links von jenen des Freundes. Er zog einen Mohnzelten aus der Jackentasche, schwenkte ihn auf und ab, als höbe ein Geistlicher zur Eucharistie an.
»Riech einmal!« Er beugte sich nach vorne, hielt den Teig unter die Nase des Freundes. »Ganz frisch! Der Mohn weich und saftig. Perfekt gezuckert, nicht zu viel, nicht zu wenig.« Dimsch beließ eine abgebrochene Hälfte auf der Brust des Toten, biss in die andere. »Na, was sagst?«
Als Dimsch das letzte übrig gebliebene Bier in den Sarg stellte, bemerkte er, wie kalt František war. Er griff ihm an die Hand, an die Stirn – und zog sich aus, um den Freund mit seiner Kleidung zu wärmen.
»Warum hast auch so früh sterben müssen! Mit vierundvierzig! Du spinnst ja!« Dimsch wickelte seine Jacke um die Füße des Toten. »Nur damit du die Wette gewinnst und ich wie ein Idiot mit Stoppelglatze herumrennen muss!« Er breitete seinen alten Lieblingspullover über den Oberkörper des Freundes, entledigte sich auch seiner Jeans, seines T-Shirts, polsterte damit den Spalt zwischen Sargwand und Leichnam.
»Weißt noch, immer haben wir uns gefragt, wie es sein wird, wenn wir erwachsen sind. Und was ist passiert? Zuletzt sind wir uns noch immer vorgekommen wie Buben. Alte Buben, stimmt schon. Aber Buben.«
Dimsch hielt inne, sah auf das Gesicht des Toten, über das ein Schimmer glitt, wie vom Flackern der Kerzen oder vom Mondlicht, das durch die Zwillingsfenster fiel.
Wehmut erfasste Dimsch. So also war das Ende. Die Traurigkeit. Das Nie-mehr-Wieder.
»Und, František?«, fragte er, um loszukommen von sich, »wie ist es, wenn man erwachsen ist? Weißt du es jetzt?«
Stets hatten sie auf etwas gewartet. Etwas, das ihnen ein dauerhaftes Gefühl, eine Art göttergleiche Sicherheit geben würde, etwas, das sie souverän über den Dingen stehen ließe. Aber bis zuletzt, ja sogar bis in den Tod, waren sie lebensanfällige, liebesbedürftige Kinder geblieben.
Nichts Wesentliches hatte sich geändert seit jener wolkenlosen Nacht, in der sie gemeinsam zu den Sternen gesehen hatten. Schulbuben waren sie gewesen, dreizehn, vielleicht vierzehn Jahre alt, und hatten beschlossen, sich auf dem Oval der Laufbahn niederzulassen, um in die Unendlichkeit zu schauen. Ausgestreckt waren sie dagelegen, Schulter an Schulter, Grün hinter den Ohren, und hatten nach oben gespäht, in Gedanken, wie das Leben denn sei.
Nun waren sie wieder beisammen. Und wieder standen die Sterne am Himmel, funkelten zum Greifen nahe, obgleich sie Welten entfernt waren und womöglich längst verglüht.
Sauer auf den Tod schleuderte Dimsch sein letztes Kleidungsstück in Františeks Sarg. Und bemerkte ein phosphoreszierendes Licht weit oben im Raum. Das Licht oszillierte, funkelte vielfarbig wie die Scheiben der Mausoleumsfenster. Vergnügt huschte es hin und her, sprang auf und ab, glitt dann unversehens zum Spalt des Eingangsportals und flirrte nach draußen.
Dimsch fühlte ein feines Stechen, gleich darauf ein sonderbares Pochen in seinem Herzen. Es war so drängend, als schlüge etwas Appell, als zöge und höbe etwas an ihm. Ein Gefühl später wusste er: Dieses Licht war sein Freund gewesen.
Dimsch stürzte nach draußen, sah nach oben, hastete zur Rückseite des Mausoleums und kletterte am Regenrohr empor. Da oben, ja da oben, war František.
- 2 -
Alles Zurufen, Pfeifen und Winken hatte nichts gebracht. Der Nackte, der da oben auf dem First des alten Mausoleums saß, sicherlich acht Meter über dem Erdboden, schien wie entrückt.
Für die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd war es eine Hetz, eine noch nie da gewesene Ablenkung. Sie riefen Dimsch zu, er solle doch herunterkommen, in der Hoffnung, dass er es nicht täte, schrien, er möge doch bitte Vernunft annehmen, und fürchteten für diesen Fall um einen Einsatz, über den noch ihre Enkelkinder reden würden. Gegenüber dem Lokalreporter, den sie herbeigerufen hatten, sprachen sie von einer großen Herausforderung, könnten sie hier, mitten auf dem Friedhof, doch weder mit dem Einsatzwagen anrücken noch die automatische Leiter verwenden. Neben Bürgermeister, Pfarrer, Verwandten, Bekannten und Polizei wurde auch die Familie Habsburg-Lothringen informiert, war es doch das Mausoleum ihres Urahns Erzherzog Sigismund von Österreich, des kaiserlich-königlichen Feldmeisters und ehemaligen Inhabers des Infanterieregiments 45, auf dessen Dach ein nackter Irrer hockte.
Nach ausgiebigem Fachsimpeln und Beratschlagen gab der Feuerwehrkommandant endlich den Befehl, eine ausziehbare Leiter flach gegen die Dachschräge zu lehnen. Möglichst sachte freilich, möglichst leise, der Irre sollte nicht verrückt gemacht werden.
Es war bemerkenswert still, stiller noch als sonst auf dem Friedhof in Gmünd, als die Aluminiumleiter scheppernd aufschlug. Drei, vier Dachziegel lösten sich, polterten nach unten, krachten auf den Asphalt. Einige Zuschauer sprangen erschrocken zur Seite. Nur einen rührte das Spektakel nicht: den Mann auf dem Dach. Alles, was er tat, war, seinen Blick vom Himmel zu lösen. Jetzt erst bemerkte Dimsch, weshalb er derart fror die längste Zeit. Er war ja nackt!
Der junge Feuerwehrmann, der hinaufstieg, hatte keine allzu konkrete Vorstellung, was zu tun sei, würde der Wahnsinnige nicht rechtzeitig, also bevor er bei ihm angelangt wäre, vom Dach springen.
Spring, Narrischer, bitte spring, dachte er in einem fort, betete es geradezu. Unten standen die Kollegen mit einem Sprungtuch, der Kommandant hatte Vorkehrungen getroffen.
Wie, dachte der rotbackige Bursch und stieg höher von Sprosse zu Sprosse, wie redet man eigentlich mit einem Verrückten? Und was, wenn er mich attackiert? Was, wenn er zu toben beginnt? Wie handeln, wenn er überhaupt nicht reagiert? Und wo, verdammt, den Nackerten angreifen? Die Kameraden würden sich gewiss bucklig lachen, packte er aus Versehen an einer dummen Stelle zu. Bang kletterte er weiter.
Als er nur noch eine Körperlänge vom Dachfirst und also vom Verrückten entfernt war, hatte seine Fantasie ausreichend Zeit gehabt, ihn in Panik zu versetzen. Seine Knie schlotterten und seine Beine zitterten so hochfrequent, dass es sich anfühlte, als gingen die Knochen eine Legierung mit der Leiter ein. Der Angstschweiß stand ihm im Nacken, klebte ihm am Rücken und kroch langsam Richtung Arschritze. Verflucht, bestimmt hatten es alle Schaulustigen da unten schon bemerkt. Bei der Feuerwehr lernst du, dich in den Griff zu kriegen. Bei der Feuerwehr wirst du ein Mann, kriegst du eine Ausgehuniform. Die Verdienstmedaille in Bronze mit dreieckig eingeschlagenem rot-gelb-blauem Band hatte er sich tatsächlich gleich beim ersten Einsatz unter den Nagel gerissen. Niemanden gerettet zwar, nicht einmal eine Katze vom Baum, dafür eine Rauchgasvergiftung abbekommen, das galt auch. Lieber Gott, hoffentlich geht der Krampf in den Haxen weg, sonst haut’s mich da noch runter. Tapferer Jungfeuerwehrmann bei Einsatz von Leiter gestürzt. Nach Verdienstmedaille in Bronze: Verdienstmedaille in Silber. Im Spital nach langem heldenhaften Kampf seinen inneren Verletzungen erlegen: Verdienstmedaille in Gold. Vater stolz. Mutter tränenreich. Foto in der Bezirkszeitung.
Er blickte nach unten. Dort nickte ihm der Kommandant auffordernd zu, fuchtelte energisch mit den Händen. Als der Bursche wieder nach oben sah, war der Verrückte aufgestanden.
Lautlos und mit traumwandlerischer Sicherheit schritt der Nackte den First entlang. Und teils unter Raunen, teils unter Empörungsrufen der Umstehenden nahm er an dessen Ende das steinerne Kreuz Christi zwischen die Schenkel. Aus Granit gemeißelt war das Kreuz, erhöhte plan die Vorderseite des Mausoleums, vierteilte dort oben die Luft und vereinte die derart getrennten Himmel gleichsam in seinem Zentrum.
Dimsch hatte sich auf dem Querbalken niedergelassen und umschlang das Symbol der Heiligen Römischen Kirche. Für die aufgewühlten, zumeist älteren Schaulustigen musste es wirken, als wollte der Nackte das Kreuz beschlafen. So sehen die Gaffer da unten meinen Pimmel nicht, dachte Dimsch. Das Kreuz, glaubte er, wäre ihm Schutz.
Die Feuerwehrmänner stolperten mit dem Sprungtuch zum Portal. Dimsch indes sah zur Seite. Wie violett der Himmel war und wie weit zu sehen an diesem Morgen! Bis weit ins Tschechische. Im Südwesten der Madelstein, der Wachtberg, bis zum Freiwald reichte der Blick. Und über all dem dieser herrliche Himmel, diese lichtdurchdrungene Farbenpracht: Zyklam, Rosa, leuchtendes Orange! Dimsch atmete ein. Die Farben des Himmels schmeckten wie kühles Engelshaar.
Den anderen schien der Himmel einerlei, sie gierten nur nach ihm. Dimsch streckte den Arm aus, rief »Schaut doch!«. Und als all die Menschen sich umwandten und ihren Blick in den Himmel dieses klaren, kalten Morgens tauchten, nutzte Dimsch die Gelegenheit, stieg auf den Querbalken des Kreuzes, schloss die Augen und sprang. Die Feuerwehrmänner erschraken, als wie aus dem Nichts etwas vom Himmel raste. Als schösse ein Cherub, weißhäutig, spinnenbeinig, stoppelglatzig, in ihre Mitte. Dimsch klatschte ins Tuch.
Die beiden Polizisten wollten bei all den Leuten keinen mimosenhaften Eindruck hinterlassen. Kurzerhand zerrten sie Dimsch vom Sprungtuch, fixierten ihm die Arme auf dem Rücken. Die Raffinesse bestand darin, den Nackten sicher im Griff zu behalten und dennoch nicht allzu intensiv mit ihm in Berührung zu geraten. Als müssten sie radioaktiven Stoff entsorgen, schoben sie Dimsch mit gestreckten Armen Richtung Friedhofsausgang und waren überrascht, wie professionell die Sache vonstattenging.
Beim Wagen angelangt, kam den Beamten der Gedanke, eine Decke wäre nicht schlecht, zum Schutz der Rückbank. Weiß Gott, zu welchen Sauereien der Nackerte imstande war.
»Gebt ihm wenigstens eine Decke!«, rief beinahe zeitgleich eine Frau.
Da bemerkten die beiden, dass sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnten. Etwas umständlich wickelten sie die Pannendecke um den Verhafteten, verfrachteten ihn in den Fonds des Wagens.
Blaulicht und Sirene wären nicht nötig gewesen, aber wann, wenn nicht jetzt, sollten sie das Signalhorn einschalten? Die Stimmung schrie geradezu danach. Mit quietschenden Reifen verließ die Polizeistreife den Friedhofsparkplatz, driftete um die Ecke, kollidierte dabei ums Haar mit einem parkenden Auto und verschwand schließlich aus dem Blickwinkel der Schaulustigen.
»Rast doch nicht so«, bat Dimsch im Wageninneren.
Nach wenigen Hundert Metern bremste sich das Dienstfahrzeug vor dem Polizeigebäude ein.
Die Niederschrift des Protokolls besorgte der Fahrer, das Vorlesen sein Kollege. Er beugte sich nach vorne und stellte, langsam vom Blatt rezitierend, vier Straftatbestände fest: Hausfriedensbruch, Beschädigung fremden Eigentums, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Störung der Totenruhe.
Dimsch schüttelte über alles nur den Kopf. Ihm war mulmig vom vielen Bier und er war schrecklich müde. Als der Beamte allerdings auch von Leichenschändung zu reden begann, geriet Dimschs spontane Reaktion heftig, sodass noch Vandalismus und Widerstand gegen die Staatsgewalt hinzukamen. Der Irre war gefährlich, es war nicht anders zu erwarten gewesen.
Die Polizisten waren gespannt, was Doktor Porsts, der alte Amtsarzt, zu dem Fall sagen würde. Er wusste gewiss mit dem Verrückten umzugehen. Doktor Porsts galt als Legende in der Gegend, als Arzt alter Schule, der mit jeder Verzwicktheit zurande kam. Nachdem sich die Polizisten telefonisch angekündigt hatten, klopften sie an die Tür seines Behandlungszimmers.
Porsts war ein schmächtiges Männlein mit einem weißen, bleistiftschmalen Oberlippenbärtchen. Ruhigen Blicks beäugte er Dimsch, der ihm in Handschellen zugeführt wurde, besah diesen langen, schlaksigen Kerl, der, in eine schäbige Decke gewickelt, schließlich vor ihm auf dem Holzsessel kauerte und seinen kahlen Schädel rieb. Und sonst nichts tat. Nichts sagte, nichts antwortete, auf nichts reagierte. Obgleich Porsts gelernter Zahnarzt war und nicht Psychiater, fiel es dem Amtsarzt leicht, neben Unterkühlung und Alkoholisierung hochgradige Verwirrtheit sowie Apathie zu diagnostizieren. Da ihm das als Diagnose bei einem ganz offensichtlich Geistesgestörten unzureichend schien, fügte er kurzerhand auch noch Wahnvorstellungen hinzu. Das, sagte er sich und zupfte an seinem Bärtchen, treffe ohnehin in den allermeisten Fällen zu.
Die beiden Polizisten warfen einander zufriedene Blicke zu. Nun war es also amtlich: Der Nackte war irre.
Bevor der Amtsarzt den Patienten entließ, schob er dessen Oberlippe mit einem Holzstäbchen nach oben, dessen Unterlippe nach unten, erforschte, interessiert zu ihm gebeugt, Dimschs Mundhöhle. Wortlos nickte er, nickte ausgiebig, als hätte er gefunden, wonach er gesucht hatte. Auf sein Zeichen hin packten die Polizisten den Verrückten, zogen ihn aus dem Zimmer und schlossen die Tür hinter sich. Der alte Amtsarzt indes nickte immer noch und brummte still zufrieden vor sich hin. Die Zähne des Irren, Respekt, Respekt, waren vorzüglich erhalten. Feine Beißerchen.
Der Bürgermeister von Gmünd war erleichtert. Der Nackerte war zwar hier geboren, aber seit Langem in Wien gemeldet und musste somit nicht vor Ort verwahrt werden. Noch am selben Tag wurde Dimsch mit einem Rettungswagen des Roten Kreuzes ins psychiatrische Krankenhaus Baumgartner Höhe nach Wien überstellt. Ins Otto-Wagner-Spital, wie es neuerdings offiziell hieß. Ins Irrenhaus, wie die Leute immer noch sagten.
Postskriptum:
Als sich die Menschenmenge rund um das Mausoleum verlaufen hatte, stieg der junge Feuerwehrmann wohlbehalten von der Leiter.
- 3 -
Primar Lobell lustwandelte seit gut einer Stunde im weitläufigen Erholungsgebiet hinter dem Krankenhausareal. Die Hände hatte er tief in die Taschen seines Arztkittels vergraben, und wenn er sie ab und zu nach vorne schob, um während des Dahinschlenderns seine Leibesmitte zu befühlen, stellte er beruhigt fest, dass sein Bauch genau jene Wölbung aufwies, wie sie sich für einen Herrn seines Alters gehörte.
Es war ja nicht so, dass er gravitätisch daherkam, mehr schwankend als gehend, wie manch anderer um die sechzig. Nein, nein, er war noch fit, bewegte seinen Körper stolz und elegant, wenn nicht gar geschmeidig durch die Landschaft. Eine gewisse Dralligkeit, ja sicher, ein wohlig anzugreifendes Bäuchlein. Aber das war es schon. Dick war er nicht. Gut, er musste etwas tun für seine Sportlichkeit, aber das machte er schließlich auch – mit den ausgedehnten Spaziergängen. Ein wenig, aber wirklich nur ein ganz klein wenig zugenommen hatte er womöglich. Doch gewiss nicht in dem Grad, dass es angebracht wäre, sich zu beunruhigen. Die Pistazienmilch jedenfalls würde er nicht aufgeben. Nicht die Pistazienmilch! Da noch lieber eine Extrarunde drehen. Wenn es sein musste ums gesamte Areal. Kurz war eine kleine Grimmigkeit in Lobells Gesicht. Der Primar beschleunigte seine Schritte.
Föhn aus Südwest hatte sich an diesem Aprilmorgen über die Baumgartner Höhe und das dahinterliegende Erholungsgebiet, die Steinhofgründe, gelegt. »Wie der warme Atem eines übermütigen Kindes«, hatte Cecilie festgestellt; Cecilie Weisz, Lobells Liebling unter den Patienten, die Grande Dame der psychiatrischen Anstalt, gemäß Geburtsurkunde vierundachtzig Jahre alt, ihrer tiefen Überzeugung nach jedoch exakt sechstausendzweihundertzwölf. Eine Frau mit viel Erfahrung jedenfalls. Der Primar hatte im Gehen wieder seinen Rhythmus gefunden.
Der Steinhof bot Spaziergängern eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, war überzogen von einem Netz aus Wegen, mehr oder weniger ausgetretenen Pfaden. Lobells Naturell kam das entgegen. Er fand es wichtig, flexibel zu bleiben, nicht in eingefahrene Bahnen zu geraten. Bei seinem täglichen Ausmarsch achtete er deshalb darauf, die Route zu variieren. Ohne Ausnahme tat er das. Einmal war der Primar abrupt vor einer Weggabelung stehen geblieben. Der Gedanke war ihm eingeschossen, dass seine zum Gesetz erhobene Flexibilität, seine unbedingte Neigung, immer neue Wege zu wählen, womöglich eine Abart von Gedankenstarre war, eine raffiniert getarnte Geistlosigkeit. Oder gar ein krankhafter Zwang. An diesem Tag hatte Lobell seine Pistazienmilch nicht so vortrefflich geschmeckt wie sonst.
An die fünfzig Hektar maß das Erholungsgebiet. Vorwiegend bestand es aus Wiesen, war an jenem Rand, der Richtung Krankenhausareal wies, bewaldet, mit Fichten, Föhren, Lärchen. Lobell mochte es, wenn sich ein Kollege oder ein Patient erkundigte, welchen Weg er denn diesmal gewählt habe. Er konnte antworten, dass es keinesfalls so sei, dass er einen Weg wähle. Vielmehr wähle ein Weg ihn. Er folge diesem bloß, demütig und mit Freude.
Heute führte ihn sein Weg hinunter zum Kinderspielplatz, den Hügel hinauf Richtung Feuerwache, den Hauptpfad entlang, vorbei an mäandernden Wasserlacken, kreuz und quer über die abfallende Wiese, beorderte ihn von dort retour zur großen Weide, schickte ihn zum alten Wasserreservoir, dann rund um das wuchernde Dickicht und letztlich die schmälere der beiden zentralen Routen zurück. Lobell hüpfte von einem Wegrand zum anderen, um dem Matsch in der Mitte auszuweichen.
Der Primar blickte auf. Vor ihm blitzte die goldene Kuppel der Otto-Wagner-Kirche durch die Baumreihen. Täglich sah er sie, seit vielen Jahren schon, und noch immer löste ihr Anblick eine … Lobell hielt inne … eine … ja, was eigentlich löste sie aus in ihm? Eine Melancholie. Eine Sonderlichkeit. Eine beinahe … religiöse Ahnung. Hinreichend sich zu analysieren aber gelang dem Primar nicht; hinreichend sich zu erklären, weshalb diese Emotion in ihm aufkam, wenn er jener Kirche ansichtig wurde, die für Wiens Geisteskranke errichtet worden war. Ein wenig irre machte ihn diese Ambivalenz durchaus. Zugleich aber mochte Lobell die Unbestimmtheit, diese auf ihn einwirkende geheimnisvolle Kraft. Und er fürchtete den Tag, an dem er Gewissheit haben könnte. Dann nämlich wäre er womöglich um ein Geschenk gebracht, verblasste womöglich der Effekt der himmelstrebenden Kuppel. Doch noch war er unwissend. Noch bestand der Zauber. Primar Siegfried Lobell nahm einen zufriedenen Atemzug.
Die Kirche stand nicht am Zenit der Baumgartner Höhe, sondern leicht darunter. Ihr Goldkuppel-Kreuz jedoch befand sich gleichauf mit den Baumwipfeln. Dieser Entschluss Otto Wagners, die Kirche nicht wichtig thronen zu lassen auf der Spitze der Anhöhe, ihr Symbol aber, das Kreuz, hinausweisen zu lassen über alles Weltliche, schien dem Primar von bestechender Eleganz.
Unterhalb der Kirche lagen, an den Hügel gebettet, nicht weniger als sechzig Gebäude, vorwiegend Patienten-Pavillons. Samt Erholungsgebiet maß das unter Kaiser Franz Joseph fertiggestellte Krankenhausareal um die eineinhalb Quadratkilometer und war damit halb so groß wie der erste Wiener Gemeindebezirk. Spitzzüngigen Zeitgenossen zufolge hielten sich hier auch nur halb so viele Verrückte auf wie im ersten Wiener Gemeindebezirk. Zwischen den im Jugendstil errichteten Pavillons jedenfalls hatten die Planer großzügig Luft, Licht und Raum belassen, und so wirkte die Anlage von Beginn an weniger wie eine Krankenanstalt als eine Villengegend inmitten eines von Föhren bestandenen Parks. Die Depperten da oben wohnen besser als wir Bürger in der Stadt, beschwerten sich einst die Wiener. Derlei Granteln, das der echte Wiener pflegt wie eine kulturelle Errungenschaft, gilt als Volkssport und Volksmedizin gleichermaßen, lässt sich damit der Schmerz des Neids wie des Selbstmitleids doch ebenso anstacheln wie lindern, je nach innerer Notwendigkeit.
Primar Lobell querte mit ausladenden Schritten den geschotterten Vorplatz der Kirche. Wäre jemand an seiner Seite gewesen, hätte der Primar nun gut gelaunt mit einer dirigentengleichen Handbewegung in die Weite gewiesen, auf die zu Füßen liegende Stadt, und erzählt, dass die Geisteskranken Wiens von hier aus eine zumindest ebenso herrschaftliche Aussicht hätten wie einst der alte Kaiser vom Balkon seines Schlosses Belvedere, das bekanntlich wegen des vorzüglichen Ausblicks seinen Namen trage. Einmal, Lobell hatte eben eine kleine Gruppe angeführt, hatte seine neue, aus Deutschland stammende Oberärztin Rosa Fraukenschlag auf derlei Ausführungen des Primars ihre feuerrote Irokesenfrisur in Kampfposition gebracht und erwidert, dass die Patienten von jenem Ausblick krankheitsbedingt wohl weniger Nutzen zögen als seinerzeit der Kaiser. Beinahe hätte Lobell eingeschnappt reagiert, vermied die Plumpheit gegenüber der kleinwüchsigen, energisch dreinblickenden Kollegin aber, indem er lächelnd konterte, viele Patienten seien gewiss genussbereiter als einst der greise Monarch, zumal dessen Ernsthaftigkeit im Alter ein Maß angenommen hätte, das mit teutonisch wohl treffend beschrieben sei. Die deutsche Oberärztin hatte daraufhin keine Miene verzogen und nichts an ihr ließ erkennen, wie sie mit Lobells Spitze zurechtkam.
Einige Wochen später war ausgerechnet sie es, die gegenüber einer Gruppe von Doktoranden jene Anekdote wiedergab, wonach die Geisteskranken Wiens vom Vorplatz der Kirche einen besseren Ausblick hätten als ehedem der Kaiser der österreichisch-ungarischen Monarchie. Lobell war schmunzelnd danebengestanden und hatte darauf gewartet, dass ihm die Oberärztin das Gesicht zuwenden würde, gewiss ebenfalls schmunzelnd. Rosa Fraukenschlag jedoch vermied jeden Augenkontakt, blickte im Gegenteil halsstarrig in die Ferne. Danach marschierte sie in Feldherrenmanier und ihre feuerrote Irokesenfrisur demonstrativ nach hinten werfend so dicht an Lobell vorbei, dass der Primar trotz des Knirschens der Steinchen unter ihren Sohlen ein dezentes, wohl nur für ihn bestimmtes Räuspern vernahm. Es war die Kombination aus diesem Räuspern, dem ungewöhnlich dicht an ihm Vorbeidefilieren und freilich dem Erzählen seiner Kaiser-Ausblicks-Geschichte, die Lobell die Zuversicht gab, in Rosa Fraukenschlag, dieser auffallend kleinen wie auffallend ernsten Person, von nun an eine Verbündete zu haben.
An diesem föhnigen Aprilmorgen befand sich Primar Lobell jedoch alleine auf dem breiten Vorplatz der Kirche. Mit zwei, drei Atemzügen ließ er Luft in seine Lungen strömen und bog dann in den hügelab führenden Weg. Für Momente fühlte er sich derart beschwingt, dass er von Schritt auf Trab wechselte, sodass die Steinchen unter seinen Sohlen nur so davonschossen. Derart dynamisch aufgeladen gelang es Lobell beinahe, die Nervosität abzuschütteln, die beim Gedanken an den nächsten Termin aufgekommen war. Tags zuvor hatte er die Schriftstellerin, die ihn um ein Gespräch gebeten hatte, gegoogelt. Es hatte die Sache nicht besser gemacht. Sie war hübsch und jung. Zu jung. Gott sei Dank zu jung. Wobei, was hieß das heutzutage schon bei Frauen – jung? Und ein klappriger Greis war er ja beileibe noch nicht.
Dunkles, volles Haar hatte sie, endlos lang, bis unter den Rand des Fotos. Ein intelligentes, schlankes Gesicht, hohe Wangenknochen und einen kräftigen Blick, der so viel Unsagbares zu sagen schien, dass es Lobell ganz sonderbar zumute wurde. Und konnte es sein, dass … Er war näher herangerückt und hatte seine rahmenlose Lesebrille zu Hilfe genommen. Wahrhaftig! Ungeschminkt! Der Primar hatte noch keine Handvoll Frauen kennengelernt, die selbstsicher genug waren, ihre natürliche Schönheit ungeschminkt zu belassen.
Lobell löste sich, etwas unschlüssig noch, von seinen Fantasien, blickte im Gehen auf seine alte Armbanduhr und befand, welch glückliche Fügung, dass vor dem Termin noch Zeit blieb für ein Fläschchen Pistazienmilch.
- 4 -
Stets hatte Lobell unabhängig bleiben wollen, frei. Um die fünfzig war er es so sehr, dass er sich nach nichts mehr sehnte als nach einer ihn verpflichtenden Familie. Einer ihn fordernden Frau. Schreienden Kindern. Weil er aber mit den Frauen kein Glück zu haben schien, beziehungsweise die Frauen kein Glück mit ihm und jedenfalls die Komponenten Glück, Lobell und Frauen inkompatibel schienen, fand der Primar sein trautes Heim letztlich nicht im warmen Nest einer Familie, sondern in der offenen psychiatrischen Anstalt der Baumgartner Höhe.
Siegfried Lobell war nicht nur der Star der Krankenanstalt, er war der Star der Wiener Ärztewelt. Er war das, was man gemeinhin prominent nennt. Benötigte ein Journalist eine Expertenmeinung, dachte er zuallererst an Lobell. Suchte ein Nachrichtensender einen Live-Gast zur Kommentierung eines aktuellen psychiatrischen Falls, wurde Siegfried Lobell gebeten. Und liefen Talkshows, die dem Bildungsauftrag des staatlichen österreichischen Fernsehens zu verdanken waren, erschien über Inserts wie Star-Psychiater oder Spitzen-Primar freilich ebenfalls das sympathisch runde Gesicht jenes gescheitelten weißhaarigen Herrn, der sommers wie winters nichts anderes zu tragen schien als weiße Rollkragenpullover.
Und nun hatte diese Schriftstellerin angerufen und wollte ein Buch schreiben über ihn. Lobell hatte sich geschmeichelt gefühlt, doch in möglichst unauffälligem Ton geantwortet, er sei doch keineswegs so bedeutend, dass ein Buch über ihn gerechtfertigt wäre.
Spontan war der Schriftstellerin eine herrlich spitze jüdische Redensart in den Sinn gekommen: Machen Sie sich nicht so klein – so groß sind Sie nicht! Diplomatisch aber entschied sie sich für Nachsicht, sagte: »Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel.«
»Bin ich nicht das eine oder andere Jährchen zu jung für eine Biografie?«, hatte Lobell daraufhin gefragt. Und sie umgehend ihre Nachsicht bereut. Und gesagt: »Zu jung?! Keineswegs, Herr Primar. Abgesehen davon plane ich keine klassische Biografie.«
Oh, sie plante gar keine Biografie über ihn! Lobell bemerkte, dass das Telefonat nicht rasend gut lief; bemerkte, dass er sich vorbereiten hätte sollen, bemerkte, dass er sich benahm wie ein Narr. Dabei war er für gewöhnlich doch halbwegs souverän, war er für gewöhnlich nicht so befangen. »Ich bin aktuell wohl zu sehr beschäftigt«, sagte er – was die Sache noch verzwickter machte.
»Lieber Siegfried Lobell«, hatte die Schriftstellerin entgegnet, »heutzutage werden Bücher über Zwanzigjährige geschrieben, deren hervorstechende Merkmale unzulänglich ausgedrückte Pickel sind. Dass ich einen Roman über Sie und Ihre Arbeit mache, passt also schon. Wir sehen uns kommende Woche, einverstanden?«
Diese Frau war gefährlich. Lobell massierte seine Schläfen.
Sie hieß Aliza Berg. Lobell konnte sich nicht erinnern, je etwas von ihr gelesen zu haben. Ihre Homepage bestand lediglich aus ihrem Foto und einem knappen Hinweis: Aliza Berg, Schriftstellerin und Kolumnistin, schreibt unter Pseudonymen. Falls Sie von ihr um ein Gespräch oder um Hintergrundinformationen gebeten werden und sich ihrer Seriosität vergewissern möchten, können Sie gerne die Vertrauenspersonen bei ihren Verlagen kontaktieren.
Darunter standen die Namen von zwei Verlagshäusern sowie jener einer Tageszeitung samt Kontaktpersonen, Mail-Adressen und Telefonnummern.
Lobell fixierte das Telefon auf seinem Schreibtisch, lehnte sich zurück. Schüttelte die Plastikflasche samt letztem Rest Pistazienmilch. Schüttelte sie sachte aus dem Handgelenk heraus, schüttelte sie anschließend heftig. Und griff mit der anderen Hand zum Hörer – doch ohne ihn zu berühren. Er atmete tief ein, zog die Hand zurück, atmete aus. Öffnete den Drehverschluss und sog den letzten Schluck schäumend grüner Flüssigkeit aus der breiten Öffnung. Schnaufte im geräuschlosen Raum geräuschvoll durch die Nase ein, entzog dem Zimmer einen Kubikdezimeter Luft. Die Oberfläche seiner Lunge diffundierte entsprechend Sauerstoff, eine Blutwelle leitete ihn zu den Lobellschen Zellen. Sie sonderten 0,039 Volumenprozent des enthaltenen Kohlenstoffdioxids aus und vertrauten zu Recht darauf, dass es mittels Blutkonvektion umgehend zur Lunge abgepumpt wurde, woraufhin der im Sessel mehr hängende als sitzende Lobell nichts weiter tun musste, als offenstehenden Mundes das Gas in den Orbit seines Zimmers zu entlassen.
Der Primar drehte die Verschlusskappe zu. Stellte die leere Flasche Pistazienmilch neben das Telefon. Trommelte mit den Fingerkuppen gegen die Tischplatte und wählte, aber gut fühlte es sich nicht an, die Nummer der Zeitung.
Wie erleichtert Lobell war, dass niemand abhob! Stattdessen eine dieser professionellen weiblichen Tonbandstimmen sagte, dass der gewünschte Teilnehmer gegenwärtig nicht erreichbar sei. Es folgte der Hinweis auf die Homepage der Zeitung und die übliche Marketingmusik samt Werbejingle. Lobell legte auf, griff nach der leeren Pistazienmilchflasche und schoss sie Richtung Mistkübel, den sie knapp verfehlte. Befreit atmete der Primar durch. Gewiss würde ihm Aliza Berg bei einem ihrer ersten Gespräche für sein Vertrauen danken. Was meinen Sie damit?, würde er fragen und sie antworten, dass er sich weder bei den Buchverlagen noch bei der Zeitung über sie informiert hätte. Woher wollen Sie das wissen?, würde er mit zweideutigem Blick entgegnen, und sie lächelnd antworten, dass ihre Vertrauensleute sie stets benachrichtigten, holte jemand Erkundigungen über sie ein. Daraufhin könnte er ihr Lächeln erwidern, diskret freilich, und sagen: So etwas in der Art vermutete ich schon.
Primar Lobell stand auf, spazierte in die Ecke des weiten Raums, wohin die Plastikflasche auf dem alten Parkettboden geschlittert war, und griff nach ihr – was nur einen kurzen Schmerz zwischen fünftem Lendenwirbel und Os sacrum zur Folge hatte, weil er den Rat eines Kollegen beherzigte und sich nicht verbog, sondern devot in die Knie ging. Ebenso geschmeidig wie beim Senken seines lädierten Beckens verfuhr der Primar beim Hantieren mit der Plastikflasche. Solch Zartheit war klarerweise nicht aus ergonomischen Gründen nötig, doch gewinnbringend aus ästhetischen, bot sich hier und jetzt doch einmal mehr die Möglichkeit, aus dem an und für sich banalen menschlichen Dasein ein Kunstwerk zu formen, eine feinsinnigere Dimension. Wenn auch kein nachweislicher Sinn daraus entstand, so doch ein augenblicklicher. Und was konnte schöner sein als das – in diesem Augenblick? Tänzelnd beförderte Lobell seinen Körper samt Pistazienmilch-Plastikflasche zum Mistkübel. Hielt das leere Behältnis mit Daumen und Zeigefinger, während die übrigen Finger, obgleich nicht die schlanksten, einen Fächerbogen schufen, was gewiss ein hübsches Schattenbild an die Wand geworfen hätte, wäre denn ausreichend Licht in flachem Winkel eingefallen. Lobell gab die Flasche frei und begleitete ihr Fallen mit einem Gefühl finaler Zufriedenheit. Bei ihrem Weg nach unten beschleunigte das Behältnis, wie es sich nach Newton gehörte, auf 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat, benötigte für den einen Meter bis zum Mistkübelboden demnach nur eine Zehntelsekunde, was Lobell ziemlich flott vorkam. Der Primar überlegte: Durchtauchte die Flasche nun dank eines spontanen Pausierens der physikalischen Gesetze den ellipsoiden Erdball diretissima und überstünde zudem die fünftausendfünfhundert Grad Celsius im Erdkern, würde das Ding als antipodische Flaschenpost im Südpazifischen Meer östlich von Neuseeland an die Oberfläche schwappen, was dort vermutlich nicht sonderlich auffiele. Spannend wäre, Lobell kratzte sich mit dem kleinen Finger hinterm Ohr, wenn mit der Pistazienmilchflaschenplanetendurchquerung die Gravitationskraft aufgehoben würde. Dann empfänden Geliebte keine Anziehung mehr, höben Größenwahnsinnige gänzlich ab, gerieten im Sonnensystem sämtliche Bahnen durcheinander, verformten sich Galaxien nicht mehr unter dem Einfluss der übrigen. Letztlich wäre die göttliche Reiseplanung des Universums beim Teufel. Seine Expansion, die seit vierzehn Milliarden Jahren so formschön anhielt, geriete außer Rand und Band. Auch die programmierte Kontraktion des Universums wäre dahin auf Nimmerwiedersehen. Infolge krachte womöglich alles ans Ende des irrtümlich endlos geglaubten Alls, zerschellte und zerbröselte dort und der Sternenstaub rieselte aus allen Winkeln und von der Decke herab und wenn er sich nicht im weißen Bart Gottes verfinge und dort neue Ordnung fände, fiele er zu Boden und Gott müsste sich mühselig bücken, aus Altersgründen in die Knie gehen dabei, um das Chaos aufzukehren, auf dass seine Frau ihn nicht schelte.
Lobell verharrte mit abwesendem Blick vor dem Mistkübel. Er erwog, die Plastikflasche versuchsweise herauszuholen, ob nicht doch noch ein Tröpfchen Pistazienmilch darin wäre. Doch er ließ es. Ein wenig würde er sich doch noch auf das Treffen mit der Schriftstellerin vorbereiten. Das Telefonfiasko sollte sich nicht wiederholen.
Beginnen würde er das Gespräch mit dem Lobellschen Wasserglas. Der Primar verschob den Schwerpunkt seines Körpers ein wenig, worauf der Thonet-Sessel unter seinem Hintern ein knarzend leises Ächzen von sich gab. Das Lobellsche Wasserglas würde die Schriftstellerin gewiss beeindrucken. Nicht beeindrucken, das war das falsche Wort, er schob das Motiv beiseite. Nicht kleinlich beeindrucken wollte er sie, stattdessen ihr die Augen öffnen für sein Menschenbild mit dem … Lobellschen Wasserglas.
Was ist das?, würde er fragen und ein simples Wasserglas in die Höhe halten. Wie alle anderen zuvor würde sie antworten, es sei ein Glas. Woraufhin er zu seiner Schiefertafel schlendern würde, möglichst elegant würde er die paar Schritte vom modernen Schreibtisch, der in der Mitte des altehrwürdigen Zimmers stand, Richtung Schiefertafel schlendern, am Fenster vorbei würde er schlendern, das Glas dabei in der Hand wiegen, um es schließlich mit der Unterseite gegen die Tafel zu drücken, jene Tafel, auf der bereits, er würde es wie nebenbei erwähnen, keine Geringeren ihr Wissen dargelegt hatten als die Wiener Psychiatrie-Heiligen Sigmund Freud und Alfred Adler. Daraufhin würde er das Glas als Zirkelersatz verwenden und einen Kreidekreis auf die Tafel zeichnen. Das wäre der magische Moment, in dem sie beginnen würde zu erkennen. Von wegen ein Glas, könnte er sagen und sie über die Schulter hinweg anlächeln.
Gemächlich würde er anschließend zum Waschbecken in die gegenüberliegende Ecke des Raumes gehen, an ihr vorbei, nicht zu aufdringlich knapp an ihr vorbei freilich, und dann den Hahn aufdrehen, Wasser einlaufen lassen und das Glas: als Gießkrug gebrauchen. Und zwar zugunsten der hüfthohen Palme, die ihr Dasein ausschließlich ihrer Statistenrolle im Stück des Lobellschen Wasserglases verdankte und die in diesen Tagen hoffnungslos ausgedorrt wirkte. Viele Wochen schon hatte der Primar kein Publikum für seine Inszenierung gefunden. Nicht nur die Pflanze, auch Lobell litt unter der Dürreperiode.
Keineswegs alles Wasser würde er an die Palme verschwenden, wenigstens die Hälfte im Glas belassen und es anschließend auf den Schreibtisch stellen als: Briefbeschwerer. Mittlerweile würde die Autorin in einem fort nicken und er könnte zum Finale übergehen und also einen Schluck nehmen, zugegeben, ein Glas ist es auch sagen und gleich danach die eigens gekaufte weiße Rose aus der obersten Lade nehmen, um sie in die … Vase zu tauchen.
Die Dinge, würde er sagen, sind nicht immer, was sie zu sein scheinen. Und schon gar nicht sind es die Menschen. So wenig es allein den Guten, den Bösen, den Bescheidenen, den Aufschneider gebe, so wenig gebe es den Manischen, den Depressiven, den Schizophrenen. Jeder Mensch bestehe aus einer Buntheit an Facetten. Eine psychische Erkrankung allerdings könne so weit führen, dass sie vom Menschen nicht viel mehr übrig lasse als die Krankheit selbst. Dann sei das Glas nur ein Glas. Und das, in diesem Moment würde er die Hand nach der Rose ausstrecken, sie aus dem Glas nehmen und Aliza Berg mit einem charmanten Lächeln überreichen, das wäre doch schade, oder?
Lobell verschränkte die Hände über seinem Bauch, streckte die Beine unter den weißen Designer-Schreibtisch und malte sich aus, welchen Verlauf die wunderbare Szene nehmen könnte. In jedem Fall könnte er nach einer kunstvollen Pause hinzufügen: Vielleicht beziehen die Dinge um uns ihre Wirklichkeit nur aus unserer Gewissheit, dass sie es sind und keine anderen; aus der Starrheit des Denkens, mit der wir ihnen begegnen. Schönes Zitat, würde sie sagen und beginnen, den Satz in ihrem Notizblock zu notieren. Leider nicht von mir, wäre seine Antwort, Proust, würde er sagen und sie damit gewiss nachhaltiger beeindrucken, als wäre das Bonmot von ihm. Schließlich war es seit jeher so: Gab jemand etwas Kluges von sich, verunsicherte das die Zuhörer, da sie dem eigenen Urteil ebenso misstrauten wie der intellektuellen Redlichkeit ihres Gegenübers. Wurde das Kluge aber bestätigt durch einen geläufigen, anerkannten Namen, einem etwa wie Marcel Proust, war das Kluge mit einem Mal verbürgt und konnte bedenkenlos, also hirnlos angenommen werden.
Eine der Eigenarten des Menschen, dachte Lobell. Er hält sich für intelligent und handelt instinktgetrieben wie all die anderen Tiere. Der Mensch, das dekadente Tier. Lobell überlegte, ob der Gedanke originell genug sei, um ihn zu notieren. Gleich darauf hörte ihn seine Sekretärin durch die geschlossene Tür auflachen. Und du, sagte sich der Primar, gehörst zur Spitze der eingebildeten Spezies. Wie affig er eben gewesen war in seiner Selbstverliebtheit. Sein Vermögen, es lachend zu bemerken, wie vertrackt, schuf die Möglichkeit einer neuen Eitelkeit – die es erneut erlaubte, sich darüber zu amüsieren, und so weiter und so fort. Aber wie dieser Spirale entkommen? Der Homo sapiens schien, umso mehr als er sich sapiens nannte, ein unendlicher Narr. Lobells Mundwinkel zuckten vergnügt, doch schon dachte es weiter in ihm: Legte der Narr sein Narrenkostüm ab, erschiene darunter nicht etwa ein Weiser, wie der Narr glauben machen will. Nein, legte er sein Narrenkleid ab, erlebten ihn plötzlich alle in seiner blanken Narrheit.
Lobell stand auf, um seine vorlauten Gedanken zum Schweigen zu bringen. Mit einer schwungvollen Bewegung warf er sich den schneeweißen Arztkittel über. Narrenkittel, dachte Lobell. Er war bereit für die Schriftstellerin.
- 5 -
Primar Siegfried Lobell lernte ich an einem föhnigen Apriltag kennen. Ich betrat sein Büro, sah ihn an und dachte: Was für ein Lausbub. Er wirkte nicht souverän wie im Fernsehen, sondern fast herzig mit seinem Mondgesicht und dem weißen auf und ab schwebenden Seitenscheitel. Seine kompakte Figur steckte in einem offenen Arztkittel und füllte den weißen Rollkragenpulli so behaglich aus, dass ich unvermittelt an ein Walross in einer zu engen Livree dachte. Entschuldigen Sie meine flapsige Ausdrucksweise und die Bilderüberhäufung, das kommt daher, dass ich mein Geld mit einer launigen Zeitungskolumne verdiene.
Der Primar hatte sich schon am Telefon nicht ernsthaft zur Wehr gesetzt, als ich ihm eröffnete, ich wolle ein Buch über ihn und seine Arbeit schreiben. Von Anfang an war es ein Scheingefecht gewesen, es war zu offensichtlich, und ich wunderte mich, dass der bekannteste Psychiater des Landes nicht mehr draufhatte und so durchschaubar war. Was wäre das denn für ein Buch, fragte er bei unserem Treffen, als hielte er sich noch immer offen, abzusagen. Ich antwortete ihm, ich wüsste selbst noch nicht exakt, wohin der Roman führen würde, dass er jedenfalls um den Kern des Menschseins kreisen sollte und er als zentrale Figur vorgesehen war.
Mein Leben und Wirken, wiederholte er die Worte, mit denen ich ihn während des Telefonats geködert hatte. Ja, bestätigte ich und merkte, wie meine Enttäuschung wuchs. Ich hatte mir von Lobell einen Primar wie im Film erwartet: weise, witzig, weltgewandt. Und nun stellte er sich als so einfach gestrickt heraus wie meine Zeitungskolumne. Als ich aufblickte und noch nicht wusste, was ich gleich tun würde, entweder ihn weiter überreden, obwohl er doch längst Feuer und Flamme war, oder die Sache einfach sein lassen, schlug er unvermittelt einen neuen Ton an. Sie denken sich, nuschelte er und lehnte sich gemächlich in seinen knarzenden Sessel zurück, dass ich ein jämmerlicher Schauspieler bin, es in meiner Position und meinem Alter nicht nötig haben sollte, darauf zu gieren, dass eine junge Autorin wie Sie ein Buch über mich schreibt und ich mich, wenn es nun schon einmal so ist, zumindest nicht so anstellen dürfte, stattdessen humorvoll zu meiner Eitelkeit stehen sollte. Aber wissen Sie, er legte eine Pause ein und fuhr schließlich seelenruhig fort, wissen Sie, es ist nun einmal so, dass alle Menschen im Grunde gleich sind. Alle wünschen sich Respekt und Liebe und fürchten, die Größe der Zuneigung, nach der sie sich sehnen, nicht wert zu sein. Mir geht es mit Ihrem Buch über mich ebenso. Noch dazu ist ein Roman etwas immens Großes, nicht wahr? Was soll es, abgesehen vom Leben selbst, Größeres geben? Und ich habe nun einmal Angst, etwas so Großes nicht zu verdienen. Obgleich ein Roman freilich exakt jenem Format an Zuneigung entspricht, nach dem ich mich sehne.
Das waren seine Worte, und als er sie gesprochen hatte, tat er nichts weiter, als mich anzusehen. Saß wie ein Walross im weißen Rollkragenpulli hinter seinem viel zu großen Designer-Schreibtisch und sah mich an. Er tat es nicht melodramatisch oder auf sonst eine irgendwie peinliche Art, sondern, ich sagte es eingangs, er sah mich an wie ein Lausbub, mit schelmischen Augen.
Jetzt hat er mich in der Tasche, dachte ich. Und weil er das keinesfalls bemerken sollte, sagte ich: Eines noch, Herr Primar, ich habe etwas geschummelt, es soll kein Roman über Sie werden. Sie sollen lediglich als Vorlage für eine der Figuren dienen, das ist alles.
Er lachte. Dann sagte er: Sieht man mir meine Enttäuschung eigentlich an? Und gleichzeitig meine Beruhigung? Ich wusste, dass ich keinen Roman wert bin.
Eine Weile saßen wir einander wortlos gegenüber, gefangen in einem Hin und Her von Emotionen, wie ich es in dieser Art mit einem fremden Menschen noch nicht erlebt hatte. Am Ende lächelte Primar Lobell, spitzte die Lippen, und ich gebe zu, ich konnte seinem Blick nicht standhalten, sah stattdessen nach unten, auf meine überschlagenen Beine, und fühlte mich in dem kurzen Rock und den dunklen wollenen Strümpfen, die mir bis vor Kurzem noch zu einer aufgekratzten Stimmung verholfen hatten, plötzlich wie ein Mädchen.
Er rückte geräuschvoll mit seinem Sessel nach hinten. Die Dinge, sagte er, nun im sachlichen Ton eines Professors, sind nicht immer, was sie zu sein scheinen, und schon gar nicht sind es die Menschen. Daraufhin öffnete er eine Schreibtischlade, nahm ein Wasserglas heraus, stellte es auf den Tisch und fragte: Was ist das?
Ich riss mich zusammen, mir nichts anmerken zu lassen.
Glas, sagte ich, eigens ohne Artikel.
Irritation in seinem Blick. Vielleicht auch Enttäuschung. Sie sind eine kluge Frau, sagte er.
Ich hatte ihm die Show vermasselt, hatte nicht ein Glas gesagt und ihn damit um die Möglichkeit gebracht, mir darzulegen, dass nur unsere vorgefasste Meinung das Glas zu einem Glas machte, dieses Ding aber durchaus auch eine Kreisvorlage sein konnte, ein Krug, eine Vase, ein Briefbeschwerer oder ein Wurfgegenstand. Ich überlegte, ob ich ihm sagen sollte, dass ich das Lobellsche Wasserglas bereits kannte, dass ich als Studentin im Hörsaal gesessen war, als er es vorgeführt hatte.
Der Primar nickte wie in Gedanken, wiederholte beinahe tonlos »eine kluge Frau« und stellte sein Glas zurück in die Lade.
Der weitere Verlauf des Gesprächs war holprig, wir bemühten uns beide zu sehr umeinander. Es drängte mich, ihm zu sagen, dass ich das Lobellsche Wasserglas schon kannte, aber es schien mir zu spät. Und mit jeder Minute wurde es weniger möglich. In einer der zähen Gesprächspausen hörte ich ein leises Klacken hinter mir. Ich drehte mich um und sah, seine jämmerlich verdorrte Zimmerpalme hatte ein Blatt abgeworfen. Die Szene war zu skurril. Es wäre ein wunderbarer Anlass gewesen, aufzulachen und die Wahrheit über das Lobellsche Wasserglas zu sagen, aber ich wurde nur rot, fühlte es im Gesicht.
Wir redeten über die Modalitäten meiner Recherche. Lobell war überaus höflich und kooperativ, sagte zu, mir für Gespräche und Fragen zur Verfügung zu stehen, wann immer es seine Aufgaben zuließen, er kam sogar meiner Bitte nach, mich als Beobachterin im Pavillon aufhalten zu dürfen, um hautnah bei der täglichen Routine des psychiatrischen Betriebs dabei zu sein, bei den Visiten, den Aufnahmen von Patienten, den Diagnosen, Ärztebesprechungen. Er erlaubte mir, mit den Patienten zu reden, und schlug mir nicht einmal die Bitte nach einem einfachen Zimmer ab, sodass ich gänzlich ins Leben auf der Baumgartner Höhe würde eintauchen können.
Zum Abschied gab er mir die Hand. Ich bedankte mich zum x-ten Mal, folgte ihm zur Tür, er hatte schon die Klinke in der Hand, da entschied ich mich, sagte, Herr Primar, ich kannte das Lobellsche Wasserglas schon.
Da war es wieder, sein Lausbubengesicht, das Schelmische in seinen Augen.
Ich weiß, antwortete er. Sie waren als Studentin in meiner Vorlesung.
- 6 -
Die Lider des Patienten zuckten bei geöffneten Augen. Langsam zog er einen Arm unter der Decke hervor, öffnete die Hand und es schien, als griffe er nach einem imaginären Gegenstand knapp oberhalb seines Gesichts. Mehrmals lockerte und schloss er die Faust, tat es sachte, als ließe er Sand durch seine Finger rieseln.
»Sebastian Dimsch.« Oberpfleger Peter Rosner tippte mit dem Zeigefinger an einen der Monitore. »Wurde vor drei Tagen vom Waldviertel mit der Rettung zu uns gebracht. Ist bei Eiseskälte auf dem Dach eines Mausoleums gesessen, nackt. Er behauptet, die Seele seines verstorbenen Freundes zu sehen und dessen Stimme zu hören. Posttraumatisch und schizophren. Bekommt Neuroleptika, wir erhöhen gerade die Dosis.«
Der Zeigefinger des Oberpflegers wanderte einen Bildschirm weiter. »Gestern erst eingeliefert. Netter Bursche, schwer psychotisch. Hat bisher nicht mehr gesagt als seinen Namen. Dreimal dürfen Sie raten, für wen er sich hält?«
Ein junger Mann lag im zweiten Bett des Zimmers. Die Decke hatte er bis zu den Hüften nach unten gestreift. Erschreckend abgemagert war er, jede Rippe zu sehen. Wenn der Brustkorb sich im Schlaf zitternd hob und senkte, sah es aus, als berührte Wind ein Wesen aus Seidenpapier. Das blasse, bärtige Gesicht des Burschen wirkte wie ein Gemälde aus Demut und Leid. Über seinen Schultern lag, sanft gewellt, aschblondes Haar.
»Verblüffend.« Aliza Berg verlagerte ihr Gewicht von einem Bein auf das andere.
»Allerdings. Wir hatten hier schon einige Söhne Gottes, aber er ist eindeutig der spektakulärste.«
Die Schriftstellerin nickte, schob ihr Gesicht näher zum Monitor. Eine ungekannte Anziehung ging von diesem jungen Mann aus, nichts Erotisches, jedenfalls nichts Sexuelles, am ehesten eine keusche Sinnlichkeit. Gerne hätte sie diesen Schlafenden länger beobachtet. Sie fühlte, wie sie in seinem Anblick versank. Gerade deshalb war es gut, dass der Oberpfleger fortfuhr. Ihr Blick war gewiss zu intensiv gewesen, zu schamlos, freilich nicht in böser Absicht, aber gegenüber einem halb nackten fremden Menschen, der sich unbeobachtet glaubte, war ihr Verhalten, um das Mindeste zu sagen, unangebracht gewesen.
Ob die Würde des Menschen geachtet werde in der psychiatrischen Anstalt, das hatte sie sich unter anderem vorgenommen zu recherchieren. Und nun war sie, die kritische Autorin, keine Stunde hier und hatte es nötig gehabt, dass der Oberpfleger sie vor einer Grenzüberschreitung rettete.
»Die Bildschirme darunter zeigen das Zimmer der beiden Patientinnen.« Peter Rosner verschränkte die Arme. »Die junge Dame ist unser gefährliches Engelchen. Schwere Persönlichkeitsstörung. Ist aktuell in einer depressiven Phase.«
»Gefährliches Engelchen?«
»Claudia Hofer. Unberechenbar. Es kommt vor, dass sie von einer Sekunde auf die nächste von liebenswürdig zu brutal wechselt.« Der Oberpfleger drehte das Gesicht zur Seite, tippte mit dem Finger auf seine Wange. Oberhalb des Backenknochens verlief eine fleischfarbene Narbe. »Kleines Andenken von ihrem letzten Aufenthalt.«
»Unglaublich! Das würde man ihr nie zutrauen, wie sie so daliegt. So hübsch und friedlich.«
»Sie hat Antipsychotika bekommen, war notwendig nach ihrem Anfall von gestern Nacht.«
»Aber hier.« Peter Rosner lächelte. »Das hier ist unser Liebling, Cecilie Weisz, über achtzig Jahre alt, doch geistig beweglich wie eine frischgebackene Nobelpreisträgerin. Ist sicher die berühmteste manisch-depressive Patientin Wiens.« Er blickte zur Schriftstellerin. »Cecilie war sogar schon einmal in der Zeitung. Es gibt ein Bild mit ihr und Primar Lobell, sie hat darauf ihren Kopf gegen seine Schulter gelegt wie ein verliebtes Mäderl. Diesmal ist sie bei uns, weil sie etwas von ihrer Wohnung aus dem Fenster geschossen hat, vom vierten Stock runter.«
»Deshalb wird man auf die Baumgartner Höhe gebracht?« Aliza Berg zog die Augenbrauen zusammen. »Weil man etwas aus dem Fenster schmeißt?«