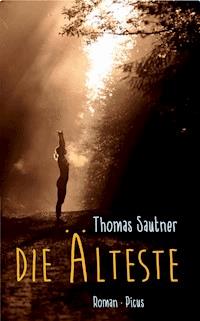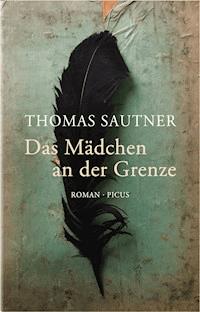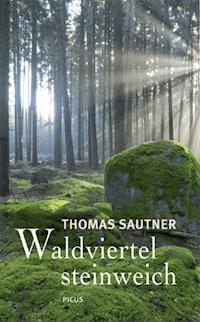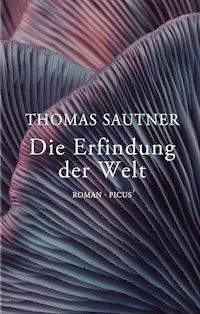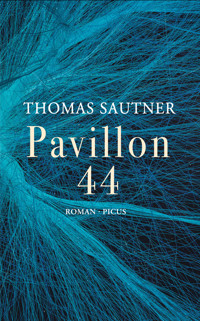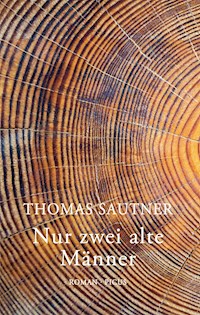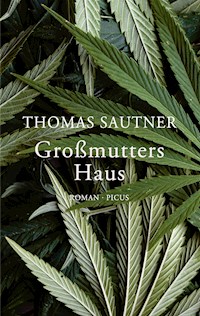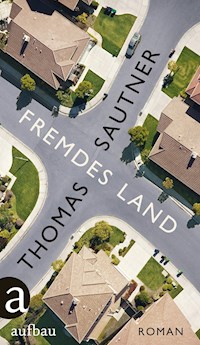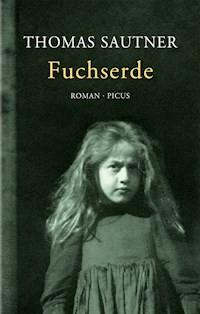
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon seit ihrer Kindheit ist Frida der charismatische Mittelpunkt einer grossen Familie. Angstlos nach dem frühen Tod ihrer Mutter, sorgt sie mit ihrer ungezähmten Art für Kopfschütteln bei den Bewohnern des kleinen Dorfes, in dem sie lebt. Kein Mann ist ihr recht, und kein Mann kann ihr widerstehen. Frida ist eine Jenische – Angehörige eines beinahe in Vergessenheit geratenen fahrenden Volkes. Über Generationen hinweg haben ihre Vorfahren schon im "Biberling", den kalten Monaten, ihre einfachen Hütten bewohnt, um dann im "Hitzling", in dem die Sonne zunehmend an Kraft gewinnt, wieder mit ihren Pferdewagen loszuziehen. Es ist ein rau-romantisches Leben, das Frida und die Ihren führen, mit dem Sternenhimmel als Dach, geheimnisvollen Geschichten am Feuerplatz und einer Sprache, die den Sesshaften Rätsel aufgibt. Ihren Lebensunterhalt verdienen die Fahrenden noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts als Scherenschleifer, Besenbinder, Pfannenflicker, als Wahrsagerinnen oder als Kräuterfrauen. Sie fühlen sich frei wie der Wind. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten aber setzt eine dramatische Zäsur im Leben der Familie, die versucht, der Vernichtung zu entrinnen: mit Hilfe uralten Wissens, schier waghalsigem Humor und unbändiger Kraft. Thomas Sautner erzählt die Geschichte zweier Familien, deren Schicksale durch die Liebe ihrer Kinder miteinander verknüpft werden und deren Alltag vom tiefen Verstehen der Natur geprägt ist, von wunderbaren Weisheiten und vom Leben mit den Jahreszeiten. Das nördliche Waldviertel, mystisch-schön mit seinen ausgedehnten Wäldern, dunklen Teichen, tiefen Mooren und den Jahrmillionen alten markanten Restlingen aus Granit ist dabei mehr als bloß der Schauplatz eines grossen Familienromans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Copyright © 2006 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien6. Auflage 2021
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
Umschlagabbildung: © Getty Images/Hulton Collection
ISBN 978-3-7117-2115-0
eISBN 978-3-7117-5460-8
Informationen über das aktuelle Programm
des Picus Verlags und Veranstaltungen unter
www.picus.at
Thomas Sautner wurde 1970 in Gmünd geboren, heute lebt er im nördlichen Waldviertel sowie in Wien. Neben zahlreichen Essays und Erzählungen erschienen im Picus Verlag auch seine Romane »Milchblume«, »Die Älteste«, »Das Mädchen an der Grenze«, »Großmutters Haus« und 2021 »Die Erfindung der Welt«.
www.thomas-sautner.at
THOMAS SAUTNER
Fuchserde
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
Für Martin
Eine ferne, verlorene Welt ist niemalsverloren und fern, wenn jemand sienoch im Herzen trägt.
ALBERTO CAVALLARI
Inhalt
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
Kapitel 16.
Glossar
Dank
1.
Als Franz Jandrasits bereits bis zum Hals im Moor versunken war, kroch der Frühnebel aus dem Wald. Feucht und behutsam wälzte sich der üppige Dunst über die taunasse Wiese, schluckte das Schilfgras am Übergang zum Moor und verschlang schließlich sehr sorgfältig die gesamte Lichtung. Und das Moor verschlang Franz Jandrasits.
Seine Kräfte hatten ihn vor Sonnenaufgang verlassen, waren mit jeder verzweifelten Ruderbewegung aus seinem aufgeweichten Körper entschwunden. Seine Schreie, anfangs hysterisch und kreischend, wurden von Stunde zu Stunde leiser, seine Stimme kippte immer öfter. Am Schluss krächzte er nur noch, jammerte leise vor sich hin und weinte. Er weinte nicht seinetwegen. Er dachte an seine beiden Kinder und an seine junge Frau, die am anderen Ende des Waldes auf ihn wartete, die verzweifelt sein musste und es nun vielleicht ein Leben lang bleiben würde, seinetwegen. Warum war er nur so töricht und unersättlich gewesen, wieso nur hatte er sich nicht zufriedengegeben mit dem Flecken Land, den der Graf zur Urbarmachung für ihn und seinesgleichen vorgesehen hatte.
Die anderen Strafgefangenen hatten nichts vom Verschwinden Franz Jandrasits’ bemerkt. Und hätte seine Frau die müden Männer nicht an den Haaren gerissen, gekratzt und gebissen, um sie dazu zu bewegen, ihr bei der Suche zu helfen, hätten die Hände des Franz Jandrasits wohl noch lange unbemerkt aus dem Moor geragt. Der starke Regen hatte sie rein gewaschen vom Moorschlamm, hatte auch den letzten Schmutz aus den tief zerfurchten Pranken gespült, und so sahen die gen Himmel gestreckten Handflächen von der Ferne aus wie zwei weiße Porzellanteller, die jemand an der feuchten Oberfläche des Moores abgestellt hatte.
Die blütenweißen Handflächen inmitten des sumpfigen Morasts waren es auch, die die Männer glauben ließen, Franz Jandrasits sei nicht qualvoll und stundenlang um sein Leben kämpfend im Moor versunken, sondern mit einem einzigen gewaltigen Ruck vom Moorgeist nach unten gezogen worden. Bestätigung fanden die Männer, als die Hände des Franz Jandrasits nicht etwa langsam dem übrigen Körper ins Moor folgten, sondern plötzlich und begleitet von einem dumpfen Gurgeln, sowie dem Aufsteigen einer an der Oberfläche zerberstenden Blase, vom Moor eingesaugt wurden. »Jetzt hat er ihn ganz geschluckt!«, war die Reaktion der Umstehenden, deren Erschrecken rasch dem beruhigenden Gefühl wich, dass die Tragödie einen durchaus konsequenten Abschluss gefunden hatte: Der Moorgeist hatte sein Opfer restlos verspeist.
»Holt ihn raus! Holt mir meinen Mann!«, schrie Jandrasits’ Frau die Männer an, die mit offenen Mündern dastanden. Doch der Graf ließ keine unnützen Gedanken und ebenso zeitraubende wie riskante Eskapaden mehr zu: »Zurück!«, befahl er kurz, zerrte an den Zügeln und trabte voran, in die Richtung des Siedlungsgebiets.
Franz Jandrasits’ Frau kniete noch stundenlang im Gras und starrte auf die Stelle, an der ein Teil von ihr im Morast versunken war. Rund um sie trockneten Sonnenstrahlen die regennassen Halme. Die Vögel begannen lautstark ihr Tagwerk und ihre beiden Kleinen, die nun nur noch die ihren waren, spielten vergnügt im Gras.
1799 vergab Graf Vinzenz von Straßoldo, Eigner der Herrschaft Schwarzenau im nördlichen Waldviertel, in einem besonders entlegenen und unwegsamen Flecken seiner Besitzungen stückweise Land an eine Hundertschaft von Menschen. Viele davon wurden im Volksmund als Gesindel und Zigeuner beschimpft. Es waren Männer und Frauen, die wegen Delikten wie Mundraub, Raufereien, Anpöbelungen der Obrigkeit, kleineren Diebstählen und anderen Übertretungen in Ungnade gefallen waren. Unter ihnen waren Sinti und Jenische, Angehörige des fahrenden Volkes. Diesen Menschen bot Graf Vinzenz von Straßoldo folgenden Tauschhandel an: Wenn sie innerhalb von drei Jahren die raue Gegend, vorwiegend Wald- und Moorland, urbar machten, also rodeten und trockenlegten, sowie darauf Häuser erbauten, würde er ihnen die Freiheit schenken.
Die fortan Kleinhäusler genannten Siedler nahmen das Angebot an und bearbeiteten das ihnen zugeteilte Land. Gut drei Jahre später, 1803, bestand der Ort tatsächlich und wurde der fünf Kilometer entfernt liegenden Pfarre Langegg zugeteilt. Und weil der Graf nicht nur hoch- und wohlgeboren war, sondern auch Obrist-Hofmeister der Erzherzogin von Österreich, der durchlauchtigsten Frau Amalie, bekam der arme und teils vom Pöbel gegründete Ort einen wahrhaft funkelnden und fürstlichen Namen: Amaliendorf.
Leg noch zwei Scheit Holz in den Ofen, kleiner Fuchs. Weißt du, wenn jemand ein Lebtag lang gefroren hat, genießt er die Wärme umso mehr. Und dann setz dich zu mir. Ich weiß doch, dass du gekommen bist, um noch mehr zu hören. Ja, so ist es gut. Es wärmt schon, allein das Knacken des Holzes im Ofen zu hören. Früher wurde ja noch mit Torf geheizt. Aber das ist lange her. Das war, als deine Vorfahren hier herauf ins Waldviertel gekommen sind. Die älteste Geschichte über deine fahrenden Ahnen stammt aus jener Zeit, mein kleiner Fuchs. Wie könnte es bei uns anders sein, handelt die Geschichte von einer Reise. Allerdings einer ganz besonderen Reise.
Es begann schon damit, dass es nicht deine Verwandten waren, die sich für die Fahrt entschieden hatten. Es war auch nicht ihr armseliger, klappriger Karren, mit dem sie fuhren. Diesmal reisten sie mit einem mächtigen Wagen; einem Wagen, der keinen Geringeren gehörte als den Habsburger Regenten und der von einem Kutscher gelenkt wurde, in dem blaues Blut floss. Der Name des Kutschers war Graf von Straßoldo. Die strengen Maßstäbe, die der Graf in puncto Anstand und Ordnung anlegte, und zwar an sich zumindest ebenso wie an die gesamte Welt, für deren moralische Entwicklung er sich verantwortlich fühlte, diese Maßstäbe hatten ihm ein lästiges Leiden eingebracht. Es entlud sich des Öfteren durch Nervenzucken in seinem Gesicht, was der Graf mit Haltung über sich ergehen ließ.
Das Entscheidende aber, das diese Fahrt so außergewöhnlich machte, habe ich dir noch nicht erzählt, mein kleiner Fuchs. Das Entscheidende war: Diese Reise sollte die letzte deiner fahrenden Ahnen sein. Die letzte Reise von Menschen, deren ureigenste Lebensform seit Generationen immer nur das Reisen gewesen war. Es sollte die allerletzte Fahrt dieser Jenischen sein. So wollte es der Graf. So wollte es die große österreichisch-ungarische Monarchie. Aber du weißt ja, mein kleiner, schlauer Fuchs: Fahrende kann man nicht aufhalten, nicht auf Dauer. Ebenso wenig wie man Wasser aufhalten kann. Es findet seinen Weg.
Graf Straßoldo plante ein politisches Meisterstück. Er wollte zwei Ärgernisse mit einer einzigen Maßnahme loswerden: Zum einen suchte die Monarchie nach einer Lösung für das »Zigeunerunwesen«. Wobei das Unwesen zumeist darin bestand, dass unsere reisenden Ahnen den eingesessenen Zünften allzu große Konkurrenz machten und sich die Bauern beschwerten, weil ihre dummen Henderln wie verhext hinter den Karren deiner Vorväter nachrannten und schließlich in deren Kochtöpfe stolperten. Die Obrigkeit und die fantasielosen, sesshaften Bürger nannten das dann Diebstahl. Neben diesem Zigeunerunwesen jedenfalls hatte der Graf das Problem, Land zu besitzen, das wegen seiner Wildheit und Unzugänglichkeit keinen Gewinn abwarf. Also kombinierte der Graf: Er hatte unbrauchbares Land und unbrauchbares Volk. Was lag da näher, als unbrauchbares Land durch unbrauchbares Volk brauchbar zu machen. Und umgekehrt.
Um seinen Willen durchzusetzen, wählte der Graf eine seiner billigsten Waffen: Als sich eine Gelegenheit bot, deinen Vorfahren straffälliges Verhalten vorzuwerfen, ließ er die Richter noch strenger vorgehen als sonst. So setzte es diesmal nicht wie gewohnt eine Geldstrafe oder die üblichen Wochen hinter Gittern. Diesmal war es Kerker. Einzelhaft. Ein ganzes Jahr lang Trennung von der Familie. So erreichte der Graf, was er erreichen wollte: Er hatte deinen Vorfahren die Angst tief bis in die letzten Winkel ihrer Seelen gejagt. Diese Angst durchdrang sie so unerbittlich, dass sie deine Ahnen schließlich eintauschten. Und zwar gegen einen Zustand, den der Graf, weil er es nicht besser wusste, Freiheit nannte. Innerhalb von drei Jahren mussten deine Vorfahren Wälder roden, steinige Wiesen urbar machen, Sümpfe trockenlegen und danach – und das war das Schlimmste für sie – danach mussten sie Häuser errichten und sesshaft werden. Für immer. Kein Herumtreiberleben mehr, vorbei mit den Reisen und dem sittenlosen Dasein, wie der Graf es nannte. Diesmal kamen deine Verwandten nicht mit Haft davon, diesmal war es Sesshaft.
Zwei, drei und vier Joch großer, karger Grund wurde ihnen geboten – einzutauschen gegen endlose Freiheit und den Besitz von allem, was Gott je für sie hat wachsen und gedeihen lassen auf Erden. Das Einzige, mein kleiner Fuchs, was deinen Vorfahren erhalten bleiben sollte, war der Hunger. Er sollte mit einziehen in das kleine Häuschen, das sie zu bauen hatten. Der Hunger, da waren sie sicher, würde bei ihnen bleiben, als steter Begleiter. Denn der steinige Boden, das war bald gewiss, würde zu wenig abgeben, würde geizig sein beim Verteilen seiner Früchte. Zudem waren hier heroben, im nördlichsten Zipfel des Waldviertels, die Sommer allzu kurz, die Winter hingegen hart und lang.
Das war auch der Grund, warum sich dein Urahn eines Abends nach der Arbeit davonmachte und nicht wie die anderen Männer zu seiner Familie zurückkehrte, in die notdürftig errichtete Holzbaracke, wo alle Frauen und Kinder warteten, gleichsam lebendes Pfand des Grafen für die Rückkehr der Männer. Dein Vorfahre glitt unbemerkt vom schmalen Pfad ab, den er und die anderen Männer in den letzten Monaten geschlagen hatten, tauchte ein in den nach Sommer duftenden Jungwald und wollte nach einem Flecken Erde Ausschau halten, der satter war und üppiger als die vom Grafen zugeteilten Parzellen.
Nach Stunden des Herumirrens im Wald beschloss er umzukehren. Er konnte sich nur noch am Schein des Mondes orientieren, zudem schmerzte sein Magen – teils weil er beinahe leer war, teils wegen der Beeren und Schwammerln, die er im Heißhunger blindlings verschlungen hatte, und die nun in seiner Magengrube ihre Gaukeleien trieben. Die wilden Früchte des Waldes waren es wohl auch, die den Geist deines Urahns verrückt hatten. Was irrst du hier herum?, fragte er sich und gab sich im Stillen die verzweifelte Antwort: Ich will doch nur einen Flecken finden, der windgeschützt ist und dessen Erde sich bereitwillig auftut, um zu nehmen, und die sich auch wieder bereitwillig auftut, um zu geben. Kaum hatte er diese Hoffnung zu Ende gedacht, eröffnete sich vor ihm eine Lichtung. Der Wald zeichnete ihre traumhaften Umrisse und der Mond warf sanftes Licht auf üppiges Geflecht, auf Kräuter und auf eine Wiese mit sattem, frischen Gras. Dein Urahn jauchzte vor Freude und rannte los. Er schrie »Danke! Danke!« und warf die Hände zum Himmel. Nach wenigen Metern versank er im Moor.
Als er aufgehört hatte zu schreien und das Moor begann, ihm die Luft zu rauben, vernahm er eine tiefe, ruhige Stimme: »Du hast mich gesucht und nun hast du mich gefunden«, sagte der Moorgeist zu ihm. »Du wolltest Erde, die nimmt, und Erde, die gibt. Nun nehme ich. Und ich verspreche dir, auch wieder zu geben. Ich werde deine Kinder und deine Frau wärmen und ihnen Nahrung sein.« Nach diesen Worten nahm der Moorgeist deinem Vorfahren die Angst und zog ihn zu sich.
Schon am Tag darauf stellte sich heraus, dass der Moorgeist Wort gehalten hatte. Denn unweit der Stelle, an der dein Vorfahre vom Moor verschluckt worden war, ließ der Graf fortan Torf stechen. Torf, mit dem die Öfen der Siedlung befeuert wurden und dessen Ertrag dank des gräflichen Zubrots ausreichte, Frau und Kinder deines Urahns zu ernähren.
Ich weiß, du kennst diese Geschichte schon, mein kleiner, schlauer Fuchs. Unzählige Male habe ich sie dir erzählt, so wie die vielen anderen Geschichten auch. Aber du weißt, warum ich all das nun noch einmal wiederhole, nicht wahr? Du weißt, warum ich die alten und uralten Geschichten unserer Vorväter noch einmal hervorkrame aus meinem Schädel. Freilich weißt du es, mein kleiner, schlauer Fuchs: Es wird nicht mehr lange sein, dann werde ich diese Welt verlassen, um in eine andere zu gehen. Ich spüre schon, wie ich der Erde zuwachse. Tag für Tag ein Stückchen näher. Bald werde ich sie nähren, wie sie mich ein Leben lang genährt hat. Das ist der Lauf der Dinge.
Du bist der Letzte und Jüngste unserer Sippe. Nur dir erzähle ich all die Geschichten und Weisheiten. Nur dir vertraue ich all mein Wissen an, wie es Sitte ist bei uns, seit jeher: vom Ältesten zum Jüngsten. Es ist ein jahrhundertealtes Wissen, ein Wissen, das von unseren Ahnen und Urahnen gesammelt wurde, und das es zu hüten gilt wie einen sehr wertvollen Schatz. Und ich sehe an deinen Augen, dass dieser Schatz gut bei dir aufgehoben ist, mein kleiner, schlauer Fuchs.
2.
Lillis Wehen wurden immer stärker, doch das ließ sie die beiden Gendarmen nicht merken. Sie hatte die Beine unter ihrem langen, schweren Rock versteckt, hockte auf dem staubigen Boden, den Rücken ans Wagenrad gelehnt, und sah in zwei pausbäckige Gesichter, die von Fusel und Schweinefett aufgedunsen waren. Als der kleinere der beiden zu reden begann, schoben sich die Falten seines Doppelkinns übereinander wie die Lappen einer alten, speckigen Ziehharmonika. »Verschwindet sofort vom Gemeindegebiet, wenn ihr keine Wandererlaubnis und kein Hausierbuch habt«, keifte er, nahm den Holzknüppel von seinem Gürtel und ließ ihn ein paarmal lässig in die flache Hand klatschen. Lilli hatte keine Angst. Sie war zornig, und das war der Grund, warum sie erwog, die beiden zu verhexen. Sie hätte ihnen Kröpfe wachsen lassen können oder eitrige Furunkel. Beides womöglich. Freilich wusste sie, dass das Kraftverschwendung gewesen wäre, denn der Zauber würde keinesfalls rasch genug wirken, um die Gendarmen zu vertreiben. Weit schwerer aber noch wog, dass sie die Flüche viel, sehr viel Kraft kosten würden. Kraft, die ihr und ihrem Ungeborenen, das immer heftiger nach draußen ins Leben drängte, bei der nahen Geburt fehlen würde. Und dennoch war die Versuchung für Lilli groß, die beiden Fettwänste für ihre Gemeinheit noch mehr zu strafen als es Gott, für jedermann offensichtlich, ohnehin bereits getan hatte.
»Ist schon in Ordnung«, sagte da Lillis Mann, der ihren Holzkarren zur Nachtrast am Tag davor in alter Übung und mit Vorbedacht an einem Grenzstein angehalten hatte. »Komm Lilli«, sagte er in ruhigem, fröhlichem Ton, »steh auf, wir rücken ein bisschen herüber auf Zwettler Boden, zur anderen Gemeinde.«
Es hatte schon Nächte gegeben, in denen es bis zum Morgengrauen so ging: von einer Gemeinde in die andere, und wieder retour. Für die beiden Gendarmen war der einfache Trick neu. Die rasche Lösung der Angelegenheit irritierte sie. Also setzten sie sich einige Meter neben dem Karren der Jenischen ins Gras, und es dauerte eine Weile, bis sie schließlich begreifen mussten, dass ihnen nun von Gesetzes wegen keinerlei Handhabe mehr gegen die Fahrenden blieb. Für Lilli dauerte die Nachdenkpause der beiden zu lange. Ihr Kind wollte nicht länger warten. Und da die beiden Gendarmen keine Anstalten machten, sich auch nur ein paar Zentimeter von der Stelle zu bewegen, lief sie, ihren prallen Bauch mit den Händen haltend, auf den nahen Hügel und verschwand hinter ein paar Haselnusssträuchern. Keine halbe Pfeifenlänge verging, da tauchte sie wieder auf. Ihr Mann, ihre Kinder und die beiden Gendarmen sahen sie vom Hügel herunterkommen. Ihre nackten Füße schienen über die Wiese zu schweben. Ihre Sohlen streichelten vom Himmel her das Gras. Ihr offenes, rabenschwarzes Haar war eins mit dem Wind und ihre goldenen Ohrringe glänzten im Sonnenlicht. Sie hatte ihren knöchellangen, schmetterlingsbunten Rock nach oben gerafft, sodass man ihre schönen Beine bis weit über die Knie sehen konnte. Lillis Gesicht war Entspannung und ihr Lachen der Frühling. Im Rock trug sie ihren Sohn. Zu Ehren des Ururgroßvaters, der einst im Moor versunken war, als er für die Familie Land gesucht hatte, sollte er Franz heißen.
Fünf Wochen war es nun her, dass sie von Amaliendorf aufgebrochen waren. Während der ersten Frühlingstage hatten sie ihr Hab und Gut und all die Tandlerwaren, die in den letzten Monaten fabriziert worden waren, auf den Karren gepackt. Sie hatten ihrem guten, alten, zotteligen Hund das Geschirr umgelegt, damit er beim Ziehen helfen konnte, und waren Richtung Süden aufgebrochen. Den ganzen langen Winter über hatten die Frauen und Mädchen aus unansehnlichen Fetzen, aus Stoffund Wollresten bunte Kleider, hübsche Schürzen und Tischdecken, schöne Westen und Umhänge gezaubert, hatten gestrickt und gehäkelt. Hatten die unzähligen getrockneten Heilkräuter sortiert, die sie im Wald und im Moor gesammelt hatten, bevor der Schnee die Landschaft so fest einschloss, als wollte er sie nie wieder freigeben. Sie hatten die Kräuter im hölzernen Mörser zerstampft und sie anschließend fein säuberlich in kleine Stoffsäckchen verschnürt. Die Männer und die Buben wiederum hatten Holz mit Flacheisen und Feilen bearbeitet, auf dass handelbare Holzschuhe daraus würden, sie hatten unzählige Besen gebunden, mehrere Dutzend Körbe und Schwingen geflochten und kurzstielige Pfeifen geschnitzt.
Gemeinsam war die ganze jenische Sippschaft bei der Arbeit in der kleinen Stube zusammengehockt, dem einzigen Zimmer im Haus, das dank des behelfsmäßigen Ofens und des darin verheizten Torfs zumindest so warm gehalten werden konnte, dass man den eigenen Atem nicht mehr sah. Was aber noch behaglicher wärmte, waren die Geschichten und Märchen, die von der Ältesten erzählt wurden. Sie war die Einzige, die nicht Hand anlegte, und dennoch durfte sie am nächsten zum Ofen sitzen. Ihr Zutun war nämlich nicht minder wichtig für das Gelingen der Arbeiten, und das war allen bewusst. Um aber ganz sicherzugehen, erwähnte die Alte eine ihrer Weisheiten besonders häufig: »Alles Gute, was man tut, ist seines Lohnes wert«, beendete sie viele ihrer Geschichten und beobachtete mit Wohlgefallen das stumme Nicken der anderen.
Als Lilli und ihr Mann samt den Kindern und dem Ungeborenen aufgebrochen waren, war ihr Karren so hoch mit Hausrat und anderen Handelswaren beladen, dass zu fürchten stand, der klapprige Wagen könnte beim erstbesten Windstoß oder beim nächsten Schlagloch umkippen. Nahrung hingegen führten sie kaum bei sich. Für nur drei Tage wurde Proviant geladen. Mehr sollte schließlich und endlich auf der Reise erbettelt oder vorteilhaft gegen Ware eingetauscht werden.
Beim Abschied von den anderen, die in den nächsten Monaten die kargen Felder zu bewirtschaften haben würden, flossen Tränen. Ein Wiedersehen würde es erst in gut einem halben Jahr geben, dann, wenn die Tage fürs Herumziehen zu kurz und zu kalt würden, dann, wenn bald die Raunächte übers Land kämen, knapp vor dem nächsten Winter – also noch lange, lange nicht. Denn dieser Winter war gerade erst dabei, sich widerwillig zu verabschieden, mit den letzten Schneeresten, die an den Wegböschungen der schwachen Sonne trotzten.
Bevor der Wagen losrollte, umarmten einander alle und die Älteste steckte Lillis Mann beim Abschied einen alten, zusammengeschrumpelten Erdapfel in die Manteltasche. Worte verlor sie darüber keine.
Die Herkunft der Jenischen ist nicht restlos geklärt. Vermutet wird, dass sie, anders als andere Fahrende, etwa Roma und Sinti, europäischen, womöglich keltischen, Ursprungs sind. Zudem stießen im Laufe der Jahrhunderte Menschen zum Volk der Jenischen, die wegen Hunger, Armut, Krieg, Massenkrankheiten oder Realteilung zur Wanderschaft gezwungen waren. Im Mittelalter sah sich etwa ein Fünftel der Menschen genötigt umherzuziehen, im 17. und 18. Jahrhundert gar ein Viertel. Noch im 19. Jahrhundert waren es etwa zehn Prozent. Bei den Jenischen unter ihnen wurde aus der Not des Reisens eine Tugend sowie ureigenste Tradition und Lebensform. Ihr Brot verdienten sich die Jenischen als Handwerker, Kesselschmiede, Pfannenflicker, Korbflechter und Besenbinder, Bettler, Hausierer mit Waren aller Art, als Schausteller, Wahrsager, Kräuterfrauen, Kartenleger, Seiltänzer, Bärentreiber, Vogelhändler, Zirkusbetreiber, Drehorgelspieler und mit vielen anderen Tätigkeiten.
Heute gibt es in Europa Schätzungen zufolge zwischen zweihundertfünfzigtausend und eineinhalb Millionen Jenische. Eine Gruppe davon sind zum Beispiel die Tinkers in Irland, Schottland und England. Ihre Sprache (Shelta) ist die reinste Form des noch gesprochenen Keltischen. Jenische leben aber unter anderem auch in Frankreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und in Österreich.
Die Jenischen haben eine eigene Sprache, mit der sie sich über alle Landesgrenzen hinweg untereinander verständigen können. Bedeutung und Herkunft des Wortes »Jenisch« sind strittig. Die Wortwurzel könnte im Romanes liegen und die Sprache der Wissenden und Eingeweihten bezeichnen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Jenisch eine Mischung aus Keltisch, Romanes, Jiddisch sowie regional gefärbten Wortkreationen. Jenisch hat keine eigene Grammatik, allerdings einen großen Wortschatz. Die Fahrenden verwendeten und verwenden Jenisch als Geheim- und Berufssprache.
Die Götter verließen deine Ahnen keinen einzigen Tag. Während ihrer ganzen langen Reise nicht. Ab dem Tag, an dem die Familie von Amaliendorf aufgebrochen war, stand sie unter ihrer Obhut. Und weißt du warum, mein kleiner, schlauer Fuchs? Weil ihnen die Älteste der Sippe einen Glückserdapfel mitgegeben hatte, so wie es noch heute Brauch ist hier heroben, bei uns im Waldviertel. Den Erdapfel hatte sie im Sommer ausgegraben. Und ab diesem Moment, ab dem Augenblick, an dem dieser Erdapfel dem sonnengetrockneten Acker entnommen worden war und die groben Hände der Alten ihn zum ersten Mal befühlt hatten, bekam er die Aufgabe, der Familie beizustehen. Alleine mit diesem Gedanken fütterte die Alte den Erdapfel. Immer wenn sie ihn ansah, ihn zwischen ihren Händen rieb und mit ihrem knöchrigen Daumen aufs Neue grüne Triebe abstreifte, konzentrierte sie sich darauf, dass dieser Erdapfel dazu bestimmt war, Glück zu bringen. Vielleicht hundertmal wurde der Erdapfel auf diese Art von der Alten mit Liebe und Energie aufgeladen. Je älter und somit kleiner, runzeliger und härter er wurde, desto mehr Kraft wohnte in ihm.
Als er schließlich gut ein halbes Jahr später in die Rocktasche von Lillis Mann plumpste, war er kein gewöhnlicher alter Erdapfel. Er war Schutzschild und Glücksbringer zugleich: Er bewahrte seinen Besitzer und dessen Liebste vor dem schlimmsten Unglück und half dem Glück etwas nach, wenn es nötig war. Außerdem stand die Familie dank des Erdapfels stets unter dem Schutz der Ältesten. Wenn sie sich einmal alleine fühlten, nahmen sie den Erdapfel, reichten ihn in der Runde herum, ließen ihn zwischen ihren Fingern tanzen, befühlten ihn, rochen an ihm, nahmen ihn fest in ihre Faust: Lilli, ihr Mann und die Kinder. Und dann wussten sie, dass die Älteste und mit ihr die ganze Sippe bei ihnen war. Dann wussten sie, dass alles gut war und dass ihnen nichts geschehen konnte.
Ich finde es schön, dass du nicht lachst, wenn ich dir diese Geschichte erzähle, mein kleiner, schlauer Fuchs. Als ich sie dir das erste Mal erzählte, konntest du dein Kichern nicht zurückhalten. Doch inzwischen bist du älter geworden und ich weiß, dass auch du die Kraft des Glückserdapfels mittlerweile zu schätzen weißt.
Kannst du dich noch erinnern, wann der Erdapfel auf dieser Reise zum ersten Mal seine Wirkung tat? Zum ersten Mal schüttete er Glück aus, als ihn Lillis Mann kurz nach der Abreise in seiner Rocktasche entdeckte. Als er nach seiner Pfeife greifen wollte, rollte ihm der Erdapfel in die Hand. Kaum hatten seine Finger das runzelige Etwas ertastet, begriff er: Die Älteste hatte an ihn und seine Familie gedacht. Sie hatte einen Glückserdapfel reifen lassen, auf dass ihnen nichts geschehen konnte, auf dass sie wohl behütet seien. Lillis Mann durchrieselte das Glück. Er behielt die Hand in der Tasche, umfasste den Erdapfel, und mit einem Mal ließ sich der Wagen leichter ziehen, mit einem Mal war die Angst verflogen, die ihn die letzten Kilometer begleitet hatte, und der Zweifel, ob diese Wanderschaft nicht zu beschwerlich sein würde für seine schwangere Frau und die kleinen Mädchen. Nein, nun war alles gut. Mit einem Mal war er voller Zuversicht. Als er sicher war, dass seine Augen nicht mehr allzu sehr glänzten, hielt er an, drehte sich zu Lilli um, die mit den Kleinen auf dem Karren saß, lachte sie an und sagte: »Ich liebe dich.« Ab diesem Moment hatte auch Lilli keine Angst mehr.
Ja, mein kleiner Fuchs. Das war das erste Mal, dass der Erdapfel seine Wirkung getan hatte.
Wenige Wochen später, es war im Morgengrauen, da setzten Lillis Wehen ein. Und bald darauf, als die Sonne eine Handbreit über den Wipfeln stand, fiel ein gesunder, kräftiger Bub aus Lillis Schoß. »Wurde auch Zeit«, sagte ihr Mann und lachte, als ihm Lilli nach drei Mädchen den ersten Buben entgegenstreckte.
So leicht die Geburt dank der wochenlang zuvor eingenommenen Kräutermixturen und der aufgetragenen Heilsalben verlief, so mühsam zäh verrann die Zeit knapp davor. Denn deine Vorfahren waren von zwei Gendarmen aufgehalten worden, die Streit anfangen wollten. Deine Ahnen wussten nach nur wenigen Augenblicken, dass es sich um armselige und mit sich selbst unzufriedene Menschen handelte. Sie verrieten sich, wie sich alle unglücklichen Kreaturen verraten: durch Hass, Wichtigtuerei und Neid. Gottlob hatte sich Lillis Mann schon viel Lehrreiches von der Ältesten abgeschaut und darum wusste er, wie zu handeln war. Es ist sinnlos, solche Menschen bekehren zu wollen, denn das provoziert sie nur und ist der Mühe nicht wert. Unnütz ist es auch, mit der Faust zu antworten, das verlängert nur den Ärger. Also ging Lillis Mann den Weg des Raben. Du weißt doch: Der Rabe ist unscheinbar, er trägt kein buntes Kleid. Und doch steckt er voller Intelligenz und eleganter List. Lillis Mann machte nicht viel Aufsehen. Er ging sowohl mit seinen Nerven als auch mit seinen Muskeln sparsam um. Er tat nicht mehr und nicht weniger, als nötig war: Er zog seinen Karren ein paar Meter über die Gemeindegrenze – und damit aus dem geistigen Horizont der plötzlich nicht mehr zuständigen Gendarmen.
Auch Lilli hatte viel von der Ältesten mitgegeben bekommen. Eine Gabe, die besonders hervorstach, hatte sie allerdings bereits in die Wiege gelegt bekommen: das Hexen. Hexen ist, wie du weißt, mein kleiner, schlauer Fuchs, ein durchaus brauchbares Geschenk der Götter. Mit Hexerei wurden schon viele brave Menschen von Unheil befreit, und etliche böse Menschen wurden in ihrem zerstörenden Treiben gebremst. Allerdings ist die Hexerei eine Kunst, die nicht nur Können verlangt, sondern, und das ist zumindest ebenso wichtig, große Weisheit. Mit der war deine Ahnin aber leider nicht gesegnet. Lilli war ungestüm und allzu jähzornig. Und so schleuderte sie ihre Verwünschungen ebenso wahl- und ziellos durch die Gegend, wie Zeus seine Blitze an einem schwülen Sommerabend. Weil sie dafür von ihrem Mann oft gescholten wurde, verschwieg ihm Lilli bald ihre Hexereien, die ihr, sobald sie ihr entfahren waren, oft selbst nicht ganz koscher waren. Und so kam es, dass sich auf ihrer Reise erst auf dem Rückweg zeigte, wo Lilli Monate zuvor Ärger bereitet worden war: Es wimmelte nur so von ehemals gemeinen Gendarmen, geizigen Bauern, rabiaten Bürgern und lüsternen Burschen, die ihnen, nun sehr stumm und das Gesicht rasch abwendend, mit Eiterbeulen, Furunkeln und Geschwüren wieder begegneten.
Als sich diese Wiedersehen einige Male zugetragen hatten, fragte Lillis Mann nicht mehr nach den Gründen für die Verwünschungen. Er rügte seine Frau auch nicht mehr. Er drehte sich nur kurz nach Lilli um, die gerade wie zufällig wegsah, schüttelte den Kopf und steuerte auf den jeweils armseligen Tropf zu. Lilli wusste dann, was sie zu tun hatte, um ihren Mann zu besänftigen. Sie sprang vom Karren und gab heilende Salbe, lindernde Kräuter und schmerzstillendes Wurzelpulver. Wie viel Geld sie den Gadsche* dafür abknöpfte, erzählte sie ihrem Mann nicht. Sie tat die Einnahmen einfach in die gemeinsame Schatulle. So falle ihr Geschäft mit den zuerst aus Zorn verhexten und dann aus Liebe – Liebe freilich nur zu ihrem Mann – geheilten Opfern nicht auf, dachte sie.
Zu verheimlichen versuchte sie ihrem Mann auch, wie sehr die vielen Verwünschungen sie auszehrten, wie viel Seelenkraft sie sie kosteten – auch die rettenden Gegenzauber, die neben den Tinkturen und Mixturen für eine Heilung unabdingbar waren.
Dass Lilli zu spät die nötige Ruhe und Weisheit fand und zu lange verschwenderisch mit ihrer Gabe und ihrem Ärger umgegangen war, zeigte sich, als sie schon nach vierzig Wintern schwer krank wurde und ihren Körper mit jenen Furunkeln, Beulen und Geschwüren übersät fand, die sie einst anderen an den Hals und wer weiß wo sonst noch hingewünscht hatte. Als ihre teils erwachsenen Kinder sie knapp vor ihrem Tod fragten, wie dieses Unheil nur über sie kommen konnte, da sie doch besser als alle anderen mit Hexerei, Heilkräutern und Kobolden umzugehen wisse, hieß Lilli ihre Kinder eine einfache Übung sehr, sehr sorgfältig zu machen. »Lasst eine Eisenkugel auf eine Marmorplatte fallen«, sagte sie und lächelte bitter.
Hast du das schon einmal gemacht, mein kleiner, schlauer Fuchs? Hast du schon einmal eine Eisenkugel auf eine Marmorplatte fallen lassen? Es ist eine sehr lehrreiche Lektion über Aktion und Reaktion. Denn merke dir, mein kleiner Fuchs: Alles, was du im Leben tust, hat Konsequenzen. Für dich und für deine Umwelt. Mag es dir noch so klein und nichtig erscheinen – mit allem, was du tust, bist du Quell für Neues. Und das Schöne ist: Du bekommst jeden Tag, ja sogar jede Minute, das Geschenk, dich für Gut statt Böse, für Liebe statt Hass zu entscheiden.
Unsere Urahnin Lilli hat sich nach ihrem Tod ganz dem Guten zugewandt. Als Mulo* konnte sie zwar noch eine Generation lang das Hexen auf Erden nicht lassen, und sie mischte sich immer wieder in den Lauf der diesseitigen Dinge ein. Doch stets tat sie es in großer Weisheit und Liebe. Und nie wieder zu irgendjemandes Schaden.
* Mit einem Stern gekennzeichnete Begriffe werden im Glossar erläutert
3.
Luca Resulatti wollte nicht das Leben führen, das für ihn bestimmt war. Er wollte auch nicht auf den Tod warten, der für ihn vorgesehen war. Er wollte nicht enden wie sein Großvater. Der war als Korberkind geboren worden, hatte sein Leben lang nichts anderes getan als Körbe zu flechten, und er war auch als Korber gestorben – und wie ein Korber: im Schneegestöber einer zu kalten Novembernacht. Dabei war Luca Resulattis Großvater keinesfalls ein trauriger Mensch gewesen. Und wenn ihn hin und wieder doch die Traurigkeit überkam, dann lenkte er sich ab, indem er seinem Enkelkind, das ihm zugefallen war, wundervolle Luftschlösser baute. So war etwa der Bretterverschlag, in dem sie hausten, nur deshalb so löchrig, damit, wie der Großvater dem Kleinen glaubhaft erklärte, ja damit das goldene Glück durchs Dach auch reichlich auf sie niederrieseln könne.
Je älter Luca wurde, umso mehr liebte er seinen Großvater. Und umso mehr schmerzten die warmen Weisheiten des altersschwachen Mannes, die, wie Luca wusste, nur noch ihm galten. Es waren Geschenke zum Abschied. Und die wiegen besonders schwer. Luca schmerzte es auch mitanzusehen, wie höchste Weisheiten mit niedrigsten Lebensumständen einhergehen. Es schmerzte, dass Tugendhaftigkeit und Fleiß nicht satt machten. Das war schlimmer als der Hunger selbst.
Als die Arthritis die Finger des Großvaters immer mehr anschwellen ließ und das Flechten der Körbe schließlich zur unerträglichen Tortur wurde, beschloss der Alte Mundharmonika spielen zu lernen. Dazu seien keine flinken Finger nötig und das Musizieren würde sicher auch nicht weniger Geld einbringen als das Körbeflechten. Dass er keine Mundharmonika besaß und darüber hinaus noch nie einen Ton auf nur irgendeinem Instrument gespielt hatte, schien Lucas Großvater nicht zu verunsichern. »Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg«, sagte er feierlich. »Und was ein Jenischer nicht kann, das kann er lernen.« Zur Bekräftigung für den Kleinen – und sich selbst – legte er zärtlich seine schwere Hand auf die Schulter des Enkelkinds. Dann lächelte er Luca an und sagte: »Weißt du, wir Zigeuner finden immer einen Weg. Wir sind wie das Wasser.«
Drei Wochen später verfolgte der Großvater einen seiner Träume. Er verfolgte ihn ganz intensiv, und weil es ein so schöner Traum war, wollte er ihn diesmal, dieses eine Mal, nicht wieder loslassen. Und so entschied sich Lucas Großvater, bis in alle Ewigkeit weiter zu schlafen.
Am Abend zuvor hatte er auf einer verrosteten Mundharmonika zum ersten Mal fehlerfrei eine einfache Melodie gespielt.
Luca Resulatti hatte sich schon Monate vor dem Tod seines Großvaters entschieden. Er wusste, was er tun würde, an dem Tag, an dem er zum ersten Mal in seinem Leben niemanden, wirklich niemanden mehr haben würde. Sobald es so weit wäre, würde er aufbrechen. Er würde sich auf die Suche machen nach dem anderen Teil seiner Sippschaft. Auf die Suche nach seinem Onkel, dem Herrn über Elefanten, Bären und Löwen. Nach seinem Onkel, von dem sein Großvater immer erzählt hatte, er sei einer der größten Zirkusdirektoren, die Italien je erlebt habe. Jener Onkel, den er selbst nie zu Gesicht bekommen hatte und von dem es hieß, dass er sich in der Umgebung nicht blicken lassen könne, wegen Geschichten, die lange her wären und von denen man besser nichts wissen sollte. »Zu deinem eigenen Vorteil«, wie Lucas Großvater stets betonte und jedem darauf folgenden Drängen seines Enkels widerstand, was Seltenheitswert hatte.
Der Tag, den Lucas Großvater durch seinen Tod zum Abreisetag für seinen Enkel machte, schien der denkbar ungünstigste für den Beginn einer langen Wanderung. Der Schnee lag kniehoch, was seit Jahren nicht mehr der Fall gewesen war, und eisiger Wind peitschte übers Land. Wie schon sein Großvater konnte Luca alles, was er besaß, auf seinem Rücken tragen. Um seine Füße hatte er mit Bast Gamaschen aus Lederresten gebunden, um seinen Körper – zusätzlich zur Kleidung – Zweige. Dazwischen hatte er Moos gestopft. Dennoch klapperten seine Zähne, als er nach stundenlanger Wanderung zum ersten Mal bei einem Bauern anklopfte, und sein Körper zitterte vor Kälte. Als niemand öffnete, klopfte er nochmals, diesmal fester. Seine Knöchel spürte er nicht mehr. Dann trommelte er mit der Faust an die schwere Holztür. Als sie sich endlich öffnete, grinste Luca Resulatti breit und bemühte sich, fröhlich zu erscheinen. Kurz überlegte er, ob man ihm ansah, dass er seine Mimik nicht mehr unter Kontrolle hatte, weil er vor Kälte nicht nur in seinen Händen und Füßen, sondern auch in seinem Gesicht kein Gefühl mehr hatte. Er grinste und sprang fidel hin und her, weil er von seinem Großvater gelernt hatte, dass die Menschen mit Leid nichts zu tun haben wollen, dass sie an Problemen vorbeisehen, und dass sie die Not anderer nur interessiert, wenn sie ihr Mitleid von der sicheren Ferne aus zeigen können; freilich nicht durch Taten, sondern nur sich selbst und anderen Gaffern, durch Händeringen, Seufzen, womöglich die eine oder andere Träne. Sehr wohl aber mögen Menschen