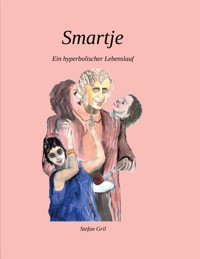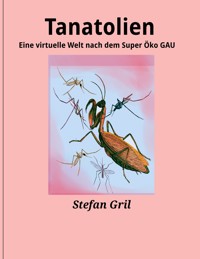Die Erlebnisse eines wahnsinnigen Pilgers bei seinen Wanderungen durch die reale Welt E-Book
Stefan Gril
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Erlebnisse eines wahnsinnigen Pilgers bei seinen Wanderungen durch die reale Welt Vincent Selten ist kein gewöhnlicher Mensch. Schon als Kind hat er Visionen über ungewöhnliche oder zukünftige Ereignisse. Als Fünfjähriger versteht er die Sprache eines Hundes. Er sieht Krieg und Tod, weiß auch, dass sein Vater unversehrt aus dem Krieg heimkehren wir. Er sieht voraus, dass das Verhältnis zum Vater sich zu unerträglicher Spannung entwickeln wird. Als Sechzehnjähriger erlebt er seine erste große Liebe und weiß, dass seine Wünsche sich nicht erfüllen werden. Den Menschen seiner Umgebung gilt er als genial, arrogant, psychopathisch, wahnsinnig. Die Anspannung, in der er lebt, entlädt sich in einer Psychose. Danach scheint der Weg für ihn frei zu sein in ein fast normales Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das BuchVincent Selten ist kein gewöhnlicher Mensch. Schon als Kind hat er Visionen über ungewöhnliche oder zukünftige Ereignisse. Als Fünfjähriger versteht er die Sprache eines Hundes. Er sieht Krieg und Tod, weiß auch, dass sein Vater unversehrt aus dem Krieg heimkehren wird. Er sieht voraus, dass das Verhältnis zum Vater sich zu unerträglicher Spannung entwickeln wird. Als Sechzehnjähriger erlebt er seine erste große Liebe und weiß, dass seine Wünsche sich nicht erfüllen werden. Den Menschen seiner Umgebung gilt er als genial, arrogant, psychopathisch, wahnsinnig. Die Anspannung, in der er lebt, entlädt sich in einer Psychose. Danach scheint der Weg für ihn frei zu sein in ein fast normales Leben.
Über den Autor: Stefan Gril, bürgerlich Dr. Ernst Flaig, ist Naturwissenschaftler im Ruhestand und freiberuflicher Maler und Autor surrealistischer und gesellschaftskritischer Erzählungen. Als Autor tritt er mit diesem Buch zum ersten Mal an die Öffentlichkeit.
Inhaltsverzeichnis
Die Erlebnisse eines wahnsinnigen Pilgers bei seinen Wanderungen durch die reale Welt
Im regnerischen Juni kam ich in die Welt, die man die Realität nennt
Mein erster Freund ist ein sprechender Hund
Leben in der Schule, Schule des Lebens
Krieg und Tod
Schein und Sein
Nach Westen
Reise ins Ungewisse
Wiedervereinigung in Potzdam
Das Recht der Sieger
Heißer Sommer in Babelsberg
Oktober im Garten
Magdeburg
Ellrich – Walkenried
Endstation Moor
Seehaus – Meinertshagen
Gesellschaftsspiele
Altertümlicher Neubau
Der Möbelhändler Walter Scheffler
Der Steißtrommler
Es lebe der Sport
Ratinger
Gundula Herzensgöttin
Penne, Wissenschaft und Fledermaus
Die Fledermaus
Noctula
Epilog
Gespräch über die Vergangenheit.
Abu Telfan
Quo vadis?
Die Erlebnisse eines wahnsinnigen Pilgers bei seinen Wanderungen durch die reale Welt
Im regnerischen Juni kam ich in die Welt, die man die Realität nennt.
Als ich den Leib meiner Mutter verließ, trommelten die Regentropfen wie Gewehrsalven an die Fenster und als ein Blitz mit krachendem Donner in den Dachstuhl fuhr, erschrak die Hebamme und ließ mit eine Schrei das neugeborene Bündel Leben zu Boden fallen. Ich schlug mit dem Kopf auf einen filzigen leicht übel riechenden Teppichboden auf und verlor für einen Augenblick das vor Sekunden gerade erst erwachte Bewusstsein. Man legte mich in ein warmes Wommenbad, in dem ich das Bewusstsein wiedererlangte. Aber dieses Bewusstsein war ein anderes, als zuvor. Hatte ich vorher einen verschwommenen Blick auf eine unbekannte Realität gehabt, so erblickte ich nun mit voller Schärfe eine Welt von Dingen, die mir fremdartig und vertraut zugleich erschienen. War ich womöglich in zwei Welten gleichzeitig geboren worden – oder war mein Bewusstsein durch den Sturz gespalten worden?
Mein erster Freund ist ein sprechender Hund
Im Alter von fünf Jahren bemerke ich, dass der Mann, der sich als mein Vater bezeichnet hat, irgendwann abhanden gekommen sein muss. Ebenso sind auch die Väter der anderen Kinder, die ich kenne , spurlos verschwunden. Meine Mutter erklärt mir, es sei nun Krieg und die Väter würden als Helden in denselben ziehen. Und sie würden sicher die Welt erobern und am Ende als Helden und mit großem Pomp zu ihren Familien zurückkehren. Da sie bei dieser Ansprache Tränen in den Augen hat, beschließe ich, ihr nicht zu glauben und lieber selbst nach den verschwundenen Vätern zu suchen. Warum wollen sie denn unbedingt Helden werden? Warum sind sie nicht zufrieden, sonntags mit ihren kleinen Söhnen und Töchtern an der Hand spazieren zu gehen und das Leben zu genießen? Mit solchen Gedanken gehe ich in der Abenddämmerung durch die Stadt und stehe unvermittelt vor einer breiten Toreinfahrt.
Das Tor gibt den Blick frei auf einen grünen Park und eine weiße wundersame Villa, hinter Bäumen versteckt. Hätte ich schon lesen können, wäre ich wahrscheinlich davon gerannt. Am Portal ist ein Schild angebracht mit Schriftzeichen und dem Bild eines braunen Hundes. Der Hund gefällt mir, ich gehe hinein um ihn zu suchen. Da steht er nun vor mir, vor dem Treppenaufgang des Hauses, sieht mich mit einem leicht bösen Blick an.
„Bist du der, der hier Wache hält? Ist dein Vater auch im Krieg und was bist du überhaupt für ein Hund?“
Sein Gesicht verändert sich und durch seinen Ausdruck kann ich verstehen, was er antwortet:
„Ich bin Foxterrier und ich beiße jeden, der unbefugt hier herein kommt! Mein Herr ist ein hoher Offizier und nun ist er im Krieg, um dort ein berühmter Held zu werden.“
„So ist dein Herr dort, wo mein Vater ist,“ sage ich, „wollen wir zusammen losgehen um sie zu suchen?“
„Ich kann hier nicht weg, ich muss das Haus bewachen und die Frau beschützen, die darin wohnt.“
„Vor wem musst du sie denn beschützen?“
„Vor den Anderen, die hier leben und die meinen Herrn und seine Frau als Fremde und Eindringlinge bezeichnen. Ich mag sie nicht, und wenn sie mit ihren Fahrrädern vor unserem Tor vorbeifahren, laufe ich ihnen nach und beiße sie in die Wade.“
Ich habe das Gefühl, dass dieser Hund genau so einsam ist, wie ich und dass wir das gleiche Problem haben. Ich kraule ihm die braune Wolle zwischen den Ohren und er leckt mir die Hand.
„Was können wir unternehmen, und wie heißt du eigentlich?“
„Mein Name ist Dacius, und wenn du mich so nennst, dann würde ich am liebsten mit dir durch die Stadt laufen und hinaus gehen in den Wald, wo es wispernde Geheimnisse gibt, denen man nachjagen kann. Aber ich kann doch meine Herrin nicht im Stich lassen!“
„Lass mich mit deiner Herrin sprechen, vielleicht gibt sie dir ein paar Stunden frei?“
Ich klingele an der Haustür. Die wird nach einiger Zeit einen Spalt weit geöffnet. Man sieht eine Frau, die ein Küchenchassuble trägt und die Haare mit einem Kopftuch hochgesteckt hat.
„Was willst du, Kleiner?“
Das klingt ziemlich abweisend.
„Sind Sie die Herrin von meinem Freund Dacius?“
„Ich bin die Haushälterin, und Dacius ist nicht dein Freund, sondern unser Wachhund. Frau von Prittwitz ist für niemanden zu sprechen, der nicht angemeldet ist, das gilt auch für kleine Jungen. Woher hast du überhaupt den Namen unseres Hundes?“
„Er hat ihn mir gesagt, und er hat mir auch erzählt, dass sein Herr ein großer Offizier sei, der nun in den Krieg gezogen ist, so wie auch mein Vater. Darum wollte ich seine Herrin fragen, ob ich nicht ein wenig mit ihm spazieren gehen kann.“
Der Gesichtsausdruck der Frau drückt etwas zwischen Erstaunen und ängstlichem Zweifel aus. Sogleich verstehe ich,warum.
„Wie kommst du an diese Informationen, Junge – wir haben doch mit niemandem in der Stadt Kontakt, und dass unser Chef Offizier ist, General, weiß überhaupt keiner.“
Jetzt wird die Tür weiter geöffnet und es erscheint eine zweite Frau. Sie trägt eine schwarze Robe, mit fein gearbeiteter Stickerei auf den Ärmeln. Als ich sie sehe, glaube ich, sie schon lange zu kennen: Das ist Frau von Prittwitz und sie ist wesentlich älter als meine Mutter und macht sich große Sorgen um ihren Mann. Woher weiß ich so etwas?
Ich sehe zu Dacius hinüber, verstehe: Er signalisiert es mir.
„Guten Tag, Frau von Prittwitz, ich bin Vincent Selten, und ich wollte fragen, ob ich ein wenig mit Dacius spazieren gehen kann. Mein Vater ist doch im Krieg, wissen Sie …“
Frau von Prittwitz nimmt eine kleine Brille aus einem Seitentäschchen ihrer Robe und setzt sie sich als kunstvollen Goldschmuck auf die Nase. Sie mustert mich eine geraume Weile mit gelegentlichem leichtem Kopfschütteln. Jetzt wird sie mich gleich dasselbe fragen, wie ihre Haushälterin, geht es mir durch den Sinn.
„Was bist du denn für ein Junge, was weißt du über uns und woher? Dich hat doch nicht etwa die STAPA geschickt – aber nein, die wissen gar nichts, das kann wohl nicht sein. Komm doch herein, ich möchte mit dir reden.“
Ich betrete, mit Dacius an der Seite, die große Diele eines edel eingerichteten Landhauses. Da gibt es große schwere Ledersessel, an der Seite glimmen die Reste eines Kaminfeuers, im gedämpften Licht von golden und braun eingefärbten Intarsienfenstern sieht man an den Wänden zahlreiche Bilder – Portraits von Soldaten in prächtigen Uniformen, mit allerlei glänzenden Orden an der Brust. Ich deute spontan auf eines der Portraits:
„Das ist Generaloberst Wilhelm von Prittwitz, der hier zu Hause ist, aber er ist nicht da und das macht Ihnen große Sorgen, nicht wahr?“
Der Frau vor mir entfährt ein kleiner Schrei des Erstaunens. Sie lässt sich in einen Sessel fallen und mustert mich von Kopf bis Fuß.
„Du warst noch nie hier – wie kannst du das wissen, woher hast du das?“
Ich deute auf Dacius.
„Er sagt es mir. Seit wir uns draußen am Tor kennen gelernt haben spricht er mit mir. Ich verstehe seine Sprache, wenn ich sein Gesicht anschaue, aber wie es kommt, weiß ich auch nicht.“
„Das ist ja ganz unglaublich, was sagt denn deine Mutter zu deiner sonderbaren Begabung?“
„Meine Mutter sagt, ich sei bei der Geburt auf den Kopf gefallen und hätte seither ein gespaltenes Bewusstsein. Und der eine Teil würde sich immer wieder in das Bewusstsein und das Wissen eines Anderen hineindrängen. Mein Vater sagte auch oft, ich sei ‚nicht ganz normal‘, aber er denkt, dass es mir sogar nützlich ein könnte, wenn ich mal zur Schule komme.“
„Nun, Vincent, das erscheint mir so unglaublich, dass ich jetzt neugierig werde auf eine rationale Erklärung. Sage deiner Mutter einen Gruß von mir, und ich würde mich freuen, wenn sie mich besuchen würde. Wenn sie Lust hätte auf einen Nachmittagskaffee oder ein Gespräch unter Soldatenfrauen – abends am Kamin – sollte sie mir einen Termin signalisieren. Aber bitte nichts schriftliches, am Besten indem sie dich herschickt. Und derweil kannst du natürlich auch mit Dacius spazieren gehen, vielleicht erzählt er dir mehr über unsere Familie.“
Meine Mutter verbringt nun manche Nachmittage in dem Haus im Park. In dieser Zeit renne ich mit Dacius um die Wette durch die Straßen, durch die Felder, durch die sumpfigen Auen am Fluss, vorbei an gewaltig breiten Brombeerhecken in den schattigen Wald auf den Hügeln über der Stadt.
„Dacius, sind deine Herrin und meine Mutter jetzt Freundinnen?“
„Ich weiß nicht, was du meinst, aber meine Herrin war neuerdings oft sehr traurig. Sie sagte zur Haushälterin: ‚ich hätte gern jemanden, der meinen Kummer versteht und mit dem ich reden kann‘. Nun reden sie miteinander, aber es scheint, dass sie sich nicht gut verstehen.
Jede redet über ihre Probleme, aber sie hören sich nicht wirklich zu. Das ist so was wie eine Zweckgemeinschaft. Jede benutzt die andere als Strohhalm um im Meer der Trübsal nicht unter zu gehen. Vielleicht denken sie, es sei eine Freundschaft.“
„Ist es keine Freundschaft, wenn man sich gegenseitig benutzt, Dacius? Wir beide – sind wir Freunde oder benutzen wir uns?“
„Wir öffnen uns und lernen voneinander. Und wir machen etwas gemeinsam, wir laufen in den Wald und erleben Interessantes. Ich glaube, dass man das Freundschaft nennt.“
Am Fuß eines der mit Buchen bewachsenen Hügel bleibt Dacius stehen und blickt nach oben.
Seine Nackenhaare stellen sich hoch, „Achtung, Gefahr!“ heißt das bei ihm.
„Was ist dort, was siehst du?“
„Ich rieche etwas, hier hat vor kurzem ein Krieg stattgefunden. Und nun liegt ein Toter da oben“.
Wir gehen langsam und die Umgebung sorgfältig beobachtend, Dacius voraus, um den Hügel herum. Eine Mulde wird sichtbar, hier ist der Waldboden aufgewühlt. Ich nehme nun auch einen Geruch wahr, der mir bekannt vorkommt.
„Dacius, ist das der Geruch, den wir am Westende der Flussaue gerochen haben, wo die Soldaten eine Schießübung gemacht und mit Maschinengewehren in den Hang hinein geballert haben?“
„Es ist der Geruch, aber hier ist noch etwas dabei - so riecht es bei uns, wenn die Haushälterin im Keller Rattenfallen aufstellt. Der Geruch des Todes.“
Wir klettern noch etwas höher, noch etwas näher, bis wir in die Mulde hinein sehen können.
Der Hang ist stark zerwühlt, unzählige Patronenhülsen liegen herum. Mitten am tiefsten Punkt der Mulde, liegen die gekrümmten Körper zweier Männer. Sie sind mit den auf dem Rücken gefesselten Armen aneinander gebunden und liegen in einem schwarzen See getrockneten Blutes. Der eine blickt mit weit geöffneten Augen starr in den Himmel, der andere hat den Mund weit geöffnet und zeigt zwei Zahnreihen mit größeren Lücken als wolle er gerade zubeißen. Ich bin im Zwiespalt, ob ich über den Anblick lachen oder mich doch eher fürchten sollte. Nun nehme ich auch den Geruch des Todes wahr und die Empfindung neigt sich etwas auf die Seite des Fürchtens. Dacius ist ziemlich unbekümmert und schnuppert in der Szene herum. Schließlich hat er eine Erklärung parat:
„Das sind Nedui, eine Gruppe von Einheimischen, die von der STAPA gejagt werden. Sie verbergen sich in Kellern oder in Höhlen im Wald. Wenn die STAPA sie erwischt, werden sie als Zielobjekte beim Schießtraining verwendet. Achtung Vincent, schnell weg hier!“
Wir ducken uns in ein dichtes krautiges Feld von blühendem Fingerhut und machen uns unter den breiten Blättern der Pflanzen so gut wie möglich unsichtbar. Das Krachen von trockenem Unterholz zeigt an, dass sich jemand näherte. Fünf Männer in schwarzen Uniformen erscheinen oben am Hang und rutschen mit ihren klobigen Stiefeln der Berg herab bis zur Mulde. Einer trägt zwei silberne Sterne auf den Schultern seiner Uniformjacke. Er scheint der Anführer zu sein und sagt in barschem Ton:
„Schaufelt Erde drüber, muss ja nicht jeder Leppo gleich sehen, was hier los war. Aber kontrolliert vorher nochmal, ob alles Zahngold raus ist. Für die Mühe, die Kerle ins Jenseits zu schicken, haben wir schließlich etwas Belohnung verdient. Und sucht die Umgebung ab, ich will keine Zeugen, die dann irgendwas Wirres plappern.“
„Was sind das für Menschen, die andere erschießen und ihnen dann die Zähne ausbrechen?“ “Mein Herr Wilhelm sagt, sie seien eine Untereinheit der STAPA und heißen ‚schwarzes Kreuz‘. Er nennt sie aber auch ‚Todesschwadron‘ oder ‚Swastikaner‘.“
„Er hat sie gekannt?“
„Jeder kennt sie und fürchtet sie. Herr Wilhelm hat sie in Gesprächen mit seinem heimlichen Freundeskreis oft erwähnt.“
„Wer ist das – sein heimlicher Freundeskreis?“
„Sie nennen sich ‚freie Architekten‘ und Herr Wilhelm ist ihr Großmeister. Sie haben sich oft bei uns getroffen. Sie kamen immer nach Anbruch der Dunkelheit. Im Keller gibt es bei uns einen Raum, der ‚die Kapelle‘ genannt wird. Man kommt durch den Weinkeller hinein, indem man ein Weinregal zur Seite schiebt.
Einmal geschah es, dass die STAPA Wind bekommen hatte von diesen Treffen und das schwarze Kreuz schickte. Da sie am Tage kamen, war natürlich niemand da. Sie schienen zu glauben, dass wir im Garten etwas staatsgefährdendes versteckt hätten. Mit Spaten und Spitzhacken zertrümmerten sie die ganze Gartenanlage, auch die schönen Skulpturen wurde zerschlagen. Da sie rein gar nichts fanden, brüllten sie vor Wut und verlangten, dass der General von Prittwitz sofort heraus kommen solle. Aber Herr Wilhelm war nicht da, weder Herr Wilhelm noch Frau Amalie von Prittwitz waren zu finden. Nur die ahnungslose Haushälterin wurde in der Küche gefunden. Deren angstvolles Gezeter ging ihnen so auf die Nerven, dass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Die Haushälterin ging in den Keller, öffnete die Tür zur Kapelle und holte Herrn Wilhelm und Frau Amalie heraus. Während Frau Amalie noch zitterte vor Angst, sagte Herr Wilhelm in stoischer Ruhe: ‚soviel Gewalttätigkeit und Dummheit begegnet man selten. Wir werden die Treffen der Bruderschaft wohl an einen anderen Ort verlegen müssen‘.“
Was Dacius alles weiß! Und wie erstaunlich, dass ich das, was er weiß, in seinen Gedanken lesen kann!
Später im Jahr, als die Buchen im Wald schon ihre bunten Herbstfarben tragen, ändert sich mein Leben grundlegend. Statt mit Dacius durch Flussaue und Wald zu streifen, bekomme ich einen Schulranzen auf den Rücken geschnallt und werde von meiner Mutter zu einem großen roten Backsteingebäude geführt, in dem ich jetzt einen Teil meines Tages verbringen soll.
„Du kommst jetzt in die Schule, Vincent, und ich ermahne dich, ein aufmerksamer und fleißiger Schüler zu werden, damit dein Vater eine Freude hat, wenn er aus dem Krieg kommt. Und hör’ damit auf, die Gedanken anderer Leute erraten zu wollen, dabei erfährst du nur Dinge, die überhaupt nicht gut für dich sind.“
„Kann ich auch nicht mehr mit Dacius laufen gehen?“
„Ich weiß es nicht, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall haben Schule und Lernen jetzt immer Vorrang.“
„Scheißschule“, denke ich, spreche es aber vorsichtshalber nicht aus, denn meine Mutter ist nämlich sehr konservativ, und duldet keine Gossenausdrücke. Statt dessen sage ich:
„Ach Mama, seit du die Frau von Prittwitz besuchst, bist du nicht mehr so lustig wie früher.
Du denkst immerzu daran, dass Papa im Krieg ist und wie gefährlich es dort ist. Frau von Prittwitz hat große Angst um ihren Mann. Und nun denkst du auch, dass Papa womöglich gar nicht mehr wieder kommt.“
„Sei still, Junge“, sagt sie und beginnt zu weinen. „Du weist ja nicht, wie es zugeht in der Welt.“
„Doch Mama, doch weiß ich es! Eines Tages wird er vor der Tür stehen. Aber das Leben wird dann ein anderes sein.“
Leben in der Schule, Schule des Lebens
Im Klassenzimmer riecht es penetrant nach Putzmitteln und Veilchenparfüm. Auf dem Flur kommen mir schon die Trägerinnen dieses Aromas entgegen. Sie führen Eimer mit Putztüchern mit sich und haben langstielige Schrubber unter die Achseln geklemmt. Ihr lautes Geschnatter weißt sie als Angehörige des Stammes der Leppo aus und ihre Gedanken gegenüber den Aroi gleichen wüsten Vernichtungsfantasien. Denen wollte ich lieber nicht bei Dunkelheit begegnen, oder nur, wenn Dacius dabei wäre. Aber Dacius – wo mochte er jetzt wohl sein?
Der ohrenbetäubende Lärm von dreißig Sechsjährigen, der den Raum erfüllt hat, ist wie auf Knopfdruck abgeschaltet, als die Tür sich öffnet und eine formlose Masse sich durch die zu enge Türzarge hereinwälzt. Über einem elefantenmächtigen Bauch türmen sich zwei zentnerschwere Glockentürme, darüber ansatzlos ohne Hals der Kopf eines Breitmaulnashorns. Die Figur könnte aus dem Zoo von Torunna entlaufen sein. Dort hat mir meine Mutter kürzlich gezeigt, wie differenziert das Leben aussehen kann, wodurch mein Erstaunen sich nun in Grenzen hält. Das ist unsere Lehrerin Frau Dreier. Klarer Fall: In Zoo von Torunna, wo sie mit Lebewesen allerlei Experimente ausführten, hatten sie drei Frauen zu einer zusammengenäht. Und dem Produkt den Namen Dreier gegeben. Meine Mutter würde diese Idee natürlich missbilligen, ist mir klar. Andererseits weiß auch sie, dass es eine Flüsterpropaganda gibt in der Stadt, wonach die STAPA im Zoo von Torunna auch mit Menschen experimentieren soll. Um die Rasse der Aroi weiter zu entwickeln. Ist Frau Dreier schon eine höhere Lebensform?
Auf jeden Fall ist sie linientreu im Sinne der STAPA. Während sie uns beibringt, Buchstaben auf unsere Schiefertafeln zu schreiben, beschäftigen sich ihre Gedanken mit den Haaren ihrer Schüler. Mädchen haben blond zu sein und lange Zöpfe zu tragen. Jungen müssen einen kurzen Militärhaarschnitt haben und dürften, wenn sie nicht blond wären, äußersten Falles rötliches Haar haben. Ansonsten gelten sie nicht als reinrassige Aroi und ein solcher Verdacht wird umgehend der STAPA gemeldet. Die Familien bekommen dann gelegentlich Post vom Einwohneramt, worin ihnen mitgeteilt wird, dass ihre rassische Zensur aufgrund des Aussehens ihres Kindes um eine Note herabgesetzt werden müsse. Verbunden sei damit, dass die Bezugsscheine für hochwertige Waren gekürzt und die Aufstiegschancen der Väter in Wirtschaft oder Verwaltung verringert werden müssten. Es sei denn, sie würden sich bemühen, ihre Nachbarn zu überprüfen und abweichende Meinungen oder Lebensweisen zu melden, womit die Rückstufung noch vermieden werden könne. In dieser Gedankenwelt lebt Frau Dreier. Ihr Denunziantentum ist hoch entwickelt, ihre Intelligenz etwas weniger. So wurde sie zu einem wichtigen Werkzeug der STAPA und ihre Chancen, eines Tages Schulleiterin zu werden, sind groß. Ich bin mir allerdings sicher, dass mein Foxterrier Dacius in Sachen Intelligenz viel eher zum Schulleiter geeignet sein würde.
Einer der Schüler in meiner Klasse ist Jakob Dombrowsky. Er ist mager und wirkt schüchtern. Ich sehe ihn an und verstehe, dass seine Schüchternheit nur eine aufgesetzte Geste ist. In Wirklichkeit hat er Angst. Die Angst rührt daher, dass seine Haarfarbe schwarzbraun ist mit einem rötlichen Stich. Und seine Eltern haben ihm eingeschärft, sich im Umgang mit den anderen Kindern zurück zu halten und sich keine Blöße zu geben. Und sich keinesfalls auf Gespräche über die Bedeutung von Haarfarben einzulassen.
Jakob und seine Eltern wohnen in unserer Nachbarschaft. Wir haben den gleichen Heimweg. Wir reden über tausend Dinge, aber ich habe von Anfang an verstanden, dass er nicht über seine Herkunft befragt werden will. Statt dessen malen wir uns aus, wie wir im kommenden Winter mit unseren Schlitten die Steilhänge zur tiefen Flussaue hinunter rasen wollen, schneller als alle Anderen. Oder wie wir im kommenden Sommer droben im Wald die reifen Brombeeren zu pflücken versuchen. Die Zukunft ist eine heile Welt, Krieg und STAPA gibt es nicht in unserer Projektion. Dann bemerke ich an einem Tag, dass Frau Dreier Jakob ansieht mit einem Gesichtsausdruck, der keinen Zweifel zuließ: „Du bist doch ein Nedui!“
Auf dem Heimweg fasse ich Jakob am Ärmel seiner Jacke und sagte:
„Höre, Jakob, du musst deine Eltern warnen, diese fette Sau, die sich Frau Dreier nennt, will euch bei der STAPA anschwärzen – du weißt schon, warum“.
Jakob wird leichenblass. „Woher weißt du, was sie vorhat?“
„Frag’ mich nicht danach und glaube mir, dass es so ist. Ihr müsst euch in Acht nehmen, und lasst keinen Uniformierten ins Haus. Vor allem keine vom schwarzen Kreuz.“
Ein nasskalter Tag, ein eisiger Ostwind pfeift um die Hausecken und wir rennen, um dem aufkommenden Regen zu entkommen. Würden Jakobs Eltern meine Botschaft verstehen?
Erst einmal geschieht nichts. Wir sitzen wie immer im Klassenzimmer, Frau Dreier erklärt uns, was man unter Rechtschreibung zu verstehen hat und wie Schönschrift aussehen muss, draußen tobt dazu ein Schneesturm, es ist unvermittelt Winter geworden.
„Erkläre mir, was ein Aro ist, Vincent!“
„Die Aroi sind die Herren der Welt, und sie sind so stark, dass sie bei dem Wetter, das jetzt draußen herrscht, mit nacktem Oberkörper hinausgehen können!“
„Was redest du, woher hast du diese Idee mit dem nackten Oberkörper?“
„Na ja, Frau Dreier, auf dem Marktplatz steht doch ein Denkmal von drei Aroi, mit einem Hammer, einer Zange und einer Sense. Die haben nackte Oberkörper und stehen jetzt im Schneesturm, ohne umzufallen.“
„Ich hoffe für dich, dass du nur ein Einfaltspinsel bist und nicht etwa einen bösen Witz machst. Über Aroi macht man keine Witze, merke dir das!“
„Siegfried: kannst du mir sagen, was ein Leppo für Eigenschaften hat?“
Der Angesprochene, Siegfried Maurer, ist der Blondeste in unserer Klasse. Er ist auch der größte Raufbold, lediglich in Rechtschreibung ist er etwas schwach.
„Leppos sind bucklig und hinterlistig, sie wohnen in Nissenhütten und stehlen immer Hühner.“
„Na schön, Siegfried, das ist zwar keine gute Antwort, aber sie zeigt, dass du eine gute Gesinnung hast, das lasse ich durchgehen.“
„Jakob: beschreibe mir das Aussehen eines Nedui.“
Plötzliche Totenstille zeigt, dass das Gerücht um Jakob schon die Runde gemacht hat. Wie wird er reagieren?
„Ein Nedui sieht aus wie ich!“
Oh Gott, ist der wahnsinnig geworden?
„Aber dafür kann ich nichts. Viele Menschen sehen nicht genormt aus, und ich bin kein Nedui, nur weil ich so aussehe. Das Aussehen eines Menschen ist kein Abstammungsnachweis, und die Unterlagen des Bürgeramtes gehören in den Müll.“
„Deine Ausrede ist nicht schlecht, aber deine Frechheit auch nicht. Das Bürgeramt zu kritisieren steht einem Erstklässler nicht zu. Du erhältst einen Tadel im Klassenbuch, und mach so was nie wieder!“
Auf dem Heimweg durch Schnee und Eiseskälte packt Jakob mich am Arm.
„Das war super von dir, dass du uns vorgewarnt hast. Mein Vater hat mit mir überlegt, was wir anfangen sollten, wenn so etwas kommt und hat mir vorgegeben, was ich sagen soll.
Woher hast du bloß immer diese Eingebungen?“
„Nun, ich habe solche Vorstellungen, du kannst auch Visionen sagen, weil ich ich als Baby auf den Kopf gefallen bin. Aber ich rede nicht gern darüber, die Leute tippen sich dann mit dem Zeigefinger an die Stirn, wenn du verstehst.“
Die Schule ist für mich kein besonders attraktiver Ort. Von den Lehrern lerne ich wenig Positives, das meiste was sie von sich geben ist unverhohlene STAPA – Propaganda. Um so mehr lerne ich im Umgang mit den anderen Kindern etwas über die menschliche Natur und ihre Abgründe.
Nach Weihnachten gibt meine Mutter mir eine geschälte Orange in meine Pausenbox, weil ich die üblichen Wurst- oder Käsebrote regelmäßig wieder mit nach Hause bringe. Kaum habe ich meine Box geöffnet, bin ich von einer Schar jauchzender Kinder umringt.
„Eine Orange, er hat eine Orange! Gib mir auch ein Stück! Mir auch, und mir!!“
Ein Stück nach dem Anderen von der begehrten Frucht wandert in eine mir entgegen gestreckte hohle Hand. Schließlich ist nur noch ein letztes Stück in der Box, aber die hohlen Hände sind immer noch da. Und nun kommt Siegfried. Er schubst sie alle beiseite und greift in die Box. Triumphierend hält er seine Beute hoch. Die Kinder weichen vor ihm zurück. Ich sage:
„Ist es wahr, Siegfried, dass die Leppo alles stehlen?“
Das hätte ich besser nicht sagen sollen. Ein Faustschlag trifft mich ins Gesicht und der Oberaro schiebt sich mein Orangenstück in den Mund. Im Klassenraum betrachtet Frau Dreier mein Gesicht.
„Wieso blutet deine Nase, Vincent?“
„Ich bin mit einer Bronzefigur zusammengestoßen.“
„Na schön, wenn du Blödsinn redest und nichts sagen willst, dann kann es nicht Bedeutendes sein. Putz dir die Nase und geh’ auf deinen Platz.“
Es war eine dreifache Lektion, die ich gerade als lebende Darstellung gelernt hatte:
1. Wenn die Gier der Menschen einmal geweckt ist, verlieren sie alle Hemmungen,
2. Überlegenheit wird schnell zu Brutalität und der Stärkere genießt seine Macht und die Ohnmacht des Unterlegenen,
3. Wer sich einmal als Sieger hervorgetan hat, findet immer Unterstützer und Bewunderer.
Würde mir Frau Dreier die Frage nach den Eigenschaften der Aroi noch einmal stellen, so wüsste ich eine bessere Antwort, als den Hinweis auf Bronzestatuen.
Krieg und Tod
Nun ist es Frühjahr und die Väter sind noch immer nicht aus dem Krieg zurück. Es wird Sommer und man hört gelegentlich ein fernes Donnern, das uns von unseren Lehrern als die Musik des ‚großen vaterländischen Krieges‘ erklärt wird. Es wird Herbst und einige Väter kommen zurück zu ihren Familien. Es ist entsetzlich: Manchen fehlen Arme oder Beine.
Manche werden im Rollstuhl geschoben oder laufen mit Krücken.
„Hey, Vincent, du bist doch allwissend. Sehen alle Väter so aus, wenn sie zurück kommen?“
„Nein, Janosch, nicht alle, nur die Helden.“
„Und die Anderen?“
„Die sind meistens tot oder gar nicht existent.“
Janosch ist ein etwas dicklicher Junge und hat Mühe, den Sinn meiner Aussage zu verstehen.
Von ihm wird getuschelt, dass er keinen Vater habe, nur eine Mutter. Oder dass sein Vater vielleicht Leppo sein könnte, was seine Mutter heftig bestreitet. Deshalb füge ich noch hinzu:
„Verstehst du, Janosch: Lieber würde ich noch einen Leppo zum Vater haben als einen toten oder gar keinen.“
Janosch rennt mit Höchstgeschwindigkeit davon und schreit im Weglaufen noch:
„Du bist ein altes Arschloch, Vincent, mit dir rede ich nie mehr!“
Wieder eine Lektion gelernt: Wahrheiten soll man aussprechen. Aber nicht andeuten – wenn man sich keine Feinde machen will.
Der Herbst bringt eine kleine Sensation. Unsere Eltern werden zur Versetzungsfeier in die Schule eingeladen. In der großen Aula sitzen wir Erstklässler mit unseren Müttern und harren der kommenden Dinge. Rektor Bucerius, ein schnauzbärtiger Griesgram mit einem Bauch wie Napoleon hält eine Rede über die vaterländische Bedeutung der Schule. Wie wichtig es sei, den Kindern gleich zu Beginn die richtige vaterländische Gesinnung beizubringen.
Gesinnungen zu entwickeln, könne nicht dem Individuum überlassen werden sondern müsse systematisch und notfalls mit Strenge von den Eltern gesteuert werden. Die richtige Gesinnung könne auch einem weniger begabten Kind anerzogen werden, wohingegen hohe Intelligenz keine Entschuldigung für schlechte Gesinnung sein könne.
„Ja. Warum eigentlich?“ Da tritt auch schon Frau Dreier ans Rednerpult.
„Wir kommen nun zur Preisverleihung für die besten dieses Jahrgangs. Den Siegerpreis erhält der Schüler Siegfried Maurer. Seine Note in Rechtschreibung ist zwar leider nur eine Vier, aber seine vaterländische Gesinnung ist außergewöhnlich und sollte ein Vorbild für alle sein. Um das nochmal klar zu machen: Gesinnung geht vor Intelligenz! Damit zeigen wir auch, warum der mit Abstand intelligenteste der Klasse, der Schüler Vincent Selten, von uns nicht als preiswürdig angesehen wird. Vincent hat zwar in Rechtschreibung und im Rechnen ein Niveau erreicht, mit dem er schon in der drittem Klasse mithalten könnte – aber seine Gesinnungsäußerungen sind subversiv und immer voller kryptischer systemfeindlicher Andeutungen. Sie, Frau Selten, müssen im kommenden Schuljahr ihren Sohn auf die richtige Gesinnungsschiene setzen, anderenfalls könnte das Bürgeramt Ihnen die Anerkennung als Aro entziehen. Überlegen Sie sich das also gut.“
Nachdem noch einige weitere Preisträger ihren Mangel an Intelligenz feiern durften, wird die Zeremonie rasch beendet. In Gruppen gehen die Familien nach Hause, um meine Mutter und mich bildet sich ein großer Freiraum. Meine Mutter erscheint sehr bekümmert deswegen, darum sage ich :
„Das ist doch schön, Mama, Intelligenz schafft Freiheit, Gesinnung ist was fürs Zusammenleben im Kuhstall.“
„Kuhstall? Was meinst du damit?“
„Dort sind doch die dummen Kühe, die den größten Ochsen bewundern, haben wir gerade erlebt.“
„Sei um Gottes Willen still, Vincent, deine widerborstige Denkweise bringt uns eines Tages noch ins Gefängnis.“
Sie ahnt, dass es bei mir mit dem ‚auf die richtige Gesinnungsschiene setzen‘ wohl schwierig werden würde. Wenn er doch damals bloß nicht auf den Kopf gefallen wäre!
Wieder leuchtet der Wald über der Stadt in bunten Herbstfarben, aber Jakob hat keine Lust, mit hinauf zu gehen.
„Was ist los, Jakob, was für ein Problem hast du?“