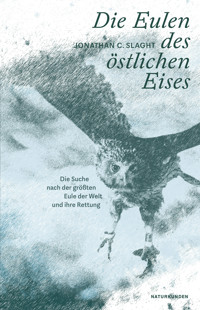
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zottelige Federpracht, gelbe Augen, zwei Meter Flügelspannweite, vier Kilo Gewicht: Sie ist die größte Eule der Welt – und eine der seltensten, denn ihr Habitat – die Primorjer Auenwälder im fernen Osten Russlands – ist so unzugänglich und abgelegen, dass 100 Jahre vergehen mussten, bis ein Forscher den Riesenfischuhu wieder zu Gesicht bekam. Jonathan Slaghts so obsessive wie abenteuerliche Suche nach dem majestätischen Vogel führt ihn über Tausende von Kilometern unwegsamen Geländes, durch verschneite Wälder, über zugefrorene Seen und tauende Permafrostböden. Irgendwo in dieser winterlichen Welt, die Tiger und Bären, Wilderer und Mystiker bevölkern, lauert die wundersame Eule, nachtaktiver Jäger, Sänger unheimlicher Duette und beharrlicher Überlebenskünstler in einem schrumpfenden Lebensraum. Die Eulen des östlichen Eises bietet einen so seltenen wie fesselnden Einblick in den Alltag eines Wissenschaftlers, zu dem Wodka-getränkte Begegnungen, waghalsige Schneemobilfahrten und vor Eiseskälte durchwachte Nächte ebenso gehören wie seltsame Eulenspuren im Schnee. Es ist das leidenschaftliche Zeugnis des heldenhaften Versuchs, einen der großartigsten Vögel der Welt zu retten, Beispiel für die Kreativität und Entschlossenheit, die Feldforschung erfordert – und eine leidenschaftliche Erinnerung an die Schönheit und Verletzlichkeit der natürlichen Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JONATHAN C. SLAGHT
Die Eulen des östlichen Eises
Die Suche nach der größten Eule der Welt und ihre Rettung
Aus dem Englischen von Sigrid Ruschmeier
Für Karen
NATURKUNDEN No 87herausgegeben von Judith Schalanskybei Matthes & Seitz Berlin
Unglaublich, was um uns herum geschah. Blindwütig riss der Wind Äste ab und wirbelte sie durch die Luft […] Riesige alte Kiefern schwankten hin und her wie junge Bäume mit dünnen Stämmchen. Und wir sahen nichts – nicht die Berge, nicht den Himmel, nicht den Boden. Alles war vom Schneesturm eingehüllt […] wir kauerten in unseren Zelten. Stumm.
Wladimir Arsenjew, 1921, Durch die Urwälder des Fernen Ostens
Wladimir Arsenjew (1872–1930), Forschungsreisender, Naturkundler und Autor vieler Schriften über Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt sowie die Menschen in der Region Primorje in Russland, war einer der ersten Russen, die sich in die Wälder hineinwagten, um die es in diesem Buch geht.
Inhalt
Prolog
Einleitung
ERSTER TEIL
Mit Eis getauft
1Ein Dorf namens Hölle
2Die erste Suche
3Winterleben in Agsu
4Die stille Brutalität des Ortes
5Den Fluss hinunter
6Tschepeljew
7Die Wasser kommen
8Der Ritt über das letzte Eis zur Küste
9Das Dorf Samarga
10Die Wladimir Golusenko
ZWEITER TEIL
Die Riesenfischuhus im Sichote-Alin-Gebirge
11Ein uralter Laut
12Ein Riesenfischuhu-Nest
13Wo es keine Verkehrsschilder mehr gibt
14Man muss auch mal banal die Straße nehmen
15Reißende Fluten
DRITTER TEIL
Das Fangen
16Vorbereitungen zum Fangen
17Fast gefangen
18Der Eremit
19Gestrandet an der Tunscha
20Ein Uhu in der Hand
21Funkstille
22Die Eule und die Taube
23Blindes Vertrauen?
24Fische für den Ornithologen
25Auftritt Katkow
26Fangen an der Serebrjanka
27Teufelskerle wie wir
28Katkow im Exil
29Die Monotonie des Scheiterns
30Dem Fisch folgen
31Kalifornien des Ostens
32Der Rajon Ternei, wild, rau und unberührt
33Das Riesenfischuhu-Schutzprogramm
Epilog
Dank
Anmerkungen
Register
Prolog
Meinen ersten Riesenfischuhu sah ich im Jahr 2000 in der russischen Region Primorje, die sich wie eine Kralle nach Süden im Bauch Nordostasiens verhakt, eine entlegene Ecke der Welt an der Küste des Pazifik, wo Russland, China und Nordkorea inmitten von Bergen und Stacheldraht aufeinandertreffen. Bei einer Waldwanderung scheuchten ein Mitwanderer und ich unversehens einen mächtigen, in Panik versetzten Vogel auf, der sich mit schwerfälligen Flügelschlägen und deutlich bekundetem Missvergnügen kurz in den kahlen Baumwipfeln etwa ein Dutzend Meter über unseren Köpfen niederließ. Skeptisch musterte uns das holzspanbraune zauselige Wesen aus stechend gelben Augen. Was für ein Vogel da über uns saß, wussten wir erst einmal nicht. Klar, eine Eule, aber eine so riesige hatten wir noch nie gesehen. Ungefähr so groß wie ein Adler, aber fluffiger und stattlicher, mit enormen Ohrenbüscheln, wirkte sie vor dem diesig grauen Winterhimmel beinahe zu wuchtig und skurril für einen echten Vogel, fast so, als hätte jemand ein Bärenjunges hastig mit einem Haufen Federn beklebt und das verwirrte Tier auf einen Baum gesetzt. Als es zu dem Schluss gekommen war, dass wir eine Bedrohung darstellten, drehte es sich lieber um und flog davon. Mit seinen Flügeln von zwei Metern Spannweite brach es durch das Astgeflecht und hinter ihm trudelten abgebrochene Rindenstückchen herab.
Zu diesem Zeitpunkt, also im Jahr 2000, war ich bereits seit fünf Jahren immer wieder in die Region Primorje gekommen. Da ich mein Leben bis dahin größtenteils in Städten verbracht hatte, war mein Blick auf die Welt von menschengemachten Landschaften geprägt. Doch als ich mit 19 eines Sommers meinen Vater auf einer Dienstreise begleitete, mit ihm von Moskau nach Primorje flog und gebannt zusah, wie die Sonne auf einem endlosen Meer dicht bewaldeter, üppig grüner Berge funkelte, auf hohen dramatischen Gebirgskämmen, die zu tiefen Tälern abfielen, war ich sofort verliebt. Dörfer, Straßen und Menschen sah ich keine. Das war Primorje.
Nach diesem ersten kurzen Besuch kehrte ich während meines Studiums noch einmal für sechs Monate zurück und verbrachte dann drei Jahre mit dem Peace Corps dort. Am Anfang beobachtete ich nur hin und wieder Vögel – ein Hobby, das ich mir am College zugelegt hatte. Aber mit jeder Reise in den Fernen Osten Russlands war ich faszinierter von der Wildheit Primorjes, insbesondere von seinen Vögeln. In meiner Peace-Corps-Zeit lernte ich viel besser Russisch, freundete mich mit Ornithologen an und trottete, wenn ich Zeit hatte, unzählige Stunden hinter ihnen her, um die Gesänge der Vögel kennenzulernen und bei verschiedenen Forschungsprojekten zu helfen. Dabei sah ich dann auch meinen ersten Riesenfischuhu. Bald schon überlegte ich, ob ich nicht eine Liebhaberei zum Beruf machen könnte.
Die Riesenfischuhus waren mir im Grunde ein Begriff, seit ich Primorje kannte. Sie waren so etwas wie eine schöne Vorstellung, die ich nicht recht in Worte fassen konnte. Und sie riefen in mir das gleiche wundersame Sehnen hervor wie ein ferner Ort, den ich unbedingt besuchen wollte, obwohl ich eigentlich nicht viel von ihm wusste. Beim Gedanken an sie spürte ich die Kühle der schattigen Baumkronen, in denen sie sich verbargen, und roch das Moos auf den Steinen an Flussufern.
Kaum hatten wir damals den Riesenfischuhu vertrieben, blätterte ich in meinem eselsohrigen Bestimmungsbuch, aber keine der Illustrationen wollte passen. Das gemalte Bild des Tieres darin erinnerte mich eher an eine miesepetrige Mülltonne als an den frechen puscheligen Kobold, den wir gerade gesehen hatten, und dem Uhu in meiner Vorstellung entsprach es schon gar nicht. Lange musste ich übrigens nicht herumrätseln, wen wir da erspäht hatten. Die Fotos, die ich gemacht hatte, fanden nämlich, wenn auch unscharf, den Weg zu einem Ornithologen namens Sergej Surmatsch in Wladiwostok, dem einzigen, der in der Gegend zu Riesenfischuhus arbeitete. Es stellte sich heraus, dass seit 100 Jahren kein Wissenschaftler so weit südlich einen Riesenfischuhu gesehen hatte, und meine Aufnahmen waren nun der Beweis, dass es diese seltene, äußerst scheue Spezies noch gab.
Einleitung
Nach erfolgreichem Abschluss meiner Masterarbeit an der University of Minnesota 2005, einer Studie über die Folgen der Abholzung für die Singvögel in Primorje, machte ich mir Gedanken zu einem Dissertationsthema ebenfalls in der Region. Ich wollte mich mit etwas beschäftigen, das wirklich breite Relevanz für den Naturschutz dort hatte, und schränkte meine Auswahl möglicher Kandidaten daher schnell auf den Mönchskranich und den Riesenfischuhu ein: die beiden am wenigsten erforschten, aber eindrucksvollsten Vögel der Region. Es zog mich mehr zu den Uhus, doch angesichts der geringen Informationen über sie befürchtete ich, dass es zu wenige von ihnen gab, um sie zu studieren. Während ich noch hin und her überlegte, machte ich eine mehrtägige Wanderung durch ein Lärchensumpfgebiet, eine offene feuchte Landschaft mit licht stehenden spillerigen Bäumen über einem dichten Teppich duftendem Grönländischem Porst. Zuerst fand ich es wunderschön, nachdem ich allerdings bald schon nirgendwo mehr Schutz vor der Sonne fand, ich von dem erdrückenden Duft des Grönländischen Porsts Kopfschmerzen bekam und sich immer wieder Wolken pieksender Insekten auf mich stürzten, hatte ich genug. Schlagartig begriff ich: Das hier war das Biotop des Mönchskranichs! Mochte der Riesenfischuhu auch selten, mochte die Verwendung von Zeit und Energie auf ihn ein Lotteriespiel sein – wenigstens musste ich mich nicht die nächsten fünf Jahre durch Lärchensümpfe quälen. Uhus also!
Mit seiner Reputation als wackerer Bewohner einer unwirtlichen Umwelt ist der Riesenfischuhu fast genauso sehr ein Symbol für das wilde Primorje wie der Amurtiger (auch Sibirischer Tiger oder Ussuritiger genannt). Beide leben zwar in denselben Wäldern und sind bedroht, aber über das Leben der gefiederten Lachsfresser sind die Informationen viel spärlicher. Erst 1971 wurde in Russland überhaupt das Nest eines Riesenfischuhus entdeckt, und in den 1980ern glaubte man, im ganzen Land gebe es nicht mehr als 300 bis 400 Paare. Man sorgte sich ernsthaft um ihre Zukunft, wusste aber nicht mehr über sie, als dass sie offenbar große Bäume zum Nisten und viele Fische in Flüssen zum Fressen brauchten.
Anfang der 1980er-Jahre war die Zahl der Tiere in Japan, nur ein paar hundert Kilometer übers Meer weiter östlich, auf weniger als 100 Exemplare geschmolzen. Ende des 19. Jahrhunderts waren es noch annähernd 500 Paare gewesen, also 1000 Vögel. Die arg dezimierte Population verlor ihre Nistplätze durch die Abholzung und ihre Nahrung durch den Bau von Dämmen am Unterlauf von Flüssen, was die Lachswanderung verhinderte. Vor einem ähnlichen Schicksal wurden die Riesenfischuhus in Primorje durch sowjetische Trägheit, schlechte Infrastruktur und niedrige Bevölkerungsdichte bewahrt. Doch die sich in den 1990ern entwickelnde freie Marktwirtschaft brachte Wohlstand, Korruption und begehrliche Blicke mit sich, die sich auf die unberührten Naturschätze im nördlichen Primorje richteten – das man, weltweit gesehen, für die Hochburg der Riesenfischuhus hielt.
Sie waren in Gefahr. Für eine von Natur aus sich langsam reproduzierende Spezies, die viel Raum braucht, kann jede umfassende, anhaltende Störung und Zerstörung ihrer Lebensumwelt wie in Japan jäh zu einem freien Fall der Bestände führen. Russland würde einen seiner geheimnisvollsten, symbolträchtigsten Vögel verlieren. Er und einige andere gefährdete Arten waren zwar unter Naturschutz gestellt worden – es war verboten, sie zu töten oder ihr Habitat zu vernichten –, doch ohne genaue Kenntnis ihrer Bedürfnisse konnte man keinen praktikablen Plan zu ihrem Schutz entwickeln. Nicht nur bemühte man sich gar nicht darum, sondern Ende der 1990er-Jahre wurden auch bisher unzugängliche Wälder in Primorje zunehmend zur Gewinnung von Rohstoffen erschlossen. Es war also Eile geboten, ernsthaft eine Strategie zum Schutz der Riesenfischuhus zu entwickeln.
Artenschutz kann man auf zweierlei Weise betreiben. Hätte ich die Riesenfischuhus lediglich erhalten wollen, hätte es keiner Forschung bedurft. Als Lobbyist hätte ich bei der Regierung versucht, ein totales Abholzungs- und Angelverbot zu erwirken. Mit solchen pauschalen Maßnahmen, ähnlich dem weitgehenden Verbot menschlicher Aktivitäten in Nationalparks, hätte man die Riesenfischuhus durch Ausschalten aller Bedrohungen geschützt. Aber abgesehen davon, dass ein derartiges Vorgehen unrealistisch war, würde man die Interessen der zwei Millionen in der Provinz lebenden Menschen missachten. Nicht wenige verdienen ihren Lebensunterhalt in Holz- und Fischereiwirtschaft, sodass ihre und die Bedürfnisse der Riesenfischuhus nicht voneinander zu trennen sind. Seit Jahrhunderten leben beide von den gleichen Ressourcen. Bevor die Russen dort ihre Netze in den Flüssen ausgelegt und Bäume zum Bauen und Verkaufen gefällt haben, haben das mandschurische und andere indigene Völker getan. Die Udehe und Hezhen fertigten zum Beispiel wunderschöne Kleidung aus bestickter Lachshaut an und bauten Boote aus riesigen ausgehöhlten Baumstämmen. Während die Abhängigkeit der Menschen von den Naturgütern allerdings im Laufe der Zeit eklatant gewachsen ist, ist die der Riesenfischuhus auf bescheidenem Niveau geblieben. Wenn ich dafür sorgen wollte, dass sich wieder einigermaßen ein Gleichgewicht herstellte und die notwendigen natürlichen Lebensbedingungen geschützt wurden, konnte ich nur durch wissenschaftliche Forschung an die dazu erforderlichen Informationen kommen.
Ende 2005 traf ich mich mit Sergej Surmatsch in seinem Arbeitszimmer in Wladiwostok. Freundliche Augen, klein, sportlich, jugendlich widerspenstiger Haarschopf – ich mochte ihn sofort. Und weil er dafür bekannt war, dass man gut mit ihm zusammenarbeiten konnte, hoffte ich, ihn für eine Partnerschaft zu gewinnen. Ich schilderte ihm, dass ich für eine Doktorarbeit an der University of Minnesota zu Riesenfischuhus forschen wollte, und er erzählte mir, was er über diese Vögel wusste. Bei einem lebhaften Austausch von Ideen befeuerten wir uns gegenseitig immer mehr und fassten rasch den Entschluss, so viel wie möglich über das geheime Leben der Riesenfischuhus zu lernen und mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse einen realistischen Plan zu ihrem Schutz zu entwerfen. Unser Ansatz war trügerisch einfach. Wie muss eine Landschaft beschaffen sein, damit Riesenfischuhus darin (über)leben können? Eine grobe Vorstellung hatten wir natürlich – hohe Bäume und jede Menge Fische etwa –, aber die Details zu erfassen, würde gewiss Jahre dauern. Wir hatten lediglich vereinzelte Berichte anderer Naturforscher und mussten im Wesentlichen bei null anfangen.
Surmatsch war ein gestandener Feldbiologe. Er hatte die für ausgedehnte Expeditionen ins entlegenste Primorje nötige Ausrüstung, einen riesigen GAZ-66-Geländewagen mit einem spezialangefertigten Wohnbereich (beheizbar mit Holzofen), mehrere Schneemobile und ein kleines Team Feldforschungsassistenten, die geübte Fischuhusucher waren. Für unser gemeinsames Projekt vereinbarten wir als Erstes, dass er und sein Team die Hauptarbeit bezüglich Logistik und Personal im Inland übernahmen und ich mich um aktuelle Forschungsmethoden kümmerte sowie Forschungsgelder auftrieb, das heißt, für den Großteil der Finanzierung sorgte. Wir gliederten die gesamte Studie in drei Phasen. Für die erste, das praktische Training, veranschlagten wir zwei, drei Wochen, für die zweite, eine Studienpopulation von Riesenfischuhus auszuwählen, etwa zwei Monate, und für die dritte, die Vögel einzufangen, mit Sendern auszustatten und Daten zu sammeln, vier Jahre.
Ich war Feuer und Flamme. Das war kein nachträglicher Krisennaturschutz, bei dem Forscher mit zu wenig Mitteln und zu viel Arbeit in Landschaften gegen die Ausrottung von Arten kämpfen, in denen der ökologische Schaden längst entstanden ist. Primorje war noch immer weitgehend unberührt. Wirtschaftliche Interessen hatten noch nicht die Oberhand gewonnen. Wenn wir uns auf eine gefährdete Spezies wie die Riesenfischuhus konzentrierten, konnten unsere Empfehlungen zum besseren Umgehen mit der Landschaft vielleicht sogar dazu beitragen, das ganze Ökosystem zu schützen.
Der Winter war die beste Zeit, die Uhus zu finden, denn im Februar machten sie sich akustisch am meisten bemerkbar und hinterließen Spuren im Schnee entlang von Flüssen. In dieser Zeit hatte Surmatsch allerdings auch am meisten zu tun. Seine Nichtregierungsorganisation hatte einen über mehrere Jahre laufenden Vertrag zur Erforschung von Vogelpopulationen auf der Insel Sachalin bekommen, und er musste sich in den Wintermonaten dort um die Logistik für diese Arbeit kümmern. Was zur Folge hatte, dass ich mich zwar regelmäßig mit ihm beriet, aber nie im Feld mit ihm arbeiten konnte. Als Vertretung schickte er immer Sergej Awdejuk, einen alten Freund, der sich im Wald hervorragend auskannte. Seit Mitte der 1990er-Jahre hatten die beiden zu Riesenfischuhus eng zusammengearbeitet.
In der ersten Phase wollten wir in den nördlichsten Teil Primorjes fahren, wo ich im Flussgebiet der Samarga lernen sollte, nach den Uhus zu suchen. Das Gebiet war insofern einzigartig, als es in der Provinz das letzte seiner Art ohne jede Straße war. Doch die Abholzungsunternehmen waren auf dem Vormarsch. Im Jahr 2000 beschloss ein Rat der indigenen Udehe in Agsu, einem von nur zwei Dörfern im gesamten Flussgebiet der Samarga von 7280 Quadratkilometern, das Land der Udehe solle für die Holzgewinnung freigegeben werden. Das bedeutete, dass Straßen gebaut und natürlich Arbeitsplätze geschaffen, aber der erleichterte Zugang und das Mehr an Menschen die Landschaft durch Wilderei, Waldbrände und vieles andere schädigen würden. Leidtragende als nur zwei von vielen Spezies waren dann die Riesenfischuhus und die Tiger. 2005 machte das Holzfällerunternehmen, dem nicht verborgen blieb, was für eine Empörung der Beschluss bei umliegenden Gemeinden und Wissenschaftlern in der Region ausgelöst hatte, eine Reihe nie dagewesener Zugeständnisse. In erster Linie sollten die Erntemethoden wissenschaftlich fundiert werden. Die Haupttransportstraße wollte man hoch über dem Flusstal anlegen, nicht wie die meisten Straßen in Primorje neben einem ökologisch sensiblen Fluss, und in Gebieten mit hohem Naturschutzwert wollte man gar keine Bäume fällen. Surmatsch gehörte zu der Wissenschaftlergruppe, der vor dem Bau der Straße die ökologische Begutachtung des Flussgebiets oblag, und sein Team vor Ort, unter Leitung von Awdejuk, bekam den Auftrag, am Fluss Samarga Riesenfischuhu-Reviere ausfindig zu machen, damit dort keinerlei Holzeinschlag stattfand.
Wenn ich mich dieser Expedition anschloss, würde ich nicht nur helfen, die Riesenfischuhus der Samarga zu schützen, sondern mich auch in der Kunst üben, sie aufzufinden. Das Erlernte würde ich in der zweiten Phase unseres Projekts anwenden können, wie gesagt beim Bestimmen meiner Studienpopulation von Riesenfischuhus. Da Surmatsch und Awdejuk eine Liste von Gebieten in den leichter zugänglichen Wäldern von Primorje erstellt hatten, wo sie Riesenfischuhus rufen gehört hatten, und sogar wussten, wo ein paar Nistbäume standen, hatten wir Informationen, auf welche Orte wir unsere Suche zunächst konzentrieren konnten. Awdejuk und ich würden dort und an weiteren Stellen innerhalb eines 20 000 Quadratkilometer großen Gebiets entlang eines großen Teils der Küste Primorjes verbringen. Wenn wir ein paar Riesenfischuhus gefunden hatten, wollten wir ein Jahr später dorthin zurückkehren und mit der dritten und längsten Phase des Projekts beginnen: mit dem Einfangen und Besendern. Wenn wir so viele Uhus wie möglich mit einem unaufwendigen rucksackähnlichen Sender ausstatteten, konnten wir über eine Dauer von vier Jahren überwachen und aufzeichnen, wohin sie gingen und wo sie sich aufhielten. Die gewonnenen Daten würden uns genau sagen, welche Teile der Landschaft mit welchen Merkmalen für das Überleben der Riesenfischuhus am wichtigsten waren, und das wiederum wollten wir zur Erstellung eines Plans zum Schutz beider nutzen.
So schwer konnte das ja wohl alles nicht sein.
ERSTER TEIL
Mit Eis getauft
1
Ein Dorf namens Hölle
März 2006. Der Hubschrauber würde zu spät abfliegen. Und weil ich dringend nach Agsu im Flussgebiet der Samarga wollte, fluchte ich über den Schneesturm, der ihn in dem Küstenort Ternei am Boden festhielt, 300 Kilometer nördlich von der Stelle, wo ich meinen ersten Riesenfischuhu erblickt hatte. Mit etwa 3000 Einwohnern ist Ternei die nördlichste menschliche Niederlassung von nennenswerter Größe in Primorje. In noch entlegeneren Dörfern wie Agsu kann man die Einwohner nach Hunderten oder sogar Dutzenden zählen.
Schon über eine Woche wartete ich nun in der eher rustikalen »Siedlung städtischen Typs« mit ihren niedrigen, holzbeheizten Häusern. Vor dem Ein-Raum-Flughafengebäude stand ein Mil Mi-8 mit blau-silbernem, vereistem Rumpf im wütenden Schneesturm und rührte sich nicht vom Fleck. Ich wartete nicht zum ersten Mal in Ternei. Mit dem Hubschrauber war ich zwar noch nie geflogen, doch die Busse nach Wladiwostok, 15 Stunden südlich von hier, fuhren zweimal die Woche und waren nicht immer pünktlich oder gar straßentauglich. Im Übrigen reiste ich schon seit zehn Jahren nach Primorje (oder lebte dort), und Warten gehörte hier zum Alltag.
Nach einer Woche bekamen die Piloten endlich die Starterlaubnis. Als ich mich zum Flughafen aufmachte, gab mir Dale Miquelle, ein Amurtigerforscher in Ternei, einen Umschlag mit 500 US-Dollar. »Geliehen«, sagte er, »für den Fall, dass du dich da oben aus Problemen rauskaufen musst.« Im Gegensatz zu mir war er schon mal in Agsu gewesen und wusste, worauf ich mich einließ. Jemand fuhr mich an den Stadtrand beziehungsweise an die aus einem Primärwald an der Serebrjanka herausgeschnittene Start- und Landebahn. Das Flussbett war hier eineinhalb Kilometer breit, eingerahmt von den niedrigen Hängen des Sichote-Alin-Gebirges und nur ein paar Kilometer von der Mündung und dem Japanischen Meer entfernt.
Nachdem ich mir am Schalter ein Ticket geholt hatte, reihte ich mich ein in die unruhige Gruppe alter Frauen, kleiner Kinder und Jäger, vom Land und aus der Stadt, die, eingemummelt in dicke Filzmäntel und ihre Koffer fest umklammernd, draußen auf den Einstieg warteten. Ein so lang andauernder Schneesturm war ungewöhnlich, und deshalb waren wir nicht wenige, die jetzt durch dieses Nadelöhr schlüpfen wollten.
Genauer gesagt, etwa 20. Ohne Fracht konnte der Hubschrauber bis zu 24 Passagiere aufnehmen. Mit mulmigem Gefühl sahen wir zu, wie ein blau uniformierter Mann einen Karton mit Versorgungsgütern nach dem anderen davor aufstapelte und ein gleich Uniformierter sie verlud. Da uns Wartende allmählich der Gedanke beschlich, dass man mehr Leuten Tickets verkauft hatte, als regulär mitfliegen konnten – die vielen Kisten und Kartons belegten wertvollen Platz –, waren wir alle wild entschlossen, uns durch die winzige Einlasstür zu drängen. Wenn ich diesen Flug verpasste, würden Surmatsch und sein Team, die schon seit acht Tagen in Agsu auf mich warteten, vermutlich ohne mich aufbrechen. Ich stellte mich hinter eine kräftigere, ältere Frau; aus Erfahrung wusste ich, dass man tunlichst jemandem wie ihr folgt, wenn man einen Sitzplatz in einem Bus ergattern möchte. Es ist, als werde man von einem Schleppkahn durch einen vollen Hafen gezogen, und ich ging davon aus, dass diese Regel auch für Helikopter galt.
Sofort nach der kaum vernehmbaren Erlaubnis zum Einsteigen schoben wir uns in kompakter Formation vorwärts. Die Einstiegsleiter des Hubschraubers fest im Blick, kämpfte ich mich darauf zu und in das Fluggerät hinein, kraxelte über Kisten mit Kartoffeln und Wodka und anderen unverzichtbaren Dingen für das russische Dorfleben und folgte meiner Vorkämpferin, die zielsicher in den hinteren Teil tuckerte, wo man die Aussicht aus einer Luke und ein wenig Beinfreiheit hatte. Während die Zahl der Passagiere auf ein bedenkliches Niveau stieg, behielt ich zwar meinen Fensterplatz, verlor aber meine Beinfreiheit an einen riesigen Sack (Mehl?), auf dem ich jedoch zumindest meine Füße abstellen konnte. Als auch das letzte bisschen Raum zur Zufriedenheit der Crew besetzt war, begannen sich die Rotoren zu drehen, zuerst träge, dann mit zunehmender Vehemenz und schließlich so rabiat, dass sie alle Aufmerksamkeit auf sich zogen. Lautstark wie ein Presslufthammer knatterte der Mi-8 schließlich in niedriger Flughöhe über Ternei hinweg, schwankte himmelwärts, drehte ein paar hundert Meter links über dem Japanischen Meer ein und folgte dann dem östlichen Rand Eurasiens gen Norden.
Die Küste unter uns war ein zwischen die Sichote-Alin-Berge und das Japanische Meer eingeklemmter schmaler Streifen. Das Gebirge endete abrupt, Hänge mit hoch aufgeschossenen Mongolischen Eichen wechselten sich ab mit plötzlich senkrecht abfallenden Felswänden, manche bis zu 120 Metern, alle gleich grau, bis auf Flecken brauner Erdkrume mit sich daran klammernden Pflanzen sowie kalkige Verfärbungen, wo in einem Spalt Greifvögel oder Krähen nisteten. Die kahlen Eichen oben waren älter, als sie wirkten. Wegen der rauen Umweltbedingungen – der Kälte, dem Wind und der weitgehend im dichten Küstennebel ablaufenden Wachstumsperiode – waren sie knotig und verkrüppelt und dünn geblieben. Am Fuß der Felsklippen hatte der Winter mit seinen mächtigen Brechern und dem Nebel auf jeder erreichbaren Stelle eine dicke schimmernde Eisschicht hinterlassen.
Drei Stunden nach dem Abflug aus Ternei landete der Mi-8 in aufgewirbeltem, glitzerndem Schnee auf dem Flugplatz von Agsu: nicht mehr als ein Schuppen und ein Stück gerodeter Wald, um das herum eine lockere Ansammlung von Schneemobilen parkte. Die Passagiere stiegen aus, und die Crewmitglieder entluden den Hubschrauber, räumten ihn frei für den Rückflug.
Ein junger Udehe von etwa 14 Jahren, das schwarze Haar fast ganz unter einer Kaninchenfellmütze verborgen, kam mit ernstem Gesicht auf mich zu. Ich sah anders aus und gehörte augenscheinlich nicht unbedingt hierher. Zumindest war ich nicht von hier, denn ich trug einen Bart, während Russen in meinem damaligen Alter von 28 der Mode entsprechend meist glatt rasiert waren. Auch fiel ich mit meiner bauschigen, roten Jacke unter all dem gedämpften Schwarz und Grau auf, das russische Männer bevorzugten.
Was mich an Agsu interessiere, wollte der Junge wissen.
»Hast du schon mal von Riesenfischuhus gehört?«, fragte ich auf Russisch zurück, das ich bei dieser Expedition ausschließlich und bei meiner Arbeit zu den Riesenfischuhus generell verwenden würde.
»Riesenfischuhus? Also die Vögel?«
»Ja, ich bin hier, um Riesenfischuhus zu suchen.«
»Du suchst Vögel«, sagte er völlig ungerührt, aber mit einem Fragezeichen versehen, als überlege er, ob er etwas missverstanden habe. Ob ich in Agsu jemanden kenne, ging es weiter.
»Nein«, erwiderte ich.
Er hob die Brauen und fragte, ob mich jemand abholen werde.
»Na, das will ich doch hoffen!«, gab ich zurück.
Seine Brauen verzogen sich zu einem Stirnrunzeln, dann schrieb er seinen Namen an den Rand eines Zeitungspapierfetzens, schaute mich an und reichte ihn mir. »Agsu ist kein Ort, den man einfach mal so aufsucht«, sagte er. »Wenn du einen Schlafplatz brauchst oder Hilfe, frag in der Stadt nach mir.«
Wie die Eichen an der Küste, war der Junge das Produkt dieser harschen Umwelt, und er war zwar jung, aber nicht unerfahren. Agsu war ein raues Pflaster, so viel wusste ich. Im vergangenen Winter war der dort stationierte Meteorologe, ein Russe (trotzdem Außenseiter) und der Sohn eines Bekannten von mir in Ternei, verprügelt und anschließend bewusstlos im Schnee liegen gelassen worden, wo er schließlich erfroren war. Offiziell wurde sein Mörder nie gefunden. Doch in so einem kleinen und eng verbandelten Ort wie Agsu kannten ihn vermutlich alle. Nur hatte man es den Untersuchungsbeamten nicht gesagt. Die Strafe, wie auch immer sie ausgefallen sein mochte, war wahrscheinlich intern vollzogen worden.
Bald entdeckte ich Sergej Awdejuk, den Leiter unseres Feldforschungsteams, unter den wartenden Menschen. Er holte mich mit dem Schneemobil ab. Wir erkannten uns sofort an unseren auffälligen, dicken Daunenjacken, und dennoch hätte man Sergej hier nicht für einen Fremden gehalten. Mit seinem kurzgeschorenen Haar, der ewigen Zigarette zwischen den Lippen und der oberen Zahnreihe aus Gold kam er wie jemand dahergeschlendert, der ganz und gar hierhergehörte. Er war ungefähr so groß wie ich – etwas über eins achtzig –, und sein kantiges, gebräuntes Gesicht war vor lauter Bartstoppeln kaum zu erkennen, gegen die wegen des Schnees extrem blendende Sonne trug er zudem eine Sonnenbrille. Obwohl die Expedition an die Samarga die erste Phase des Projekts war, das ich mit Surmatsch konzipiert hatte, war ohne Frage Awdejuk hier der Chef. Er hatte sowohl Erfahrung mit Riesenfischuhus als auch mit Expeditionen in die tiefen Wälder, und für die Dauer dieses Trips würde ich mich selbstverständlich seinem Urteil beugen. Er und zwei weitere Angehörige des Teams hatten sich vor ein paar Wochen eine Fahrt auf einem Holztransportschiff vom 350 Kilometer südlich von Agsu gelegenen Hafen Plastun organisiert. Im Gepäck hatten sie zwei Schneemobile, turmhoch mit Ausrüstung vollgeladene, selbstgebaute Schlitten und etliche Fässer Benzin für den Notfall. Von der Küste aus waren sie bisher schon schnell mal die mehr als 100 Kilometer zum Oberlauf der Samarga gefahren, hatten Zwischenlager mit Essen und Brennstoff angelegt, dann kehrtgemacht und wollten nun von Agsu aus Schritt für Schritt zur Küste zurückkehren. Hier am Ort hatten sie eigentlich nur ein, zwei Tage bleiben und mich abholen wollen, aber dann mussten sie genau wie ich darauf warten, dass sich der Sturm legte.
Agsu ist nicht nur die nördlichste menschliche Ansiedlung in Primorje, sondern auch die isolierteste. Man hatte das Gefühl, in diesem am Ufer eines der Nebenflüsse der Samarga gelegenen Dorfes von etwa 150 Einwohnern, zumeist Udehe, sei die Uhr zurückgedreht. Zu Sowjetzeiten war Agsu ein Zentrum der Wildfleischverarbeitung gewesen, die Dörfler hatten als professionelle Jäger gearbeitet und wurden vom Staat bezahlt, Pelze und Fleisch gegen Barzahlung mit dem Helikopter abgeholt. Als 1991 die Sowjetunion zusammenbrach, dauerte es nicht lange, bis die staatliche Wildfleischindustrie das gleiche Schicksal ereilte. Die Helikopter kamen nicht mehr, und dank der galoppierenden Inflation im Gefolge des Untergangs der UdSSR standen die Jäger nun mit Händen voll wertloser Rubelbündel da. Weggehen war unmöglich, niemand hatte das Geld dazu. Ohne andere Alternativen griff man wieder auf die Subsistenzjagd zurück, und der Handel am Ort wurde bis zu einem gewissen Grad zum Tauschhandel. Im Dorfladen tauschte man frisches Fleisch gegen Waren ein, die aus Ternei eingeflogen wurden.
Die Udehe im Flussgebiet der Samarga hatten bis vor nicht allzu langer Zeit an einzelnen Lagerplätzen am ganzen Flusslauf entlang gelebt. Doch im Rahmen der sowjetischen Kollektivierung in den 1930er-Jahren wurden die Lager zerstört und die Udehe in vier Dörfern zusammengepfercht, die meisten in Agsu. Die Hilflosigkeit und das Leid eines zum kollektiven Leben gezwungenen Volkes zeigt sich im Namen des Dorfes: Agsu leitet sich womöglich vom Udehewort ogso ab, was »Hölle« bedeutet.
Sergej fuhr das Schneemobil von dem festgefahrenen Weg durch die Ortschaft hinunter und parkte es vor einer nicht bewohnten Hütte, die wir benutzen durften, während deren Besitzer für eine längere Jagd im Wald war. Wie alle anderen Gebäude in Agsu war sie im traditionellen russischen Stil gebaut: einstöckig, Giebeldach, breite, kunstvoll geschnitzte Rahmen um die Doppelfenster. Zwei Männer, die vor der Hütte Vorräte ausluden, hielten inne und begrüßten uns. An ihrem modernen Outfit, den dicken isolierten Latzhosen und Winterstiefeln, erkannte ich, dass sie zu unserem Team gehörten. Sergej zündete sich eine neue Zigarette an und stellte uns vor. Tolja Rischow, stämmig und dunkel, rundes Gesicht, mächtiger Schnurrbart und sanfte Augen, war Fotograf und Kameramann. Da es fast kein Videomaterial von Riesenfischuhus in Russland gab, wollte Surmatsch diese Art bildhafte Beweise eventueller Sichtungen sammeln. Schurik Popow, klein und athletisch, das braune Haar kurz wie Sergejs, längliches Gesicht, braun gebrannt nach Wochen im Feld und fusselige, eher von spärlichem Bartwuchs zeugende Stoppeln, war unser Mann für besondere Aufgaben. Wenn es galt, einen morschen, alten Baum zu erklimmen und nachzusehen, ob sich ein Fischuhunest darin befand, oder ein Dutzend Fische zum Abendessen auszunehmen und zu putzen – erledigte Schurik es umgehend und ohne Murren.
Nachdem wir den Schnee so weit beiseitegeräumt hatten, dass wir das Tor öffnen und den Hof betreten konnten, begaben wir uns ins Haus. Kleiner dunkler Vorraum, danach die Küche. Ich atmete kalte abgestandene Luft, es stank heftig nach Holzrauch und Zigaretten. Das Haus war, seit sein Besitzer in den Wald gegangen war, abgeschlossen gewesen und nicht beheizt worden, aber der Geruch hielt sich auch in der Kälte. Der Boden war übersät mit Gipsstückchen von den bröckelnden Wänden, um den Holzofen verteilten sich Zigarettenkippen und gebrauchte Teebeutel.
Ich ging durch die Küche, dann in die beiden Nebenräume. In den Türrahmen hingen schmuddelig verlotterte, gemusterte Tücher. Im hinteren Raum knirschte einem der viele Gips unter den Füßen, an einer Wand unter dem Fenster klebten offenbar gefrorene Fleisch- und Fellstücke.
Sergej holte eine Ladung Feuerholz aus dem Schuppen und zündete den Holzofen an. Dazu sorgte er mit etwas Zeitungspapier erst mal für Durchzug darin, weil durch die Kälte im Inneren und die relative Wärme draußen eine Drucksperre im Kamin entstanden war. Wenn das Feuer zu schnell zu brennen begann, zog es nicht durch, und der Raum würde völlig verqualmen. Der Ofen namens Russkaja petschka (russischer Ofen) war in einer Küchenecke in die Wand eingebaut, wie in den meisten Hütten im Fernen Osten Russlands aus Ziegelsteinen gemauert und mit einem dicken Eisenblech bedeckt, auf das man einen Tiegel mit Essen oder einen Topf Wasser zum Kochen stellen konnte. Da sich der heiße Rauch durch Schächte in der Ziegelsteinwand schlängelte und dann durch den Kamin abzog, hielt sich die Wärme noch lange nach Erlöschen des Feuers in der Küche und dem Raum auf der anderen Seite. Leider hielt aber unser geheimnisvoller Gastgeber seinen Russkaja petschka nicht in Schuss, und obwohl sich Sergej redlich bemühte, drang Rauch durch unzählige Ritzen und die Luft wurde aschgrau.
Als wir alle unsere Sachen nach drinnen in den Vorraum geschafft hatten, setzten Sergej und ich uns mit Karten der Samarga hin und besprachen unsere weitere Vorgehensweise. Er zeigte mir, wo er mit den beiden anderen schon die oberen 50 Kilometer des Flusses und einige Nebenflüsse nach Riesenfischuhus abgesucht und ungefähr zehn dort lebende Paare gefunden hatte. Eine sehr hohe Dichte für diese Spezies, meinte er. Jetzt müssten wir noch die restlichen 65 Kilometer bis hinunter zum Dorf Samarga und bis zur Küste erkunden und ein paar Wälder um Agsu selbst.
Das hieß noch eine Menge Arbeit, und die Zeit wurde langsam knapp. Es war Ende März, und wir hatten schon etliche Tage wegen des Wetters verloren. Das Eis auf dem Fluss – unsere einzig mögliche »Fahr-bahn«, wenn wir erst einmal Agsu verließen – war bereits im Schmelzen begriffen. Das machte die Fahrten im Schneemobil gefährlich, und wenn der Frühling zu schnell kam, konnten wir irgendwo an der Samarga hängen bleiben, gefangen zwischen den Dörfern Agsu und Samarga. Sergej schlug vor, dass wir mindestens eine Woche lang von Agsu aus arbeiteten, dabei aber stets ein wachsames Auge auf die Frühjahrsschmelze hielten. Wir wollten uns Tag um Tag flussabwärts vorarbeiten, vielleicht zehn bis 15 Kilometer, und zum Übernachten jeden Abend mit dem Schneemobil nach Agsu zurückfahren. In dieser abgelegenen Gegend verzichtete man ungern auf einen sicheren warmen Schlafplatz, und wenn wir nicht in Agsu schliefen, blieben uns nur die Zelte. Nach ungefähr einer Woche wollten wir zusammenpacken und nach Wosnesenowka weiterziehen, einem Lagerplatz für Jäger etwa 40 Kilometer flussabwärts von Agsu und 25 Kilometer von der Küste entfernt.
Unser erstes Abendessen – Dosenrindfleisch mit Nudeln – wurde unterbrochen, als mehrere Dorfbewohner vorbeikamen und ohne weitere Umstände eine Vierliterflasche mit 95-prozentigem Äthanol auf den Küchentisch stellten, dazu einen Eimer mit rohem Elchfleisch und mehrere gelbe Zwiebeln. Das war ihr Beitrag zur Abendunterhaltung, im Gegenzug erwarteten sie interessante Gespräche. Als Fremder in Primorje, einer bis in die 1990er-Jahre von der Außenwelt weitgehend abgeschotteten Provinz, war ich es gewohnt, dass man mich neu und interessant fand. Die Leute wollten hören, was ich über das »wahre Leben« in der Fernsehserie California Clan zu erzählen hatte und ob ich Fan der Chicago Bulls war – zwei in den 1990er-Jahren in Russland populäre US-amerikanische Kulturgüter. Einheimische freuten sich aber auch immer sehr, wenn ich ihre auf unserem Globus so entlegene Ecke rühmte. Im Übrigen betrachteten sie jedweden Besucher als kleine Berühmtheit. Dass ich aus den Vereinigten Staaten kam und Sergej aus Dalnegorsk aus dem südlichen Primorje, machte nichts, denn beide Orte waren gleichermaßen exotisch, und so hatten wir hohen Unterhaltungswert und waren willkommene Trinkkumpane.
Während die Stunden verstrichen und Leute kamen und gingen, wurden Elchkoteletts gebraten und verspeist und dazu durchgehend Hochprozentiges verköstigt. Bald war der Raum von dem undichten Ofen und der Zigarettenraucherei vollkommen verqualmt. Ich saß auf ein paar »Schnäpse« dabei, verspeiste Fleisch und rohe Zwiebeln und hörte dem Jägerlatein der Männer zu, wie sie mit gefährlichen Begegnungen mit Bären, Tigern und Fluss voreinander prahlten. Einer fragte mich, warum ich nicht einfach in den Vereinigten Staaten Riesenfischuhus studierte, den weiten Weg an die Samarga auf sich zu nehmen schien ihm doch ein Heidenaufwand. Als ich sagte, in meiner Heimat gebe es keine Riesenfischuhus, war er einigermaßen überrascht. Diese Jäger liebten die Wildnis, verstanden aber offenbar nicht, wie unglaublich einzigartig ihre Wälder waren.
Schlussendlich wünschte ich eine Gute Nacht und verzog mich in den hinteren Raum. In dem Versuch, den Rauch und das lärmende, bis weit in die Nacht dauernde Gelächter auszusperren, zog ich das Tuch in der Tür vor. Dann blätterte ich mich mithilfe meiner Stirnlampe durch die fotokopierten Riesenfischuhu-Veröffentlichungen, die ich in russischen wissenschaftlichen Fachzeitschriften gefunden hatte: mein Last-minute-Büffeln vor dem morgendlichen Test. Viel gab es nicht, mit dem man hätte weiterarbeiten können. In den 1940er-Jahren hatte ein Ornithologe namens Jewgenij Spangenberg als einer der ersten Europäer Riesenfischuhus erforscht, und seine Artikel boten grobe Anhaltspunkte dazu, wo man sie finden konnte: an sich kreuzenden Armen von Flüssen mit sauberem, kaltem Wasser, in dem es von Lachsen wimmelte. In den 1970er-Jahren schrieb dann ein Ornithologe namens Juri Pukinski etliche Artikel über seine Erfahrungen mit Riesenfischuhus am Fluss Bikin im nordwestlichen Primorje, wo er Informationen über die Nistökologie und ihre Gesänge gesammelt hatte. Und schließlich gab es noch ein paar Artikel von Sergej Surmatsch, dessen Forschung sich hauptsächlich auf die Verteilungsmuster der Uhuvorkommen in Primorje konzentrierte.
In den frühen Morgenstunden zog ich mich bis auf die lange Unterwäsche aus, stopfte mir Ohrstöpsel in die Ohren und rollte mich in meinen Schlafsack, voller Spannung, was der nächste Tag wohl bringen würde.
2
Die erste Suche
Irgendwo in der Nähe von Agsu waren Riesenfischuhus auf nächtlicher Lachsjagd. Sie müssen sich nicht groß darum kümmern, ob sie gehört werden, denn ihre Hauptbeute lebt im Wasser und interessiert sich nicht für das feinere akustische Geschehen an Land. Während sich die meisten Eulenarten an den Geräuschen orientieren, die die kleinen Nager, ihre Beute, nichtsahnend machen, wenn sie über den modrigen Waldboden huschen – Schleiereulen können das in vollkommener Dunkelheit –, muss ein Riesenfischuhu Tiere jagen, die sich unter der Oberfläche des Wassers tummeln. Den unterschiedlichen Erfordernissen der Jagd entspricht ein körperliches Merkmal. Viele Eulen haben einen gut erkennbaren Gesichtsschleier, die charakteristische kranzförmige Einfassung des vorderen Kopfes durch steife, besonders geformte Federn, die die leisesten Geräusche zu den Ohrlöchern leiten. Bei den Riesenfischuhus dagegen ist dieser Gesichtsschleier nur gering ausgebildet. Evolutionär gesehen brauchten sie diesen Vorteil nicht, deshalb hat er sich mit der Zeit verflüchtigt.
Die Flüsse mit den Lachsfischen, der Hauptnahrung der Riesenfischuhus, sind monatelang fast vollständig zugefroren. Um die Winter zu überleben, in denen es regelmäßig kälter als -30 Grad wird, legen sich die Vögel dicke Fettpolster zu. Das wiederum machte sie einmal zu einer wertvollen Nahrungsquelle für die Udehe, die sie nicht nur verspeisten, sondern die riesigen Flügel und Schwänze auch auseinanderbreiteten, trockneten und sie beim Hirsch- und Wildschweinjagen als Fächer gegen die dichten Wolken stechender Insekten benutzten.
Im fahlen Licht des Tagesanbruchs in Agsu erwachte ich immer noch inmitten von Gips- und Wildfleischbrocken, aber den abgestandenen Geruch des Hauses nahm ich nicht mehr wahr. Sicher hatte ich mich daran gewöhnt, und er hing jetzt in meiner Kleidung und in meinem Bart. Im Nachbarzimmer war der Tisch übersät mit Elchknochen, Bechern und einer leeren Ketchupflasche. Nach einem triefäugigen, eher schweigsamen Frühstück mit Würstchen, Brot und Tee gab mir Sergej eine Handvoll Bonbons mit den Worten, das sei das Mittagessen und ich solle Jacke, Watstiefel und Fernglas holen, die Uhusuche gehe los.
Als unsere Karawane aus zwei Schneemobilen durch Agsu rumpelte, machten uns Dorfbewohner und Hundemeuten auf den engen Wegen Platz, traten zurück in den tiefen Schnee und beobachteten von dort, wie wir an ihnen vorbeifuhren. Normalerweise sind Hunde in Primorje als Wachhunde in Hütten angekettet und gleichermaßen unterwürfig wie bösartig, doch die Ostsibirischen Laikas, Angehörige einer zähen Jagdhundrasse, liefen in lockeren Rudeln hochmütig durchs Dorf. In jüngster Zeit hatten sie die lokale Hirsch- und Wildschweinpopulation arg dezimiert, denn der tiefe Schnee der letzten Monate lag unter einer spätwinterlichen Eisschicht, die die Huftiere durchstießen, als sei es Papier, und dann wie in Treibsand steckenblieben, auf der die Hunde aber mit ihren gepolsterten Pfoten flott dahertrabten. Hatte ein Reh das Pech, von diesen Laikas verfolgt zu werden und nicht weiterzukommen, war es von seinen beweglicheren Fressfeinden rasch bis auf die Knochen abgenagt. Wie zum Beweis des von ihnen veranstalteten Massakers trugen die Lakais, an denen wir vorbeikamen, blutverkrustetes Fell.
Direkt vor dem Fluss trennten wir uns. Außer mir waren alle Teammitglieder alte Hasen, und herumdiskutiert wurde nicht groß. Sergej wies Tolja an, mir zu zeigen, was ich tun solle, er selbst und Schurik lenkten ihr Schneemobil nach Süden zur Samarga. Tolja und ich fuhren zurück an dem Hubschrauberlandeplatz vorbei und hielten an einem Nebenfluss, an dem entlang wir nordöstlich weg von der Samarga gehen wollten.
»Dieser Fluss heißt Aksa«, sagte Tolja und schaute blinzelnd das enge, sonnenbeschienene Tal hoch, das mit kahlen Laubbäumen und einzelnen Kiefern, die sich unter der Last des frisch gefallenen Schnees bogen, nur locker bewaldet war. Ich hörte Wasser plätschern und die Warnrufe einer von uns aufgeschreckten Pallaswasseramsel. »Hier hat immer ein Mann gejagt, der, als er jünger war, mal wegen eines Riesenfischuhus einen Hoden verloren hat. Von da an hatte er die Vögel auf dem Kieker. Wo immer er sie sah, scheute er weder Zeit noch Mühe, auf sie zu schießen, sie zu vergiften und ihnen Fallen zu stellen. Aber egal, wir arbeiten uns jetzt flussaufwärts vor und suchen nach Zeichen wie Federn oder Spuren im Schnee.«
»Moment mal, er hat wegen eines Riesenfischuhus einen Hoden verloren?«
Tolja nickte. »Ja, es heißt, er ging eines Nachts in den Wald kacken – das muss im Frühjahr gewesen sein – und dabei hockte er sich offenbar direkt über einen jungen Uhu, der gerade erst das Nest verlassen hatte, aber noch nicht fliegen konnte. Wenn die Tiere in Gefahr sind, lassen sie sich auf den Rücken plumpsen und verteidigen sich mit ihren Krallen. Dieser Vogel packte sich einfach das nächstbeste Stück Fleisch und quetschte es zusammen. Na, die leichteste Beute eben.«
Dann erklärte mir Tolja, dass man für die Suche nach Riesenfischuhus Geduld und ein gutes Auge braucht. Da die Vögel schon auffliegen, wenn sie noch weit von einem entfernt sind, geht man am besten immer davon aus, sie nicht zu sehen, selbst wenn man sie ganz in der Nähe weiß. Lieber konzentriert man sich auf das, was sie hinterlassen. Wir arbeiteten uns also auf die übliche Weise vor, nämlich ganz langsam durch das Tal, und achteten auf drei wesentliche Dinge. Zunächst auf eine offene, nicht zugefrorene Stelle im Fluss. Da es im Winter in Riesenfischuhu-Gebieten nur eine begrenzte Anzahl solcher Stellen mit fließendem Wasser gibt, halten sich die Vögel am ehesten dort auf. Und dort muss man auch im Schnee am Flussufer sorgsam nach Abdrücken suchen, die sie beim Verfolgen eines Fischs machen, oder nach Spuren von den Handschwingen, die sie beim Landen oder Losfliegen hinterlassen.
Federn sind das Zweite, nach dem man Ausschau halten muss. Die Vögel verlieren immer welche. Vor allem in der Frühlingsmauser lösen sich fluffige, bis zu 20 Zentimeter lange Halbdaunen, schweben weg und bleiben mit ihren Widerhaken wie mit tausend Tentakeln an Ästen in der Nähe von Jagdgründen oder Nistbäumen hängen. Sieht man diese kleinen Fähnchen anmutig in der Brise schimmern, sind das stumme Zeugen dessen, dass hier Riesenfischuhus waren.
Als Drittes muss man nach mächtigen Bäumen mit einer überdimensionalen Höhle suchen. Riesenfischuhus sind so groß, dass sie zum Nisten wahre Giganten des Waldes brauchen – normalerweise uralte Japanische Pappeln oder Mandschurische Ulmen. Weil es in einem Tal aber stets nur wenige dieser Kolosse gibt, sollte man jedes Mal, wenn man einen solchen erspäht, hingehen und ihn sehr genau unter die Lupe nehmen. Ist auch noch einer mit Halbdaunen in der Nähe, dann hat man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Nistbaum gefunden.
In den ersten paar Stunden wanderte ich mit Tolja über den zugefrorenen Fluss durch den Talgrund und verfolgte wie ein gelehriger Schüler, wie mein Kollege auf gute Bäume oder vielversprechende Wasserstellen zeigte, bei denen es sich lohnen könnte, sie gründlicher zu untersuchen. Er bewegte sich sehr bedacht. Sergej, der im Handumdrehen Entscheidungen traf und sie dann unbeirrt umsetzte, ranzte ihn oft wegen seiner vermeintlichen Trägheit an, doch Toljas gemächliche Arbeitsweise machte ihn zum guten Lehrer und angenehmen Gefährten. Er arbeitete häufig für Surmatsch, vor allem beim Erstellen einer Naturkunde der Vögel in Primorje.
Am frühen Nachmittag machten wir Pause. Tolja entzündete ein Feuer, kochte Wasser aus dem Fluss und wir tranken Tee und zermalmten knirschend unsere Bonbons, während in den Bäumen über uns neugierige Kleiber pfiffen. Nach der Mittagspause schlug Tolja vor, jetzt solle ich die Führung übernehmen und meine Instinkte und das am Morgen Gelernte benutzen, während er zusah. Einen Abschnitt im Fluss, den ich zum näheren Prüfen für geeignet hielt, verwarf er als zu tief für die Uhus zum Jagen, einen anderen als zu dicht mit Weiden umwachsen, weil die riesigen Vögel dort schlicht nicht einfliegen konnten. Nachdem ich in einem langsam fließenden Nebenarm durchs Eis gebrochen war – zum Glück nur bis zu den Knien, dank meiner Watstiefel blieb ich trocken –, begriff ich, wie nützlich Toljas mit einer Metallspitze versehene Stange war, mit der er die Tragfähigkeit des Eises prüfte, bevor er es betrat. Wir folgten dem Fluss, bis sich das Tal zu einem spitzen V verengte und er unter Schnee, Eis und Fels verschwand.
An diesem Tag fanden wir keine Zeichen von Riesenfischuhus, blieben aber in der Dämmerung noch ein bisschen draußen, um ihr mögliches Rufen zu vernehmen. Doch die Wälder waren still, der Schnee am Fluss unberührt. Tolja war mir auch ein guter Lehrmeister darin, wie man auf das Ausbleiben greifbarer Ergebnisse reagiert. Er erklärte mir nämlich, dass Riesenfischuhus durchaus genau an der Stelle des Waldes leben mochten, an der wir standen, wir sie aber trotzdem eine Woche suchen oder ihnen lauschen könnten, bis wir sie endlich zu Gesicht bekämen. Natürlich fand ich das enttäuschend, aber es war eben eine Sache, gemütlich in Surmatschs Arbeitszimmer in Wladiwostok zu sitzen und über die Suche nach Riesenfischuhus zu reden, und eine vollkommen andere, es wirklich zu tun, in Kälte, Finsternis und Stille.
Es war schon lange dunkel, vielleicht neun Uhr, als wir nach Agsu zurückkamen. Schräg aus dem Fenster unserer Hütte fiel Licht auf den Schnee; Awdejuk und Schurik waren schon da. Sie hatten aus Kartoffeln und Elchfleisch, Geschenken vom Nachbarn, Suppe gekocht und als Gast einen dürren russischen Jäger in einem übergroßen Parka, der sich als Lëscha vorstellte. Er war um die vierzig, seine dicken Brillengläser verzerrten zwar seine Augen, doch nicht so sehr, dass sie hätten verbergen können, wie betrunken er war.
»Ich trinke seit zehn oder zwölf Tagen«, verkündete er dann auch am Küchentisch, als verstehe sich das doch wohl von selbst.
Während Sergej und ich unsere Eindrücke des Tages austauschten, teilte Schurik die Suppe aus, und Tolja holte aus dem Vorraum eine Flasche Wodka, die er zusammen mit ein paar Tassen feierlich mitten auf den Küchentisch stellte. Sergej missfiel das gewaltig. In Russland ist es unumstößlicher Brauch, dass man eine Flasche Wodka, die für Gäste auf den Tisch gestellt wird, erst wegräumt, wenn sie leer ist. In manchen Wodkabrennereien werden die Flaschen nicht mal mit einem Verschluss versehen, sondern mit einem dünnen Aluminiumdeckel zum Durchstechen. Denn wofür braucht man einen Verschluss? Entweder ist eine Flasche voll oder leer, und zwischen diesen beiden Zuständen vergeht nicht viel Zeit. Nun verpflichtete Tolja Sergej, Schurik und mich an einem Abend, an dem wir auf eine Trinkpause gehofft hatten, auf das Leeren einer Flasche Wodka. Wir waren zu fünft, aber Tolja hatte nur vier Tassen auf den Tisch gestellt. Ich schaute ihn fragend an.
»Ich trinke nicht«, erwiderte er auf meine stumme Frage. Womit er sich das Leiden ersparte, das einem weiteren Abend mit ausgiebigem Alkoholgenuss folgen würde. Später stellte ich sogar fest, dass das eine Marotte von ihm war. Er bot Gästen in unserem Namen Wodka an, ohne uns vorher zu fragen, und das oft zur Unzeit.
Bei Suppe und Schnaps sprachen wir über den Fluss. Sergej erklärte, dass die Samarga nicht besonders tief sei, man aber Respekt vor der Strömung haben müsse. Wer Pech hatte und im Eis einbrach, hatte vielleicht nicht genug Zeit, sich zu befreien, und die Strömung konnte ihn, ehe er sich versah, in einen raschen, kalten Tod hinabziehen. In diesem Jahr sei das schon einmal passiert, man hatte Spuren eines vermissten Dorfbewohners gefunden, die zu einer klaffenden, schmalen dunklen Spalte im Eis führten, unter dem die Samarga wild daherrauschte. Manchmal entdeckte man flussabwärts an der Mündung menschliche Skelette, Opfer der Samarga aus den vergangenen Jahren, verklemmt und verquer zwischen Holzstämmen, Felsbrocken und Sand.
Lëscha nahm mich genauer ins Visier.
»Wo wohns du?«, lallte er.
»In Ternei«, erwiderte ich.
»Bisu von hier?«
»Nein, ich bin aus New York.« Das war leichter, als Leuten, die wahrscheinlich keine Ahnung von der Geografie Nordamerikas hatten, zu erklären, wo Milwaukee und der Mittlere Westen waren.
»New Yor …«, sinnierte Lëscha, zündete sich eine Zigarette an und warf Sergej einen kurzen Blick zu. Und dann, als dringe ein wichtiger Gedanke durch den dichten Nebel ununterbrochenen Alkoholkonsums: »Warum lebsu in New Yor?«
»Weil ich Amerikaner bin.«
»Amerikaner?« Lëscha fielen fast die Augen aus, aber er schaute Sergej noch einmal an. »Er is Amerikaner?«
Sergej nickte.
Ungläubig und ohne mich aus dem Blick zu lassen, wiederholte Lëscha das Wort ein ums andere Mal. Offenbar hatte er noch nie einen Ausländer getroffen und schon gar nicht erwartet, dass dieser fließend Russisch sprach. Jetzt in seinem Heimatort Agsu an einem Tisch mit einem Feind aus dem Kalten Krieg zu sitzen war doppelt schwer zu verdauen.
Plötzlich hörten wir Geräusche von draußen. Eine kleine Gruppe Männer kam herein, die meisten erkannte ich vom Vorabend. Da ich am nächsten Morgen ausgeruht sein wollte, nahm ich das als Zeichen, mich nach hinten zu verziehen; auch Tolja kniff und spielte Schach mit Amplejew, einem russischen Rentner, der gegenüber von uns wohnte. Im Schein der Stirnlampe machte ich mir ein paar Notizen vom Tag und legte mich dann in meinen Schlafsack. Wieder zuckte ich beim Anblick des rot glänzenden Fleisch- und Fellhäufleins, das unbeachtet in der Ecke lag, zusammen. Es taute auf, wie das Eis auf dem Fluss, von dem wir abhängig waren.
3
Winterleben in Agsu
Im grauen Licht des nächsten Morgens hockte Sergej, Zigarette in der Hand, vor dem noch glimmenden Holzofen. Die Rauchringe, die er ausblies, gerieten in den Luftzug und verschwanden im Ofen. Sergej fluchte über die riesige, leere Äthanolflasche, die umgekippt auf dem Tisch lag, und sagte, wenn wir nicht bald aus Agsu weggingen, brächte ihn der Alkohol noch um. Einen freien Willen hätten wir nicht, solange wir hier seien, müssten wir mit den Dorfbewohnern trinken.
Während wir für die Arbeit draußen zusammenpackten, ermahnte mich Sergej zur Wachsamkeit. Riesenfischuhus seien einfach so scheu gegenüber Menschen, dass sie entwischen würden, bevor ich dicht genug dran sei, um sie zu sehen. Von Vorteil für uns sei allerdings, dass sie beim Fliegen einen ziemlichen Radau veranstalteten.
Das unterscheidet sie von ihren Eulenverwandten. Die meisten Vögel machen beim Fliegen Geräusche, und manche Arten kann man sogar nur am Schlagen ihrer Flügel erkennen. Eine Eule aber fliegt eigentlich vollkommen lautlos. Das liegt daran, dass ihre Schwungfedern am Rand mit winzig kleinen, kammähnlichen Zacken versehen sind, die wie eine Schallschluckvorrichtung fungieren und die Luft ablenken, bevor sie die Flügel erreicht, und auf diese Weise das Geräusch minimieren. Das nützt den Tieren, wenn sie auf der Erde Beute nachstellen. Nicht überraschend, dass die Schwungfedern eines Riesenfischuhus glatt sind und diese Anpassung nicht aufweisen, denn ihre Hauptbeutetiere leben unter Wasser. Besonders in stillen Nächten vibrierte oft die Luft, wenn sich Riesenfischuhus mit schweren Schwingen voranarbeiteten.
Der Plan für den heutigen Tag war mehr oder weniger wie der für den gestrigen. Riesenfischuhu-Arbeit im Feld ist eigentlich immer gleich: suchen, suchen und noch mal suchen. Wir mussten uns vernünftig anziehen, mehrere Schichten, denn wir würden bis nach Sonnenuntergang draußen bleiben. Die Fleecejacke, die ich beim Wandern durch die Nachmittagssonne sogar öffnete, würde mir nicht mehr warm genug sein, wenn ich in den fallenden Temperaturen nach Einbruch der Dunkelheit unbeweglich dasaß, um nach Rufen der Vögel zu lauschen. Spezialkleidung und -ausrüstung für die Arbeit waren aber außer einem Paar Watstiefeln bzw. brusthohen Wathosen nicht erforderlich. Tolja wollte seine Kamerautensilien nur mitschleppen, falls wir was fanden, das sich auch zu filmen lohnte. Ansonsten ließ er sie in der Hütte.
Ich wurde wieder ihm zugeteilt, und da er seinem Schachpartner Amplejew, der an diesem Tag angeln gehen wollte, versprochen hatte, ihn mit zum Fluss zu nehmen, hängten wir einen unserer leeren Schlitten an Toljas grünes Schneemobil, fuhren ein kleines Stück und hielten vor Amplejews Hütte. Er kam auch bald in einem wuchtigen Pelzmantel heraus, in Händen Eisstange und hölzerne Angelkiste, die er auch zum Sitzen auf dem Eis benutzen konnte. Er streckte sich gemütlich auf dem Schlitten aus, sein alter Hund, ein Laika, schmiegte sich an ihn und schaute mich an. Zum Jagen waren die beiden zu alt, aber angeln konnten sie noch.
»Fiiiischuhuuuu!«, sagte Amplejew auf Englisch und grinste mich an. Dann fuhren wir los.
Tolja hielt an der Stelle, die ihm der alte Mann nannte, gleich im Süden von Agsu, an einem offensichtlich bei Anglern beliebten Abschnitt des Flusses, an dem das Eis von überfrorenen Bohrlöchern vernarbt war.
Amplejew samt Hund glitten vom Schlitten, Tolja bohrte mit unserem Bohrer eine Auswahl an Löchern auf. Aus jedem erfolgreich gebohrten Loch quollen sofort Schneematsch und Wasser und verbreiteten sich über der Eisfläche. Es war Anfang April, und überall lugte der Frühling durch die Eiswelt um uns herum, hier und dort gab es aufgetaute Stellen, bald würde sich der gewaltige Wandel weiter ankündigen.
Nun, zum ersten Mal direkt auf der Samarga, verspürte ich doch ein gewisses Maß an Beklemmung und Ehrfurcht. Die Geschichten, die ich von dem Fluss gehört hatte, waren legendär. Die Samarga brachte Agsu zwar Leben, war jedoch gleichzeitig eine gnadenlose, eifersüchtige Macht, die jeden böse zurichtete, versehrte oder sogar umbrachte, der so anmaßend war, ihr die in ihrem Einflussbereich gebührende Aufmerksamkeit zu verweigern.
Tolja hakte den Schlitten vom Schneemobil ab und sagte, er werde zur Uhusuche zurück flussaufwärts fahren, merkte aber dann, dass er nichts für mich geplant hatte.
»Hm, warum suchst du nicht all diese offenen Wasserstellen nach Uhuspuren ab«, sagte er und wedelte vage, in einem weiten Bogen, mit seiner Eisstange. »In einer Stunde oder so bin ich zurück.«
Dann gab er mir die Eisstange mit den Worten, sie fleißig zu benutzen.
»Schlag auf das Eis, und wenn es hohl klingt oder die Stange durchstößt, halt dich fern.«
Und schon war er mit lautem Motorenknattern in einer Wolke von Auspuffgasen entschwunden.
Amplejew holte eine kurze Angelrute hervor sowie ein schmuddeliges, dreck- und fettverschmiertes Gefäß mit gefrorenem Lachsrogen aus seiner Angelkiste, schloss sie wieder und setzte sich darauf. Dann drückte er eine Handvoll Rogen an einem Eisloch unter Wasser weich, bestückte seinen Haken mit einem Ei und warf seine Schnur hinein. Ich deutete auf die offenen Flussabschnitte, die Tolja mir zum Prüfen vorgeschlagen hatte, und fragte Amplejew, ob das Eis darum herum wohl sicher sei. Er zuckte mit den Schultern.
»Um diese Zeit im Jahr ist kein Eis wirklich sicher.«
Mit diesen Worten wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Eisloch zu und ließ den Haken mit dem Köder in dem Dämmer unten tanzen, während der arthritische Laika herumwanderte.
Ich wiederum bewegte mich Zentimeter um Zentimeter über das Eis und schlug kräftig darauf ein, als hätte ich Angst, eine verborgene Falle auszulösen. Alle offenen Wasserbereiche umging ich weiträumig und suchte mit dem Fernglas ihre schneebedeckten Ränder nach Riesenfischuhu-Spuren ab. Ich fand nicht die geringste. Langsam, von einer offenen Stelle zur nächsten, beging ich auf diese Weise etwa einen Kilometer flussabwärts und hörte nach gut eineinhalb Stunden das Schneemobil. Als ich wieder an der Angelstelle war, sah ich, dass Tolja Schurik mitgebracht und beide sich zum Angeln zu Amplejew gesellt hatten. Mit ihren zuckenden Angelruten zogen sie Masu-Lachse und Arktische Äschen unter dem Eis hervor.
Beim Angeln erzählte mir Schurik, dass er aus demselben landwirtschaftlichen Städtchen Gaiworon stamme wie Surmatsch, nur ein paar Kilometer vom westlichen Ufer des Chankasees im Westen Primorjes gelegen. Orte wie Gaiworon liegen ökonomisch darnieder, haben kaum Arbeitsplätze und eine beträchtliche Armut, was wiederum zu weitverbreitetem Alkoholismus, schlechter Gesundheit und frühem Tod führt. Vor diesem Schicksal hatte Surmatsch Schurik, den Dorfjungen, bewahrt und ihn unter seine Fittiche genommen. Er hatte ihm beigebracht, wie man Vogelnetze benutzt, Vögel beringt und wieder freilässt (oder Bälge für Museumskollektionen präpariert), wie man sachgemäß Gewebe sammelt und Blutproben nimmt. Schurik hatte keine formale Ausbildung, doch seine Vogelbälge waren vorzüglich präpariert, seine Aufzeichnungen von der Feldforschung sehr genau, und im Finden von Riesenfischuhus war er eine Koryphäe. Als geschickter Kletterer auf hoch aufragende, morsche Primärwaldbäume (am liebsten in Socken), in deren Höhlen er nach Riesenfischuhu-Nestern sah, war er für das Team ein absoluter Gewinn.
Bis Einbruch der Nacht blieben wir an den Angellöchern, in der Hoffnung, den einen oder anderen Uhu zu hören. Ich behielt die Bäume im Blick, spähte nach Bewegungen in den Ästen und spitzte bei jedem noch so fernen Geräusch die Ohren. Doch eigentlich wusste ich nicht einmal, wie ein Riesenfischuhu klang. Klar, ich hatte mir die Ultraschallbilder in Pukinskis Studien aus den 1970ern angeschaut und auch gehört, wie Surmatsch und Awdejuk den Wechselgesang als Ausdruck des Territorialverhaltens der Riesenfischuhus nachahmten. Aber ich hatte keine Ahnung, wie lebensecht diese Töne waren.
Riesenfischuhu-Paare singen und rufen in Duetten. Das ist eine ungewöhnliche Eigenheit, die man von weniger als vier Prozent der Vogelarten auf der Erde kennt, und von denen leben die meisten in den Tropen. Meist beginnt das Männchen mit dem Duettieren. Es füllt einen Sack in seiner Kehle mit Luft, bis der so geschwollen ist, dass es wie ein monströser Ochsenfrosch mit Federn aussieht. Der weiße Fleck auf seiner Kehle wird ein auffallender Kreis, der von den Brauntönen seines Körpers und den Grautönen der dichter werdenden Dämmerung sehr absticht und seiner Gefährtin anzeigt, dass es gleich losgeht. Nach einem Moment stößt es wirklich einen kurzen heiseren Schrei aus, der klingt, als werde ihm die Luft herausgehauen, und das Uhuweibchen antwortet sofort. Doch sein Schrei klingt tiefer. Untypisch bei Eulenarten, weil Weibchen normalerweise eine höhere Stimme haben. Dann stößt das Männchen einen längeren, ein wenig höheren Schrei aus, auf den das Weibchen ebenfalls antwortet. Dieses aus vier Tönen bestehende Rufen und Antworten dauert nur drei Sekunden, aber die Vögel fahren damit in regelmäßigen Abständen fort, unterschiedlich lange, von einer Minute bis zu zwei Stunden. Es verläuft so synchron, dass viele Leute, die ein Riesenfischuhu-Paar rufen hören, meinen, es sei ein einziger Vogel.
An dem Abend vernahmen wir jedoch nichts dergleichen. Durchgefroren und enttäuscht kehrten wir im Dunkeln nach Agsu zurück, wo wir unsere Angelausbeute säuberten und brieten und zusammen mit vorbeikommenden Besuchern verspeisten. Meine Kollegen schüttelten die Enttäuschungen des Tages ab und widmeten sich umstandslos Essen und Trinken, und mir wurde klar, dass das alles für sie ein Job war. Manche Leute arbeiten auf dem Bau, andere entwickeln Software. Diese Männer waren von Beruf Assistenten bei Feldforschungen. Je nachdem, für welche Tierart Surmatsch Geld auftrieb, suchten sie danach. Riesenfischuhus waren eben nur Vögel für sie. Nicht, dass ich sie deshalb verurteilte, aber für mich bedeuteten die Tiere doch viel mehr. Meine akademische Laufbahn und vielleicht der Schutz dieser gefährdeten Spezies hingen von dem ab, was wir fanden und was wir mit den gewonnenen Informationen anfingen. Surmatsch und ich würden Daten sammeln, analysieren und interpretieren. Aus meiner Perspektive betrachtet, fing das alles nicht besonders gut an. So recht vorangekommen waren wir nicht, und das Eis im Fluss schmolz kontinuierlich. Einigermaßen sorgenvoll legte ich mich schlafen.
Am folgenden Tag ging ich mit Sergej in den Wald. Wir wollten nur wenig weiter südlich von der Stelle, an der ich am Vortag gewesen war, nach Uhus beziehungsweise ihren Spuren suchen. Da Sergej erst am frühen Nachmittag aufzubrechen gedachte, hatten wir lediglich ein paar Stunden für diese Arbeit, bevor wir in der Dämmerung nach Rufen horchen konnten. Jetzt wollte Sergej, dass wir erst noch einmal die Pläne für unsere Erkundungen flussabwärts ansahen und sicherstellen, dass wir genug Feuerholz für unseren restlichen Aufenthalt in Agsu hatten.
Also saß ich vormittags bei einer Tasse schwarzem Tee allein in der Küche und studierte Karten, während Sergej draußen Holz hackte. Plötzlich stürzte ein Bär von Mann, riesig und haarig, herein und kam zum Tisch. Er trug einen dicken, filzgefütterten Mantel aus gegerbter Tierhaut, vermutlich eine Eigenkonstruktion. Der linke Ärmel hing schlaff herunter. Es musste Wolodja Loboda sein, der einzige einarmige Jäger im Ort und trotz des Jagdunfalls, bei dem er verkrüppelt worden war, gerühmt als einer der besten Schützen in Agsu.
Ohne Umschweife setzte er sich hin, zog zwei Halbliterdosen Bier aus den Manteltaschen und knallte sie auf den Tisch. Die Dosen waren sicher gut angewärmt.
»So«, sagte er und schaute mich zum ersten Mal an. »Du jagst.«
Es war eine Tatsachenfeststellung, keine Frage. Und anscheinend erwartete er eine für Jäger typische Antwort: was ich gern jagte, wo ich jagte, was für einen Typ Gewehr ich benutzte. Das nahm ich jedenfalls an, denn ich bin kein Jäger, und sagte es ihm auch. Er rutschte auf dem Hocker herum, stützte sich mit dem Armstumpf auf den Tisch und behielt mich fest im Blick. Sein Arm fehlte ihm vom Ellenbogen an abwärts.
»Dann angelst du.«
Auch wieder eine Feststellung, aber jetzt weniger überzeugt. Und als müsse ich mich entschuldigen, verneinte ich. Da wandte er sich ab und stand abrupt auf.
»Was zum Teufel willst du dann in Agsu?«, knurrte er.
Obwohl das nun schließlich eine Frage war, war sie rhetorisch. Er packte die beiden noch ungeöffneten Bierdosen wieder in seine Manteltaschen und ging ohne ein weiteres Wort hinaus.
Lobodas Missachtung hatte gesessen. So unrecht hatte er nicht. Hier an der Samarga war das Leben eine ständige Herausforderung. Das bewiesen die Wildnis ringsum und Lobodas Armstumpf. Andererseits war ich in Agsu, weil ich alles, was möglich war, über Riesenfischuhus lernen und dazu beitragen wollte, dass diese Gegend so unverdorben blieb, wie es irgend ging – und damit auch dafür sorgen würde, dass Loboda und Leute wie er immer Wild zum Jagen und Fische zum Angeln hatten.
Nach dem Mittagessen packten Sergej und ich Proviant ein – Bonbons und Würstchen – und brachen zum Fluss auf. Am Rand von Agsu hielt mein Kollege mit laufendem Motor vor einer mir unbekannten Hütte an. Durch die kleine Glasscheibe in der Tür winkte uns ein Mann mit weit aufgerissenen Augen verzweifelt zu und bedeutete uns, zu ihm zu kommen.
»Bleib hier«, sagte Sergej.





























