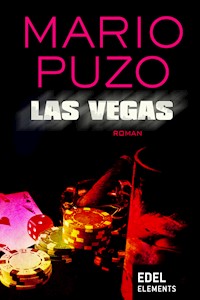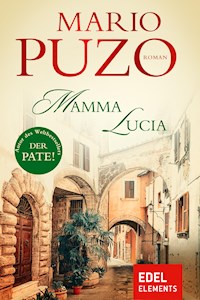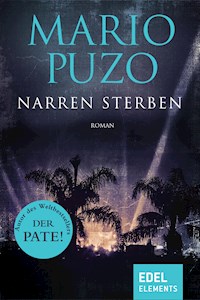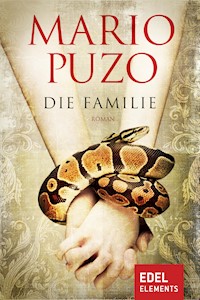
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Italien, zur Zeit der Renaissance. Schutzlos ist das Land den Kriegen ausgeliefert, die die Stadtstaaten gegeneinander führen. Auch in Rom herrschen gesetzlose Zustände: Kardinal Rodrigo Borgia beginnt ein grausames Intrigenspiel. Mario Puzo verwebt Fakten und Fiktion zu einem grandiosen Familienepos - ein überrwältigender Beweis seiner meisterhaften Erzählkunst. Die Borgias gelten in vielerlei Hinsicht als die erste wirklich kriminelle Familie Italiens. Und so war zum Aufzeichnen ihrer Geschichte niemand prädestinierter als Mario Puzo, Schöpfer und Autor der legendären Mafiasaga "Der Pate"! Puzo hegte den lebenslangen Traum, einen Roman über diese mächtige Familie der Borgias zu schreiben - der Familie, die in Italien zur Zeit der Renaissance eine so herausragende und bestimmende Rolle gespielt hat. Aus ihrer Mitte kamen Päpste und Politiker, sie hatte Einfluß auf die Geschicke des Landes im 15. Jahrhundert und stand als Sinnbild für eine üppige und verruchte Lebensführung einer skandalumwitterten und schillernden Dynastie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mario Puzo
Die Familie
Vollendet von Carol Gino Ins Deutsche übertragen von Peter Hahlbrock
Edel eBooks
Inhalt
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreissigstes Kapitel
Epilog
Nachwort
Mag ich verflucht sein, mag ich niedrig und gemein sein, doch lasst mich auch den Saum des Gewandes küssen, in das sich mein Gott hüllt; mag ich auch zur selben Zeit dem Teufel folgen, so bin ich doch Dein Sohn, Herr, und liebe Dich und empfinde die Freude, ohne die die Welt nicht bestehen und nicht sein kann!
FJODOR DOSTOJEWSKI,
Die Brüder Karamasow
Prolog
Als der Schwarze Tod in Europa um sich griff und die Hälfte der Bevölkerung mit sich riss, wandten viele Menschen die Blicke verzweifelt vom Himmel zur Erde. Dort hofften die philosophischen Geister, um Herrschaft über die Welt zu erlangen, die Geheimnisse der Existenz aufzudecken und die großen Mysterien des Lebens zu entschlüsseln, während die Armen nur wünschten, von ihren Leiden erlöst zu werden.
Und so geschah es, dass Gott zur Erde fiel als Mensch und die starre religiöse Lehre des Mittelalters ihre Macht verlor und durch das Studium der großen antiken Zivilisationen Roms, Griechenlands und Ägyptens ersetzt wurde. Während der Kreuzzugsgeist schwand, wurden die Herren des Olymps wiedergeboren und die olympischen Schlachten von neuem geschlagen. Der Menschengeist forderte Gott heraus und die Vernunft regierte.
Dies war eine Zeit großer Leistungen in der Philosophie, den Künsten, der Medizin und Musik. Die Kultur blühte auf mit großer Pracht und an Mitteln wurde nicht gespart. Alte Gesetze wurden gebrochen, ehe neue geschaffen wurden. Der Übergang von der gehorsamen Befolgung von Gottes Wort und dem Glauben an die ewige Seligkeit zur Hochachtung des Menschen und der Erwartung einer Belohnung in der materiellen Welt – der Übergang zum Humanismus (wie man den neuen Glauben nannte) – war in Wahrheit nicht einfach zu finden.
Damals war Rom keine Heilige Stadt, sondern ein gesetzloser Ort. Auf den Straßen war man seines Lebens nicht sicher, Raub und Prostitution waren allgegenwärtig und wöchentlich wurden Hunderte von Menschen ermordet.
Zudem existierte damals noch kein italienischer Staat. Die unabhängigen Stadtstaaten des Landes – Venedig, Mailand, Florenz, Neapel und Rom – wurden von alten Familien regiert, die Könige mit örtlich begrenzter Macht ließen Herzöge und Bischöfe aus ihren eigenen Reihen regieren. Benachbarte Stadtstaaten kämpften um territoriale Gewinne. Und die Sieger in diesen Kriegen mussten immer auf der Hut sein, denn sie konnten sich nie darauf verlassen, das Eroberte in Frieden zu genießen.
Von außen drohten stets Überfälle anderer Mächte, die bestrebt waren, ihre Reiche zu vergrößern. Die Herrscher Frankreichs und Spaniens kämpften um neue Territorien und die unchristlichen barbarischen Türken bedrohten den Kirchenstaat.
Kirche und Staat stritten um die Vorherrschaft. Nach der Tragikomödie des großen Schismas – wo sich zwei Päpste, die in zwei Städten regierten, die Macht und Einkünfte teilen mussten – war jetzt die Kirche wieder vereinigt, stand der Papstthron wieder in Rom, und diese Konsolidierung der kirchlichen Macht gab den Kirchenfürsten neue Hoffnung. Sie hatten sich jetzt nur noch mit der weltlichen Macht, den Königen, Königinnen und Herzögen der Stadtstaaten und Lehnsfürstentümer auseinander zu setzen. Dennoch war die Heilige Katholische Kirche in Aufruhr, denn die grassierende Gesetzlosigkeit machte vor dem Klerus nicht Halt.
Kardinäle schickten ihre Bediensteten mit Steinen und Armbrüsten in Straßenschlachten mit der römischen Jugend, die Inhaber hoher Kirchenämter – die von Amts wegen auf die Ehe verzichten mussten – besuchten Kurtisanen und hielten zahlreiche Geliebte aus, Bestechungen waren gang und gäbe, und gegen Zahlung angemessener Beträge war der hohe Klerus nur allzu gewillt, jeden von den Gesetzen der Kirche zu dispensieren und selbst die scheußlichsten Verbrechen zu rechtfertigen.
Im Volke hieß es, dass in Rom alles käuflich sei. Hatte man Geld genug, so konnte man Kirchen, Priester, Dispens und sogar die Vergebung Gottes kaufen.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurden damals die Männer Priester und traten in den Kirchendienst, weil sie jüngere Söhne ihrer mächtigen Väter waren, als solche deren weltliche Macht daher nicht erben konnten und deshalb von Kindesbeinen an für den geistlichen Beruf erzogen wurden. Die Wenigsten empfanden wahre Berufung zum geistlichen Amt, aber da die Kirche noch immer die Macht hatte, Könige zu krönen und großen Segen auf Erden zu erteilen, brachte jede adlige Familie Italiens Geschenke und Bestechungsgelder auf, um sich die Ernennung ihrer Söhne in das Kardinalskollegium zu sichern.
Das war die Renaissance. Die Zeit des Kardinals Rodrigo Borgia und seiner Familie.
Erstes Kapitel
Die goldenen Strahlen der Sommersonne wärmten an diesem Tage das Kopfsteinpflaster der Straßen von Rom, als der Kardinal Rodrigo Borgia geschwinden Schritts vom Vatikan zu dem dreistöckigen Haus an der Piazza de Merlo unterwegs war, wo er drei kleine Kinder sein Eigen nennen konnte: seine Söhne Cesare und Juan und seine Tochter Lucrezia. Fleisch von seinem Fleische, Blut von seinem Blute. An diesem Tage fühlte sich der Vizekanzler des Papstes, der zweitmächtigste Mann der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche besonders gesegnet.
Beim Hause der Mutter seiner Kinder, Vanozza Catanei, angelangt, pfiff er vergnügt vor sich hin. Als Sohn der Kirche war ihm die Ehe verboten, doch als Gottesmann war er sich gewiss, Einblick in die Pläne des Herrn zu haben. Denn hatte nicht der himmlische Vater sogar im Paradies zur Vervollständigung Adams diesem sein Weib Eva geschaffen? Folgte daraus etwa nicht, dass in dieser von Unglück erfüllten, unzuverlässigen Welt ein Mann den Trost einer Frau noch dringender brauchte? Er hatte schon als junger Bischof drei Kinder gezeugt, aber diese drei Jüngsten seiner Kinder, die er mit Vanozza hatte, waren ihm besonders teuer. Sie schienen in ihm die gleichen großen Leidenschaften zu entfachen, wie sie es getan hatte. Und schon jetzt, da sie noch so klein waren, stellte er sich vor, dass sie auf seinen Schultern stünden und mit ihm den Riesen bildeten, der berufen sein würde, den Kirchenstaat zu einigen und die Herrschaft der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche über die Welt auszudehnen.
Die Kinder waren es gewöhnt, den regelmäßigen Besucher des Hauses »Papa« zu nennen und empfanden dessen Ergebenheit ihnen gegenüber und Loyalität zum Heiligen Stuhl als keineswegs unvereinbar. Und die Tatsache, dass dieser Mann zugleich ihr Vater und ein Kardinal der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche war, hatte für sie nichts Beunruhigendes. Schritten nicht auch der Sohn und die Tochter Papst Innozenz’ bei festlichen Prozessionen und Umzügen in großer Pracht durch die Straßen Roms?
Kardinal Rodrigo Borgia war mit seiner Geliebten Vanozza schon seit über zehn Jahren zusammen. Er lächelte, wenn er daran dachte, wie wenige Frauen ihm so viel Erregung verschafft und sein Interesse so lange hatten wach halten können wie diese. Nicht etwa, dass Vanozza die einzige Frau in seinem Leben gewesen wäre, denn er war ein Mann mit großem Verlangen auf alle weltlichen Genüsse. Doch die wichtigste Stellung unter seinen Frauen kam zweifellos Vanozza zu. Sie war intelligent – aus seiner Sicht –, schön und mit ihr konnte er von irdischen und himmlischen Dingen reden. Sie hatte ihm schon oft weise Ratschläge erteilt, und er hatte sich dafür erkenntlich gezeigt, als großzügiger Liebhaber und ergebener Vater ihrer Kinder.
Vanozza stand im Eingang ihres Hauses und winkte tapfer lächelnd ihren drei Kindern zum Abschied. Eine ihrer großen Stärken bestand nun, da sie das vierzigste Lebensjahr vollendet hatte, darin, den Mann zu verstehen, der die Gewänder eines Kardinals trug. Sie wusste, dass er von glühendem Ehrgeiz beseelt war, ihm ein unauslöschliches Feuer im Leibe brannte und er unentwegt auf eine Strategie sann, welche die Reichweite der Heiligen Katholischen Kirche erweitern, neue Bündnisse für sie schließen, die sie stärken und seine persönliche Macht festigen sollte. Er hatte über all diese Dinge mit ihr gesprochen. Ideen marschierten durch seinen Geist so unaufhaltsam wie Armeen durch neue Territorien. Es war ihm bestimmt, ein großer Menschenführer zu werden, und mit ihm würden auch ihre Kinder emporkommen. Vanozza versuchte sich mit dem Wissen zu trösten, dass sie als des Kardinals legitime Erben eines Tages Reichtum, Macht und günstige Verbindungen ihr Eigen nennen würden; also konnte sie sie ziehen lassen.
Nun drückte sie nur Jofre, den Säugling, an sich; ihn konnte man ihr noch nicht wegnehmen, ihn hatte sie noch an der Brust. Bald schon würde auch er fortgehen müssen. Ihre dunklen Augen waren feucht von Tränen. Nur einmal schaute ihre Tochter Lucrezia zurück. Die Knaben sahen geradeaus und wandten sich nicht nach ihr um.
Vanozza sah die ansehnliche, achtunggebietende Gestalt des Kardinals nach der Hand ihres jüngeren Sohns Juan greifen und die winzige Hand seiner dreijährigen Tochter Lucrezia halten. Ihr ältester Sohn Cesare schien sich übergangen zu fühlen und sah bestimmt bereits mürrisch und unzufrieden aus. Da drohte gewiss Ärger. Doch mit der Zeit würde Rodrigo die Kinder genauso gut kennen lernen, wie sie sie kannte. Zögernd schloss sie das schwere hölzerne Haustor.
Sie waren erst wenige Schritte gegangen, als Cesare, der nun ganz unverhohlen zornig war, seinen Bruder Juan einen so kräftigen Stoß versetzte, dass Juan die Hand seines Vaters loslassen musste und fast zu Boden gestürzt wäre. Der Kardinal verhinderte den Sturz des kleinen Jungen, drehte sich um und fragte: »Cesare, mein Sohn, konntest du nicht einfach um das bitten, was du willst, anstatt deinen Bruder zu stoßen?«
Juan, der nur ein Jahr jünger, aber viel schmächtiger als der siebenjährige Cesare war, kicherte stolz, als der Vater ihm so zu Hilfe kam. Doch ehe er sich lange in seiner Genugtuung wiegen konnte, trat Cesare dem kleinen Bruder heftig auf den Fuß.
Juan schrie vor Schmerz auf.
Der Kardinal packte Cesare mit seiner großen Hand am Hemd, hob ihn hoch und schüttelte ihn so derb, dass ihm die kastanienbraunen Locken ins Gesicht fielen. Dann stellte er das Kind wieder auf die Füße. Er kniete vor dem kleinen Jungen nieder, seine grauen Augen schauten bereits sanfter. »Was ist, Cesare? Was hat dir so missfallen?«
Die dunklen Augen des Jungen glühten wie Kohlen und er starrte den Vater an. »Ich hasse ihn, Papa«, sagte er mit leidenschaftlicher Stimme. »Du ziehst ihn immer vor.«
»Nein, nein, Cesare«, meinte der Kardinal belustigt. »Die Stärke einer Familie besteht wie die Stärke eines Heeres in der gegenseitigen Loyalität ihrer Angehörigen. Überdies ist es eine Todsünde, den eigenen Bruder zu hassen, und es gibt keinen guten Grund, dass man solcher Empfindungen wegen das eigene Seelenheil in Gefahr bringt.« Er stand nun, hoch aufragend, neben seinen kleinen Söhnen. Dann klopfte er sich lächelnd auf den stattlichen Bauch. »Es gibt doch sicherlich genug von mir für euch alle ... oder etwa nicht?«
Rodrigo Borgia war ein beleibter Mann, jedoch groß genug, sein Gewicht zu tragen. Er war eher auf plebejische denn auf aristokratische Art gut aussehend. Seine dunklen Augen funkelten oft belustigt, seine Nase war zwar groß, aber nicht abstoßend, und die vollen sinnlichen Lippen, die gewöhnlich lächelten, verliehen ihm ein großzügiges Äußeres. Doch es war seine persönliche Anziehungskraft, die unfassbare Energie, die er ausstrahlte, die jeden davon überzeugte, dass er einer der interessantesten Männer seiner Zeit war.
»Ces, du kannst meinen Platz haben«, sagte die Tochter Rodrigos nun zu Cesare mit einer so klaren Stimme, dass sich der Kardinal fasziniert ihr zuwandte. Lucrezia, die mit vor der Brust verschränkten Armen dastand und deren lange blonde Locken über die Schultern hingen, hatte einen Ausdruck fester Entschlossenheit auf ihrem engelsgleichen Gesichtchen.
»Willst du nicht deines Papas Hand halten?«, fragte der Kardinal, als wollte er mit ihr schmollen.
»Ich muss nicht weinen, wenn ich nicht deine Hand halte«, sagte sie. »Und ich werde auch deshalb nicht gleich wütend.«
»Crezia«, meinte Cesare, »sei nicht dumm. Juan benimmt sich einfach wie ein Baby. Er kann sehr gut alleine gehen.« Er starrte seinen Bruder wütend an, während dieser schnell mit dem seidenen Ärmel des Hemdes seine Tränen trocknete.
Der Kardinal kraulte Juan das dunkle Haar und tröstete ihn. »Hör auf zu weinen. Du kannst meine Hand nehmen.« Dann wandte er sich zu Cesare und sagte: »Und du, mein kleiner Krieger, kannst die andere nehmen.« Dann sah er Lucrezia an und lächelte. »Und du, süßes Kind? Was soll Papa mit dir machen?«
Als das Kind seinen Gesichtsausdruck nicht änderte und keine Gemütsregung erkennen ließ, war der Kardinal entzückt. Er lächelte anerkennend. »Du bist wirklich Papas Tochter und zum Lohn für deine Großmut und deine Tapferkeit darfst du auf dem einzigen Ehrenplatz sitzen.«
Rodrigo Borgia beugte sich nieder und hob das kleine Mädchen hoch und setzte es auf seine Schultern. Dabei lachte er voller Freude.
Als er nun, umweht von seinen fließenden, eleganten Gewändern, vorwärts schritt, sah seine Tochter aus wie eine neue und schöne Krone auf dem Kopfe des Kardinals.
An diesem Tage brachte Rodrigo Borgia seine Kinder im Orsini-Palast unter, der dem seinigen gegenüber am Vatikan stand. Seine verwitwete Cousine Adriana Orsini sorgte dort für sie und überwachte ihre Erziehung. Als Adrianas Sohn Orso sich mit dreizehn verlobte, zog seine Verlobte Julia Farnese, die damals schon fünfzehn war, ebenfalls in den Palast und kümmerte sich mit Adriana um die Kinder.
Obwohl nun der Kardinal die Alltagsverantwortung für seine Kinder übernommen hatte, besuchten diese doch noch ihre Mutter, die jetzt mit ihrem dritten Ehemann, Carlo Canale, verheiratet war. Rodrigo Borgia hatte, wie bereits die beiden früheren Ehemänner Vanozzas, auch diesen dritten für sie ausgewählt, denn er wusste, dass eine Witwe einen Ehemann brauchte, der ihr Schutz bot und den Ruf eines angesehenen Hauses. Der Kardinal war gut zu ihr gewesen, und was sie nicht von ihm erhalten hatte, hatte sie von ihren verstorbenen Ehemännern geerbt. Im Gegensatz zu den schönen, aber geistlosen Kurtisanen, mit denen sich mancher römische Edelmann zu schmücken glaubte, war Vanozza eine praktische Frau und wurde deswegen von Rodrigo umso mehr bewundert. Sie besaß mehrere gut geführte Gasthäuser und ein Landgut, aus dem sie ein ansehnliches Einkommen bezog – und da sie eine fromme Frau war, hatte sie auch eine der Madonna geweihte Kapelle errichten lassen, in der sie ihre täglichen Gebete sprach.
Nach zehn Jahren hatte ihre Leidenschaft füreinander begonnen sich abzukühlen und so wurden sie gute Freunde.
Nach wenigen Wochen musste Vanozza auch Jofre hergeben, denn der Knabe verzehrte sich nach seinen Brüdern und seiner Schwester. Und so befanden sich nun alle Kinder Rodrigo Borgias in der Obhut seiner Cousine.
Wie es sich für die Kinder eines Kardinals gehörte, wurden sie während der nächsten Jahre von den fähigsten Lehrern Roms unterrichtet, in den Geisteswissenschaften, in Astronomie und Astrologie, in alter Geschichte und verschiedenen Sprachen, darunter Spanisch, Französisch, Englisch und natürlich die Sprache der Kirche, Latein. Cesare tat sich durch seine Intelligenz und seinen Ehrgeiz hervor, aber am meisten versprach die Entwicklung Lucrezias, denn sie besaß vor allem Charakter und wahre Tugend.
Obwohl viele junge Mädchen in die Klöster geschickt und dort erzogen und den Heiligen geweiht wurden, wurde, mit Einwilligung des Kardinals und auf Rat Adrianas, Lucrezia den Musen geweiht und von den gleichen hochbegabten Lehrern erzogen wie ihre Brüder. Weil sie die Künste liebte, lernte sie die Laute zu schlagen, zu tanzen und zu zeichnen. Sie konnte hervorragend auf silbernen und goldenen Stoffen sticken.
Wie es ihre Pflicht war, entwickelte Lucrezia alle Reize und Talente, die ihren Wert für die ehelichen Bündnisse zu steigern geeignet waren, von denen die Familie der Borgias zukünftige Vorteile erhoffte. Insbesondere liebte sie die Poesie. Stundenlang saß sie über Versen, welche die Liebe zu Gott und Entzückung für ihn zum Gegenstand hatten. Auch die romantische Liebe liebte sie zu besingen. Aber insbesondere fühlte sie sich von den Heiligen inspiriert, und oft war ihr Herz so voll, dass ihr die Worte fehlten.
Julia Farnese verwöhnte Lucrezia wie eine jüngere Schwester, und Adriana bedachte sie, wie auch der Kardinal, reichlich mit Aufmerksamkeit. Sie wuchs also als glückliches Kind von angenehmem Wesen auf. Sie war wissbegierig und umgänglich. Disharmonie war ihr zuwider, und so tat sie stets, was in ihrer Macht stand, um den Frieden in der Familie zu wahren.
An einem schönen Sonntag, nachdem er im Petersdom das Hochamt gefeiert hatte, lud der Kardinal Borgia seine Kinder in den Vatikanpalast ein. Er bewies damit Mut, wenn nicht sogar eine gewisse Verwegenheit, denn bis zu den Tagen von Papst Innozenz war es üblich gewesen, dass Kleriker ihre Kinder als ihre Neffen und Nichten ausgaben. Bekannte sich ein Kleriker offen zu seiner Vaterschaft, so riskierte er, bei der nächsten Ernennung zu einem hohen kirchlichen Amt übergangen zu werden. Natürlich war bekannt, dass Kardinäle und sogar Päpste Kinder hatten, jeder wusste, dass auch Kirchenfürsten sündigten, aber so lange diese geheimen Beziehungen unter dem Deckmantel der Familie verborgen blieben und nur auf geheimen Pergamenten unzweideutig festgestellt wurden, wurde die Ehre des Amtes nicht davon befleckt. Mochte jeder glauben, was er wollte, der Kardinal jedoch hatte für Heuchelei nichts übrig. Natürlich gab es Zeiten und Gelegenheiten, bei denen auch er die Wahrheit zu ändern und zu beschönigen genötigt war. Aber das war selbstverständlich, er war schließlich Diplomat.
Adriana zog den Kindern zu diesem Anlass die schönsten Kleider an. Cesare ging in schwarzem Satin, Juan in weißer Seide, und der erst zweijährige Jofre trug einen blauen Samtanzug, der reich mit Stickerei besetzt war. Julia kleidete Lucrezia in ein pfirsichfarbenes langes Spitzenkleid und setzte dem Mädchen ein kleines Diadem in die hellblonden Locken.
Der Kardinal hatte soeben die Lektüre eines Dokuments beendet, das ihm von seinem obersten Rat Duarte Brandao aus Florenz gebracht worden war. Es ging darin um einen gewissen Bruder des Ordens der Dominikaner, der neuerdings in Florenz von sich reden machte. Von diesem Savonarola hieß es, er wäre ein Prophet und vom Heiligen Geist inspiriert. Der Kardinal sah jedoch seine Zwecke durch ihn gefährdet, vor allem, weil das Volk von Florenz sich zu seinen Predigten drängte und seinen Ermahnungen zujubelte. Er war ein sehr wortgewandter Prediger, galt als Seher, und seine feurigen Worte richteten sich oft gegen die fleischlichen und finanziellen Exzesse des römischen Papsttums.
»Wir müssen diesen einfachen Ordensbruder im Auge behalten«, sagte Rodrigo Borgia. »Denn schon manche große Dynastie ist gestürzt worden durch einfache Männer, die sich im Besitz einer heiligen Wahrheit glaubten.« Brandao war groß und dünn, mit langem schwarzem Haar und eleganten Gesichtszügen. Er schien sanften und freundlichen Wesens zu sein; doch in Rom verlautete gerüchteweise, dass, wenn er durch Untreue oder Unverschämtheit herausgefordert wurde, der Zorn dieses Mannes nicht seinesgleichen hatte. Dass nur ein Narr es wagen würde, sich ihn zum Feinde zu machen, war allgemeine Meinung. Jetzt glättete sich Duarte den Schnurrbart mit dem Zeigefinger, während er darüber nachsann, was Rodrigo Borgia gesagt hatte.
»Es heißt auch, dass dieser Mönch von der Kanzel die Medici angreift und dass die Bürger von Florenz ihm dabei zujubeln.«
Als die Kinder Rodrigo Borgias private Gemächer betraten, verstummte das Gespräch. Duarte Brandao grüßte sie mit einem Lächeln und trat beiseite.
Lucrezia warf sich dem Kardinal freudig in die Arme, aber die Jungen standen abwartend, die Hände auf dem Rücken. »Kommt, meine Söhne«, sagte Rodrigo, der noch immer seine Tochter in den Armen hielt. »Kommt und gebt Papa einen Kuss.« Und mit einem warmen Lächeln des Willkommens winkte er ihnen zu, doch näher zu kommen.
Cesare war als Erster beim Vater. Rodrigo Borgia setzte Lucrezia auf einen kleinen goldenen Hocker, der zu seinen Füßen stand, und umarmte seinen Sohn. Er war ein kräftiger Junge, groß und muskulös. Dem Vater gefiel diese Robustheit, sie vergewisserte ihn seiner eigenen Zukunft. Er lockerte seine Umarmung und schob den Jungen auf Armeslänge von sich, sodass er ihn ansehen konnte. »Cesare«, sagte er liebevoll. »Ich danke der heiligen Jungfrau jeden Tag, denn du erfreust mein Herz jedes Mal, wenn ich dich anschaue.« Cesare lächelte glücklich; dass sein Vater sich freute, ihn zu sehen, machte ihn froh.
Dann trat Cesare beiseite, um Platz für Juan zu machen. Es mochte der schnelle Herzschlag des jüngeren Knaben gewesen sein, den er an der eigenen Brust fühlte, es mochte der schnelle Atem gewesen sein, der die Nervosität des Jungen verriet, irgendetwas jedenfalls ließ Juan verletzlich und besonders schutzbedürftig erscheinen. Und als der Kardinal ihn umarmte, drückte er ihn nicht so fest an sich wie zuvor den Älteren, doch hielt er ihn ein wenig länger.
Speiste der Kardinal in seinen Gemächern im Vatikan allein, so aß er spartanisch, nur Brot, Früchte und Käse, doch an diesem Tag hatte er befohlen, ein üppiges Mahl aufzutragen, mit Nudeln, Geflügel, Rindfleisch und Pyramiden von kandierten Kastanien.
Als sich nun die Kinder, Adriana, deren Sohn Orso und die schöne und bezaubernde Julia Farnese plaudernd und lachend zu Tisch setzten, fühlte sich Rodrigo Borgia in der Huld des Glücks. So, im Kreise seiner Familie und Freunde, befand er das Erdenleben für gut. Er sprach ein stilles Dankgebet. Als ihm sein Diener blutroten Wein in seinen silbernen Pokal goss, war er noch immer von diesem Empfinden beseelt. Und so bot er, als Zeichen der Zuneigung, seinem Sohn Juan, der neben ihm saß, den ersten Schluck an.
Juan kostete den Wein und verzog das Gesicht. »Er ist zu bitter, Papa. Ich mag ihn nicht.«
Rodrigo Borgia, stets auf der Hut, erstarrte vor Furcht. Dies war ein süßer Wein, bitter durfte er keinesfalls schmecken ...
Sofort klagte Juan über Übelkeit und Magenschmerzen ließen ihn sich krümmen. Sein Vater und Adriana versuchten, ihn zu beruhigen, doch kurz darauf musste Juan sich heftig erbrechen. Der Kardinal hob den Jungen aus seinem Sessel und trug ihn in das Vorzimmer, wo er ihn auf ein mit Brokat bedecktes Sofa legte.
Umgehend wurde der päpstliche Leibarzt gerufen, aber noch ehe er eintraf, hatte Juan das Bewusstsein verloren.
»Gift«, erklärte der Arzt, nachdem er das Kind untersucht hatte.
Juan war weiß wie der Tod und fieberte bereits; ein dünner Streifen schwarzer Galle rann ihm aus dem Munde. Er sah sehr klein und hilflos aus. Rodrigo Borgia verlor seine Beherrschung. Er wurde wütend. »Ein Gift, das mir zugedacht war ...«
Duarte Brandao stand neben ihm, nun mit gezogenem Degen, wachsam für den Fall, dass noch weitere Anschläge gegen die Sicherheit des Kardinals oder seiner Familie zu gewärtigen wären.
Der Kardinal wandte sich an ihn: »Es gibt einen Feind im Palast. Lassen Sie alle Angehörigen des Hauses sich im Hauptsaal versammeln. Geben Sie jedem einen Becher Wein zu trinken und bringen Sie mir denjenigen, der sich weigert.«
Adriana flüsterte bestürzt: »Geliebter Vetter, Euer Hochwürden, Euer Kummer ist mir allzu verständlich, aber auf diese Weise werdet Ihr Eure treuesten Bediensteten verlieren, denn viele werden erkranken und manche sterben ...«
»Ich werde ihnen nicht den Wein anbieten, den mein armer unschuldiger Sohn zu trinken bekam. Der Wein, den ich ihnen einschenken lassen werde, wird rein sein. Aber der Sünder wird fürchten, daran zu ersticken, noch ehe er den Becher an die Lippen setzt.«
Duarte führte sofort die Anordnungen des Kardinals aus. Juan lag still wie ein Stein, blass wie der Tod. Adriana, Julia und Lucrezia saßen an seiner Seite und legten ihm nasse Tücher auf die Stirn und rieben sie mit Heilsalben ein.
Kardinal Rodrigo Borgia nahm die kleine schlaffe Hand des Kranken und küsste sie, dann begab er sich in seine Hauskapelle und kniete vor der Madonna zum Gebet nieder. Er trug ihr Argumente vor, denn er wusste, dass sie verstand, was es hieß, einen Sohn zu verlieren, und dass sie den Schmerz kannte, den ein solcher Verlust verursacht. Und dann gelobte er: »Ich werde tun, was in meiner Macht steht, alles irgend Menschenmögliche, die unsterblichen Seelen von Abertausenden der einen wahren Kirche zuzuführen. Deiner Kirche, Heilige Mutter. Ich werde dafür sorgen, dass sie deinen Sohn anbeten, wenn du nur meinen Sohn vom Tode erretten mögest ...«
Der junge Cesare stand an der Schwelle der Kapelle, und als der Kardinal zu ihm hinüberblickte, hatte er Tränen in den Augen. »Komm, Cesare. Komm, mein Sohn. Bete für deinen Bruder.« Und Cesare kniete neben seinem Vater nieder.
In den Gemächern des Kardinals saßen alle schweigend beisammen, bis Duarte zurückkam und verkündete: »Der Schuldige ist gefunden. Es ist ein Küchenjunge, der früher im Dienste des Hauses Rimini stand.«
Rimini war ein kleines Herzogtum an der Ostküste Italiens. Der regierende Herzog Gaspare Malatesta war ein gefürchteter Feind Roms und des Papstes. Er war ein massiger Mann, sein Körper groß genug für die Seelen von zweien, sein Gesicht zerklüftet und kantig. Aber es war seines krausen, wilden roten Haares wegen, dass er »der Löwe« genannt wurde.
Kardinal Borgia entfernte sich von der Seite seines kranken Sohnes und flüsterte Duarte zu: »Fragen Sie den Küchenjungen, weshalb er Seine Heiligkeit so gering schätzt. Und dann sorgen Sie dafür, dass er die Weinflasche von unserem Tisch austrinkt. Achten Sie darauf, dass er sie bis auf den letzten Tropfen austrinkt.«
»Und was sollen wir tun, wenn der Wein zu wirken beginnt?«, fragte er.
Der Kardinal, dessen Gesicht gerötet war und dessen Augen glühten, antwortete: »Setzen Sie ihn auf einen Esel, binden Sie ihn fest und schicken Sie ihn mit einer Botschaft an den ›Löwen‹ von Rimini. Sagen Sie ihm, er soll schon mal anfangen, um Vergebung zu beten und seinen Frieden mit Gott zu schließen.«
Juan lag mehrere Wochen lang wie in tiefem Schlaf, und der Kardinal bestand darauf, dass der Kranke im Vatikan blieb und von seinem eigenen Leibarzt behandelt wurde. Während Adriana an seinem Krankenbett saß und mehrere Dienerinnen ihn pflegten, kniete Rodrigo Borgia stundenlang in seiner Kapelle vor der Madonna. »Ich werde die Seelen von Tausenden in deine Kirche führen«, gelobte er inbrünstig. »Wenn du nur Christus bitten wolltest, meinen Sohn zu verschonen.«
Als seine Gebete erhört wurden und Juan sich erholte, war der Kardinal der Heiligen Katholischen Kirche und seiner Familie in noch tieferer Ergebenheit verbunden als zuvor.
Aber Rodrigo Borgia wusste, dass der Himmel allein ihm die Sicherheit seiner Familie nicht für lange garantieren konnte. Und so begriff er, dass noch eine weitere Maßnahme getroffen werden musste.
Der Kardinal hatte keine andere Wahl, er wusste, dass er den nunmehr unter dem Namen Don Michelotto auch in Rom bekannten Miguel Corello aus Spanien holen lassen musste ...
Dieser uneheliche Neffe des Kardinals Rodrigo Borgia hatte das Drängen der Mächte des Schicksals bereits am Anfang seines Erdenweges verspürt. Als Kind in Valencia hatte er weder zur Bosheit noch zur Grausamkeit geneigt, vielmehr oft die Verteidigung jener armen Seelen übernommen, deren Güte sie verwundbar für anderer Menschen Grausamkeit machte. Denn allzu oft wird Freundlichkeit als Schwäche missverstanden.
Miguel Corello hatte sich schon als Kind seiner Bestimmung ergeben: die Apostel Gottes und der Heiligen Römischen Kirche zu beschützen.
Miguel war ein starker Junge und in seiner Treue so wild entschlossen wie in seinen Taten. Eines Tages hatte er das Haus seiner Mutter, der Schwester des Kardinals, gegen einen gefürchteten Räuber verteidigt.
Er war damals erst sechzehn gewesen, aber tapfer hatte er sich dem Räuber und dessen Gesellen widersetzt, als sie ins Haus eindrangen und die hölzerne Truhe aufzubrechen suchten, in der sich die kostbaren heiligen Reliquien und das Leinen befanden, die Wertsachen, die seiner Mutter am teuersten waren. Als Miguel, der selten sprach, die Banditen verfluchte und sich weigerte, beiseite zu gehen, versetzte ihm der Anführer einen Messerstich ins Gesicht, der ihm die Wange tief aufschlitzte. Miguels Mutter schrie, als sie das Blut fließen und ihm auf seine Brust tropfen sah. Seine Schwester brach in Schluchzen aus, aber Miguel rührte sich nicht von der Stelle.
Da inzwischen draußen auf der Straße die Leute zusammenliefen und Krach schlugen, hielten es die Räuber schließlich doch für besser, das Weite zu suchen. Sie verließen das Dorf und flohen in die Berge.
Einige Tage später, als die gleiche Bande das Dorf erneut überfiel, war man dort auf der Hut, leistete Widerstand und verjagte die Räuber. Der Anführer, der Miguel die Wange aufgeschlitzt hatte, wurde von ihm gefangen genommen. Am nächsten Morgen sah man ihn, einen dicken Strick um den Hals, am Ast eines großen Baumes auf dem Dorfplatz hängen.
Von diesem Tage an verbreitete sich die Kunde, dass mit Miguel Corello nicht gut Kirschen essen war, durch das Königreich Valencia, und aus Furcht vor der Vergeltung, wagte niemand mehr, ihm, seiner Familie oder seinen Freunden etwas anzutun. Die Narbe des Messerstichs entstellte sein Gesicht, sodass es ständig zu einer Grimasse verzerrt zu sein schien, aber sonst hatte er bei jenem Angriff keinen bleibenden Schaden davongetragen. Und obwohl diese Narbe im Gesicht jedes anderen Mannes abschreckend gewirkt hätte, gaben die barmherzigen Blicke seiner goldbraunen Augen jedem zu verstehen, dass der Ruf eines Gerechten, der Don Miguel vorausging, das Verdienst einer aufrechten Gesinnung und barmherzigen Seele war. Damals begannen ihn die Bauern liebevoll »Don Michelotto« zu rufen. Auch in Rom wurde er unter diesem Namen respektiert.
Kardinal Rodrigo Borgia war der Meinung, dass in jeder Familie irgendjemand hervortreten musste, das Wort Gottes zu verkündigen. Doch dass es hinter diesem, im Schatten, andere geben müsste, die ihm den Rücken deckten und seinen heiligen Bemühungen den Erfolg sicherten. Er schloss also, dass die Inhaber hoher Kirchenämter menschliche Hilfe verteilen konnten – so wie die Welt, in der man lebte, nach Gottes unerforschlichem Ratschluss eingerichtet war.
Dass der junge Don Michelotto die Rolle des Übeltäters zu spielen berufen wurde, überraschte weder seinen Auftraggeber noch ihn selbst, denn er war ein überlegener Charakter. Seine Liebe und Treue zum himmlischen Vater und zum Heiligen Stuhl standen nie in Zweifel, der geflüsterten Verleumdungen seiner Feinde ungeachtet. Denn Rodrigo Borgia war überzeugt, dass Don Michelotto seinen Willen stets dem des himmlischen Vaters unterordnen und die Befehle der Heiligen Mutter Kirche gehorsam ausführen würde.
Und wie der Kardinal gewiss war, zu seinen Handlungen durch göttliche Eingebung angeleitet zu werden, so auch Don Michelotto. Sodass sich ihm die Frage nach der etwaigen Sündhaftigkeit dieser Handlungen erst gar nicht stellte. Denn jedes Mal, wenn er einem Feinde des Kardinals oder der Kirche die Luft abschnitt, tat er doch im Grunde nichts anderes, als die Seelen dieser Missetäter vor das Jüngste Gericht zu bringen. Und so ließ kurz nach Juans Genesung Rodrigo Borgia, der selbst in Valencia aufgewachsen war und das Blut kannte, das in den Adern dieses Spaniers floss, seinen Neffen Miguel nach Rom kommen. Er beauftragte den inzwischen zwanzigjährigen jungen Mann mit der Aufsicht über die Sicherheit seiner Familie. Und als dann die Kinder des Kardinals älter wurden, merkten sie bald, dass ihnen der Schatten Don Michelottos, wohin sie auch gingen, überall folgte.
Wann immer der Kardinal nun in Rom war und ihn seine Pflichten als Vizekanzler nicht zur Abwesenheit nötigten, besuchte er seine Kinder, sprach und spielte mit ihnen. Oft war Don Michelotto dabei an seiner Seite. Und bei der ersten Gelegenheit floh er die erstickende Sommerhitze der engen überfüllten Gassen der Stadt aufs Land.
Zweites Kapitel
Verborgen in den Vorbergen des Apennin lag, eine Tagereise von Rom entfernt, ein großes Landgut mit einem herrlichen Zedern- und Pinienwald an einem kleinen klaren See. Rodrigo Borgia hatte das Anwesen als Geschenk von seinem Onkel Papst Calixtus III. erhalten und hatte dort während der letzten Jahre eine prunkvolle Villa für sich selbst und seine Familie erbauen lassen.
Dies war der Silbersee, ein magischer Ort. Die Laute der Natur und die Farben der Schöpfung vereinigten sich hier für den Kardinal auf eine Weise, die ihm die Gegenwart des irdischen Paradieses zumindest vortäuschte. Im Morgengrauen und in der Abenddämmerung, wenn das Blau aus dem Himmel gewichen war, schimmerte die Oberfläche des Sees in einem silbrigen Grau. Die Gegend hatte den Kardinal auf den ersten Blick entzückt. Und er hoffte, dass er und seine Kinder dort ihre glücklichsten Stunden erleben würden.
Während der heißen, zitronengelben Sommertage schwammen die Kinder im See, um sich abzukühlen, und tobten dann durch die üppig grünen Felder, während der Kardinal durch die duftenden Limonenhaine schritt, die goldenen Perlen seines Rosenkranzes in der Hand. In diesen friedlichen Zeiten bewunderte er die Schönheit des Lebens und insbesondere die Schönheit seines Lebens. Natürlich hatte er hart gearbeitet und mit großer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit auch die Einzelheiten seiner Aufgaben ins Auge gefasst, seitdem er als junger Bischof seine Laufbahn begonnen hatte – aber inwiefern versprach das Erfolg? Denn mühten nicht viele arme Seelen sich erfolglos ab, ohne den Lohn des Himmels auf Erden zu empfangen? Dankbarkeit erfüllte sein Herz und der Kardinal sah zum klaren blauen Himmel auf, um ein Gebet zu sprechen und Segen zu erbitten. Denn unter der Oberfläche seiner Zuversicht war selbst nach all den Jahren, in denen ihm die Gnade des Himmels so reichlich gewährt worden war, die Angst verborgen, dass ein Mann für ein Leben, wie es ihm zuteil wurde, eines Tages würde einen hohen Preis entrichten müssen. Zweifellos gab Gott aus seinem Überfluss, ohne Bezahlung zu verlangen, doch musste man sich der Aufgabe, Seelen in die Heilige Kirche zu führen, würdig erweisen, und die Aufrichtigkeit der Seele eines Mannes musste Prüfungen bestehen. Wie anders sonst konnte der himmlische Vater die Würdigkeit beurteilen? Der Kardinal konnte nur hoffen, die Prüfungen zu bestehen, die ihn erwarteten.
Eines Abends, nachdem ihnen am Ufer des Sees ein üppiges Mahl aufgetischt worden war, erfreute der Kardinal seine Kinder mit einem außergewöhnlichen Feuerwerk. Er hielt dabei den kleinen Jofre auf dem Arm und Juan hing an seinen Rockschößen.
Silberne Sterne beschrieben weit ausholende leuchtende Bogen über den Himmel und ergossen sich in funkelnden Kaskaden fröhlicher Farben. Cesare hielt die Hand seiner Schwester und spürte ihr Zittern, während sie, als krachend Schießpulver explodierte, das mit wiederholten Blitzen den Himmel über ihnen erhellte, kleine Schreckensschreie ausstieß.
Als der Kardinal die Angst seiner Tochter bemerkte, reichte er Cesare den kleinen Jofre und bückte sich, Lucrezia in den Arm zu nehmen. »Papa wird dich halten, Papa passt auf dich auf.«
Cesare stand neben seinem Vater, nun mit dem kleinen Jofre auf dem Arm, und lauschte dem Kardinal, der mit großen Gebärden und höchst eloquent die am Himmel sichtbaren Konstellationen erläuterte. Er empfand die Stimme seines Vaters als sehr tröstlich und ahnte schon damals, dass er diese Tage am Silbersee immer in Erinnerung behalten würde. Denn an diesem Abend war er das glücklichste Kind der Welt, und plötzlich wurde er von dem Gefühl durchdrungen, dass ihm nichts unmöglich war.
Kardinal Rodrigo Borgia fand Freude an allem, was er tat. Er war einer dieser seltenen Menschen, die so begeisterungsfähig sind, dass sie unwiderstehlich ihre Nächsten in den Wirbel ihres eigenen Enthusiasmus hineinziehen. Als seine Kinder älter wurden und schon einige Kenntnisse erworben hatten, begann er über Religion, Politik und Philosophie mit ihnen zu sprechen und unterwies Juan und Cesare stundenlang in der Kunst der Diplomatie und der Strategie, auch auf politischem und religiösem Gebiet. Das machte Cesare sichtlich Spaß, während es Juan nicht selten zu langweilen schien. Der Kardinal verwöhnte den Sohn, der ihm fast entrissen worden wäre, was diesem jedoch nicht zum Vorteil gereichte, denn er wurde launisch und verzogen.
Die größten Hoffnungen allerdings setzte er denn auch in den Älteren, Cesare, und von diesem allerdings versprach er sich viel.
Rodrigo genoss seine Besuche im Orsini-Palast, denn sowohl seine Cousine Adriana als auch deren Schwiegertochter, die junge Julia, bewunderten ihn und schenkten ihm ihre ganze Aufmerksamkeit. Julia wuchs zu einer sehr schönen Frau heran, ihr Haar, goldener noch als Lucrezias, reichte fast bis auf den Boden. Auch ihrer großen blauen Augen und vollen Lippen wegen galt sie in ganz Rom als La Bella, die Schöne. Der Kardinal begann eine gewisse Zuneigung zu ihr zu empfinden.
Julia Farnese, deren Familie dem kleinen Adel angehörte, hatte Orsini, der einige Jahre jünger war als sie, als Mitgift dreihundert Gulden gebracht, eine stattliche Summe. Die Kinder freuten sich immer über Rodrigos Besuch. Bald schon begann auch Julia, sich auf diese Besuche zu freuen. Bei seinem Anblick röteten sich ihre Wangen, wie das übrigens bei den meisten Frauen der Fall gewesen, denen er im Laufe seines Lebens begegnet war. Und oft unternahm Julia, wenn sie Lucrezia beim Haarewaschen, Frisieren und Ankleiden geholfen hatte, an den Tagen, da sie den Besuch Rodrigos erwartete, besondere Anstrengungen, auch sich selbst so anziehend wie möglich herauszuputzen. Trotz des Altersunterschieds zwischen ihnen war Rodrigo Borgia von der jungen Frau bezaubert.
Als es dann Zeit wurde für die Trauung der Verlobten, seines Patensohns Orso und der entzückenden Julia Farnese, erbot sich der Kardinal, um seiner Cousine Adriana und der Braut seine Achtung zu erweisen, dieselbe in der Sternkammer seines eigenen Palastes persönlich vorzunehmen.
An jenem Tag erschien ihm die junge Julia in ihrem weißseidenen Brautkleid, einem perlenbesetzten Schleier über dem lieblichen Gesicht, aus dem entzückenden Kind, das er gekannt, plötzlich verwandelt worden zu sein in die schönste Frau, die er je gesehen hatte. Sie war so frisch, so voller Leben, dass der Kardinal nur mit Mühe die Leidenschaft bezähmen konnte, die sie in ihm erweckte.
Es dauerte nicht lange, bis der junge Orso mit seinen Beratern auf den Landsitz des Kardinals bei Bassanello geschickt wurde, wo man sich der Ausbildung des jungen Mannes zum Heerführer widmete. Julia Farnese aber nahm Zuflucht, zuerst in den Armen des Kardinals, dann in seinem Bett.
Als Cesare und Juan in das Alter zwischen dreizehn und neunzehn kamen, wurden sie in die Welt geschickt, sich auf ihre Bestimmung vorzubereiten. Aber Juan tat sich schwer mit den Studien, und der Papst erkannte, dass dieser junge Mann als Priester oder Gelehrter wohl keine große Zukunft hatte. Es wurde also beschlossen, ihn Soldat werden zu lassen. Cesares blendende Intelligenz brachte ihn zunächst an die hohe Schule in Perugia. Nachdem er in zwei Jahren gelernt hatte, was dort zu lernen war, wurde er auf die Universität von Pisa geschickt, um dort sein Studium der Theologie und des kanonischen Rechts fortzusetzen. Der Kardinal hoffte, dass Cesare in seine Fußstapfen treten und zu hohen Ehren in der Kirche aufsteigen würde. Obwohl er auch gegenüber seinen drei älteren Kindern seine Pflicht getan hatte, setzte er doch seine Hoffnungen in die Zukunft der drei jüngeren, in Cesares, Juans und Lucrezias. Es war dem Kardinal nie gelungen, in eine ähnlich enge Beziehung zu seinem jüngsten Sohn Jofre zu treten, wie er sie zu den anderen drei Kindern unterhielt, die ihm Vanozza geboren hatte. In den tiefsten Winkeln seiner Seele regten sich manchmal Zweifel, ob dieser jüngste Sohn wirklich sein eigener wäre. Denn wer, dachte er dann, kann wirklich wissen, welche Geheimnisse in einem Frauenherzen begraben liegen?
Kardinal Borgia hatte das Amt des Vizekanzlers oder päpstlichen Rechtsberaters unter mehreren Päpsten innegehabt. Dem jetzigen Papst Innozenz hatte er acht Jahre lang gedient, und während dieser Zeit hatte er, was in seiner Macht stand, getan, um die Befugnisse und die Legitimation des Papsttums zu erweitern.
Doch als der arme Papst Innozenz im Sterben lag, gelang es auch mit frischer Muttermilch und Transfusionen des Blutes dreier Knaben nicht, ihm das Leben zu retten. Die Knaben hatten pro Kopf einen Dukaten erhalten. Als jedoch das medizinische Experiment scheiterte, erhielten sie aufwändige Begräbnisse und ihre Familien wurden für jeden von ihnen mit vierzig Dukaten entschädigt.
Unglücklicherweise hatte Papst Innozenz die päpstliche Staatskasse leer hinterlassen, sodass die Heilige Kirche wehrlos war gegen die Beleidigungen seitens des katholischen Königs von Spanien und des höchst christlichen Königs von Frankreich. Die päpstlichen Finanzen waren in so kläglicher Unordnung, dass der Heilige Vater selbst sich genötigt gesehen hatte, seine Mitra zu versetzen, um Palmenwedel zur Verteilung am Palmsonntag kaufen zu können. Gegen den Rat Rodrigo Borgias hatte er den Herrschern von Mailand, Neapel, Venedig, Florenz und anderen Stadtstaaten und Fürstentümern gestattet, die dem Kirchenstaat schuldigen Abgaben hinauszuzögern und seinerseits Unsummen auf die Vorbereitung eines Kreuzzuges verschwendet, den niemand antreten wollte.
Es bedurfte eines strategischen und finanziellen Genies, die Heilige Katholische Kirche zu ihrem früheren Glanz zurückzuführen. Aber wo sollte dieses Genie herkommen? Wer war zu der großen Aufgabe, die Kirche zu sanieren, berufen? Alle Welt fragte sich das. Doch die Berufung dieses Mannes von strategischem und finanziellem Genie war Amt des heiligen Kardinalskollegiums, die Entscheidung würde von den göttlich erleuchteten und vom Heiligen Geist geführten Kardinälen getroffen werden. Denn ein Papst durfte kein gewöhnlicher Mensch, er musste ein Gesandter des Himmels sein.
Am 6. August 1492 trat in der großen Halle der Sixtinischen Kapelle, von der päpstlichen Schweizergarde gegen Einmischungen von außen abgeschirmt, das Konklave des Kardinalskollegiums zusammen zur Wahl des neuen Papstes. Erforderlich war eine Zweidrittelmehrheit.
Dem traditionellen Verfahren entsprechend, hatten sich nach dem Tode Papst Innozenz’ die Fürsten der Kirche, die dreiundzwanzig Angehörigen des Kardinalskollegiums, versammelt, um den neuen Papst zu wählen: den Gottesmann, der als Nachfolger Petri der Schlüsselbewahrer und der Stellvertreter Christi auf Erden sein würde. Der Gewählte würde nicht nur der geistliche Führer der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche sein, sondern auch der regierende Fürst des Kirchenstaates. Für diese Aufgaben waren überragende Intelligenz erforderlich, die Fähigkeit, Männer und Heere zu führen, die Begabung, bei Verhandlungen mit anderen weltlichen Fürsten und Königen Vorteile für den Kirchenstaat zu erzielen.
Die Papstkrone verhieß ihrem Träger große Reichtümer wie die Möglichkeit zu verantwortlichem Wirken, zur Vereinigung oder ferneren Zersplitterung der Stadtstaaten und Lehnsgebiete der italienischen Halbinsel, auf der ein Nationalstaat derzeit noch nicht existierte. Und so waren schon vor dem Tode Papst Innozenz’ Verabredungen getroffen worden, Besitztümer und Titel versprochen für die Einwilligung in die Wahl gewisser Kardinäle.
Innerhalb der auszuwählenden Gruppe von Kardinälen, die als papabili, für das Amt des Papstes in Frage kommend, galten, würde schließlich einen die Wahl treffen.
Da gab es Kardinal Ascanio Sforza von Mailand, Kardinal Cibo von Venedig, Kardinal della Rovere von Neapel und Kardinal Borgia von Valencia. Der Letztere hatte den Nachteil, ein Ausländer aus Spanien, zu sein. Er galt als Katalone und das sprach gegen ihn. Zwar war er schon lange in Italien und hatte die spanische Schreibweise seines Namens Borja zu Borgia italienisiert, aber die alteingesessenen Familien sahen ihn weiterhin als einen fremden Emporkömmling an.
Nichtsdestoweniger war in Rechnung zu stellen, dass er der Kirche schon seit fünfunddreißig Jahren hervorragende Dienste leistete. Als päpstlicher Rechtsbeistand hatte er bereits für mehrere frühere Päpste diffizile Verhandlungen zu gutem Ende geführt. Übrigens nicht nur für die Kirche, denn bei jedem Siege des Papstes hatte er die Reichtümer und Pfründen auch seiner Familie vermehrt. Er hatte viele von seinen Verwandten in Machtstellungen gebracht und ihnen Besitzungen überlassen, von denen die ältesten Familien Italiens glaubten, dass sie eher ihnen von Rechts wegen zustünden. Ein spanischer Papst? Unsinn. Der Sitz des Heiligen Stuhls war in Rom, und so war es nur vernünftig zu verlangen, dass der Mann, der diesen Thron bestiege, aus einer der Provinzen Italiens käme.
Nun also begann, geheimnisumwoben, das Konklave Gottes Werk zu tun. Innerhalb der riesigen, kalten Kapelle, voneinander in Einzelzellen isoliert, sollten die Kardinäle weder miteinander noch mit der Außenwelt in Verbindung treten. Jeder sollte ganz für sich entscheiden, im Gebet und von göttlicher Eingebung geleitet, am besten auf den Knien vor dem kleinen Altar mit brennenden Kerzen und Kruzifix, die der einzige Schmuck jeder der Einzelzellen waren.
In jedem dieser feuchten dunklen Räume stand außerdem eine Pritsche, für den Fall, dass einer seine Kräfte durch Schlaf erneuern musste, ein Abtritt, wo er sich erleichtern konnte, verschiedene Schachteln mit Süßigkeiten: gezuckerte Mandeln, Marzipan und Rohrzucker. Außerdem auch Salz und Wasser. Da es in der Sixtinischen Kapelle keine Küche gab, mussten die Kardinäle ihre Mahlzeiten in ihren eigenen Palästen zubereiten und sich in hölzernen Gefäßen bringen lassen, wo sie ihnen dann durch Luken in den Türen gereicht wurden. Unterdessen musste jeder Kardinal sorgfältig erwägen, welcher Kandidat am besten seiner eigenen Familie, der Provinz, für die er verantwortlich war, und der Heiligen Mutter, der Kirche, dienen würde. Da hieß es aufzupassen. Denn wenn nicht, konnte es passieren, dass man zwar seine weltlichen Güter mehrte, aber seine unsterbliche Seele verscherzte. Man durfte keine Zeit verschwenden, denn nach einer Woche wurden den Kardinälen die Rationen gekürzt. Danach erhielten sie nur noch Wasser, Brot und Wein. Denn immer nach dem Tode des Papstes brach das Chaos aus. Auf den Straßen von Rom herrschte, da die Stadt ohne Herrscher war, die blanke Willkür: Läden wurden geplündert, Paläste ausgeraubt und Hunderte von Bürgern ermordet. Und dem war nicht genug. Denn solange die päpstliche Tiara nicht fest auf einem Kopfe ruhte, war Rom selbst in Gefahr, erobert zu werden.
Bei Beginn der Wahl versammelten sich Tausende von Bürgern auf der Piazza vor der Kapelle. Die Menschen beteten laut und sangen fromme Lieder in der Hoffnung, dass der neue Papst den Himmel bitten würde, den höllischen Zuständen auf den Straßen Roms Einhalt zu gebieten. Sie schwenkten Fahnen und hielten Banner in die Höhe. Und sie warteten auf das Erscheinen eines Boten auf dem Balkon der Kapelle, der ihnen ihre Erlösung verkünden würde.
Der letzte Wahlgang dauerte drei Tage, doch konnte keiner der Kardinäle die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Stimmen auf sich vereinigen. Kardinal Ascanio Sforza von Mailand und Kardinal della Rovere von Neapel hatten jeder acht Stimmen. Rodrigo Borgia, der sieben Stimmen hatte, war für die Mehrzahl der Stimmberechtigten die zweite Wahl. Als die Stimmen gezählt waren und sich gezeigt hatte, dass auf niemanden die erforderliche Mehrheit gefallen war, wurden die Stimmzettel zeremoniell verbrannt.
An diesem Morgen sah die Menge auf dem Petersplatz erwartungsvoll zu, wie etwas aus dem Schornstein aufstieg, das wie ein dunkelgraues Fragezeichen am blauen Himmel über der Sixtinischen Kapelle stehen blieb. Sie glaubte, ein Vorzeichen darin zu erkennen, bekreuzigte sich und hielt einfache Holzkreuze in die Höhe. Je länger die Antwort auf sich warten ließ, desto inbrünstiger wurde gebetet und desto lauter gesungen.
Die Kardinäle kehrten in ihre Zellen zu ihren Erwägungen zurück.
Der zweite Wahlgang zwei Tage später kam zu einem ganz ähnlichen Ergebnis wie der erste, es waren keine ernsthaften Zugeständnisse gemacht worden, und als dann wie beim ersten Mal schwarzer Rauch aus dem Schornstein aufstieg, wurde das Beten schwächer und den Sängern ging der Atem aus. Die Piazza wirkte unheimlich in der nur von wenigen Laternen und flackernden Lichtern durchbrochenen Finsternis.
Wilde Gerüchte gingen in Rom um. Bürger schworen, dass bei Sonnenaufgang am folgenden Tage drei identische Sonnen am Himmel gestanden hätten, und das wurde von der staunenden Menge zum Zeichen dafür genommen, dass der nächste Papst die drei Mächte des Papsttums, die geistliche, die weltliche und die himmlische, im Gleichgewicht halten würde. Es schien den Leuten also ein gutes Vorzeichen zu sein.
Aber am Abend dieses Tages wollte man gesehen haben, wie hoch auf dem Turm des Palastes des Kardinals Giuliano della Rovere, wohin zu steigen niemandem gestattet war, sechzehn Fackeln sich spontan entzündet hatten und dann, unter den Augen der staunenden Menge, alle bis auf eine heruntergebrannt und erloschen waren. Ein schlechtes Vorzeichen! Welche Macht würde dem Papsttum verbleiben? Eine unheimliche Stille breitete sich auf der Piazza aus.
Drinnen befand sich das Konklave in einem hoffnungslosen Zustand. Der Zwiespalt der Meinungen schien unüberwindlich zu sein. Viele der älteren Kardinäle begannen unter der Dunkelheit und Feuchtigkeit ihrer Zellen zu leiden. Die Belastung drohte unerträglich zu werden – und wie konnte man vernünftige Entscheidungen treffen bei Durchfall und auf wunden Knien?
An jenem Abend kamen die Kardinäle nacheinander aus ihren Zellen und schlichen sich in diejenigen der anderen. Man begann, die Verhandlungen erneut zu eröffnen und um Besitztümer und Ämter zu feilschen. Versprechungen wurden gemacht. Verlockende Verheißungen von Reichtümern, Stellungen, günstigen Gelegenheiten waren für eine einzige Stimme einzuhandeln. Neue Bündnisse wurden geschmiedet. Aber Geist und Herzen der Menschen sind unbeständig, und Schwierigkeiten können sich allenfalls ergeben. Denn wenn ein Mann seine Seele dem Teufel verkaufen kann, könnte er sie dann nicht auch jemand anderem verhökern?
Auf dem Platz hatte sich die Menge inzwischen verstreut. Viele Bürger hatten, müde und entmutigt, um die eigene Sicherheit und diejenige ihrer Häuser besorgt, die Piazza verlassen und waren zu ihren Familien zurückgekehrt. Also waren am nächsten Morgen, als der Rauch aus dem Schornstein endlich weiß aufstieg und man die zugemauerten Fenster des Vatikans aufbrach, um die Ankündigung, auf die alle so lange gewartet hatten, zu machen, nur noch wenige Menschen auf dem Petersplatz, um sie zu vernehmen.
Ein Segenskreuz wurde hoch über ihre Köpfe erhoben und eine kaum erkennbare Gestalt in kostbaren Gewändern verkündete: »Mit großer Freude stehe ich hier, um zu verkünden: Wir haben einen neuen Papst.«
Diejenigen, die von den beiden einander blockierenden Parteien wussten, fragten sich, welchem von den beiden Kardinälen wohl der Durchbruch gelungen sein mochte? Kardinal Ascanio Sforza oder Kardinal della Rovere? Aber dann erschien eine andere Gestalt am Fenster, größer und eindrucksvoller als die erste, und dieser Mann warf Hände voll kleiner Papierschnitzel wie Konfetti, auf denen geschrieben stand: »Wir haben als Papst Kardinal Rodrigo Borgia von Valencia, Papst Alexander VI. Wir sind gerettet.«
Drittes Kapitel
Als Kardinal Rodrigo Borgia als Papst Alexander VI. den Heiligen Stuhl bestieg, wusste er, dass er zunächst auf den Straßen Roms Ordnung schaffen musste. Während der Zeit zwischen dem Tod Papst Innozenz’ und seiner eigenen Krönung hatten in der Stadt mehr als zweihundert Morde stattgefunden. Dieser Gesetzlosigkeit musste Einhalt geboten werden. Als ihr Heiliger Vater musste er an den Sündern ein Exempel statuieren, denn wie sonst konnten die guten Seelen der Stadt in Frieden zu ihren Gebeten zurückkehren?
Der erste Mörder wurde ergriffen und auf der Stelle gehängt. Nicht nur das, auch sein Bruder wurde gehängt. Und als größte Demütigung, die einem Bürger Roms widerfahren konnte, wurde überdies auch sein Haus dem Erdboden gleichgemacht und somit seinem Haushalt das Dach über dem Kopf genommen.
Innerhalb weniger Wochen war auf den Straßen Roms die Ordnung wiederhergestellt, und die Bürger schätzten sich glücklich, dass die Tiara auf einem so starken und weisen Kopf gelangt war. Jetzt war die von den Kardinälen getroffene Wahl auch die Wahl des Volkes.
Aber Alexander hatte noch andere Entscheidungen zu treffen und zwei sehr wichtige Probleme zu lösen, von denen keines ein geistliches war. Vor allem hatte er die Aufgabe, ein Heer aufzustellen, um die katholische Kirche als weltliche Macht wiederherzustellen und die Kontrolle über den Kirchenstaat zurückzugewinnen; zweitens musste er für die Zukunft seiner Kinder sorgen.
Dennoch, wie er da nun auf seinem Thron im Saal des Glaubens im Vatikanpalast saß, grübelte er über die Wege Gottes, der Welt, der Nationen und Geschlechter. Dabei tauchten auch unmittelbare Probleme auf, deren er sich anzunehmen und die er zu lösen hatte. War er nicht Gottes unfehlbarer Stellvertreter hier auf Erden? Und musste er mithin nicht mit der ganzen Welt umgehen, den Nationen und ihren Königen, all den unabhängigen Städten Italiens, den Republiken und Oligarchien? Ja, sogar mit den erst jüngst entdeckten Westindischen Ländern. War er nicht verpflichtet, ihnen den besten Rat zu erteilen? Stellten sie eine Gefährdung der Herrschaft Gottes dar oder nicht?
Und wie stand es nun mit seiner eigenen Familie, den Borgias, den unzähligen Verwandten, die versorgt sein wollten, und mit seinen Söhnen und Töchtern, die ihm als sein eigen Fleisch und Blut verbunden, aber wegen ihrer ungestümen Leidenschaften nicht gehorsam waren. Wie sollte er es mit ihnen halten? Wo lag seine vornehmste Pflicht? Konnte er sowohl seinen Pflichten der Kirche und der Welt gegenüber als auch denen gegenüber seiner Familie genügen, ohne dass dabei die eine oder andere Seite zu kurz kam?
Schließlich erwog Alexander seine Pflicht gegenüber Gott. Diese war klar. Er musste die Kirche stärken. Die Erinnerung an das große Schisma, die Zeit, da es zwei Päpste und zwei Kirchen gegeben hatte, beide schwach, bestärkte ihn in dieser Gewissheit.
Die Städte Italiens, die der Kirche gehörten, wurden jetzt von Tyrannen regiert, die mehr darauf bedacht waren, ihre Familien zu bereichern, als der Kirche Steuern abzuführen. Die Könige hatten die Kirche als Werkzeug benutzt, um Macht für sich selbst zu gewinnen. Die Aufgabe, auf die Errettung der unsterblichen Seelen der Menschen hinzuarbeiten, war vergessen. Selbst die reichen Könige von Spanien und Frankreich enthielten der Kirche die Abgaben vor, wenn sie mit dem Papst unzufrieden waren. Sie wagten das! Was, wenn die Heilige Kirche ihrer Herrschaft den Segen entzog? Denn schließlich gehorchte doch wohl das Volk den Königen, weil diese als Gesalbte Gottes galten, und ihre Salbung bestätigen konnte allein der Stellvertreter Christi auf Erden, das Haupt der Kirche, der Papst. Alexander wusste, dass er weiterhin die Macht der Könige von Frankreich durch die Macht der Könige von Spanien neutralisieren musste. Und daraus folgte, dass es nie wieder zu einem von den Königen einberufenen großen Konzil kommen durfte. Ebenso zwingend war die Folgerung, dass die Kirche und der Papst beträchtlicher weltlicher Macht bedurften. Kurzum, eines starken Heeres. Alexander erwog sorgfältig die Machtmittel, die ihm zu Gebote standen. Und entwickelte einen Plan.
Sofort nach seiner Krönung ernannte er seinen Sohn Cesare zum Kardinal. Schon als Kind hatte Cesare kirchliche Pfründen erhalten und hatte als Bischof ein Einkommen von Tausenden von Dukaten. Cesare war, obwohl erst siebzehn und noch voller jugendlicher Leidenschaften und Laster, doch an Leib und Seele schon ein erwachsener Mann. Er hatte ein Studium der Rechte und der Theologie an den Universitäten von Perugia und Pisa hinter sich, seine Disputation war eine der glänzendsten, die man je gehört hatte. Allerdings galt seine Vorliebe dem Studium der Kriegsgeschichte und der Strategie. Er hatte bereits Erfahrung gesammelt, da er schon an verschiedenen kleineren Gefechten teilgenommen und sich bei einem ausgezeichnet hatte. So war sein Interesse an der Kriegskunst nicht nur theoretisch.
Gott hatte diesen Sohn Alexanders gesegnet mit wachem Verstand, festem Willen und mit jener natürlichen Grausamkeit, ohne die man in dieser bösen Welt nicht überleben kann.
Cesare Borgia erhielt die Nachricht, dass er zum Kardinal der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche ernannt worden war, als er noch an der Universität Pisa kanonisches Recht studierte. Die Ernennung kam nicht unerwartet, denn er war ja der Sohn des neuen Papstes. Aber Cesare Borgia freute sich nicht über die Erhebung. Gewiss, sie würde ihn bereichern, aber er war im Herzen Soldat, wünschte, Truppen in die Schlacht zu führen, Burgen zu stürmen, Festungen zu überwinden und Städte einzunehmen. Und er wollte auch heiraten und Kinder haben, die nicht Bastarde wären wie er selbst. Zudem zürnte er seinem Vater immer noch, weil dieser ihn nicht zu seiner Krönung eingeladen hatte.
Seine beiden engsten Freunde und Kommilitonen, Gio Medici und Tila Baglioni, gratulierten ihm und bereiteten für den Abend ein Fest vor, denn in der folgenden Woche würde er zu seiner Investitur nach Rom abreisen müssen.
Gio war bereits mit dreizehn zum Kardinal ernannt worden, denn sein Vater war der Herrscher in Florenz, der große Lorenzo »der Prächtige«. Tila Baglioni hatte als Einziger der drei kein geistliches Amt, doch war er einer der Erben des Herzogtums Perugia. Hier, an der Universität von Pisa, waren sie vor allem temperamentvolle Studenten mit Bediensteten und Leibwächtern, obwohl sie alle drei in der Lage waren, sich selbst zu verteidigen. Cesare war ein geschickter Fechter mit dem Schwert, der Axt und dem Jagdspieß, wenn er auch noch keine volle Kriegsrüstung besaß. Er war von unerhörter körperlicher Kraft und größer als die meisten Männer. Dabei war er ein glänzender Student, der Stolz seiner Professoren. Aber von einem Sohn des Papstes war das zu erwarten.
Auch Gio war ein guter Student, aber körperlich nicht sonderlich beeindruckend. Er war geistreich, hütete sich aber, seine beiden Freunde mit seinem Witz zu behelligen. Cesare war schon mit siebzehn sehr einschüchternd und Tila Baglioni war für seine grausamen Wutausbrüche bekannt, zu denen er sich hinreißen ließ, wenn er argwöhnte, beleidigt worden zu sein.
An jenem Abend feierten sie in der Villa der Familie Medici vor den Toren von Pisa Cesares Ernennung. Da die Würde, zu der Cesare gelangte, die eines Kirchenfürsten war, ließ man eine gewisse Diskretion walten. Es war ein intimes Zusammensein mit nur sechs Kurtisanen. Auch bei Tisch vermied man ausschweifende Üppigkeit, es gab Hammelbraten, Wein, Süßigkeiten und leichte, angenehme Unterhaltung.
Sie gingen früh zu Bett, denn man hatte beschlossen, dass am folgenden Tag, ehe jeder die Heimreise antrat, Cesare Borgia nach Rom und Gio Medici nach Florenz, alle mit Tila Baglioni nach Perugia reiten würden, wo ein großes Fest bevorstand. Tilas Vetter sollte Hochzeit feiern und seine Tante, die Herzogin Atalanta Baglioni, hatte ihm eine besondere Einladung zu dieser Hochzeit geschickt. Er hatte gespürt, dass ihr sein Kommen wichtig war, und hatte zugesagt.
Am nächsten Morgen machten sich die drei also auf den Weg nach Perugia. Cesare ritt sein schönstes Pferd, ein Geschenk Alfonsos, des Herzogs von Ferrara. Gio Medici ritt ein weißes Maultier, denn er war kein besonders guter Reiter. Tila Baglioni, der großen Wert darauf legte, den Leuten Respekt einzuflößen, ritt ein Schlachtross, dessen Ohren man gestutzt hatte, um ihm ein wildes und grausames Aussehen zu verleihen. Pferd und Reiter wirkten überwältigend. Keiner trug Rüstung, obwohl alle drei mit Degen und Dolchen bewaffnet waren. Sie hatten dreißig Mann Gefolge, bewaffnet und leicht gerüstet. Das waren Cesares Leute, die auch seine Farben trugen, gelb und scharlachrot.
Von Pisa aus liegt Perugia am Wege nach Rom, nur weiter landeinwärts. Die Baglionis und Perugia legten großen Wert auf ihre Unabhängigkeit, obgleich der Papst auf der Zugehörigkeit der Stadt zum Kirchenstaat bestand. Wegen der daraus resultierenden Spannungen hätte Cesare wohl nicht gewagt, Perugia zu besuchen, hätte nicht Tila für seine Sicherheit gebürgt, obwohl er durchaus auch glaubte, sich auf seinen Verstand und die eigenen Kräfte verlassen zu dürfen. Aber gleichviel, jetzt kam er in Gesellschaft des Neffen der Herzogin und freute sich auf die Vergnügungen des Hochzeitsfestes, die er zu genießen gedachte, ehe er seinen Pflichten in Rom nachkommen musste.
Perugia war eine Stadt in abschreckender und schöner Lage zugleich. Die Festung der Stadt auf einem hohen Felsen war fast uneinnehmbar.
Als die drei jungen Männer in die Stadt einritten, fanden sie dort alle Kirchen und Paläste für die Hochzeit geschmückt, die Statuen in Goldbrokat gewandet. Cesare plauderte vergnügt mit seinen Reisegefährten und machte sogar Späße, achtete aber insgeheim genau auf die vorhandenen Befestigungsanlagen und überlegte, wie er vorgehen würde, um die Stadt zu stürmen.
Herrscherin von Perugia war damals die verwitwete Herzogin Atalanta Baglioni. Sie war noch immer eine schöne Frau, berühmt jedoch war sie für die Grausamkeit ihres Regiments; ihr Sohn Netto diente ihr dabei als Feldhauptmann. Es war ihr Herzenswunsch, ihren Neffen Torino mit Lavina, einer ihrer Hofdamen, zu verheiraten. Auf Torino, meinte sie, könnte sie zur Aufrechterhaltung der Herrschaft der Baglionis zählen.
Alle Zweige der riesigen Baglioni-Sippe waren im Schlosshof versammelt. Musikanten spielten auf, es wurde getanzt. Es gab auch Ringkämpfe und Lanzenbrechen. Cesare, der auf seine Kraft stolz war, nahm alle Herausforderungen an und gewann sämtliche Wettkämpfe.
Bei Einbruch der Nacht begaben sich die Baglionis zur Ruhe in die Festung. Gio, Cesare und Tila saßen bei einem letzten Krug Wein in Tilas Gemächern zusammen.
Es war fast Mitternacht und der Wein machte sie schläfrig, als plötzlich Schreie und Rufe in der Burg sie aufschrecken ließen. Tila sprang auf, den Degen gezückt, und wollte dem Geschrei nachlaufen. Cesare aber hielt ihn zurück und sagte: »Sehen wir erst mal, was los ist. Du bist vielleicht in Gefahr. Ich komme gleich wieder.«
Als Cesare die Schreie gehört hatte, war ihm klar gewesen, dass irgendein Verrat stattgefunden hatte. Er hatte einen Riecher für dergleichen. Er ließ das Schwert an seiner Seite, als er Tilas Gemächer verließ. Denn er wusste, dass die Baglionis, so berüchtigt sie auch sein mochten, es nicht wagen würden, den Sohn des Papstes zu töten. Cesare ging ruhig die Gänge der Burg entlang in Richtung des anhaltenden Geschreis. So gelangte er schließlich vor das Brautgemach.
Überall war Blut. Die Statue der Jungfrau Maria, das Bild des Jesuskindes, die weißen Laken und Kissenbezüge des Hochzeitsbettes – selbst der Betthimmel waren blutbespritzt. Und am Boden lagen die Leichen des Brautpaares, Lavina und Torino, ihre Nachthemden zerschlitzt und blutgetränkt, sie selbst durchbohrt, tödliche Wunden an Kopf und Körper.
Über ihnen stand Netto mit vier Bewaffneten, alle mit blutigen Schwertern. Sie standen Nettos Mutter Atalanta gegenüber, der Herzogin, die ihren geliebten Sohn schreiend verfluchte. Netto versuchte, sie zu beruhigen. Cesare konnte alles mit anhören.
Der Sohn erklärte seiner Mutter: »Mama, Torino war zu mächtig und seine Familie wollte dich stürzen. Ich habe alle Mitglieder seiner Sippe getötet.« Dann versicherte er seiner Mutter begütigend, dass er sie zwar absetzen und nun selbst die Regierung übernehmen müsse, es aber an der schuldigen Achtung ihr gegenüber niemals fehlen lassen werde.
»Verrat eines Sohnes«, schrie die Herzogin ihn an.
»Mach doch die Augen auf, Mama. Nicht nur Torino, sondern auch Vetter Tila hat sich gegen dich verschworen.« Cesare hatte genug gehört. Er verließ den Raum und kehrte eilig in Tilas Gemächer zurück.
Tila war außer sich vor Zorn, als er hörte, was vorgegangen war. »Klatsch und Tratsch, das ist alles!«, schrie er. »Dieser Vetter von mir, dieser Bastard Netto, versucht seiner eigenen Mutter die Krone zu stehlen. Und überdies hat er bereits einen Plan, auch mich zu ermorden!«