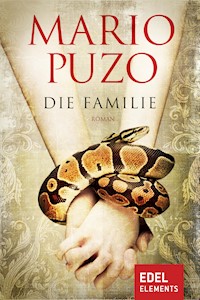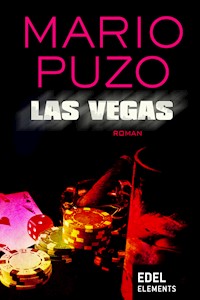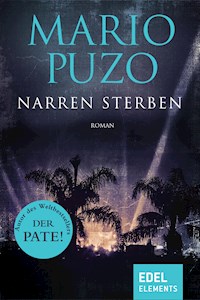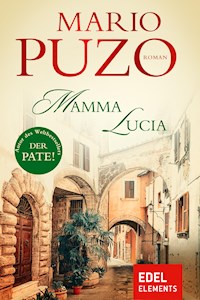
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
New York 1928: Die resolute Einwanderin Lucia Santa versucht sich und ihre sechs Kinder im Land der unbegrenzten Möglichkeiten durchzubringen. Streit und tränenreiche Versöhnungen sind an der Tagesordnung. Denn wo Lucia noch die überschäumend temperamentvolle Italienerin ist, sind ihre Kinder bereits gläubige Anhänger des amerikanischen Traums ... Unwiderstehlich lebendig, fesselnd und atmosphärisch dicht - der wohl persönlichste Roman Mario Puzos, Autor des Kultbestsellers "Der Pate"!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mario PuzoMamma Lucia
Roman Ins Deutsche übertragen von Gisela Stege
Erstes Buch
1
Larry Angeluzzi gab seinem Rappen die Sporen und trieb ihn durch den Canyon zwischen den hochragenden Wänden der Mietskasernen. Am Fuß der Steilwände unterbrachen die Kinder auf den Gehsteigen ihr Spiel, um ihn mit stummer Bewunderung anzustarren. In weitem Bogen schwenkte er seine rote Laterne; die eisenbeschlagenen Hufe seines Rappen schlugen Funken, wenn sie auf die in das Pflaster der Tenth Avenue eingelassenen Bahngleise trafen, und hinter Roß, Reiter und Laterne zuckelte der lange Güterzug, der von der Endstation St. John’s Park gemächlich nach Norden rollte.
Im Jahre 1928 wickelte die New York Central Railroad ihren Nord-Süd-Verkehr noch auf den Straßen der Stadt ab und schickte jedem Zug als Warnung für den Verkehr einen Reiter voraus. Nur wenige Jahre noch, dann sollte es damit zu Ende sein, sollte ein richtiger Bahndamm gebaut werden. Doch Larry Angeluzzi, nicht ahnend, daß er der letzte »Dummy Boy« war, daß er schon bald winziges Teilchen der Stadtgeschichte sein würde, hielt sich kerzengerade und arrogant wie ein echter Westler. Dicke weiße Segeltuchschuhe waren seine Sporen, eine mit Gewerkschaftsabzeichen gespickte Schirmmütze sein Sombrero. Die Beine seiner blauen Drillichhosen wurden von chromglänzenden Klammern zusammengehalten wie bei einem Radfahrer. In leichtem Galopp ritt er durch den heißen Sommerabend, durchseineWüste, die Stadt aus Stein. Frauen saßen schwatzend auf Holzkisten, Männer standen an den Straßenecken und rauchten De-Nobili-Zigarren, Kinder wagten sich von ihren schieferblauen Inseln und tummelten sich beim lebensgefährlichen Spiel, auf den fahrenden Frachtzug aufzuspringen. Über allem lag der rauchig-gelbe Schein der Straßenlaternen und das grellweiße Licht nackter Glühbirnen in den Schaufenstern der Süßwarenläden. An jeder Kreuzung blies von der Twelfth Avenue, vom Betonufer des Hudsonflusses herauf, eine leichte Brise, erfrischte Roß und Reiter und traf auf das heiße, schwarze Metall der Maschine, die hinter ihnen unermüdlich warnende Pfiffe von sich gab.
An der 27th Street wich die Wand rechts von Larry Angeluzzi für einen ganzen Häuserblock zurück. Auf dem freien Platz lag der Chelsea Park – jetzt, am Abend, voll dunkler, kauernder Silhouetten: Kinder, die auf dem Boden saßen und sich die vom Hudson Guild Settlement House kostenlos gezeigten Freilichtfilme ansahen. Auf der fernen weißen Riesenleinwand sah Larry Angeluzzi ein ungeheures Pferd mit Reiter in künstlichem Sonnenlicht auf sich zujagen und fühlte, wie sein eigenes Pferd angstvoll stieg, als es beim Werfen des Kopfes diese überdimensionalen Spukgestalten entdeckte. Gleich darauf hatten sie die Kreuzung der 28th Street passiert, und die Mauer wuchs neben ihnen wieder empor.
Larry war jetzt fast zu Hause. Vorn, an der 30th Street, spannte sich die Fußgängerbrücke über die Tenth Avenue. Wenn er diese Brücke hinter sich hatte, war er am Ziel, war seine Arbeit getan. Er rückte die Mütze verwegener und straffte den Rücken. Die Leute, die zwischen der 30th und 31st Street auf dem Gehsteig saßen, waren alle Verwandte und Freunde seiner Familie. Larry spornte sein Pferd zum Galopp.
Er jagte unter der Brücke durch und winkte den Kindern zu, die über ihm am Geländer hingen. Für die Leute auf dem rechten Gehsteig ließ er sein Pferd steigen, dann lenkte er es nach links hinüber auf den offenen Rangierbahnhof, der sich, ein weites Feld voll funkenstiebenden Stahls, bis an den Hudson hinunterzog.
Hinter ihm stieß die riesige schwarze Lokomotive keuchend weiße Rauchwolken von sich, in denen Brücke und Kinder verschwanden, sodaß nur noch dünne Entzückensschreie zu hören waren, die zu den bleichen, fast nicht auszunehmenden Sternen aufstiegen. Der Güterzug bog auf das Bahngelände ein, die Brücke tauchte wieder auf, und Schwärme von vom Wasserdampf durchnäßten Kindern sausten über die Stiegen hinunter und liefen davon.
Larry band sein Pferd an einen Pfosten neben dem Häuschen des Weichenstellers und setzte sich auf die Bank an der Wand. Auf der anderen Seite der Avenue wurde das wie auf eine Leinwand gepinselte Bild der vertrauten Welt, die er liebte, Zoll um Zoll lebendig.
An der Ecke der 30th Street lag die hellerleuchtete Bäckerei, deren Eisstand von Kindern umlagert war. Der panettiere persönlich füllte die weißen, gerippten Pappbecher mit kirschroten, blaßgelben und glitzerndweißen Eiskristallen. Er teilte recht großzügige Portionen aus, denn er war reich und ging sogar zum Pferderennen, um dort sein Geld zu verschleudern. Nach der Bäckerei, zur 31st Street hin, kam das Lebensmittelgeschäft mit den gelben, von glänzendem Wachs überzogenen provolone-Stangen und den hängenden Dreiecken der prosciutto in ihrer fröhlich-bunten Verpackung. Das Barbiergeschäft nebenan war für die Kundschaft geschlossen, für Kartenspieler jedoch geöffnet, aber sogar jetzt hielt der Barbier eifersüchtig Ausschau nach jedem frisch gestutzten Haarschopf, ob der nicht die Spuren einer fremden Schere trug. Kinder wimmelten wie Ameisen über das Straßenpflaster, Frauen, fast unsichtbar in ihrem Schwarz, bildeten vor jeder Haustür kleine, dunkle Barrieren. Und von jeder Barriere stieg das Gesumm angeregt schwatzender Stimmen zum sternenbesäten Sommerhimmel empor.
Der zwergenhafte Weichensteller kam von den Gleisanlagen herüber und sagte: »Schluß für heute, mein Junge.« Larry machte sein Pferd los, saß auf, lenkte den Rappen herum und ließ ihn noch einmal steigen.
Als sich das Tier auf die Hinterhand hob, begann die Häuserzeile zu wogen, sich Larry entgegenzuneigen wie eine leichte Segelleinwand. Am offenen Fenster seiner elterlichen Wohnung, im obersten Stockwerk des Hauses direkt gegenüber, sah Larry eine dunkle Gestalt, die nur sein kleiner Bruder Vincent sein konnte. Larry winkte, aber nichts rührte sich, erst als er noch einmal winkte, zeigte sich eine Bewegung. In der Häusermauer strahlten nur vereinzelte Fenster gelbliches Licht in die Nacht. Alle Bewohner waren unten auf der Straße, alle sahen ihm zu. Er gab seinem Pferd einen Klaps auf den Hals und galoppierte über das Kopfsteinpflaster der Tenth Avenue zum Stall an der 35th Street.
Früh am Abend, in der Dämmerung, Larry Angeluzzi sattelte im St. John’s Park sein Pferd, hatte sich Lucia Santa Angeluzzi-Corbo, seine Mutter und Mutter von Octavia und Vincenzo Angeluzzi, Witwe von Anthony Angeluzzi, jetzige Ehefrau von Frank Corbo und Mutter seiner drei Kinder namens Gino, Salvatore und Aileen, hatte sich also Lucia Santa angeschickt, ihre leere Wohnung zu verlassen, um der erstickenden Sommerhitze zu entfliehen, den Abend im eifernden Gespräch mit den Nachbarinnen zu verbringen und vor allem ein Auge auf die Kinder zu haben, die unten auf der dunklen Straße spielten.
Lucia Santa fühlte sich wohl heute abend, denn der Sommer war eine gute Zeit: die Kinder ohne Erkältungen und Fieber, keine Sorgen um warme Mäntel, Handschuhe, Stiefel für Winterschnee und Extraausgaben für die Schulausrüstung. Jeder beeilte sich mit dem Abendessen, um endlich der dumpfen Stube zu entfliehen und am wogenden Leben auf der Straße teilhaben zu können; es gab nicht einmal den üblichen abendlichen Streit. Das Haus war leicht sauberzuhalten, denn es war immer leer. Am meisten genoß Lucia Santa jedoch, daß sie den Abend für sich hatte; die Straße war Treffpunkt und der Sommer die Jahreszeit, da die Nachbarinnen zu Freundinnen wurden. Und so nahm sie jetzt, in einem frisch gewaschenen schwarzen Kleid, das pechschwarze Haar zum tiefen Nackenknoten frisiert, den Küchenhocker und stieg die vier Treppen hinab, um sich vor das Haus auf die Avenue zu setzen.
Jeder Block war ein Dorfplatz für sich; jeder hatte seine eigene Gruppe Frauen, die, alle in Schwarz, auf Hockern und Holzkisten saßen und mehr als nur Tratsch von sich gaben. Sie schwelgten in Erinnerungen an die Vergangenheit, stritten über Moral und Sozialgesetzgebung und verglichen damit Fälle, die sich einst in ihrem Bergbauerndorf in Süditalien ereignet hatten, aus dem sie vor so vielen Jahren nach hierher geflohen waren. Und wie genußvoll sie sich ihre Lieblingsbilder ausmalten. Zum Beispiel: Was wäre, wenn ihre gestrengen Väter durch irgendein Wunder herübergeholt würden und sich mit den Problemen herumschlagen müßten, mit denen sie es tagtäglich zu tun hatten? Oder auch ihre Mütter mit den flink zuschlagenden, harten Händen? Welch ein Geschrei, wenn sie als Töchter gewagt hätten, was sich diese amerikanischen Kinder erdreisteten! Wenn sie sich das angemaßt hätten! Wenn sie nur daran gedacht hätten!
Die Frauen sprachen von ihren Kindern, als wären es Fremde. Es war ihr Lieblingsthema: dieses Land und wie es die unschuldigen Kinder verdarb. Zum Beispiel Felicia, die gleich um die Ecke in der 31st Street wohnte. Was für eine Tochter war das nur, die bei der Nachricht von der Erkrankung ihrer Patin nicht ihre Hochzeitsreise unterbrach, obwohl die eigene Mutter sie nach Hause rief! Eine richtige Hure. O nein, sie nahmen kein Blatt vor den Mund. Felicias Mutter persönlich erzählte die Geschichte. Und was für ein Sohn, der Arme, der nicht noch ein einziges Jahr mit dem Heiraten warten konnte, wenn es der Vater verlangte! Ahh, welch eine Respektlosigkeit! Figlio disgraziato. Das könnte in Italien niemals passieren. Dort würde der Vater seinen anmaßenden Sohn umbringen; jawohl, umbringen. Und die Tochter? In Italien – Felicias Mutter schwor es mit einer Stimme, die vor Erregung zitterte, dabei hatte sich das alles vor drei Jahren abgespielt, die Patin war längst wieder gesund, und die Enkel waren das Licht ihres Lebens –, ah, in Italien würde die Mutter diese Hure an den Haaren aus dem Brautgemach und zum Krankenbett zerren. Ah, Italia, Italia! Wie sich die Welt veränderte und immer schlechter wurde! Welcher Wahnsinn hatte sie getrieben, solch ein Land zu verlassen? Wo die Väter über ihre Familie geboten und die Mütter von ihren Kindern mit Achtung behandelt wurden.
Eine nach der anderen erzählten sie ihre Geschichten von Unverschämtheit und Trotz, in denen sie selber heroisch und leiderfahren, die Kinder hingegen boshafte Teufel waren, geradegebogen nur durch Verabreichung der alten italienischen Strafe: eine Tracht Prügel mit dem Riemen. Und zum Abschluß jeder Geschichte intonierten sie ihr ewiges Requiem: Mannaggia America! – Verdammtes Amerika. Ihre Stimmen in der heißen Sommernacht waren aber voll von Hoffnung, von einer Lebenskraft, die sie in ihrer Heimat nicht gekannt hatten. Hier hatten sie Geld auf der Bank, hatten sie Kinder, die lesen und schreiben konnten, und Enkel, die, wenn alles gutging, sogar Lehrer wurden. Mit schuldbewußter Loyalität sprachen sie von Bräuchen, die sie selber in den Staub getreten hatten.
Und die Wahrheit: Diese Landfrauen von den Bergdörfern Italiens, deren Väter und Großväter im selben Zimmer gestorben waren, in dem ihre Mütter sie zur Welt gebracht hatten, diese Frauen liebten den Lärm vom Stahl und Stein, das Donnern der Züge auf dem Rangierbahnhof gegenüber, die Lichter über den »Palisades« am anderen Ufer des Hudson. Als Kinder hatten sie in der Einsamkeit gelebt, auf einem Boden, so karg, daß sich die Menschen weithin an den Berghängen verteilen mußten, um von ihm leben zu können.
Ihr Wagemut hatte ihnen zur Freiheit verholfen. Sie waren Pioniere, auch wenn sie nie über eine amerikanische Prärie gezogen waren und nie lebendige Erde unter ihren Sohlen gespürt hatten. Sie lebten in einer viel trostloseren Wildnis, in einer Wildnis mit fremder Sprache, wo ihre Kinder zu Angehörigen einer fremden Rasse wurden. Das war der Preis, den sie zahlen mußten.
Lucia Santa schwieg zu allem. Sie wartete auf Zia Louche, ihre Freundin und Verbündete. Sie ruhte sich aus, sammelte Kraft für die langen Stunden zufriedenen Geplauders, die vor ihr lagen. Es war noch früh; um Mitternacht erst würden sie in die Häuser zurückkehren. Vorher wurde es in den Zimmern nicht kühler. Sie faltete die Hände im Schoß und wandte ihr Gesicht der sanften Brise zu, die vom Fluß an der Tenth Avenue heraufwehte.
Lucia Santa, eine kleine, rundliche, hübsche Frau, stand auf der Höhe ihrer körperlichen und geistigen Kraft, tapfer und ohne Angst vor dem Leben und seinen Gefahren. Aber nicht tollkühn, nicht leichtsinnig. Sie war stark, erfahren, umsichtig und wachsam – gut gerüstet für die schwere Verantwortung, die sie zu tragen hatte, die Aufgabe, eine große Familie ins Erwachsenenalter und in die Freiheit zu führen. Ihre einzige Schwäche war ein gewisser Mangel an angeborener Schlauheit und List, mit deren Hilfe die Menschen um so viel besser weiterkommen als mit der Rechtschaffenheit.
Vor mehr als zwanzig Jahren, sie war erst siebzehn gewesen, hatte Lucia Santa ihre Heimat verlassen. Dreitausend Meilen weit war sie über einen düsteren Ozean gefahren, in ein fremdes Land, zu einem fremden Volk, um dort mit einem Mann, den sie nur von den gemeinsamen Spielen der unschuldigen Kindheit kannte, ein neues Leben zu beginnen.
Immer wieder erzählte sie diese Geschichte – mit Stolz, aber auch unter Kopfschütteln über ihre eigene Torheit.
Damals war jener Tag gekommen, an dem der Vater ihr, seiner Lieblingstochter, streng, aber voll Mitleid eröffnet hatte, sie brauche sich keine Hoffnung auf Brautleinen zu machen. Der Hof sei zu arm. Es gebe Schulden. Das Leben scheine eher noch schwerer zu werden. Nun wisse sie es also. Ihr bleibe nur noch die Möglichkeit, sich einen Mann zu suchen, den die Liebe schwachköpfig mache.
In diesem Augenblick hatte sie die Achtung vor ihrem Vater, vor ihrer Heimat, vor ihrem Land verloren. Eine Braut ohne Aussteuer war eine Schande, eine ebenso große Schande wie ein Brautbett ohne Blutflecken – nein, eine größere noch, denn hier konnte man nicht zu einer List greifen, konnte man nicht die Hochzeitsnacht auf ein Datum kurz vor der Periode festlegen. Und sogar das hatten Männer schon verziehen. Doch welcher Mann würde eine Frau mit dem Stigma hoffnungsloser Armut nehmen?
Nur die Armen können die Schande der Armut begreifen, die tiefer ist als die Schande des größten Sünders. Denn der Sünder bleibt, besiegt von seinem eigenen, anderen Ich, in einem gewissen Sinn doch der Sieger. Die Armen hingegen sind die wahrhaft Besiegten: besiegt von ihrer Umwelt, von ihren padrones, vom Schicksal und von der Zeit. Sie sind Bettler, bedürfen ständig der Barmherzigkeit. Der Adel der Arbeit ist für die Armen, die schon seit Jahrhunderten arm sind, eine Legende. Ihre Rechtschaffenheit bringt ihnen nur Demütigung und Scham.
Lucia Santa jedoch war hilflos, obwohl sie ihren trotzigen, jugendlichen Zorn nicht ablegte. Dann kam ein Brief aus Amerika; ein Junge vom Nachbarhof, ihr Spielkamerad aus früher Kinderzeit, bat sie, zu ihm in das neue Land zu kommen. Es geschah alles sehr korrekt durch die Vermittlung der beiden Väter. Lucia Santa versuchte sich das Gesicht des Jungen in Erinnerung zu rufen.
Und so wurden eines sonnigen Tages in Italien Lucia Santa und zwei andere Dorfmädchen von ihren weinenden Eltern, Tanten und Schwestern aufs Rathaus und anschließend zur Kirche geführt. Die Mädchen, alle drei ferngetraut, bestiegen ein Schiff und fuhren – vor dem Gesetz schon Amerikanerinnen – von Neapel nach New York. Wie im Traum betrat Lucia Santa ein Land aus Stahl und Stein, schlief noch in derselben Nacht mit einem Fremden, der ihr gesetzlich angetrauter Ehemann war, gebar diesem Fremden zwei Kinder und ging mit dem dritten schwanger, als er aus Unvorsichtigkeit tödlich verunglückte, ein Opfer unter den vielen, die der Aufbau eines neuen Kontinents immer wieder fordert. Sie ertrug alles, ohne sich selbst zu bemitleiden. Sie trauerte – gewiß, aber das war nicht dasselbe; sie bat das Schicksal nur um Gnade. So war sie also eine schwangere Witwe, noch jung, ohne einen Menschen, an den sie sich um Hilfe wenden konnte. Aber sie ließ sich von Angst und Verzweiflung nicht überwältigen. Wie viele Frauen besaß sie erstaunlich viel Kraft und war imstande, Unglück zu ertragen. Aber sie war nicht aus Stein. Sie wurde verbittert – doch nicht ihr Schicksal war schuld daran, sondern die Freunde und Nachbarinnen, dieselben Nachbarinnen, mit denen sie sich an diesem Sommerabend so vertraulich unterhielt.
Ah, die jungen Ehefrauen, die jungen Mütter und die anderen jungen Italienerinnen in diesem fremden Land! Busenfreundinnen waren sie – alle! Wie sie hin und her liefen, die eine in die Wohnung der anderen, die Treppen hinauf und hinab! »Cara Lucia Santa, du mußt probieren, was ich gekocht habe!« Ein Teller Wurst, eine Osterpastete aus Weizenkeimen, geronnenem Käse und mit einer von Eiweiß glänzenden Kruste, oder fette Ravioli für einen Namenstag in der Familie, mit einer besonders guten Fleischfüllung und Tomatensauce. Welch ein Getue, mit Komplimenten, Kaffee, Vertraulichkeiten und Versprechungen, bei dem noch ungeborenen Kind Pate zu stehen! Doch nach dem tragischen Unfall, nach anfänglichem Mitleid und Mit-Leiden zeigte die Welt ihr wahres Gesicht.
Grüße fielen kalt aus, Türen wurden geschlossen, zukünftige Patinnen verschwanden. Wer hatte schon Lust, zu einer jungen, vollblütigen Witwe freundlich zu sein? Ehemänner waren schwach, man würde um Hilfe gebeten werden. In den Mietshäusern wohnte man eng beisammen; eine junge Frau ohne Mann war gefährlich. Sie könnte Geld und Gut aus einem heraussaugen wie ein Blutegel das Blut. Sie waren nicht böswillig, es war einfach die Vorsicht der Armen, über die so leicht spotten ist, wenn man die ihr zugrunde liegende Angst nicht versteht.
Eine einzige Freundin hielt zu ihr. Zia Louche, eine alte, kinderlose Witwe, kam, half, stand Pate, als der vaterlose Vincenzo geboren war, und schenkte dem Patenkind eine goldene Uhr, sodaß Lucia Santa den Kopf hoch tragen konnte, denn ein so kostbares Geschenk bewies Respekt und Vertrauen. Doch Zia Louche blieb die einzige, und als die Trauerzeit vorüber war, sah Lucia Santa die Welt mit neuen und klügeren Augen.
Die Zeit heilte alte Wunden, und jetzt waren sie alle wieder gut Freund. Vielleicht – wer weiß? – war die junge Witwe zu hart in ihrem Urteil gewesen, denn nun halfen ihr dieselben Nachbarinnen, wenn auch in eigenem Interesse, bei der Suche nach einem neuen Ehemann, der ihre Kinder satt fütterte und kleidete. Sie wurden kirchlich getraut. Die Nachbarinnen richteten ihr eine prächtige Hochzeitsfeier aus. Aber Lucia Santa ließ sich von der Welt nie wieder täuschen.
Und so stand Lucia Santa an diesem drückenden Sommerabend, da ihre ersten drei Kinder erwachsen und in Sicherheit, die zweiten bis auf Lena keine Kleinkinder mehr waren, da sie persönlich ein bißchen Geld auf dem Pestsparbuch hatte – stand also Lucia Santa Angeluzzi-Corbo nach zwanzig Jahren der Mühsal und einem reichlichen Maß an Not auf jenem winzigen Hügelchen der Wohlhabenheit, das Arme erklimmen können, erklimmen mit so viel Anstrengung, daß sie glauben, der Kampf sei endgültig gewonnen und ihr Leben sei, wenn sie auch nur die normale Vorsicht walten ließen, endgültig gesichert. Sie hatte ihr Leben gelebt; die Geschichte war aus.
Genug. Da kam Zia Louche und vervollständigte den Kreis. Lucia Santa lauschte aufmerksam und wollte sich schon am Gespräch beteiligen, da sah sie ihre Tochter Octavia. Das junge Mädchen kam von der 30th Street und ging eben an dem panettiere mit seiner roten Glasvitrine voll Pizza und den Weißblechbehältern voll Speiseeis vorbei. Hier verlor Lucia Santa Octavia aus den Augen; für einen kurzen Moment sah sie nur noch das Holzfäßchen des panettiere, das beinahe überquoll von rötlichen Kupfermünzen und silbern glänzenden dimes und nickels. Heißer, leidenschaftlicher Zorn stieg in ihr auf – weil ihr ein deratiger Schatz versagt blieb und weil das Glück dem häßlichen Bäcker so hold war. Doch dann sah sie die Frau des panettiere an – alt, schnurrbartbewehrt, unfruchtbar geworden –, sah, wie sie das Holzfäßchen voll Kupfer und Silber hütete und wie ihre Molluskenaugen mit den faltigen Lidern im Abendlicht Drachenblitze schleuderten.
Lucia Santa fühlte, wie sich Octavia neben ihr auf den Hocker schob; die Hüften und Oberschenkel der beiden Frauen berührten sich. So etwas irritierte sie immer, aber die Tochter würde gekränkt sein, wenn sie von ihr abrückte, daher duldete sie es. Sie fand ihre Tochter in der amerikanischen Kleidung auf eine fremdartige Weise hübsch und sah ihre alte Busenfreundin Zia Louche mit einem Lächeln an, das sowohl Stolz als auch einen Anflug von Ironie verriet. Octavia, still, aufmerksam, wie es sich gehörte, sah dieses Lächeln und verstand seine Bedeutung. Doch sie verstand wieder einmal die Mutter nicht.
Als ob ihre Mutter jemals begreifen würde, daß sie all das sein wollte, was diese Frauen nicht waren! Sie hatte die naive, leicht durchschaubare Klugheit der Jugend, trug ein hellblaues Kostüm, das ihren Busen verbarg und ihre runden Hüften flachdrückte. Dazu, wie ihre ehemalige Lehrerin, weiße Handschuhe. Ihre Brauen waren dicht, schwarz und eindeutig nicht gezupft. Vergeblich suchte sie ihre vollen roten Lippen zu vorgetäuschter Strenge zusammenzupressen und ihren Augen einen ruhigen, ernsten Ausdruck zu geben – und alles nur, um jene übermächtige Sinnlichkeit zu verstecken, die allen Frauen ihrer Umgebung zum Verhängnis geworden war. Denn Octavia glaubte zu wissen, daß die Befriedigung jenes schrecklichen, dunklen Triebes alle anderen Bedürfnisse ausschaltete, und fühlte banges Mitleid für diese Frauen, die von ihren Kindern und den unbekannten Wonnen des Ehelagers im Bann einer Sklaverei gehalten wurden, die keine Träume kannte.
Diesem Schicksal wollte sie entgehen! Wie ein Judas saß sie mit gesenktem Kopf da und lauschte, gab vor, getreue Anhängerin zu sein, und plante dennoch Verrat und Flucht.
Jetzt, da sie ausschließlich von Frauen umgeben war, legte Octavia die Jacke ab. Die weiße Bluse mit der winzigen roten Schleife war verführerischer, als sie ahnte. Nichts konnte ihren prallen Busen verbergen. Das sinnliche Gesicht, die Haarkrone der blauschwarzen Locken, die großen, feuchten Augen – das alles widersprach der Nüchternheit ihres Straßenkostüms. Selbst mit böser Absicht hätte sie sich nicht aufreizender anziehen können, als sie es in aller Unschuld getan hatte.
Lucia Santa nahm ihr die Jacke ab und legte sie sich zusammengefaltet über den Arm – eine mütterliche Geste, die von Besitz und Überlegenheit zeugte. Vor allem aber eine versöhnliche Geste, denn etwas früher am Abend hatten sich Mutter und Tochter gestritten.
Octavia wollte zur Abendschule gehen, wollte Lehrerin werden. Lucia Santa jedoch wollte das nicht erlauben. Nein. Sie würde krank werden, wenn sie arbeitete und zur Schule ging. »Warum? Warum?« fragte die Mutter. »Du, eine so gute Schneiderin! Du kannst viel Geld verdienen.« Die Mutter verweigerte die Erlaubnis aus Aberglauben. Es war eine alte Weisheit:
Das Leben war unheilvoll; wer einen neuen Weg einschlug, brachte sich in Gefahr; er lieferte sich dem Schicksal aus. Ihre Tochter war noch zu jung, um das zu verstehen.
Unvermutet, die Schamröte im Gesicht, hatte Octavia gesagt: »Ich möchte glücklich werden.« Und da war die Mutter zur rasenden Furie geworden. Die Mutter, sonst immer das überhebliche Benehmen ihrer Tochter verteidigend, dieses ewige Bücherlesen, die Schneiderkostüme, die affektiert wirkten wie eine Lorgnette, die Mutter hatte, Verachtung speiend, Octavia nachgeäfft, das perfekte Englisch eines hohlen Collegegirls: »Du möchtest glücklich werden!« Und dann, mit tödlichem Ernst, auf italienisch hinzugefügt: »Danke Gott, daß du am Leben bist!«
In der Abendkühle akzeptierte Octavia die Versöhnungsgeste der Mutter und setzte sich, die Hände im Schoß gefaltet, graziös zurecht. Sie dachte an ihren Streit und fragte sich, wieso die Mutter eigentlich perfekt Englisch sprach, sobald sie ihre Kinder nachäffte. Aus den Augenwinkeln sah sie Guido, den dunkelhäutigen Sohn des panettiere, durch die warme Sommernacht auf den hellen Fleck zukommen, den ihre weiße Bluse bildete. In seinen dunklen, kräftigen Händen trug er einen großen Pappbecher voll Zitronen- und Orangeneis, den er ihr mit einer angedeuteten Verbeugung überreichte. Hastig murmelte er ein paar Worte, die klangen wie: »Mach keinen Klecks auf deine Bluse«, und kehrte eilig zum Eisstand zurück, um seinem Vater zu helfen. Octavia lächelte; aus purer Höflichkeit nahm sie ein paar Mundvoll Eis und gab den Becher dann ihrer Mutter, die eine wahre Leidenschaft für Speiseeis hegte und gierig wie ein Kind zu essen begann. Das Summen der Altfrauenstimmen hielt an.
Ihr Stiefvater bog, den Kinderwagen schiebend, von der 31st Street auf die Avenue ein. Octavia sah zu, wie er von der 31st Street zur 30th Street und wieder zurück wanderte. Und genau wie sie sich von der Ironie ihrer Mutter konfus machen ließ, brachte diese Fürsorglichkeit des Stiefvaters Verwirrung in ihre Gefühle. Denn sie haßte ihn, weil sie ihn für einen grausamen, gemeinen und bösen Menschen hielt. Sie hatte gesehen, wie er die Mutter schlug, wie er die Stiefkinder tyrannisierte. Und in dem verblaßten Erinnerungsbild ihrer Kindheit hatte er für ihr Gefühl viel zu schnell nach dem Tod ihres leiblichen Vaters um die Mutter geworben.
Sie hätte sich gern das schlafende Baby angesehen, die kleine Schwester, die sie von Herzen liebte, obwohl sie das Kind des Stiefvaters war. Aber sie ertrug es nicht, mit diesem Mann zu sprechen, in seine kalten, blauen Augen und in sein hartes, kantiges Gesicht zu sehen. Sie wußte, daß er sie ebenso haßte wie sie ihn, daß sie einander sogar fürchteten. Er hatte es nie gewagt, sie zu schlagen, wie er gelegentlich Vinnie schlug. Dabei hätte sie nicht einmal etwas dagegen gehabt, daß er den Stiefsohn schlug, wenn er sich ihm gegenüber sonst väterlich gezeigt hätte. Aber für Gino, Sal und Aileen brachte er immer Geschenke mit, für Vincent nie, obwohl Vincent doch auch noch ein Kind war. Sie haßte ihn, weil er mit Vincent niemals spazieren- oder zum Haarschneiden ging, wie er es mit seinen leiblichen Kindern tat. Sie fürchtete sich vor ihm, weil er so sonderbar war – der böse, geheimnisvolle Fremde der Märchenbücher, der blauäugige Italiener mit dem Mephistogesicht. Dabei wußte sie, er war ein ungebildeter Bauer, ein armer, primitiver Einwanderer, der sich nur aufspielte. Eines Tages hatte sie ihn in der Subway gesehen, wo er tat, als lese er eine Zeitung. Sie hatte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als es lachend und in verächtlichem Ton der Mutter zu erzählen. Die jedoch hatte geschwiegen und lediglich seltsam gelächelt.
Jetzt aber erzählte eine der schwarzgekleideten Frauen die Geschichte von einer gewissenlosen jungen Italienerin (natürlich in Amerika geboren). Octavia hörte zu. »Ja, ja«, sagte die Frau. »Einen Monat waren sie verheiratet, hatten gerade die Flitterwochen beendet. O ja, sie liebte ihn sehr. In der Wohnung seiner Mutter setzte sie sich auf seinen Schoß. Wenn sie zu Besuch waren, spielte sie mit seiner Hand. So ...« Zwei knotige Hände mit warzigen Fingern umschlangen einander liebevoll, abstoßend auf dem Schoß der Erzählerin. »Und dann gingen sie zum Tanzen in die Kirche. Die Torheit dieser jungen Priester, die nicht einmal Italienisch sprechen! Ihr Mann gewann einen Preis für den Sieg in einem Wettspiel. Er nahm den Preis entgegen und fiel tot um. Sein armes Herz, er war immer kränklich gewesen. Seine Mutter hatte ihn gewarnt, immer Angst um ihn gehabt. Aber jetzt: Die junge Frau, die mit einem anderen tanzt, wird benachrichtigt. Eilt sie an die Seite ihrer geliebten Mannes? Sie schreit. Sie weint: ›Nein, nein, ich kann nicht!‹ Sie furchtet sich vor dem Tod – wie ein Kind, nicht wie eine Frau. Der Mann, den sie liebt, hegt in seiner eigenen Pisse, allein, aber sie liebt ihn nicht mehr. Sie schreit: ›Nein, nein, ich kann das nicht sehen!‹«
Zia Louche sagt hämisch, die Doppelbedeutung des Wortes auf ihrer Zunge auskostend: »Ah! Als ›es‹ noch lebendig war, hat sie ›es‹ bestimmt gern gesehen.« Das rauhe Gelächter der Frauen erfüllte die Avenue, rief neidische Blicke der anderen Frauengruppen hervor. Octavia fühlte sich angewidert; sie war wütend, weil sogar ihre Mutter amüsiert lächelte.
Man ging zu ernsteren Dingen über. Lucia Santa und Zia Louche hielten tapfer die Stellung gegen die übrigen. Es ging um ein Problem aus ferner Vergangenheit, um die genauen Einzelheiten eines Skandals, der sich vor zwanzig Jahren in Italien, auf der anderen Seite des Ozeans, abgespielt hatte. Belustigt sah Octavia zu, wie ihre Mutter Zia Louche das Wort redete, während die Alte dafür mit Eifer für ihre Mutter eintrat. Sie behandelten einander wie Königinnen. Immer wieder wandte sich ihre Mutter an Zia Louche, um ehrfürchtig zu fragen: »Evero, Comare?« Und Zia Louche antwortete jedesmal hoheitsvoll: »Si, Signora.« Denn vor den anderen zeigten sie ihre Vertrautheit nicht.
Octavia jedoch wußte, was die beiden Frauen verband, wußte, wie groß die Dankbarkeit war, die ihre Mutter für tatkräftige Unterstützung in tiefster Notlage empfand.
Der Streit war zu fein ausgesponnen, Octavia begann sich zu langweilen. Sie erhob sich, um einen Blick auf das Baby, auf ihre Halbschwester, zu werfen; sie starrte in den Kinderwagen, ohne den Stiefvater zu begrüßen. Sie betrachtete den Säugling mit überwältigender Zärtlichkeit, wie sie sie nicht einmal für Vincent empfand.
Dann ging sie weiter, zur Ecke der 31st Street, um nach Gino zu sehen, und stellte fest, daß er spielte, daß der kleine Sal auf dem Randstein saß. Sie brachte Sal zu ihrer Mutter. Vinnie konnte sie nirgends entdecken. Erst als sie den Kopf hob, sah sie ihn hoch über sich auf der Fensterbank sitzen – dunkel, regungslos, wie ein Wachtposten.
Düster beobachtete Frank Corbo, wie seine große Stieftochter sich über den Wagen beugte. Fremdartig mit seinen blauen Augen, für viele ein Gegenstand der Belustigung (denn welcher Italiener schob an Sommerabenden einen Kinderwagen?), Analphabet, stumm sein Verstand sah er all die Schönheit dieser dunklen, steinernen Stadt, spürte den Haß seiner Stieftochter, doch ohne den Haß zu erwidern. Hinter dem groben, mageren Gesicht verbarg sich eine wortlose, verzehrende Qual. Sein Leben war ein Traum von Schönheit, die er fühlte und nicht verstand, von Liebe, verzerrt bis zur Grausamkeit. Zahllose Schätze gingen wie Schatten an ihm vorbei, die Welt war ihm verschlossen. Auf der Suche nach Befreiung wollte er heute nacht noch die Stadt und seine Familie verlassen. In den frühen Morgenstunden, bevor es hell wurde, wartete der Lastwagen eines Bauern auf ihn, und er würde gehen – ohne ein Wort, ohne Streit und ohne Schläge austeilen zu müssen. Er würde auf den braungrünen Sommerfeldern arbeiten, Ruhe vor der Liebe finden, seine Lebenskraft erneuern.
Er litt. Er litt wie ein Taubstummer, der singen möchte, wenn er Schönheit sieht, der nicht aufschreien kann, wenn er Schmerzen spürt. Er fühlte Liebe und konnte nicht zärtlich sein. In den Zimmern um ihn herum schliefen zu viele Menschen, durch die Straßen um ihn herum wanderten zu viele Wesen. Er hatte schreckliche Träume. Vor einem schwarzen Hintergrund umkreisten ihn seine Frau und die Kinder, und jedes zog einen Dolch aus der Stirn. Er hatte laut aufgeschrien.
Es war spät, sehr spät; die Kinder müßten eigentlich schon im Bett liegen, aber es war noch zu heiß. Frank Corbo sah seinen Sohn Gino wie einen Verrückten herumjagen: es mußte irgendein Fangespiel sein, das dem Vater ebenso unverständlich war wie die amerikanische Sprache des Kindes, wie Bücher und Zeitungen, die Farben des Nachthimmels, die Schönheit des Sommerabends und alle Freuden der Welt, von denen er sich ausgeschlossen fühlte und die ihm alle das Zeichen des Schmerzes zu tragen schienen. Die Welt war ein großes Mysterium. Ungeheure Gefahren, vor denen andere ihre Kinder schützen konnten, würden ihn und seine Lieben in den Staub werfen, würden seine Kinder lehren, ihn zu hassen.
Und dennoch schob der Vater, nicht ahnend, daß er gerettet werden sollte, den Kinderwagen auf und ab. Nicht ahnend, daß sich tief in seinem Blut, in den winzigen, geheimnisvollen Zellen seines Gehirns eine neue Welt zu formen begann. Langsam, Tag um Tag, Schmerz um Schmerz, Schönheit um verlorene Schönheit stürzten die Mauern der Welt, die er so fürchtete, in der Zeitlosigkeit seines Verstandes zusammen. Statt dessen sollte in einem Jahr eine neue, phantastische Welt erstehen, in der er der Gott und der König war, in der seine Feinde verwirrt und verängstigt und seine Lieben für immer verloren waren, in der jedoch der Verlust dieser Liebe weder empfunden noch betrauert würde. Eine Welt solch chaotischen Schmerzes, daß er in Ekstase versinken, Mysterien und Furcht gebannt sein würden. Er würde frei sein.
Solches aber war wie ein Wunder, und so konnte dem weder Zeichen noch Warnung vorausgehen. Jetzt, in dieser Nacht, setzte er all seine Hoffnung auf den Gedanken, diesen einen Sommer lang den Acker zu bestellen, wie er es vor vielen Jahren als Junge in Italien getan hatte.
Für Kinder besitzt die Welt ein besonderes Licht, die Geräusche sind von magischer Kraft. Gino Corbo rannte durch das metallische Klirren der Lokomotiven, die gelben Lichtkreise der Straßenlaternen, er hörte kleine Mädchen lachen und war so in sein Spiel vertieft, daß ihn der Kopf schmerzte. Kreuz und quer rannte er über die 31st Street in dem Versuch, andere Kinder zu fangen oder sie einzukesseln. Doch immer wich jemand mit ausgestreckten Händen an eine Wand zurück. Einmal wurde Gino in die Enge getrieben, aber ein Taxi schnitt seinen Gegnern den Weg ab, und Gino rannte auf seinen Gehsteig zurück. Er sah, daß der Vater ihn beobachtete, lief auf ihn zu und rief: »Gibst du mir einen Penny für Zitroneneis?« Die Münze in der Faust, lief er die Tenth Avenue entlang und plante einen großartigen Trick. Er versuchte an seiner Mutter und ihren Freundinnen vorbeizukommen. Doch Zia Louche erwischte ihn am Arm und brachte ihn, die knochigen Finger wie eine Falle aus Stahl, aus dem Gleichgewicht.
Benommen, ungeduldig betrachtete er die alten Frauengesichter, von denen einige sogar einen Schnurrbart hatten. Voll Ungestüm, voll Angst, das Spiel könnte enden, wollte er weiterlaufen, doch Zia Louche hielt ihn so mühelos, als sei er eine zappelnde Fliege, und sagte: »Komm, ruh dich aus. Setz dich zu deiner Mutter und ruh dich aus. Sonst bist du morgen krank. Fühl nur, wie schnell dein Herzchen pocht!« Sie legte ihm ihre dürre, klauenähnliche Hand auf die Brust. Heftig versuchte er sich loszureißen. Aber die Alte hielt fest und sagte mit grimmiger Zuneigung: »Eh, come è faccia brutta.« Er verstand, daß sie ihn häßlich nannte, und wurde still. Er starrte die Frauen an. Sie lachten, doch Gino wußte nicht, daß sie aus Freude an seinem hitzigen Temperament, aus Freude an seinen blitzenden Augen lachten.
Er spuckte nach Zia Louche – mit jenem vorgetäuschten Spucken der Italienerinnen, mit dem sie bei einem Streit ihre Verachtung kundtun. Das gab ihm Gelegenheit, sich zu befreien, und er war so flink dabei, daß ihn die Hand seiner Mutter nur streifte, als sie ihm eine Ohrfeige gab. Eilig lief er davon. Um die Ecke, die 30th Street entlang bis zur Ninth Avenue, die Avenue hinauf bis zur 31st Street, und dann durch die 31st Street zur Tenth Avenue zurück wollte er laufen; und wenn er alle vier Seiten des Häuserblocks hinter sich hatte, wollte er aus der Dunkelheit über das Spiel hereinbrechen und seine Feinde mit einem einzigen Meisterstreich vernichten.
Doch während er in vollem Tempo der Ninth Avenue zu lief, formierten sich ein paar fremde Jungen vor ihm zu einer Mauer. Gino ließ seine Beine höher und schneller wirbeln, und dann durchbrach er die Kette. Hände packten sein Hemd und zerrissen es, der Wind blies ihm ins Gesicht. Die Jungen verfolgten ihn noch die Ninth Avenue entlang, doch als er an der 31st Street ins Dunkle abbog, wagten sie sich nicht weiter. Gino verlangsamte sein Tempo. Bedächtig ging er an den Haustreppen vorbei. Hier befand er sich auf der letzten Seite des Quadrats, und weiter vorn, am Ende der Straße, dicht vor der Tenth Avenue, schossen seine Freunde in den mattgelben Lichtkegeln der Straßenlaternen wie kleine, schwarze Ratten umher. Sie spielten also noch. Er war nicht zu spät gekommen.
Im Dunkeln ruhte er sich aus und schlich dann langsam die Straße entlang. In einem Souterrainzimmer sah er ein kleines Mädchen an einer halb weißen, halb grellblau getünchten Wand lehnen. Es hatte den Kopf auf den gegen die Wand gestützten Arm gelegt, die Augen vor dem künstlichen Licht des leeren Zimmers verborgen. Gino wußte, daß es nicht weinte, sondern daß es Verstecken spielte und daß der verlassene Raum, wenn er nur lange genug wartete, auf einmal von kreischenden kleinen Mädchen wimmeln würde. Aber er blieb nicht stehen; er wußte nicht, daß er in der Erinnerung das Mädchen immer so sehen würde, wie er es in diesem Augenblick sah: allein, das Gesicht an der blau-weißen Wand versteckt, einsam, sich niemals verändernd, als habe er es, indem er nicht stehenblieb, für immer dort fixiert. Er ging weiter.
Ein blasser Lichtfleck ließ ihn anhalten. Er fror. An einem Fenster saß eine alte Irin; sie beugte sich, den Kopf auf ein pelziges Kissen gestützt, weit heraus und beobachtete ihn, der an ihr vorbei die leere, schweigende Straße entlangwanderte. Ihr Kopf wirkte in dem mattgelben Licht vom Alter verknöchert, ihr schmaler, schnurrbärtiger Mund im Schein einer heiligen, roten Kerze blutig. Hinter diesem barbarischen Gesicht, im Schatten des Zimmers nur undeutlich zu erkennen, glänzten eine Vase, eine Lampe und ein Götzenbild wie alte Knochen. Gino starrte sie an. Die Alte bleckte grüßend die Zähne. Gino lief weiter.
Jetzt konnte er die Rufe seiner Freunde hören; er näherte sich den Lichtkreisen der Tenth Avenue. Er duckte sich in einen Kellerabgang, verborgen, gewaltig, zum Zuschlagen bereit. Er dachte gar nicht daran, sich vor der Nacht oder vor dem dunklen Keller zu fürchten. Er vergaß sogar den Zorn seiner Mutter. Er lebte jetzt nur diesem Augenblick, und dem Augenblick, da er den Lichtkreis betreten und ihn zerschmettern würde.
Hoch über der Tenth Avenue hockte Vincenzo Angeluzzi, Gino Corbos dreizehnjähriger Halbbruder, auf seiner Fensterbank und lauschte grübelnd den gedämpften, wispernden Geräuschen der Sommernacht, die zu ihm heraufdrangen. Die lange Zimmerflucht hinter ihm lag dunkel und leer, die Wohnungstür, die direkt in die Küche führte, war abgeschlossen. Er hatte sich freiwillig in die Verbannung begeben.
Man hatte ihm seinen Traum von Sommer, Freiheit und Spiel genommen. Seine Mutter hatte ihm eröffnet, daß er am nächsten Morgen den Job beim panettiere antreten und bis zum Schulanfang im Herbst dort arbeiten werde. Er würde also in der heißen Sonne schwere Brotkörbe schleppen, während die anderen Jungen im Fluß badeten, Baseball oder »Johnny Ride the Pony« spielten und hinten auf Trolleybusse aufsprangen, um sich die Stadt anzusehen. Er durfte weder bequem im Schatten sitzen und Zitroneneis lutschen noch an der Mauer von Runkels Fabrik hocken und lesen, noch mit den anderen »Bankers and Brokers« oder »Seven-and-a-half« spielen.
Er war ein Wächter auf der Westmauer der Stadt, und alles, was er sah, drückte auf seine Seele und sein Gemüt: die öde Weite des Rangierbahnhofs, die Stahlschienen, die verlassenen Güterwagen, die Lokomotiven, die schmutzigrote Funken spien und leise Warnpfiffe ausstießen. Der Hudson unterhalb des felsigen Jerseyufers zog sich hin wie ein schwarzes Band.
Er döste auf seiner Fensterbank vor sich hin, und babylonisches Stimmengewirr stieg wie fernes Rufen zu ihm empor. Weit hinten auf der Avenue sah er die rote Laterne eines Dummy Boy den Güterzug vom St. John’s Park herüberführen. Die Kinder unten spielten weiter, und Vincent wartete mit düsterer Genugtuung auf ihr Freudengeschrei, genoß das bittere Gefühl, daß er an ihrem Vergnügen nicht mehr teilhatte. Und dann begannen die Kinder zu kreischen und kletterten die Treppe zur Brücke hinauf, wo sie die Dampfwolke erwarteten, die alle unsichtbar und naß machte.
Vincent war noch zu jung, um zu erkennen, daß er von Natur aus ein Melancholiker war und daß sich seine Schwester Octavia deswegen so große Sorgen machte, daß sie ihm ständig Geschenke und Schokolade mitbrachte. Als er noch klein war, hatte Octavia ihn immer mit ins Bett genommen, wo sie ihm Geschichten erzählte und Lieder vorsang, damit er mit der Erinnerung an ein Lächeln einschlafen konnte. Sein inneres Wesen verändern aber konnte sie nicht.
Unten hörte er Zia Louche, von der kräftigen Stimme seiner Mutter unterstützt, in schrillem Ton streiten. Unwillig dachte er daran, daß diese Alte da unten seine Patin war und daß er das goldene Fünfdollarstück, das sie ihm jedesmal zum Geburtstag schenkte, mit einem Kuß bezahlen mußte – mit einem Kuß, zu dem er sich nur herbeiließ, um seiner Mutter eine Freude zu machen. Er fand seine Mutter schön, obwohl sie dick und immer schwarz gekleidet war, und er gehorchte ihr aufs Wort.
Zia Louche aber haßte er, seit er sich erinnern konnte. Vor langer Zeit, als er noch zu Füßen der Mutter auf dem Küchenfußboden spielte, pflegte Zia Louche ihn intensiv zu beobachten. Die beiden Frauen unterhielten sich angeregt und ohne die Förmlichkeit, die sie in der Öffentlichkeit zeigten. Genüßlich riefen sie sich die Schicksalsschläge der vergangenen Jahre zurück. Danach folgte unfehlbar langes Schweigen. Während die Frauen Kaffee tranken, musterten sie ihn nachdenklich. Dann seufzte Zia Louche durch ihre altersbraunen Zähne, wandte sich an den Kleinen und sagte mit resignierendem, grimmigem Mitleid: »Ah, miserabile, miserabile! Dein Vater mußte sterben, bevor du zur Welt kamst.«
Das war der Höhepunkt; die Alte ging zu anderen Themen über, und er sah verwirrt, daß seine Mutter schneeweiß wurde und ihre Augen sich röteten. Sie griff nach ihm, streichelte ihn, aber sie sagte nie etwas.
Unten auf der Straße sah Vincent seine Schwester Octavia aufstehen und sich über den Kinderwagen beugen. Octavia haßte er ebenfalls. Sie hatte ihn verraten. Sie hatte gegen die Absicht der Mutter, ihn arbeiten zu schicken, nicht protestiert. Nun ritt der Dummy Boy unter der Brücke durch, und Vincent erkannte seinen Bruder Larry, der wie ein richtiger Cowboy auf seinem Rappen saß.
Sogar hier oben konnte er das laute Klappern der Hufe auf den Kopfsteinen hören. Kinder und Brücke verschwanden in der Dampf wölke der Lokomotive. Mit einem dichten Funkenregen bog der Zug in den Rangierbahnhof ein.
Es war spät geworden. Die Nachtluft hatte der Stadt Kühlung gebracht. Die Mutter und die anderen Frauen nahmen Hocker und Kisten, riefen Männer und Kinder herbei. Sein Stiefvater schob den Kinderwagen zur Haustür. Es wurde Zeit, zu Bett zu gehen.
Vincent verließ die Fensterbank und ging durch die Schlafzimmer zur Küche. Er schloß die Wohnungstür auf, ließ die Familie ein. Dann holte er das italienische Brot, einen schenkeldicken Laib, und schnitt drei kräftige, knusprige Scheiben herunter. Auf diese goß er zuerst roten Weinessig, dann dickes, gelbgrünes Olivenöl. Er trat zurück, streute Salz über die drei Brotstücke und musterte sie mit zufriedenem Blick. Das grobe Brot leuchtete in köstlichem Rot mit fettiggrünen Tupfen darauf. Gino und Sal würden selig sein über dieses Betthupferl. Sie würden es gemeinsam essen. Er wartete. Durch die noch immer offenen Fenster und die Reihe der dazwischenliegenden Räume drang Ginos Stimme in einem schrillen, langgezogenen Schrei zu ihm herauf. Lucia Santa, die das Baby auf dem Arm hielt, erstarrte bei diesem Schrei. Octavia, an der Ecke der 30th Street, fuhr herum und spähte zur 31st Street hinüber. Auf der anderen Seite der Avenue riß Larry sein Pferd herum. Der Vater, dessen Schläfen vor Angst zu platzen drohten, fluchte und setzte sich in Trab. Aber der Schrei des Kindes war ein beinahe hysterisches Triumphgeheul. Gino war aus dem Dunkel hervorgebrochen, umkreiste seine Feinde und schrie: »Brennt die Stadt nieder! Brennt die Stadt nieder!« Obwohl damit sein Spiel beendet war, konnte er dennoch nicht aufhören, zu rennen und die magischen Worte zu schreien. Mit weiten Sprüngen lief er auf die gewaltige, drohende Gestalt seiner Mutter zu, erinnerte sich noch rechtzeitig der Kränkung, die er Zia Louche zugefügt hatte, schlug einen Haken und schoß durch die Haustür und die Treppe hinauf.
Lucia Santa blieb, trotz ihrer festen Absicht, ihm eine kräftige Ohrfeige zu versetzen, regungslos stehen. Sie war wie gebannt von einem ungeheuren Stolz, einer großen Zärtlichkeit über die wilde Freude ihres Sohnes, über sein Temperament, das sie eines Tages würde zügeln müssen. Sie ließ ihn ungeschoren vorbei.
Die Neapolitaner zogen sich von der dunklen Straße zurück und überließen die Stadt dem Klappern der Hufe auf dem Pflaster, als Larry Angeluzzi sein Pferd im Galopp zum Stall an der 35th Street ritt.
2
Die Familie Angeluzzi-Corbo wohnte im besten Mietshaus der Tenth Avenue. Hier gab es in jedem der vier Stockwerke jeweils nur eine Wohnung, sodaß sowohl nach Westen, auf die Tenth Avenue, als auch nach Osten, auf die Hinterhöfe, Fenster hinausgingen und man daher Durchzug machen konnte. Die Angeluzzi-Corbos konnten, da sie das oberste Stockwerk allein bewohnten, den Hausflur sogar noch als Vorratslager benutzen. Hier standen der Eiskasten und eine Kommode mit zahllosen Dosen Tomatenmark, und an der Wand entlang waren Makkaronikartons gestapelt, denn obgleich die Wohnung aus sechs Zimmern bestand, mangelte es ihren Bewohnern ständig an Platz.
Die Wohnung war angelegt wie ein langgestrecktes E ohne Mittelbalken. Die Küche bildete den unteren Querbalken; dann kamen das Eßzimmer, die Schlafzimmer, das Wohnzimmer mit seinen Fenstern zur Tenth Avenue: der lange, senkrechte Balken; und endlich schloß Octavias kleines, als einziges mit einer Tür versehenes Schlafzimmer neben dem Wohnraum als oberer Querbalken das große E ab. Gino, Vinnie und Sal schliefen im Wohnzimmer in einem Bett, das sich zusammenklappen und zur Seite stellen ließ. Tagsüber stand es, mit einem Überwurf bedeckt, in einer Ecke. Die Eltern hatten das erste Schlafzimmer der Reihe, Larry das daran anschließende. Dann kam das Eßzimmer, das Küche genannt wurde – es war mit einem großen Holztisch zum Essen und Sitzen ausgestattet –, und dann, im rechten Winkel dazu, die eigentliche Küche mit Boiler, Spülstein und Herd. Gemessen am Wohnstandard des Viertels war diese Wohnung verschwenderisch luxuriös und wieder einmal ein Beweis für Lucia Santas Unfähigkeit zu sparsamem Wirtschaften.
Octavia legte das Baby Aileen ins Bett ihrer Mutter und zog sich dann in ihrem eigenen Zimmer um. Als sie in einem einfachen Hauskleid wieder zum Vorschein kam, schliefen die Jungen schon alle drei tief und fest in dem großen Bett, das aufgeklappt worden war. Octavia ging durch die Zimmerreihe zur Küche, um sich das Gesicht zu waschen. Die Mutter saß, ein kleines Glas Wein vor sich auf dem Tisch, wartend im Eßzimmer. Octavia hatte gewußt, daß ihre Mutter aufbleiben würde, damit sie den angefangenen Streit beenden konnten, und daß sie anschließend wie zwei Verschwörerinnen gemeinsame Pläne für eine glückliche Zukunft der Familie schmieden würden: ein Haus auf Long Island, Collegeausbildung für das gescheiteste Kind.
Lucia Santa war offensichtlich zur Versöhnung bereit. Sie sagte auf italienisch: »Der Sohn des Bäckers hat ein Auge auf dich. Er schenkt dir jedoch nicht Eis, damit du ihn ignorierst.« Sie machte gern solche ironischen Bemerkungen, hielt jetzt aber inne, um aufmerksam ins Schlafzimmer hinüberzulauschen. Beunruhigt fragte sie: »Hast du Lena auch in die Bettmitte gelegt? Kann sie bestimmt nicht herausfallen?«
Octavia war wütend. Die Spöttelei konnte sie noch verzeihen, obgleich ihre Mutter genau wußte, daß sie von den jungen Männern der Nachbarschaft nicht viel hielt. Aber sie selbst hatte der kleinen Halbschwester den Namen Aileen gegeben. Nach langem Zögern hatte Lucia Santa sich damit einverstanden erklärt. Es wurde Zeit, amerikanisch zu sein. Doch eine italienische Zunge konnte den Namen nicht aussprechen. Unmöglich. Und darum hatten sie ihn zu dem vertrauteren Lena abgekürzt. Nach einigen tapferen Versuchen der Tochter zuliebe hatte Lucia Santa eines Tages die Geduld verloren und auf italienisch geschrien: »Es ist ja nicht einmal richtig amerikanisch!« So blieb das Baby für alle Lena – nur für die anderen Kinder der Familie nicht. Denn die hatten Octavias fünf Finger im Gesicht, wenn sie sich eine solche Frechheit herausnahmen.
Mutter und Tochter wappneten sich zum Kampf. Octavia schob ihre Frisur zurecht; dann holte sie vom Regal in der Küche ihr Necessaire. In peinlich korrektem Englisch sagte sie voll Verachtung: »Ich werde nie einen von diesen Makkaronis heiraten. Die wollen doch nur eine Frau, damit sie sie wie einen Köter behandeln können. Ich will kein Leben haben, wie du es hast.« Sie begann mit einer sorgfältigen Maniküre. Anschließend wollte sie sich noch die Nägel lackieren. Das würde die Mutter ärgern.
Lucia Santa beobachtete ihre Tochter mit betont dramatischem Schweigen. Sie atmete kurz und schwer. Im Zorn glichen die beiden einander sehr: schwarze, feucht glitzernde Augen blitzten; volle, sinnliche Züge erstarrten vor Wut und Trotz. Doch als die Mutter zu sprechen begann, klang ihre Stimme völlig nüchtern.
»Ah«, sagte sie, »so sprechen in Amerika also die Töchter mit ihrer Mutter? Brava. Du würdest eine gute Lehrerin abgeben.« Kühl beugte sie sich ihrer Tochter zu. »Non mi tocca. Mir ist es egal.« Und das junge Mädchen wußte: noch eine einzige solche Unverschämtheit, und ihre Mutter würde sich wie eine Katze auf sie stürzen, um ihr eine kräftige Ohrfeige zu verabreichen. Octavia fürchtete sich nicht, aber sie war – innerhalb vernünftiger Grenzen – gehorsam. Und sie wußte, daß ihre Mutter, das Familienoberhaupt, sie brauchte, sie respektierte, sich nie mit Außenstehenden gegen sie verbünden würde. Sie hatte Gewissensbisse, denn sie kam sich wie eine Verräterin vor, weil sie das Leben ihrer Mutter für gescheitert hielt.
Octavia lächelte, um ihren Worten die Härte zu nehmen. Sie sagte: »Ich meine nur, daß ich nicht heiraten oder, wenn ich es doch tun sollte, keine Kinder haben will. Ich möchte nicht mein ganzes Eigenleben opfern – nur dafür.« Mit diesem letzten Wort gab sie ihrer tiefen Verachtung Ausdruck, aber auch ihrer heimlichen Angst vor dem Unbekannten. Lucia Santa maß ihre amerikanische Tochter von Kopf bis Fuß. »Ah«, sagte sie, »mein armes Kind!« Octavia spürte, wie das Blut ihr heiß ins Gesicht stieg, und blieb stumm. Der Mutter war etwas anderes eingefallen; sie stand auf, ging ins Schlafzimmer und kam mit dem Postsparbuch zurück, in dem zwei Fünfdollarscheine lagen. »Hier, schnell! Steck es in dein Kleid, bevor dein Vater und dein Bruder kommen. Bring es morgen bei der Arbeit zur Post.«
Octavia sagte gelassen, aber voll Bosheit: »Er ist nicht mein Vater.«
Nicht ihre Worte, sondern der stille Haß dahinter trieb der Mutter heiße Tränen in die Augen. Denn nur sie beide konnten sich an Lucia Santas ersten Mann erinnern; nur sie beide hatten jenes erste Leben wirklich miteinander geteilt und miteinander gelitten. Er war der Vater von drei Kindern gewesen, doch nur dieses eine teilte die Erinnerung an ihn mit ihr. Noch schlimmer sogar: Octavia hatte ihren Vater leidenschaftlich geliebt, und sein Tod hatte sie tief getroffen. Die Mutter wußte das, und sie wußte auch, daß ihr ihre zweite Ehe ein wenig von der Zuneigung ihrer Tochter genommen hatte.
Lucia Santa sagte leise: »Du bist ein junges Mädchen, du weißt noch nicht, wie das Leben ist. Frank Corbo hat eine einsame Witwe mit drei kleinen Kindern geheiratet. Er hat uns Brot gegeben. Er hat uns beschützt, als alle außer Zia Louche nicht mal auf unsere Schwelle gespuckt hätten. Dein eigener Vater war auch nicht so wunderbar, wie du glaubst! Ah, ich könnte dir vieles erzählen! Aber er war dein Vater.« Die Tränen waren getrocknet, und Lucia Santa trug bei der Erinnerung an eine schwere Zeit wieder die vertraute Maske aus Schmerz und Zorn, die ihre Tochter stets tief beunruhigte.
Schon oft hatten sie über dieses Thema gestritten, und jedesmal hatten sie festgestellt, daß diese Wunde immer noch nicht geheilt war.
»Er ist uns keine Hilfe«, sagte Octavia. Sie war jung und erbarmungslos. »Du zwingst Vinnie, den armen Jungen, bei diesem widerlichen Bäcker zu arbeiten. Er wird überhaupt nichts von diesem Sommer haben. Und dein wunderbarer Ehemann, der kann nur Hausmeister spielen, damit wir wenigstens mietfrei wohnen. Warum sucht er sich keine Arbeit? Warum ist er so gottverdammt eingebildet? Wofür hält er sich denn? Mein Vater, ja, der hat gearbeitet. Mein Gott, er ist bei der Arbeit sogar gestorben!« Sie schwieg, um ihre aufkommenden Tränen zu unterdrücken.
Dann fuhr sie hastig fort, als glaube sie, die Mutter tatsächlich überzeugen zu können: »Er aber, er hat seine Arbeit bei der Bahn nur verloren, weil er so überheblich war. Der Chef sagt zu ihm: ›Nun lassen Sie sich nicht den ganzen Tag Zeit, wenn Sie einen Eimer voll Wasser holen!‹ Und er nimmt den Eimer und kommt überhaupt nicht zurück. Das fand er so komisch, daß er sogar stolz darauf war. Und du hast kein Wort gesagt, kein einziges Wort! Ich hätte ihn ‘rausgeschmissen, hätte ihn nicht wieder ins Haus gelassen. Und ganz bestimmt hätte ich ihm niemals Gelegenheit gegeben, mir wieder ein Kind zu machen.« Sie sagte es geringschätzig, mit einer Miene, die andeutete, daß sie ihn niemals jenen dunklen Akt der Vereinigung und Überlegenheit ausüben lassen würde, der alle Nächte ausfüllt. Doch ihre Mutter hatte die Geduld verloren.
»Sprich nicht von Dingen, die du nicht verstehst«, wies sie ihre Tochter zurecht. »Du bist ein junges, dummes Ding, und wenn du alt bist, wirst du auch nicht klüger werden. Herr, gib mir Geduld!« Sie trank den letzten Schluck Wein und seufzte müde. »Ich gehe zu Bett. Laß die Tür für deinen Bruder offen. Und für meinen Mann.«
»Um unseren lieben Lorenzo brauchst du dir keine Sorgen zu machen«, sagte Octavia. Sie strich sich Lack auf die Nägel. Voll Abscheu starrte die Mutter das grelle Rot an und kam noch einmal ins Zimmer zurück.
»Was ist eigentlich mit Lorenzo?« fragte sie. »Seine Arbeit ist um Mitternacht beendet. Warum ist er noch nicht zu Hause? Die Mädchen sind jetzt nicht mehr auf der Straße, höchstens noch diese irischen Flittchen von der Ninth Avenue.« Und mit ironischem Pathos fügte sie hinzu: »Gott sei Dank verführt er nur gute, anständige Italienerinnen.« Sie lächelte mit einem Anflug von Stolz.
Octavia sagte kühl: »Vielleicht übernachtet Larry bei den Le Cinglatas. Mr. Le Cinglata ist wieder mal im Gefängnis.«
Die Mutter begriff. Die Le Cinglatas kelterten ihren eigenen Wein und verkauften ihn glasweise in ihrer Wohnung. Kurz gesagt, sie waren Alkoholschwarzhändler, die das Prohibitionsgesetz übertraten. Erst in der vergangenen Woche hatte die Le Cinglata Lucia Santa drei große Krüge geschickt – angeblich weil Lorenzo beim Abladen von Weintrauben behilflich gewesen war. Signora Le Cinglata war eines der drei Mädchen gewesen, die vor so vielen Jahren in Italien ferngetraut worden waren. Das schüchternste, bescheidenste sogar. Gut. Da war heute abend nichts mehr zu machen. Die Mutter zuckte die Achseln und ging zu Bett.
Zuvor ging sie noch einmal ins Wohnzimmer, um die drei Jungen mit einem Laken zuzudecken. Dann schaute sie aus dem offenen Fenster auf die dunkle Straße hinaus und sah ihren Mann noch immer die Tenth Avenue auf und ab wandern. Leise rief sie ihm zu: »Frank, bleib nicht so lange!« Er aber schaute nicht auf – weder zu ihr noch in den Himmel.
Endlich lag sie im Bett. Und jetzt wollte sie nicht einschlafen, denn sie hatte stets das Gefühl, daß sie, solange sie wach blieb, in einem gewissen Maße die Handlungen ihres Mannes und ihres Sohnes kontrollieren konnte. Sie war verärgert, aufrichtig böse darüber, daß sie die beiden nicht zwingen konnte, die Welt draußen zu verlassen und in ihr Heim zurückzukehren, zu schlafen, wenn sie schlief.
Sie streckte die Hand aus. Das Kind lag warm und sicher an der Wand. Sie rief: »Octavia, geh zu Bett! Geh schlafen, es ist schon spät, und du mußt morgen arbeiten!« Im Grunde aber rief sie das nur, weil sie nicht schlafen konnte, solange in der Wohnung noch jemand wach war. Gleich darauf durchquerte die Tochter stumm, rebellisch das Schlafzimmer ihrer Mutter.
In dem drückenden Sommerdunkel, durch das der seufzende Atem schlafender Kinder strich, dachte Lucia Santa über ihr Leben nach. Die zweite Ehe hatte ihren ersten Kindern Kummer bereitet. Sie wußte, daß Octavia ihr vorwarf, nicht in gebührender Form getrauert zu haben. Aber wie sollte man einer jungen, unberührten Tochter erklären, daß ihr Vater, der Ehemann, mit dem man das Bett teilte, mit dem man den Rest seines Lebens hatte verbringen wollen, ein Mann gewesen war, den man im Grunde nicht gern hatte?
Er war der Herr des Hauses gewesen, ein Herr aber, dem es an Voraussicht fehlte, dessen Mangel an Fürsorge für die Familie beinahe verbrecherisch war, dem es genügte, ein Leben lang in den Slums, nicht weit von seiner Arbeitsstelle in den Docks, zu wohnen. Ah, wie viele Tränen hatte sie seinetwegen vergossen! Das Geld für Lebensmittel hatte er ihr zwar immer gegeben, den Rest seines Lohnes jedoch, den sie hätten sparen können, gab er für Wein und Kartenspiel mit seinen Freunden aus. Nie hatte sie einen Penny für sich persönlich gehabt. Lucia Santa, die Bettlerin ohne Brautleinen, in dieses neue Land und in sein Bett zu holen war eine so großzügige Tat gewesen, daß er es nicht nötig hatte, je wieder großzügig zu sein. Die eine Tat genügte für ein ganzes Leben.
Lucia Santa erinnerte sich all dieser Dinge mit einem sehr unsicheren Gefühl des Mißmuts. Sie wußte, es war nicht die ganze Wahrheit. Denn eine Tochter hatte ihn geliebt. Er war ein stattlicher Mann gewesen. Mit seinen schönen weißen Zähnen kaute er Sonnenblumenkerne, und die kleine Octavia nahm ihm die Kerne aus dem Mund, was sie bei der Mutter niemals getan hätte. Seine Tochter hatte er geliebt.
Die Wahrheit war einfach. Er war ein umgänglicher, hart arbeitender, ungebildeter, friedliebender Mann gewesen. Ihre Gefühle für ihn waren die gleichen gewesen, wie sie Millionen von Frauen für ihre gewissenlosen Ehemänner hegten. Daß diese Männer über das Geld im Haus bestimmen, daß sie die Macht haben sollten, Entscheidungen zu treffen, die über das ganze Leben der Kinder entschieden – ein Wahnsinn! Männer taugten nicht dafür. Mehr noch, sie waren nicht ernst zu nehmen. Und so hatte sie, wie alle Frauen, bereits den Kampf um die Macht aufgenommen, als er eines schrecklichen Tages ums Leben kam.
Aber sie hatte um ihn geweint. Oh, wie sie geweint hatte! Es war eine mit dem Schrecken gepaarte Trauer gewesen. Nicht Trauer um dahingegangene Lippen, Augen, Hände, sondern eine verzweifelte Klage um die verlorene Schutzwehr gegen diese fremde Welt, Gram um den Ernährer ihrer Kinder, den Beschützer des Ungeborenen in ihrem Leib. Diese Witwen raufen sich die Haare, kratzen sich die Wangen blutig, erheben wildes Klagegeschrei, werden gewalttätig und tragen Trauer, damit die Welt es sieht. Sie sind die wahrhaft Trauernden, denn wahre Trauer ist angefüllt mit Entsetzen. Sie sind die wahrlich im Stich Gelassenen. Liebende werden von neuem lieben.
Sein Tod war beinahe grotesk zu nennen. Beim Löschen einer Schiffsladung war die Laufplanke hoch über dem Wasser gebrochen und hatte fünf Männer sowie ungezählte Tonnen Bananen mit sich in den Flußschlamm geschleudert, der menschliche Glieder und Bananen gemeinsam begrub. Nichts war auch nur ein einziges Mal wieder nach oben gekommen.
Trotzig wagte sie es jetzt zu denken: Im Tod hatte er ihr mehr gegeben als jemals im Leben. Jetzt, Jahre später, im Dunkeln, lächelte sie grimmig und voll Spott über ihr eigenes jüngeres Ich. Als sie daran dachte, was sie wohl damals von diesem Gedanken gehalten hätte. Doch das Gericht hatte jedem Kind tausend Dollar zuerkannt, sogar Vincent, dem Ungeborenen, der für die Welt allerdings damals schon deutlich zu sehen war. Das Geld wurde treuhänderisch verwaltet, denn in Amerika war man klug: nicht einmal den Eltern vertraute man das Geld der Kinder an. Sie selber hatte dreitausend Dollar erhalten, von denen außer Zia Louche und Octavia kein Mensch etwas ahnte. So war doch nicht alles umsonst gewesen.
Selbst jetzt aber durfte sie nicht von jenen Monaten mit dem Kind in ihrem Leib sprechen, ja nicht einmal daran denken! Ein Kind, dessen Vater starb, bevor es zur Welt kam, war wie das Kind eines Dämons. Selbst jetzt noch war sie wie gelähmt von einer schrecklichen, abergläubischen Angst, selbst jetzt noch, nach dreizehn Jahren, stiegen ihr hinter den geschlossenen Lidern Tränen in die Augen. Sie weinte um sich, wie sie damals gewesen war, und um das ungeborene Kind. Nicht aber um ihren toten Ehemann. Das konnte Octavia weder wissen noch jemals verstehen.
Und dann das Beschämendste: Nur ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes, nur sechs Monate nach der Geburt von Vincent, dem Sohn des Toten, hatte sie, eine erwachsene Frau, zum erstenmal Leidenschaft für einen Mann empfunden – für den Mann, der ihr zweiter Ehemann werden sollte. Es war Liebe. Nicht die unschuldige Liebe von Priestern und jungen Mädchen; nicht das Gefühl, das den Helden in Liebesgeschichten entgegengebracht wird, die man auch jungen Mädchen erzählen kann. Nein, diese Liebe war das Wort für das brennende Fleisch, die heißen Lenden, die fiebernden Augen und Wangen. Diese Liebe war das Gefühl geschwollenen, feucht-gedunsenen Fleisches. Ah, welch ein Wahnsinn, welch eine Torheit für eine Mutter von drei Kindern! Dem Herrgott im Himmel sei Dank, daß sie jetzt darüber hinaus war!