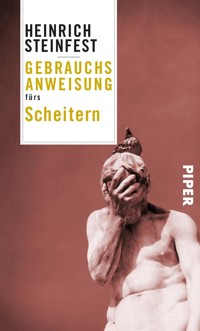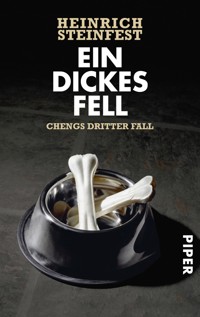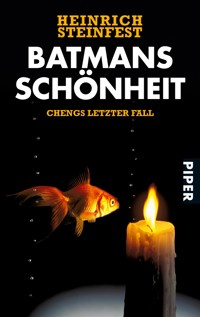9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Auffälligste an der ausgesprochen schlanken und eleganten Lilli Steinbeck ist ihre Nase. Eine Klingonennase, die ihr eine Schar stark verunsicherter Bewunderer beschert. Als international anerkannte Spezialistin für Entführungsfragen wird sie von der Polizei in einen brisanten Fall eingeschaltet – in ein Spiel mit zehn lebenden Figuren, um die ein weltweit operierendes Verbrecherteam kämpft. Auf allerhöchstem Niveau und zum Zeitvertreib. Es gewinnt, wer alle zehn Spieler getötet hat … Der Kriminalroman des preisgekrönten Erfolgsautors Heinrich Steinfest ist ein Feuerwerk der Sprache voller Humor und philosophischem Hintersinn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
3. Auflage Dezember 2011
ISBN 978-3-492-95804-2
© 2007 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: Jack Miskell / Corbis Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Letztendlich bin ich müde, denn ich meine, warum weiß ich nicht, daß aller Sinn im Schlafen liegt.
(Fernando Pessoa,Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares)
– Was tun Sie, wenn Sie nicht schlafen können? – Ich bleibe wach.
(Nicole Kidman und Sean Penn in
1
Klirrr!
Was für ein wunderbarer Abend!
Und zwar nicht der erste. Daran mußte der Mann, der Georg war, nun denken. Wie viele solcher wunderbaren Abende er bereits hatte verbringen dürfen. Zusammen mit seiner schönen Frau und seiner nicht minder hübschen Tochter. Im gemütlichen und geschmackvollen Eßzimmer seines Hauses, das hoch oben über der Stadt gebaut war, in bester Lage, ohne aber protzig zu wirken.
Die kleine Villa stammte aus einer Zeit, als an dieser Stelle kaum noch etwas gewesen war, um überhaupt von einer Lage zu sprechen. Das hatte sich geändert. So mancher hätte einen kleinen, versteckten Mord riskiert, um in dieser Gegend an eine Immobilie zu gelangen. Georg aber war ganz ohne Verbrechen ausgekommen, hatte das Haus von seinen Eltern geerbt. Manchmal kam es ihm vor, daß eigentlich alles, was ihn umgab, auch seine Frau, auch seine fünfzehnjährige Tochter, ein Erbe darstellten. Etwas, das er ohne eigenes Zutun, nur dem Zufall einer bestimmten Abstammung verdankend, entgegengenommen hatte. Da es ihm nun mal von Rechts wegen zustand. Aber nur von Rechts wegen. Nichts, was er sich ernsthaft erarbeitet hatte. Nichts, was er wirklich verdiente.
Und das war nun genau die Frage, die ihm riesengroß, eine dröhnende Blase, durch den Kopf ging: »Habe ich das eigentlich verdient?«
Georg dachte an all die Männer, die jetzt ebenfalls bei Tisch saßen und denen irgendeine frustrierte, häßliche, breitarschige Nörglerin das Essen vors Gesicht knallte, wenn man diese nie ganz aufgetauten Tiefkühldinger überhaupt als Essen bezeichnen durfte. Dazu kamen dann Kinder, die ständig vom Taschengeld sprachen und gleichzeitig ihre vermasselten Schularbeiten ohne jede Scham zur Unterschrift vorlegten. Als würden nicht sie, sondern der Unterzeichnende Schuld tragen. Und als sei also die Taschengelderhöhung das Bußgeld, das der Erwachsene zu begleichen habe. Dafür, Kinder in die Welt gesetzt zu haben.
Mia aber, Georgs Tochter, legte niemals vermasselte Schularbeiten vor, immer nur ein »sehr gut«. Und tat dies, ohne jegliches Taschengeldtheater zu vollziehen. Offenkundig war ihr die Banalität solcher Notengebung völlig bewußt. Während es natürlich gar nicht banal war, wenn ein Vater sich so gut wie nie um schulische Angelegenheiten kümmern mußte, immer nur ausgezeichnete Ergebnisse zu quittieren brauchte. Auch in dieser Hinsicht ein unverdientes Erbe antretend.
Georgs Frau, Viola, kam ebenfalls ohne Theater aus. Ihre Schönheit und Intelligenz, ihr Erfolg im Beruf führten zu einer Zufriedenheit, zu einer Art von Erholtsein, das es ihr ermöglichte, Abend für Abend ein vorzügliches Mahl auf den Tisch zu zaubern, welches nicht im entferntesten daran erinnerte, gerade noch im Schockzustand einer Vertiefkühlung gewesen zu sein. Als taue man ein Mammut auf und damit auch uralte Mikroben und Bazillen. Nein, Viola nahm sich immer noch die Zeit, frische Kräuter zu besorgen, frisches Fleisch und frischen Fisch einzukaufen, zwischen zwei Terminen einen Gemüsemarkt aufzusuchen und den Verkäufern freundlich auf die Finger zu klopfen, wenn sie versuchten, ihr verknautschte Erdbeeren unterzujubeln.
Ihre Geschäftspartner verstanden Viola nicht. Nun, ihre Geschäftspartner, vor allem die weiblichen unter ihnen, übersahen Violas Glück. Diese anderen Frauen meinten nämlich, daß Erfolg dazu verpflichte, verbissen, gehässig, freudlos und pervers zu sein. Und auf eine nicht näher definierte Weise emanzipiert. Emanzipiert wie versteinerte Eier, die man dann also nicht mehr auszubrüten brauchte.
Bei aller karrieristischer Bezogenheit – darunter fraglos auch den Freuden, ein paar blöde Männer in die Ecke zu stellen und sie zehnmal den Satz »Ich darf meine Chefin nicht dumm anmachen« aufsagen zu lassen – genoß Viola das Ausleben einer Macht, über die allein kochende Frauen verfügen, gleich ob sie schwerbusige Matronen oder schlanke, feinnervige, funktionslastige Trägerinnen von Sportunterwäsche sind. Wenn sie kochen, richtig kochen, und ihre Männer, alle Männer, wohlweislich aus der Küche verbannen und es nicht zuletzt unterlassen, selbige Männer zum Zwiebelschneiden und Kartoffelputzen abzukommandieren, erhalten sie sich die Kontrolle derer, die füttern, über die, die gefüttert werden. Wenn sie denn wissen, was sie mit diesem Füttern bezwecken wollen.
Man sollte diesbezüglich die Magie nicht vergessen. Frauen sind geborene Hexen, gleich, was die Aufklärung uns weiszumachen versucht. Und die Zubereitung von Mahlzeiten ist sicherlich die einfachste und wirksamste Art, echte Magie zu betreiben. Echt schwarz oder echt weiß. Und nicht das bunte Zeug, das tiefgefroren hinter Fotografien seiner selbst schlummert.
Jedenfalls war es so, daß Georg mit der Küche und der Kocherei absolut nichts zu tun hatte. Somit auch das Geschirr nicht etwa zu spülen brauchte, als würde er die Pinsel seiner malenden Frau abwaschen. Seine Position war allein die des Essers. Auch begriff er wohl, daß die Magie, die seine Frau dabei trieb, eindeutig Züge des Hellen und Freundlichen besaß. Wie ja auch hinter dem unkomplizierten Wesen seiner Tochter keine Dämonie verborgen schien. Dieses Kind war ganz einfach mit sich und der Welt zufrieden, ohne gleich naiv zu sein. Sie kannte den Dreck der Straße, wußte um ein paar ekelhafte Ausformungen des Sexuellen sowie um die Anziehungskraft tröstender Stimulanzien. Aber sie hatte nun mal Trost nicht nötig. Auch keinen Kerl, der es ihr beinhart besorgte. Sie fand, daß fünfzehn Jahre und ein von jeder Grobheit verschonter Körper ungeeignet waren, sich irgendeine Beinhärte anzutun, bloß weil selbige mit schicker Frisur und tätowiertem Oberarm daherkam. Oder irgendeinen Dreck der Straße zu idealisieren. Sie sagte gerne, derartiges könne sie sich in fünf bis zehn Jahren leisten. Aber das war eine Koketterie. Eine der wenigen, zu der sie sich – jung, aber nicht unschuldig, brillant, aber kein Luder – hingab. Nein, sie hatte nicht vor, in fünf bis zehn Jahren Abgründe zu schauen, nur weil die schon mal existierten.
So war das.
In diesem idyllischen Nest lebte Georg Stransky und konnte sich ein perfektes Abendessen kredenzen lassen, ohne ein schlechtes Gewissen zu entwickeln, ohne einen Vorwurf oder eine Hinterlist befürchten zu müssen. Auch war er selbst ja keineswegs ein Lebemann oder Gauner oder Sesselhocker. Er tat seinen Teil, unterrichtete an der Universität, verfaßte Artikel, ja, publizierte ganze Bücher, wie man sagt, jemand schlachte ein ganzes Schwein, als könnte man ein halbes oder viertel Schwein schlachten.
Anstatt nun aber das Faktum ungerechter Verteilung, ungleichen Glücks und Unglücks als gegeben hinzunehmen und eine gewisse philosophische Schwammigkeit des Lebens zu akzeptieren, stellte sich Georg Stransky also die Frage: »Habe ich das eigentlich verdient?«
Hätte er auf diese Frage verzichtet – sie zumindest nicht in diesem Moment mit dieser Eindringlichkeit gestellt –, wäre alles so weitergegangen wie bisher. Er hätte geerbt und geerbt und geerbt.
Aber manche Frage darf nun mal nicht gestellt werden. Auch nicht in Gedanken. Beziehungsweise vor allem in Gedanken nicht. Der Gedanke reizt mehr als das gesprochene Wort. Die Reizung funktioniert wie eine Krankheit. Plötzlich ist man nicht mehr gesund.
Klirrr!
Es gibt Sekunden, die sind gleichzeitig schneller und rasanter als übliche Sekunden, aber auch gedehnter, ja, geradezu spielfilmartig ausgezogen. Sie sind voll von Eindrücken und Bildern und Umständen, aber des ungeheuren Tempos wegen kaum nachvollziehbar. Nachdem sie geschehen sind, meint man, ein halbes Leben wäre abgelaufen, ohne auch nur eine Winzigkeit wirklich realisiert zu haben. Gleich den Leuten, die über Nacht weiße Haare bekommen. Oder über Nacht in ein Meer von Runzeln fallen.
Weiße Haare und Runzeln blieben Georg erspart. Aber sonst…
Eine Scheibe war zersprungen. Eine von denen, die hinunter auf die Straße wiesen. Ein Gegenstand hatte das geschlossene Fenster durchbrochen und war über den semmelgelben Parkettboden gekullert. Ja, gekullert. Soviel hatte Georg registrieren können, um zu wissen, daß das glänzend rote Objekt eine runde oder wenigstens halbwegs runde Form besaß. Jedenfalls geeignet war zu kullern, anstatt etwa wie ein Sack aufzuschlagen oder im Stil einer Kröte oder eines Puddings aufs Parkett zu klatschen. In der polierten Art einer Bowlingkugel hatte das fremde Ding eine leicht gebogene Spur gezogen, um unter den Eßtisch zu geraten und dort gegen das mittige Tischbein zu stoßen und seine Bewegung zu beenden.
»Jesus!« rief Georg aus und sprang in die Höhe. Er rannte zum Fenster und spähte nach draußen. Hinaus auf den Gehweg, der im Licht einer untergegangenen Spätsommersonne dalag, von niedrigen Büschen flankiert, frei von Autos, die in einer solchen Gegend friedlich in ihren Garagen hockten. Auch frei von Passanten. Zumindest war da niemand zu sehen, der in Frage kam, der Werfer zu sein.
Der Werfer wovon?
Georg kam zurück an den Tisch und betrachtete kurz seine Frau und seine Tochter, die sich erhoben hatten und auf die andere Seite des Raums gewechselt waren. In keiner Weise hysterisch oder ängstlich, bloß vernünftig. Der Eßtisch gemahnte jetzt an eine dieser Wasseroberflächen, unter denen ein paar bissige Fische zu vermuten waren. Wie bissig? Das war die Frage.
Keine Frage hingegen war, daß, wenn Violas Aufgabe darin bestand, trotz ihres Berufs famose Abendmahlzeiten zuzubereiten, und Mia unaufgeregt die Pflicht erfüllte, stets die beste Schülerin zu sein, es eindeutig Georg zukam, unter den Tisch zu kriechen und nachzusehen, wie bissig dieser Fisch war.
Oder diese Bombe.
Nicht, daß dies dem männlichen Wesen grundsätzlich entsprach. Doch es war verflixt. Aus eigener Schuld und Ohnmacht hatte der Mann – meistens schlecht im Kochen und schlecht in der Schule – genau in dieser Funktion seinen traurigen Kulminationspunkt gefunden: im Nachsehen, ob ein Gegenstand eine Bombe war oder nicht. Das ganze Leben der Männer spielte sich in dieser Kategorie ab. Ständig krochen sie unter Tische, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nicht wenige flogen dabei in die Luft. Und wenn nicht heute, dann morgen. Und wenn nicht auf die eine Art, dann auf die andere. Anstatt endlich damit aufzuhören, sich diese Unter-den-Tisch-Kriecherei als etwas Edles zu denken, als Ausdruck von Macht und Politik und Intelligenz. Was ja ein Witz ist. Selbst Weltkriege finden noch unter dem Tisch statt, wo jedermann auf allen vieren und mit geducktem Kopf durch die Gegend kriecht. Wen, um Himmels willen, meinen die Männer damit zu beeindrucken? Gott? Ihre Frauen? Ihre Mütter? Irgend jemand, der ebenfalls unter dem Tisch hockt?
Aber auch Georg hielt sich an das Muster, biß die Zähne zusammen, unterdrückte das Brennen in seinen Fingern und ging in die Knie. Er schob die Tischdecke wie einen Vorhang zur Seite und kroch in das Dunkel hinein.
Er erkannte ihn gleich, den geworfenen Gegenstand, welcher tatsächlich kreisrund schien, wobei drei Viertel des Körpers im Schatten lagen und nur ein sichelartiger Ausschnitt feurig aufleuchtete. Man hätte meinen können, ein kleiner roter Mond ziehe hier seine Bahn. Um das Tischbein herum wie um eine kosmische Säule.
Georg schluckte und griff nach dem Stück Mond. Er zog ihn aus dem Schatten, holte ihn ins Licht der Zimmerbeleuchtung und konstatierte nun, worum es sich handelte: um einen Apfel.
Beinahe war er enttäuscht. Diese ganze Aufregung für ein Stück Obst.
»Was soll das?« fragte Georg laut. »Was tun diese Kids? Äpfel klauen und damit Krieg spielen.«
Er schüttelte den Kopf, deponierte das Wurfgeschoß auf der Spüle und bemerkte nebenbei, sich mit Äpfeln nicht auszukennen. Etwa mit den einzelnen Sorten.
Anders seine Tochter. Sie erwähnte einen englischen Namen, den Georg aber nicht richtig verstand. Egal. Es war ihm gleichgültig, wie dieses blutrote Ding hieß.
Blutrot?
Nicht wirklich blutrot, wie man das von eigenen Schnittwunden kannte, sondern eher dieses Rot, das einem der Anblick erschlagener Stechmücken bot. Was ja immer ein wenig grausig war, eigenes Blut zu betrachten, das durch einen fremden Körper gegangen war. In gewisser Hinsicht erschlägt man sich selbst.
Ein solches Rot, ein Rot von quasi selbst erschlagenem eigenem Blut, besaß diese Frucht, die im übrigen wie ein ganz normaler Apfel aussah. Wie auch sonst?
Und genau darum hielt sich die Aufregung in Grenzen. Georg kehrte die Scherben auf und ließ an der betroffenen Stelle den Rolladen herunter. Viola richtete die Nachspeise, glücklicherweise nichts mit Obst. Mia räumte die Teller ab und füllte Wein in die Gläser ihrer Eltern. Der Apfel aber blieb, wo er war. Erst später, als Mia und ihr Vater bereits vor dem Fernseher saßen, fiel Violas Blick wieder auf das Corpus delicti. Auch Viola Stransky hatte so ihre Assoziationen. Nichts mit Blut. Viola war keine von denen, die ständig an Blut dachten. Eher dachte sie an Kuchen und daß man den Apfel, wenn schon nicht roh essen, so zumindest in irgendeine Süßspeise hätte einarbeiten können. Andererseits war nicht auszuschließen, daß in der Frucht ein Glassplitter steckte, obgleich die Oberfläche völlig unbeschadet schien. Wie auch immer, es gehörte sich nicht, ein durch eine Scheibe geflogenes Obststück einem Nachtisch beizufügen. Das hätte schon sehr auf eine verrückte Art von Sparsamkeit verwiesen. Und so sehr eine solche Verrücktheit in Viola Stransky auch nistete, war dies etwas, was sie hinter sich zu haben glaubte. Und darum nahm sie den Apfel und warf ihn in den Eimer.
»Gar kein Problem«, sagte sie in einem bemüht vergnüglichen Ton, obwohl das der erste Apfel ihres Lebens war, den sie so vollständig in den Müll befördert hatte. Als werfe man ein Rotkehlchen einfach ins Klo. Eigentlich schrecklich.
Viola Stransky verbat sich, weiter darüber nachzudenken, legte die beiden Geschirrtücher sehr ordentlich zum Trocknen auf und wechselte hinüber ins Wohnzimmer, wo sie sich zwischen ihren Mann und ihrem Kind niederließ. In den Fernsehnachrichten war gerade von einer wirtschaftspolitischen Entscheidung die Rede, die aber Viola vollkommen gleichgültig ließ, obgleich sie als Geschäftsfrau in der idealsten Weise davon betroffen war. Sie konnte nicht anders. Sie mußte an den Apfel denken und wie deprimierend es war, daß er nutzlos – allein auf den Schaden reduziert, den er verursacht hatte – in einer Biotonne zu vergammeln begann.
Georg Stransky hingegen fragte sich, ob man nicht die Polizei hätte rufen sollen. Andererseits wäre er sich lächerlich vorgekommen. Ein Apfel! Auch fürchtete er, daß beim Anblick der hübschen Mia die Polizisten sich dazu verstiegen hätten, die hilflose Brautwerbung eines Verehrers anzunehmen. Obstwurf statt Minnegesang. Oder was Polizeimenschen so einfiel, wenn sie kompliziert dachten. Und daß sie das taten, nämlich kompliziert denken, war ja allgemein bekannt.
Als Georg drei Stunden später zu seiner Frau ins Bett kam, hatte er die Apfelgeschichte bereits ad acta gelegt. Er drückte einen Kuß auf die Stirn der Schlafenden und betrachtete kurz die schmalen Streifen hereinfallenden Mondlichts, die auf dem Busen Violas eine kleine Graphik abzubilden schienen. Eine rasch ausgeführte Zeichnung, locker und leicht, ein Brustbild, sehr hübsch.
Georg lächelte in das Dunkel hinein wie ein Kind, das in eine leere Tonne ruft. Dann legte er sich gerade hin, das Laken jedoch bloß über seinen Unterleib ziehend. Er deckte sich selten richtig zu. Das war nie anders gewesen. Rasch schlief er ein.
Um wenig später wieder geweckt zu werden. Das Telefon läutete. Er griff automatisch nach dem Hörer, halb noch im Schlaf. Weshalb er sich erst zurechtfinden mußte, um die Frage zu bejahen. Die Frage nach seinem Namen. Ob er Georg Stransky sei.
»Ja, das bin ich. Meine Güte, was wollen Sie denn um diese Zeit?«
»Haben Sie den Apfel bekommen?« fragte die Frauenstimme.
Sogleich saß Georg aufrecht im Bett, überzeugte sich, daß seine Frau noch immer schlief, überlegte kurz und fragte dann in leichtem Stotterton: »Was für ein Apfel?«
»Oh, sehr schön. Hat es also funktioniert. Man weiß ja nie. Manchmal verfehlen die Äpfel ihr Ziel. Obwohl das eigentlich nicht geschehen dürfte. Aber was dürfte nicht alles nicht geschehen.«
»Wovon in Herrgottsnamen reden Sie eigentlich?« beschwerte sich Georg und kündigte an: »Ich lege jetzt auf.«
»Komisch, das sagen alle: Ich lege jetzt auf. Nur, daß es dann keiner tut. Die Welt wäre besser, würden alle Leute, die mit dem Auflegen drohen, auch auflegen. Aber so ist die Welt nun mal nicht. Also, Herr Stransky, lassen Sie das bleiben. Ich glaube nicht, daß Bluffen Ihre Stärke ist.«
»Und was wäre meine Stärke?«
»Keine Ahnung. Ich bin hier bloß die Telefonistin. Ich weiß nichts über Sie. Das ist nicht mein Job.«
»Und was ist Ihr Job?«
»Sie darum bitten, in den Apfel zu beißen. – Ich meine das nicht bildlich. Nein, ich fordere Sie auf, den Apfel, der heute abend durch Ihr Fenster kam, zu verspeisen. Jetzt gleich.«
»Ach was! Bitten Sie oder fordern Sie?«
»Genau in dieser Reihenfolge«, sagte die Stimme, die recht genau an jene süßlich-ironischen Stimmen in Science-fiction-Filmen erinnerte, dann, wenn wieder einmal irgendein Depp einen falschen Knopf gedrückt hatte und also aus Lautsprechern der mildtätig vorgetragene Hinweis erklang, daß in soundso viel Minuten das Raumschiff sich selbständig zur Explosion brächte und im übrigen noch ein schöner Tag gewünscht werde. Ja, eine solche Stimme war das. Selbige erklärte nun: »Zuerst bitte ich, dann fordere ich. Ganz nach Plan.«
»Und was kommt, wenn das Bitten und Fordern nichts nutzt?«
»Das können Sie sich doch denken.«
»Dann wird gedroht.«
»Wir sagen hier ›insistieren‹ dazu. Aber ›drohen‹ stimmt auch.«
»Und nur, damit ich in einen dummen Apfel beiße?«
»Der Apfel ist nicht dumm, das dürfen Sie mir glauben.«
»Gut, ein gescheiter Apfel also. Aber wieso hineinbeißen?« fragte Georg ein wenig belustigt. Er war aus dem Bett gestiegen und mit dem mobilen Telefon in den Flur getreten. Er hielt das Ganze für einen Scherz, dessen Sinn und Hintergrund er versuchen wollte herauszubekommen. Vielleicht ein Journalistenstreich. Wenn Polizisten gerne kompliziert dachten, dachten Journalisten gerne in Farcen.
Die Frauenstimme erklärte: »Ich sagte schon, ich bin bloß die Telefonistin. Und dafür verantwortlich, daß Sie, lieber Herr Stransky, irgendwann in der nächsten Stunde Ihren Apfel essen.«
»Meinen Apfel?«
»Er kam durch Ihr Fenster geflogen. Was wollen Sie mehr?«
»Was ist das eigentlich für eine Sorte?« erkundigte sich Stransky. »Ich meine die Apfelsorte.«
»Tut mir leid, keine Ahnung.«
»Sie wissen wenig.«
»Das ist richtig«, sagte die Frauenstimme. »Wahrscheinlich hat das seinen Grund. Denken Sie nicht auch?«
»Was ich denke, ist folgendes: Wir sollten das Bitten und Fordern überspringen und gleich mit dem Drohen … mit dem Insistieren anfangen. Damit Sie das mit der einen Stunde auch hinkriegen, Fräulein.«
»Ich mag es, wenn man mich Fräulein nennt. Altmodisch, aber nett. Sehr viel netter als diese ganzen Begriffe, in denen ›Fotze‹ und dergleichen vorkommt. Sie sollten nicht glauben, was ich mir manchmal anhören muß, bevor die Leute klein beigeben. Bleiben Sie also ruhig beim Fräulein.«
»Gerne«, sagte Georg und stieg hinunter in die Küche. Er wollte sich ein Glas Wein einschenken. Ihm begann die Sache Spaß zu machen. Nicht, daß er auf ein Abenteuer aus war. Nicht mit einer Stimme. Aber Flirten ging in Ordnung. Das sagte auch Viola immer: Flirten geht in Ordnung.
»Hören Sie«, bat Georg, »ich weiß nicht mal, wo der Apfel eigentlich geblieben ist.«
»Sie werden ihn finden. Der verschwindet nicht einfach.«
»Vielleicht hat ihn meine Frau gegessen.«
»Wie? Einen Apfel, der durch die Scheibe kam? Ich bitte Sie!«
»Ich dachte«, erinnerte Georg, »Sie hätten vor, mir irgendwie zu drohen. Was ist jetzt damit?«
»Wollen Sie das wirklich?«
»Nur zu, Fräulein.«
»Sie nehmen mich nicht ernst, Herr Stransky. Sie denken, es ist ein Spiel. Nun, ein Spiel ist es ja auch. Aber ein anderes. Na, dann fangen wir an: Sie haben eine Tochter.«
»Jetzt werde ich aber ärgerlich«, wechselte Georg den Tonfall.
»Fein«, sagte die Stimme und wiederholte: »Sie haben eine Tochter. Sie heißt Mia, sie ist fünfzehn Jahre, sie hat ein Reitpferd namens China Moon, eine beste Freundin namens Julia, sie verträgt keine Kuhmilch und bringt immer nur Einsen nach Hause.«
»Hören Sie sofort auf. Kommen Sie gar nicht erst auf die Idee, mir damit angst machen zu wollen, mein Kind zu belästigen.«
»Belästigen wäre auch ein allzu harmloses Wort. Zumindest wenn man an die Leute denkt, Herr Stransky, mit denen Sie es unglücklicherweise zu tun haben. Allerdings geht es dabei gar nicht um Ihre Tochter. Ihre Tochter liegt friedlich im Bett, und es wäre kaum von Wirkung, wollte ich ankündigen, Mia in der nächsten Stunde aus diesem Bett zu entführen. Sie würden auflegen, also doch noch auflegen, und augenblicklich die Polizei benachrichtigen.«
»Das werde ich auch, ich …«
»Es geht nicht um Mia, es geht um China Moon. Ein schönes Pferd. Beinahe möchte man sagen, zu schade für eine Fünfzehnjährige, so brav das Mädchen in der Schule auch sein mag. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, daß jemand mit einem Handy und einer kleinen, feinen Giftspritze ausgestattet, neben China Moon steht – jetzt eben! – und auf Ihre Entscheidung wartet. Darauf wartet, ob Sie in den Apfel beißen oder nicht.«
»Ich glaube Ihnen kein Wort.«
»Müssen Sie auch nicht. Es geht ja bloß um ein Pferd. Ein englisches Vollblut, das die besten Jahre bereits hinter sich hat und damit zufrieden sein darf, daß ein paar Gören ihm Zucker ins Maul schieben. Wenn China Moon stirbt, ist das ein Fall für die Versicherung und den Tierarzt. Es werden ein paar Tränen geweint. Das ist es schon. Hauptsache, Sie haben sich geweigert zu tun, wonach ich Sie ursprünglich einfach nur bitten wollte.«
»Mia liebt dieses Pferd. Es ist ihr …«
»Bitte nicht. Erzählen Sie mir nichts davon, wie sehr Ihr kleiner Schatz diesen Gaul vergöttert. Ich hatte als Kind selbst ein Pferd. Ich weiß, wie das ist. Mädchen sind so. Wahrscheinlich ist es eine genetische Disposition, eine freundliche Krankheit, ein netter Defekt. Was weiß ich? Jedenfalls ist es verrückt, wie sehr Mädchen an diesen Viechern hängen.«
»Was bringt es Ihnen«, jammerte Georg, »wenn ich diesen Apfel esse? Bin ich Eva?«
»Ich weiß es nicht.«
»Was? Ob ich Eva bin?«
»Was der Apfel bewirkt.«
»Vielleicht ist er vergiftet, und ich sterbe, wenn ich hineinbeiße.«
»Dann würde immerhin China Moon überlebt haben. Und auch wenn das bitter für Sie klingen mag, ich denke, Ihre Tochter würde bei aller Vaterliebe sich eher für das Pferd entscheiden. Jedes Mädchen zwischen zehn und siebzehn würde das. Wie gesagt, pure Genetik. Nichts, was einen zu kränken braucht. – Und noch etwas: Ich glaube nicht, daß Sie tot umfallen, wenn Sie in diesen Apfel beißen. Vielleicht fallen Sie um, aber nicht tot.«
»Reden wir wirklich miteinander?«
»Ja, das tun wir, Herr Stransky. Es ist kein Traum, wenn Sie das meinen.«
»Wenn ich nein sage …«
»Wird China Moon sterben.«
»Und weiter.«
»Nichts weiter. Man wird Sie in Frieden lassen. Und Sie werden nie erfahren, worum es eigentlich ging.«
»Und was geschieht dann mit Ihnen?«
»Machen Sie sich denn Sorgen um mich?« erkundigte sich die Frau mit der Computerstimme untergehender Raumschiffe.
»Ich frage ja nur«, meinte Georg abwehrend.
»Ich kriege einen kleinen Anschiß, weil ich Sie nicht überreden konnte. Das ist es auch schon. Anschisse gehören dazu. Theoretisch.«
»Und praktisch?«
»Ich habe noch jeden Kunden überzeugen können. Es ist vielleicht meine Stimme. Männer mögen das.«
»Was mögen Männer?«
»Wenn Frauen freundlich mit ihnen sprechen. Die wenigsten kennen das. Und sind dann ganz verblüfft, einmal nicht angeknurrt zu werden. Es überrascht und verwirrt sie.«
»Bei mir ist das anders. Meine Frau ist ein Schatz.«
»Stimmt. Wir hatten uns auch kurzzeitig überlegt, Ihnen mit der Ermordung Ihrer Frau zu drohen. Aber ich dachte mir, das Pferd sei das stärkere Argument. Sie lieben Ihre Tochter, nicht Ihre Frau. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich meine in einer natürlichen Art. Das ist etwa so genetisch wie die Pferdeliebe einer Minderjährigen. Dafür müssen Sie sich nicht genieren.«
»Sie tun so, als würden Sie in meinem Kopf sitzen.«
»Nichts läge mir ferner. Mir reicht mein eigener Kopf. Aber ein bißchen was weiß ich schon mit meinen siebzig Jahren.«
»Siebzig?« Georg konnte nicht glauben, daß die Frau, der diese Stimme gehörte, siebzig Jahre zählte. Er würde sie auf dreißig geschätzt haben. Maximal. Doch warum sollte sie lügen? Georg hätte den Sinn einer solchen Lüge nicht zu erkennen vermocht. Er sagte: »Ihr Alter spielt keine Rolle.«
»Ich sprach von meiner Erfahrung«, erwiderte die Stimme, eine Spur kühler als bislang. Dann aber gleich wieder im gewohnten Zuckerschleckerton fortsetzend: »Haben Sie sich entschieden? Ich würde die Sache jetzt gerne zu einem Ende bringen. Unser Gespräch beginnt abzugleiten. Leider.«
»Ich sagte schon, daß ich nicht einmal weiß, wo der Apfel ist.«
Georg stand in der beleuchteten Küche, neben sich das Glas Wein und überblickte mit einer drehenden Kopfbewegung den Raum. Im Stil einer Eule.
»Ihre Frau ist doch ein ordentlicher Typ, nicht wahr?« meinte die Stimme.
»Ziemlich«, antwortete Georg.
»Ein Apfel, der nicht gegessen wird, gehört in den Biomüll. Haben Sie Biomüll?«
»Ja.«
»Dann sehen Sie einfach nach.«
Georg brauchte nur einen Arm auszustrecken und die Türe des Unterschranks zu öffnen, in dessen Innenseite zwei himmelblaue Eimer montiert waren, deren Abdeckungen gleichzeitig und sehr manierlich in die Höhe gingen und den Blick auf ihren Inhalt preisgaben. Rechts der konventionelle Müll, links der alternative. Wie in der Politik, wenn man gerne einfach dachte.
Georg sah ihn sofort, den mückenblutroten Apfel, der vor dem dunklen Hintergrund von Salatblättern und Kaffeesud den Eindruck ausgestellten Modeschmucks machte. Ein Herz aus gefärbtem Kristall. Kitsch. Wohlgemerkt teurer Kitsch.
»Sehen Sie ihn?« fragte die Stimme.
Georg war überzeugt, daß die Frau sehr gut wußte, daß er den Apfel gefunden hatte. Er gab bloß ein Grunzen von sich.
»Ausgezeichnet«, sagte die siebzigjährige Stimme. »Beißen Sie hinein. Ich kann dann gleich unserem Mann das Okay geben, sich nicht weiter um das Pferd kümmern zu müssen.«
Sie sprach, als sei alles abgemacht. Nun, es war wohl bereits alles abgemacht. Georg begriff es. Und intuitiv begriff er auch, daß der eigentliche Fehler gewesen war, sich die Frage gestellt zu haben, ob er sein Glück, seine Familie, die Vollkommenheit seines Lebens eigentlich verdiene.
Nein! schien jemand geantwortet zu haben. Jemand oder etwas.
Georg Stransky nahm den Apfel aus dem Müll und wog ihn in der Hand. Das Ding war weder leichter noch schwerer, als man es von einem normalen Apfel erwarten durfte. Ein letztes Mal versuchte Georg sich zu drücken: »Und wenn ich jetzt sage, ich esse ihn, und esse ihn aber gar nicht?«
»Das würden wir rasch merken. Und ich darf Ihnen versichern, daß dann mehr geschieht, als daß bloß ein alter Gaul stirbt.«
»Oh! Das ist jetzt aber die Art Drohung, die nicht zu Ihnen paßt.«
»Stimmt. Aber wenn Sie meinen, Sie könnten uns betrügen, verschieben sich die Regeln hin zum Abartigen. So ist das immer. Der Betrug verzerrt alles. Wer lügt, schafft Unordnung. Das muß Ihnen klar sein. Aber ich bin sicher, Sie sind kein Dummkopf und lieben Ihre Tochter.«
»Ja, das tue ich«, sagte Georg und dachte sich: »Vielleicht doch ein Traum. Oder ich bin verrückt geworden. Der Apfel existiert gar nicht.«
Georg öffnete seinen Mund und biß in ein Stück Obst, das möglicherweise nur in seiner Einbildung bestand, aber dennoch einen moderat süßlichen Geschmack besaß. Es schmeckte weder nach Himmel noch nach Hölle, weder nach kleingehackten Seelen noch nach einer Überdosis von irgendwas. Es schmeckte nach Apfel.
Georg kaute ausgiebig. Der Saft machte sich auf den Weg in den Magen. Dann auch das zerfranste Fleisch.
»Den ganzen Apfel?« fragte Georg.
»Das wird nicht nötig sein«, meinte die Frauenstimme. »Ein Bissen noch, das sollte reichen, denke ich.«
Es reichte. Nachdem Georg das zweite Stück hinuntergeschluckt hatte, fuhr ein leichter Schmerz durch seinen Kopf, nicht wirklich unangenehm, als kraule jemand sein Hirn, und kraule halt ein bißchen kräftig. Vor seinen Augen zersetzten sich die Formen und Farben. Der Kubismus ließ grüßen.
Georg wollte noch etwas sagen. Ihm fiel aber nichts ein. Von Ferne vernahm er die Stimme der Telefonistin, die also auch diesmal ihre blütenweiße Weste in Sachen Überredungskunst reingehalten hatte. Sie sagte etwas in dieser Situation verblüffend Konventionelles, sie sagte einfach: »Viel Glück!«
Viel Glück, das klang gar nicht gut.
Georg meinte zu lächeln, in der verzweifelten Art. Dann wurde es dunkel, noch bevor er es merkte.
2
Eine dünne Frau
Die Szene erinnerte schon sehr an einen dieser amerikanischen Kriminalfilme, wenn Männer in mehr oder weniger schlecht sitzenden Anzügen herumstehen und Witze über die Leiche machen, die da zu ihren Füßen liegt. Über Samenflecken und Ehefrauen und solches Zeug. Witze halt, wie Männer sie erzählen, wenn der Makel schlecht sitzender Anzüge ihre Seele verdorben hat.
Im vorliegenden Fall freilich fehlte die Leiche. Die ganze Person fehlte. Statt dessen hatte man nichts anderes als einen Apfel. Und auch den nicht wirklich. Denn der Apfel lagerte bestens verpackt im Tresor jenes Labors, in das Viola Stransky ihn gebracht hatte.
Nachdem ihr Mann am Morgen nach dem Vorfall mit der Fensterscheibe nicht in seinem Bett gewesen war und sie ihn auch an keinem anderen Platz hatte finden können und nachdem eine Vermißtenanzeige bei der Polizei bloß Augenverdrehungen und Achselzuckungen hervorgerufen hatte, war ihr die Idee gekommen, nach dem Apfel zu sehen. Selbiger – nun mit einer zweifachen Bißstelle versehen – befand sich allerdings nicht mehr dort, wo sie ihn hingetan hatte, beziehungsweise lag er im falschen Eimer, dem für den Restmüll. Der Umstand unkorrekter Deponie erschien ihr irritierender als jener des Angebissenseins.
Viola Stransky war sich absolut sicher, das Apfelstück in den dafür vorgesehenen Behälter getan zu haben. Was also hatte das zu bedeuten? Welcher Sinn konnte darin bestehen, einen Apfel aus dem richtigen Eimer zu ziehen, zweimal davon abzubeißen und ihn dann in den anderen, den falschen wieder zurückzuwerfen, um in der Folge spurlos zu verschwinden? Und weil das nun eine so gar nicht beantwortbare Frage war und andererseits die zuständigen Behörden nicht gewillt schienen, das Verlorengehen eines Familienvaters in einem anderen Zusammenhang als dem der Familienflucht zu sehen, nahm Viola Stransky das Obststück, brachte es zum Labor eines befreundeten Lebensmittelchemikers und ließ eine Analyse vornehmen. Ein Akt purer Hilflosigkeit. Ein Akt freilich, der die Erkenntnis nach sich zog, daß neben dem üblichen Saft im Fleisch des Apfels sich auch der Saft eines neuartigen Betäubungsmittels befand, eines Benzodiazepins, welches den populären Namen »Fräuleinwunder« trug. Ob damit die narkotisierende Wirkung neuester deutscher Literatur gemeint war oder auch etwas ganz anderes, blieb unbekannt. Bekannt war hingegen die Effektivität, aber auch gute Verträglichkeit des Präparats, das sich – einmal verabreicht – nur mehr schwer nachweisen ließ. Sehr wohl aber, wenn Anteile davon im süßlichen Fleisch eines Apfels konserviert einlagen.
Der Chemiker hatte das Ergebnis seiner Analyse direkt an die Polizei weitergeleitet, die sogleich ihre Ansicht, Georg Stransky verbringe seine Tage im Freudenhaus, verwarf. Immerhin war der Mann Universitätsprofessor und seine Frau eine angesehene Geschäftsfrau. Keine wirklich superreichen Leute, das nicht, jedoch höchst respektable Bürger. Allerdings hätte eine Entführung aus finanziellen Gründen eher die minderjährige Tochter betreffen müssen und nicht einen Mann, der möglicherweise tot mehr wert war als lebend. Selbstredend bot sich eine ganze Reihe von Gründen an, wenn jemand unfreiwillig verschwand. Oder eine solche Unfreiwilligkeit vortäuschte.
Wie auch immer, die Polizei war aufgewacht. Wie man aufwacht, wenn in der Nebenwohnung der Wecker läutet, läutet er laut genug. Und das tat er ja. Fräuleinwunder! Und darum also standen die Herren Kriminalisten in der Eßzimmerküche der Familie Stransky herum, ohne Leiche, ohne Apfel, dennoch beschäftigt. Mit Witzen beschäftigt, die gewissermaßen an der Dame des Hauses vorbeierzählt wurden. Man könnte sagen: Apfelwitze.
Womit es aber augenblicklich vorbei war, als Lilli Steinbeck den Raum betrat. Sie war berühmt dafür, Witze machende Männer auf den Mond zu schießen. Sie besaß so eine gewisse arrogante, aber auch betörende Art, jemand zu erklären, daß er sich seine Blödheiten für die Freizeit aufheben solle. Sie gab Männern das Gefühl, ihre Anzüge würden schlecht sitzen. Lilli Steinbeck war somit eine Person, die etwas Tatsächliches anprangerte und folglich eine Übereinstimmung von Faktum und Wahrnehmung herstellte. Bei ihr war ein versalzenes Essen ein versalzenes Essen und nicht etwa würzig oder pikant oder wenigstens Ausdruck von Verliebtheit.
Lilli Steinbeck hatte lange Zeit ein halboffizielles Sonderdezernat der Wiener Polizei geleitet und galt als Spezialistin für Entführungsfälle. Recht spät eigentlich, in den eigenen Vierzigern, war sie der Stadt Wien überdrüssig geworden, in einem Alter, da andere bereits wieder heimkehrten, um nach einem Leben in der großen weiten Welt die Wiener Operette um eine weltmännische Note zu bereichern. Meinten sie. Jemand wie Steinbeck hielt das natürlich für eine Illusion. Um den Vergleich des versalzenen Essens nochmals zu bemühen: Wien bleibt Wien. Operette bleibt Operette. Ein amputiertes Bein bleibt ein amputiertes Bein.
Als Expertin in Fragen des Menschenraubs arbeitete sie auch am neuen Ort. Ihr Ruf war dahingehend tadellos, daß sie Erfolg hatte und sich in jeder Hinsicht als unbestechlich erwies. Wie damals in Wien galt sie auch hier als Lesbe, wahrscheinlich darum, weil weder Kollegen noch Kolleginnen sich die Existenz eines Neutrums wirklich vorstellen konnten oder wollten. Ein Neutrum erschien als gotteslästerlich. Wie jemand, der, obgleich am Verhungern, auf ein herbeigezaubertes Essen spuckt. Passenderweise war Lilli Steinbeck ausgesprochen dünn, ja mager. Ihr langer, schmaler Hals wirkte als ihr eigentliches Körperzentrum, als sitze darin das Herz und die Seele dieser Frau. Was jedoch keineswegs nach Pinocchio aussah, sondern nach Audrey Hepburn. Und das, obwohl Lilli Steinbeck eine auffällig verunstaltete Nase besaß, eine Nase, die nicht nur mehrfach gebrochen, sondern auch stark verrutscht schien, gegen die Stirne hin. Ein wenig in der Art, wie man das von Klingonen kennt.
Daß nun dieses lädierte, aus der Mittellinie eben nur bedingt herausragende Organ in einem ausgesprochen hübschen, ebenförmigen, hellen, auf eine vornehme Art geradezu weißen und glatten Gesicht lag, erschien den meisten Betrachtern als der eigentliche »Skandal«. Gerade dadurch nämlich, daß Lilli Steinbeck es unterließ, den Zustand ihrer Nase auch nur annähernd zu ändern. Wäre das ganze Gesicht, wie man so sagt, im Eimer gewesen, hätte auch eine zerdrückte Nase nicht gestört. Manche Menschen sahen nun mal wie Monster aus – was soll’s? Daß aber jemand gegen die massive Beeinträchtigung seiner Hübschheit absolut nichts unternahm, andererseits aber bestens gekleidet und frisiert war, zu jeder Zeit ein perfektes Make-up trug und auch in heiklen Situationen nicht auf modisches Schuhwerk verzichtete, daß so jemand das Schicksal seiner Nase demütig annahm, war den meisten ein Rätsel, viel mehr noch ein Ärgernis. Nicht wenige Männer dachten sich, wenn sie Lilli Steinbeck sahen: Du raffinierte Schlampe! Sie dachten es und ärgerten sich nur noch mehr, weil an Steinbeck der Schlampenvorwurf natürlich abprallen mußte, nicht aber der Vorwurf, raffiniert zu sein.
Ihr dienstlicher Rang war in keiner Sekunde ein Thema. Sie war einfach die Steinbeck, eine Autorität, und zwar in vielerlei Hinsicht. Das war keine Frage von Sympathie oder Achtung. Eher war es wie bei Geparden. Die sind nun mal die schnellsten Landtiere, ob das den anderen Viechern, den Herren Antilopen paßt oder nicht. Wobei übrigens auch sonst Lilli Steinbeck viel von einer Gepardin hatte, nicht nur der Schlankheit wegen. Geparden fehlt die Möglichkeit, ihre Krallen einzuziehen. Die Weibchen sind Einzelgängerinnen, außer sie haben Junge. Zudem sind Geparde ausgesprochen krankheitsanfällig. Fehlende genetische Variation, heißt es. Na ja, auf Variationen konnte Steinbeck so gut verzichten wie auf herbeigezaubertes Essen. Ohne gleich zu spucken. Sie spuckte nicht, versteht sich. Und sie ging früh schlafen. Was ebenfalls insgeheimen Anstoß erregte: Steinbecks rigoroser Verzicht, sich im Namen der Polizei und des Staates die Nacht um die Ohren zu schlagen. Sie bestand darauf, spätestens um acht zu Hause und um neun im Bett zu sein, um dann mindestens zehn Stunden dem Schlaf und im günstigsten Fall der Erholung zu widmen. Besser waren zwölf Stunden. So toll war das Leben wirklich nicht, um mehr als die Hälfte des Tages bei Bewußtsein zu bleiben.
»Ich bin Lilli Steinbeck«, sagte die Steinbeck und reichte Viola Stransky die Hand. Den umstehenden Männern, darunter ein Hauptkommissar namens Hübner, warf sie einen In-einem-Aufwaschen-Blick zu. Dann sah sie wieder Frau Stransky an und erklärte ohne Umschweife: »Ich soll Ihren Mann finden.«
»Gut«, antwortete die Hausherrin und zeigte auf die beiden hellblauen Müllbehälter. Nicht zum ersten Mal erzählte sie, wie erstaunt sie gewesen sei, den Apfel auf der falschen Seite vorzufinden. Diesmal aber hatte sie den Eindruck, daß man ihr auch wirklich zuhörte. Daß man endlich unterließ, unterschwellige Witze über das Verhältnis von Hausfrauen und Obst zu machen.
»Es wird Zeit, daß wir uns den Apfel genau ansehen«, meinte Steinbeck.
»Was denken Sie, daß wir finden werden?« fragte Hübner. »Abgesehen davon, was schon gefunden wurde.«
»Lassen Sie den Apfel einfach abholen. Bitte!«
Hübner nickte einem seiner Leute zu, welcher sich augenblicklich auf den Weg machte.
Das war er also, der altgediente Friedo Hübner, den alle, war er gerade nicht in der Nähe, Baby Hübner nannten, und zwar nach dem kleinen Wildschwein aus dem Marionettenspiel der Augsburger Puppenkiste »Katze mit Hut«. Wobei Hauptkommissar Hübner mit seiner rosigen Gesichtsfarbe und den stets feuchten kleinen Augen eher an ein Hausschwein als ein Wildschwein gemahnte. Wie auch immer, Baby Hübner war ein rundlicher, mittelgroßer Mann mit geradezu winzigen Händen, der genausogut fünfundvierzig wie fünfundfünfzig sein konnte, genausogut ein netter Kerl wie ein durchtriebener Querulant. Man wußte es einfach nicht. Niemand hätte sagen können, ob man Baby Hübner trauen konnte, ob er korrupt war oder unbestechlich wie Steinbeck. Ob er zum Frühstück lebende Goldfische verspeiste oder liebevoll den Tisch für sich und seine Frau deckte.
Hübner wandte sich an Viola Stransky und fragte, ob es in letzter Zeit irgendwelche Auffälligkeiten gegeben hätte.
»Ein Apfel, der durch die Scheibe flog«, erinnerte Frau Stransky.
»Und davor?«
»Nichts.«
»Sind Sie sicher?«
»Zweifeln Sie an meinem Gedächtnis oder an meiner Wahrnehmungsgabe?«
»Auch intelligente Menschen können etwas übersehen«, erinnerte seinerseits der Kriminalist. »Ich würde jetzt gerne die Wohnung durchsuchen lassen. Behutsam und mit Ihrer Erlaubnis, versteht sich.«
»Das Haus gehört Ihnen«, erklärte Viola Stransky und vollzog eine Armbewegung, als lade sie einen Haufen rotarschiger Paviane zum Essen ein.
Baby Hübner teilte seine Leute ein und schickte sie in alle Himmelsrichtungen. Gleichzeitig erschien eine Dame von der Gerichtsmedizin. Offensichtlich hatte irgend jemand geglaubt, bei Familie Stransky wäre eine Leiche zu begutachten. Da die Frau Doktor aber schon einmal da war und kein Terminstreß sie plagte, entschied Hübner, sie solle bleiben. Für alle Fälle.
»Für welchen Fall?« fragte die Dame des Hauses. »Denken Sie, ich habe meinen Mann im Garten verscharrt?«
»Bei allem Respekt, Frau Stransky, so was kommt schon mal vor. Es ist natürlich nicht das, was ich erwarte. Ich meine nur, eine Ärztin in nächster Nähe kann nicht schaden.«
Die Ärztin schnaubte verächtlich. Viola Stransky tat es ihr gleich.
Lilli Steinbeck gab Hübner ein Zeichen. Die beiden wechselten in die Diele, wo Steinbeck fragte, ob es störe, wenn sie sich mit Frau Stransky einmal allein unterhalte.
»Das wäre sicher sinnvoll«, fand Hübner, der es zu schätzen wußte, daß Steinbeck, die ihm in dieser Sache untergeordnet war, eine Eigenmächtigkeit freundlich ankündigte.
Lilli Steinbeck ging zurück, hakte sich bei Frau Stransky im Stil einer alten Freundin unter und führte sie nach draußen. Die beiden Frauen traten in ein Licht aus tausend Röhren. Die vom Morgentau noch feuchten Pflanzen dampften wie in einem Geschirrspüler. Auch die Geräusche aus der Stadt hatten etwas Dampfendes, ferne Loks, die sich im Kreis drehten. Auf halber Höhe stand eine Dunstglocke aus toten Luftgeistern. Vögel zwitscherten. Die Zäune knarrten, obwohl sich kein Lüftlein regte.
Steinbeck zog ihr Gegenüber in einen schattigen, beinahe schwarzen Flecken, den eine dicht stehende Reihe hoher Holunderbüsche warf.
»Ich will Sie nicht nerven, Frau Stransky«, begann Steinbeck, »aber die Fragerei gehört nun mal dazu. Zumindest anfangs.«
»Fragen Sie.«
»Können Sie sich einen vernünftigen Grund denken, warum jemand Ihren Mann betäubt und dann entführt? Und sich auch noch Zeit läßt, eine Forderung zu stellen.«
»Nein. Keinen vernünftigen Grund.«
»Und einen unvernünftigen?«
»Mein Gott«, seufzte Frau Stransky, »da käme alles mögliche in Frage.«
»Zum Beispiel?«
»Na, zum Beispiel eine durchgeknallte Studentin meines Mannes.«
»Ihr Mann ist Zoologe, nicht wahr?«
»Spezialgebiet: Wasservögel«, äußerte Viola Stransky, wie man äußert: Mission: Impossible.
»Sie meinen also, das Herz einer angehenden Ornithologin sei im Spiel?«
»Vielleicht. Das würde wenigstens die Lächerlichkeit eines geworfenen Apfels erklären.«
»Äpfel sind keine Vögel«, stellte Steinbeck fest.
»Wäre ja noch schöner, hätte uns das einsame Herz mit einer toten Ente bombardiert.«
Steinbeck nickte. Und fügte an, daß eine solche Ente dann eine gebratene hätte sein müssen. Freilich wäre auf diese Weise die Wirkung des Betäubungsmittels dahin gewesen. Anders im Falle eines auch roh genießbaren Apfels.
»Ich frage mich nur«, setzte Steinbeck fort, »wieso Ihr Mann in diesen Apfel gebissen hat. Wenn man bedenkt, daß er ihn aus dem Müll holen mußte.«
»Aus dem Kompost«, korrigierte Stransky.
»Von mir aus. Verstehbar ist es in keinem Fall.«
»Ach, ich weiß nicht …«, überlegte Stransky, erklärte dann aber, daß eine solche Handlung tatsächlich nicht zu ihrem Mann passe. Und auch wenn Georg kaum als Hausmann zu bezeichnen sei, wäre ihm niemals der Fehler unterlaufen, ein kompostierbares Obststück in den falschen Eimer zu befördern.
»Könnten Sie sich vorstellen …?« Steinbeck zögerte. »Es ist nur eine Frage. Ist es denkbar, daß Ihr Mann selbst es war, der eine seiner Studentinnen ermutigt hat, etwas Derartiges zu tun? Ihn zu betäuben und zu entführen.«
»Das halte ich für unmöglich. Und zwar nicht, weil ich meine, auch noch hinter den sieben Bergen die Schönste zu sein und jede andere auszustechen. Aber Georg ist nun mal kein Mann für die Liebe. Er ist zufrieden. Mit sich und dem Rest. Nur die Unzufriedenen flüchten stetig in Liebschaften.«
»Es könnte ihn aber trotzdem einmal gepackt haben. Das kann man nicht ausschließen.«
»Das kann man ausschließen«, erwiderte Viola Stransky in ruhigem Ton. So ruhig, daß Steinbeck ihr glaubte.
»Wir werden eine Fangschaltung einrichten«, kündigte Steinbeck an. »Falls sich jemand meldet.«
»Und falls sich niemand meldet?«
»Dann müssen wir auf andere Fangschaltungen zurückgreifen.«
»Finden Sie alle Leute, die Sie suchen?« fragte Stransky.
»Natürlich nicht. Wir finden nur die, die auch gefunden werden möchten. Entweder sind das die Entführten oder die Entführer.«
»Die Entführer?«
»Es gibt Kriminelle«, erklärte Steinbeck, »die schreien geradezu nach der Polizei. Wie Kinder, die sich aufs Fensterbrett stellen, um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern zu gewinnen. Wenn nun aber eine Person verschwindet und jeder damit zufrieden scheint, sogar der, der verschwand, erschwert das die Arbeit der Polizei beträchtlich. So was kommt öfter vor, als man denken sollte.«
»Ich bin überzeugt, daß Georg gefunden werden möchte. Er liebt mich, und er liebt seine Tochter.«
»Ich dachte, für ihn gibt es keine Liebe.«
»Keine abenteuerliche, meinte ich. Sehr wohl aber eine geordnete Liebe.«
»Was verstehen Sie unter geordnet?«
»Haben Sie Familie?«
»Eine Adoptivtochter«, antwortete Steinbeck.
»Dann müßten Sie eigentlich wissen, wovon ich spreche.«
»Sie meinen eine Liebe«, spielte Steinbeck mit, »die in letzter Konsequenz auch darin besteht, einen Apfel in den richtigen Mülleimer zu tun.«
»Jetzt haben wir uns verstanden«, sagte Viola Stransky und lächelte. Ihr Gesicht war eine helle Spalte im Schatten der Holunderbüsche.
Nachmittags um drei betrat Lilli Steinbeck das Büro Baby Hübners. Hübner trug denselben erdbraunen Anzug wie am Morgen. Steinbeck jedoch hatte das strenge, silbergraue Vormittagskostüm mit einem ärmellosen, kurzen Kleid getauscht, welches das durchschimmernde Rot gegen das Sonnenlicht gehaltener Johannisbeeren besaß und ziemlich viel Platz für Steinbecks lange, dünne Beine ließ, die wie ein gedehntes Echo von Steinbecks Hals anmuteten.
Auf Hübners Schreibtisch lag ein angebissener Apfel, unverkennbar Stranskys Apfel, weil eingepackt in eine Klarsichtfolie.
Steinbeck nahm Platz und schlug das rechte über das linke Bein. Hübner dachte unversehens an die französische Revolution und die vielen Guillotinen damals. Ihm wurde ein klein wenig schwindelig. Also riß er sich zusammen, starrte angestrengt an Steinbeck vorbei und sagte: »Wir haben Blut im Apfel gefunden.«
»Ach was!?« kommentierte Steinbeck.
»Na ja«, schwächte der Kommissar die Nachricht ab, »Blut vom Zahnfleisch, höchstwahrscheinlich. Jedenfalls stimmt die Blutgruppe mit jener des Vermißten überein. Er scheint also tatsächlich selbst hineingebissen zu haben.«
»Und sonst?«
»Die Rückstände von Fräuleinwunder wurden bestätigt. Dieses Ding haut einen Menschen auch bei geringer Dosierung um. Danach schläft man ein paar Stunden. Allerdings haben wir weder im Haus noch im Garten etwas entdeckt, was eine Verschleppung bestätigen könnte. Sieht also aus, als hätten wir es mit einem Profi zu tun. Oder Herr Stransky will uns das glauben lassen. Was clever von ihm wäre, nicht die üblichen Schleifspuren et cetera vorzutäuschen. Allerdings fragt sich nur, wenn denn Cleverneß vorliegt, zu welchem Zweck.«
»Ich denke, eine solche Möglichkeit können wir ausschließen.«
»Wieso?« fragte Hübner und stopfte sich eine Pfeife. Er stopfte übrigens immer nur. Noch nie hatte ihn jemand auch rauchen gesehen. Ganz typisch für diesen Mann. Er war die leibhaftig gewordene Unschärferelation.
Lilli Steinbeck, die nun nach einer Zigarette griff, die sie auch konsumieren würde, erklärte, daß es sich bei Georg Stransky mit großer Wahrscheinlichkeit um einen weiteren Fall der Kategorie »Athen« handle.
»Athen?« Baby Hübners Schweinsäuglein klappten auf.
»Ja. Athen«, bestätige Steinbeck. »Ich habe das schon befürchtet, als ich von dem Apfel hörte. Es sind in diesem Jahr bereits einige Leute auf diese Weise verschwunden. Immer war irgendein Obst im Spiel. Mal lag es im Postkasten, mal vor der Türe. Oder steckte plötzlich in der Waschmaschine. Obst plus Narkotikum. Und immer war danach ein Mann verschwunden, ohne daß sich je Entführer gemeldet hätten. Nach ein paar Tagen aber tauchten sie alle wieder auf. Leider waren sie dann tot.«
»Wie tot?«
»Sehr tot. Die Mehrzahl erschossen. Einer wurde erstochen, ein anderer erdrosselt. Aber nichts mit Folter. Pure Liquidationen. Allerdings waren die Aufgefundenen in einem Zustand, der zumindest eine anstrengende Reise nahelegt.«
»Was für eine Reise?«
»Wir haben sieben Opfer, die wir in einen Zusammenhang stellen können, einen frugalen, des Obstes wegen. Lauter Deutsche, weiß, männlich, der jüngste vierunddreißig, der älteste dreiundsechzig. Alle haben auch in Deutschland gelebt, einer aus dem Osten, der Rest über den Westen verteilt, zwei aus Hamburg – keine Struktur, die ins Auge sticht. Was dagegen ins Auge sticht, ist der Umstand, daß die Fundorte der Leichname über die ganze Welt verstreut sind. Die Südspitze Chiles ist genauso dabei wie die australische Wüste. Einer befand sich am Rand von Hanoi, ein anderer auf einer winzigen Insel nahe Alaska. Am nächsten zur Heimat war noch ein Mann, den man durchlöchert in einer Scheune bei Joki-Kokko fand. Das ist nicht in Japan, sondern in Finnland.«
»Und was hat das mit Athen zu tun?«
»Das ist nie offiziell geworden. Aber nachdem klar wurde, daß hier eine Serie vorliegen könnte, hat das BKA ein Raster entwickelt, durch welches man die Biographien der Opfer schickte. Man hat sich etwas Konkretes erhofft, eine Person, einen Namen, eine Firma, die in jedem dieser Männerleben eine Rolle gespielt hat. Oder wenigstens etwas von der mystischen Sorte. Sie wissen schon, lauter Brillenträger mit exakt übereinstimmender Dioptrienzahl. Aber da ist nichts zu finden. Nichts, was diese sieben Personen wirklich vereint. Nichts, außer dem Faktum, daß ein jeder von ihnen – allerdings in ganz verschiedenen Berufen – in Athen tätig war. Einige davon in Abständen immer wieder, wobei jeder 1995 in der Stadt gewesen ist, jedoch nicht alle gleichzeitig, leider. Alles, was über die Athener Zeit dieser Männer in Erfahrung zu bringen ist, erzeugt naturgemäß gewisse Multiplizitäten, aber niemals welche, die auf jeden einzelnen zutreffen würden. Keine Frau, kein Restaurant, kein Hotel, kein Attest, nichts, was sieben Mal aufscheint. Nur das Faktum, in Athen gewesen zu sein.«
»Ich war auch schon in Athen.«
»Sie leben noch. Und Sie haben nicht in den Apfel gebissen, der da auf Ihrem Tisch liegt.«
»Was ist jetzt mit Georg Stransky? Auch ein Athener?«
»Als ich von dem Apfel erfuhr, habe ich gleich nachsehen lassen. Stransky ist Zoologe. In dieser Funktion hat er in den Neunzigerjahren, auch fünfundneunzig, einige Gastvorlesungen an der Athener Universität gehalten. Er war für ein paar Wochen immer wieder dort. Ein Zufall ist das nicht. Wenn man den Rest bedenkt.«
»Unser Herr Stransky ist also Nummer acht in der Athen-Schublade?«
»So ist es. Glücklicherweise noch ohne die Feststellung, es handle sich bei ihm um eine Leiche.«
»Was aber zu befürchten ist.«
»Was zu befürchten ist«, bestätigte Steinbeck.
»Und seine Frau? Was halten Sie von ihr?«
»Gewieft, aber unschuldig. – Nein, die hat nichts damit zu tun. Keine Verschwörung der Ehefrauen.«
»Sondern?«
»Wäre gut, das herauszufinden.«
»Die BKA-Leute waren wohl schon in Athen, oder?«
»Natürlich.«
»Denken Sie denn, es hat Sinn, sich dort umzusehen?« fragte Baby Hübner. Um gleich zu bemerken: »Die Griechen sind unmögliche Leute, wenn ich das so frei sagen darf. Mitunter schlimmer als die Türken, und das ist eine Kunst. Ich meine das nicht rassistisch. Ich rede nur von der Organisation der Polizei.«
»Na, eine Armee von Übermenschen ist bei uns ja auch nicht am Werk.«
»Sie wollen also nach Athen fliegen?«
»Mit der nächsten Maschine, wenn Sie einverstanden sind.«
»Wir müßten den griechischen Kollegen Bescheid geben.«
»Tun Sie das. Sagen Sie, es eilt. Und sagen Sie denen, eine Frau kommt.«
»Wollen wir sie nicht überraschen?«
»Sie scheinen diese Leute wirklich nicht zu mögen. Bei mir ist das anders. Ich mag die Griechen, auch wenn die Männer schreckliche Machos sind. Aber das hält man schon aus. Jedenfalls ist mir lieber, wenn die wissen, daß da ein Weib antanzt.«
»Sie werden tanzen?« fragte der Hauptkommissar.
»Aber natürlich«, sagte Steinbeck. Es klang, als rede sie mit einer Extraktionszange.
»Also gut, ich bereite die Griechen vor«, sagte Hübner.
Am selben Abend saß Lilli Steinbeck im Flieger nach Athen.
3
Grün
»Meine Güte, lieber Gott!« dachte Lilli Steinbeck. Und sagte sich: »Nur keine Liebesgeschichte.«
Denn auch für Neutren existiert das Wort »Bedrohung«. Schließlich sind Neutren nicht vollkommen frei von jeglichem Sexus, nicht frei von Verführung und Attraktion. Neutren sind neutral, aber nicht unverwundbar. Sie sind Menschen, die sich aus gutem Grund und tiefer Überzeugung zurückhalten. Wie man sich bei Speisen zurückhält, die einem Magenschmerzen oder Ausschläge am ganzen Körper verursachen. Etwa Erdbeeren. Wenn man Erdbeeren ohnehin nicht mag, ist es natürlich kein Problem, darauf zu verzichten. Oder wenn es wieder einmal nur Erdbeeren gibt, die nach wäßrigen Tomaten schmecken.
Das war der Irrtum all der Männer, die einst in Wien wie auch an der neuen Wirkungsstätte mit Lilli Steinbeck zu tun hatten. Steinbecks kühle, distanzierte Art, ihre von einer zerquetschten Nase noch unterstrichene Unnahbarkeit funktionierte nämlich bloß darum so einwandfrei, weil keiner dieser Männer sich auch nur einigermaßen eignete, ein zärtliches Gefühl hervorzurufen. Also ein Gefühl, das besagte Ausschläge verursachte, Ausschläge auf der Seele und sonstwo. Nichts, was man sich antun mußte. Und schon gar nicht, wenn es keinen guten Grund dafür gab. Männer wie Baby Hübner boten dazu so wenig Anlaß wie seine jüngeren Kollegen, deren vielleicht einziges Plus, keinen Bauch zu haben, von so mancher Grobheit und so manchem vertrottelten Gesichtsausdruck ausgeglichen wurde.
Aber das war in diesem Augenblick ganz anders: kein Bauch, kein vertrottelter Gesichtsausdruck, nichts Grobes, auch nichts aufdringlich Weiches. Der Mann, der Lilli soeben die Hand hinhielt, schien aus der Retorte zu stammen. Ein schöner Frankenstein. Nicht ungriechisch, aber auch nicht ausgesprochen südländisch. Mediterran, das schon, mediterran wie eigentlich alles ist, das ein bißchen Zeit im Freien verbringt und nicht dreiviertel des Jahres im Regen steht wie die Iren. Der Mann besaß dunkles Haar, das in glänzenden Wellen dalag, gleich einem ölverseuchten Meer. Seine Augen hingegen waren ausgesprochen klar, Augen von der Farbe eines dieser am Rande kaltgrünen und zur Mitte hin kaltblauen Schotterteiche. So kalt die Farbe, so freundlich ihr Wesen, schien es.
Der Mann, der kaum älter als fünfundzwanzig sein konnte und eine Spur kleiner als Lilli Steinbeck war, trug einen Schnurrbart. Schade um die hübschen, vollen Lippen darunter, Lippen, die gehäkelt anmuteten. Der Schnurrbart diente wohl dazu, älter zu wirken. Wozu auch der einfache dunkle Anzug beitrug. Vor allem aber das reinweiße Einstecktuch, das wie ein Ersatzfinger aus der Brusttasche ragte. Einen Ersatzfinger sollte sowieso jedermann bei sich tragen. Man würde nämlich staunen, wie sehr ein einziger fehlender Finger abgehen kann. Die ganze Welt kippt.
»Herzlich willkommen, Frau Steinbeck. Ich bin Stavros Stirling, der Assistent von Hauptkommissar Pagonidis.«
»Stirling?«
»Mein Vater ist Engländer, meine Mutter Griechin.«
»Nette Mischung.«
»Freut mich, daß Sie das so sehen.«
»Ihr Deutsch haben Sie aber nicht von Ihrem Vater, oder?«
»Mein Deutsch habe ich aus der Schule«, sagte Stavros Stirling, wie man sagt: Ich lese nur gebundene Bücher.
»Sie müssen ein braver Schüler gewesen sein.«
»Ein ausgezeichneter. Trotzdem bin ich zur Polizei gegangen. Wofür mich meine Eltern hassen.«
»Vielleicht sind Sie deshalb zur Polizei gegangen, damit Ihre Eltern Sie hassen. So was kommt vor.«
»Nicht bei mir. Eher wollte ich verhindern, ein Verbrecher zu werden. Man wird das so leicht in dieser Welt.«
»Und Sie meinen, als Polizist seien Sie davor gefeit?«
»Einigermaßen. Zumindest sehr viel mehr, als die meisten glauben.«
Steinbeck machte ein skeptisches Gesicht. Dann drückte sie dem jungen schönen Mann ihren kleinen Koffer in die Hand und fragte ihn, ob er nur darum hier sei, weil er ein perfektes Deutsch spreche.
»Nein«, sagte Stirling, »das ist die Draufgabe. Ich bin Pagonidis’ bester Mann. Ehrlich! Ich soll Ihnen bei den Ermittlungen behilflich sein.«
»Wieso? Hat Kommissar Pagonidis keine Zeit?«
»Ich will offen sein, Frau Steinbeck. Der Kommissar kann die Deutschen nicht leiden, und Frauen schon gar nicht.«
»Deutsche Frauen, meinen Sie.«
»Frauen, die den Mund aufmachen, um genau zu sein.«
»Der Mann ist ja ein liebes Früchtchen.«
»Er wäre Ihnen keine Hilfe.«
»Und Sie?« fragte Lilli.
»Ich hoffe sehr, daß ich Ihnen dienlich sein kann«, antwortete der hübsche Frankenstein.
Steinbeck nickte ganz leicht und lächelte ganz leicht. Und verbeugte sich ganz leicht. Es waren nette kleine Gesten, die sie da vollzog. Winzige Blümchen, die herrlich rochen.
Stavros Stirling war ziemlich hingerissen von dieser Frau. Er hatte eine Furie erwartet, ein deutsches Ungeheuer, etwas durch und durch Unelegantes, wie man das eben von deutschen Frauen kannte, die auf Urlaub nach Griechenland kamen und die immer unförmig aussahen und sich meistens wie auf Krükken bewegten. Oder als wären sie zu lange auf einem Elefanten gesessen. Nun, Stirling hatte noch nicht begriffen, es mit einer Österreicherin zu tun zu haben. Österreicherinnen – um noch einmal allgemein zu werden – mögen hinterlistig und abnorm und sonstwie unmöglich sein, aber sie bewegen sich selten wie auf Krücken. Das muß man ihnen lassen. Eher bewegen sie sich, als würden sie auf Schlittschuhen stehen. Wobei die Flächen, über die sie gleiten, nicht immer nur aus Eis bestehen.
Natürlich war auch Stavros im ersten Moment von Steinbecks deformierter Nase irritiert gewesen. Nicht lange aber. Schnell begriff er, daß die Nase dazugehörte, daß sie einem intelligenten Konzept entsprach. Einen Fehler mit System darstellte. Ganz in der Art eines Impfstoffes, der die Krankheit durch sich selbst überlistet.
Als Stavros Stirling jetzt neben Steinbeck durch das Parkhaus herschritt, sagte er sich, noch niemals einen solchen Gang gesehen zu haben. Er dachte weniger an Marilyn Monroe oder an diese Models, die wie über einen aus vielen kleinen Männern geknüpften Teppich staksen, nein, er dachte an einen dieser großen Rochen, die über Meeresböden segeln. Und die ja imstande sind, Stromstöße auszusenden. Keine Frage, diese Frau verfügte über Elektrizität.
»Schönes Auto«, kommentierte Steinbeck, während Stirling – der selbstverständlich nicht die englische, sondern die griechische Staatsbürgerschaft besaß – ihr die Türe zu seinem kleinen, flachen Sportwagen öffnete. Ein Wagen, der schwarz glänzend, frisch wie aus der Waschstraße einen schwebenden, einen utopischen Eindruck machte.
Steinbeck mußte ein kleines Kunststück aufführen, um mit ihren ausgesprochen langen Beinen in das tiefliegende Cockpit zu gelangen. Wo sich dann allerdings ein für selbige Beine geradezu perfekt langgestreckter Bodenraum ergab, als hätten die Konstrukteure dieses bodennahen Vehikels in erster Linie die Umstände langer, weit unter die Motorhaube vorstoßender Beine bedacht. Nun, es waren Italiener gewesen, welche diesen Wagen erschaffen hatten, einen Fiat Barchetta, wie Stirling erklärte, ein kleines Boot. Genau, ein kleines Boot für lange Beine. Lilli fühlte sich bestens, auch wenn ihr Kopf gefährlich nahe an das Stoffverdeck heranreichte. Gut, man konnte das Verdeck ja herabsenken, was Stirling jetzt auch tat. Das Stoffdach versank wie ein umgekehrter Theatervorhang. Bühne frei. Stirling startete und fuhr los.
»Klingt wie ein Diesel«, meinte Lilli.
»Das ist die Rückstellfeder«, erklärte Stirling, wie man sagt: Mein Hund schnarcht.
Über den Verkehr in Athen soll hier nur gesagt werden, daß sich auch anderswo viel abspielt, etwa in Ameisenburgen und im Planktonbereich.
Das Hotel, in das Stirling seine Kollegin brachte, lag im Zentrum der Stadt, zwischen älteren, einfachen Häusern. Wie diese war es nicht sonderlich hoch, jedoch mit der Rückseite tief in eines von den hinterhöfischen Löchern vordringend, wo bereits die Nacht fest und schwarz gefangensaß. Der verschwenderisch beleuchtete, moderne Bau war ausgesprochen grün und ausgesprochen transparent. Zumindest mal die Vorderfront, die wie die Ansammlung gestapelter Aquarien erschien. Darin Menschen, stehend, sitzend, speisend, als posierten sie für ein Wimmelbuch. Aber eben in Grün eingefärbt. Der Name des Hotels: Studio 1.
Das Studio 1 erwies sich auch im Inneren als todschick. Erstaunlicherweise hielt die grüne Färbung an, ohne daß man immer genau hätte sagen können, ob ein Gegenstand selbst grün war oder in irgendeinem grünlichen Licht stand. Steinbecks Zimmer befand sich weit hinten, in einem fensterlosen Raum.
»Wollen Sie, daß ich ersticke?« fragte Steinbeck, obwohl deutlich hörbar durch ein Gebläse Luft hereintrieb. Luft, die besser war als die auf der Straße. Stirling erklärte, daß man das Zimmer aus Sicherheitsgründen ausgewählt habe.
»Denken Sie denn, ich bin gefährdet?«
»Falls ja, kann man Sie wenigstens nicht durch eine Scheibe erschießen.«
Steinbeck versetzte ihren Kopf in eine dekorative Schrägstellung und betrachtete den jungen Polizisten aus grünen Augen, die nicht grün waren, sondern braun … Sie dankte ihm und bat ihn, sie nach dem Frühstück abzuholen. Sie habe sich für den Vormittag mit jenem Universitätsprofessor verabredet, auf dessen Einladung Georg Stransky mehrmals in Athen gewesen sei.
»Gute Nacht!« sagte Steinbeck und zeigte vorwurfsvoll auf ihre Uhr. Es war fast zehn.
»Kali’nichta, gnädige Frau!« antwortete Stavros. Die Anrede verriet, daß er nun also doch erkannt hatte, es mit einer Österreicherin zu tun zu haben.
War das ein Grund für Lilli, sich zu freuen?
Oder war es ein Grund, sich zu ängstigen?
Steinbeck war erschöpft und deprimiert. Deprimiert wegen der späten Stunde. Ihr ganzer Rhythmus war dahin. Anstatt sich augenblicklich auszuziehen und mit der aufwendigen Abendtoilette zu beginnen, drehte sie den Dimmer ein wenig zurück und legte sich auf ein höchstwahrscheinlich fleischfarbenes Designerbett, das aber im bläulichen Licht die obligate grünliche Färbung angenommen hatte. Wie alles hier, vieles in Gelb und Rosa, aber eben eingegrünt. Jetzt im Dämmergrün.
Ende der Leseprobe