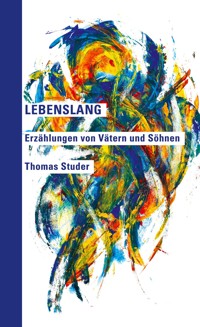Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist eine umfassende Darstellung der Finanzgeschichte des Bundes seit seiner Gründung im Jahr 1848. Es untersucht, wie politische und wirtschaftliche Ereignisse zu einer Ausweitung der Staatstätigkeit geführt haben und wie der Bund diese Aufgaben finanzierte. Es beleuchtet entscheidende Momente, die die schweizerische Finanzpolitik geprägt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Thomas Studer | Christoph Schaltegger
DIE FINANZGESCHICHTE DER SCHWEIZ
Von der Gründung des Bundes bis heute
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025Hermann-Herder-Straße 4, 79104 FreiburgAlle Rechte vorbehalten.www.herder.de
Cover: Verlag Herder GmbHCovermotiv: KEYSTONE SGA
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
ISBN Print: 978-3-451-07282-6ISBN E-Book (EPUB): 978-3-451-83642-8
Inhalt
1.Vorwort
2.Die Finanzgeschichte des Bundes – ein einleitender Überblick
3.Fazit
4.Ein geglückter Start: Der Bundeshaushalt von 1848 bis 1913
4.1Der Bund erlangt die finanzielle Unabhängigkeit
4.2Die Verfassung von 1874: Trennsystem und Zentralisierungsschub
4.3Der Bund weitet seine Tätigkeit aus – und seinen Einfluss auf die Kantone
4.4Die Verstaatlichung der Eisenbahn – und ihrer Schulden
5.Der Erste Weltkrieg: Ein Fiskalschock trifft den Bund unvorbereitet
5.1Die ruhige Entwicklung nimmt auch in der Schweiz ein abruptes Ende
5.2Die Kriegssteuer als finanzpolitische Zäsur im Bundesstaat
5.3Eine zögerliche Kriegssteuerpolitik
5.4Der Bund greift zur «Ultima Ratio» und erhebt eine neue Kriegssteuer
6.Der Versuch einer Rückkehr zu den Vorkriegsverhältnissen und eine notrechtliche Finanzpolitik während der Weltwirtschaftskrise
6.1Eine durchzogene Bilanz: die Wiederherstellung der Vorkriegsverhältnisse
6.2Die Grundsteinlegung für die AHV: Die Finanzierungsfrage bleibt ungeklärt
6.3Fiskalnotrecht als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise
6.4Finanzpolitische Verständigung vor dem Kriegsausbruch
7.Der Zweite Weltkrieg: Eine Schlüsselphase der Bundesfinanzgeschichte
7.1Besser vorbereitet und mit mehr Erfahrung durch den Zweiten Weltkrieg
7.2Das Fundament für die Nachkriegsfinanzordnung wird gelegt
7.3Der Bundesrat übernimmt die Finanzpolitik – mit Bedacht
7.4Steueramnestie: Jetzt zugreifen!
8.Verstetigung des Steuersystems und mit dem «Wirtschaftswunder» zum Wohlfahrtsstaat
8.1Ein «Finanzwunder» ebnet den Weg für die AHV
8.2Das lange Ringen um die Bundesfinanzreform
8.3Antizyklische Finanzpolitik und ihre Grenzen: Zurückhaltende Ausgabenpolitik, Steuerabbau und eine «automatische» Schuldentilgung
8.4Steueramnestie statt Steuererhöhung
8.5Eine verhängnisvolle Aufholjagd
9.Schuldenkrise und Reformwerke
9.1Zuerst sparen, dann Steuern – Die Haushaltskonsolidierung nach dem Boom
9.2Steuerharmonisierung: Der Bund greift in die kantonale Steuerhoheit ein
9.3Föderalismusreform in der Politikverflechtungsfalle
9.4Die Bundesfinanzen an einem Scheideweg: Die Schuldenkrise der 1990er-Jahre
9.5Die grosse Föderalismusreform
9.6Aufschwung und Abbau des internationalen Steuerwettbewerbs
10.Abbildungsverzeichnis
11.Tabellenverzeichnis
12.Abkürzungsverzeichnis
13.Bibliographie
14.Bildnachweis
1. Vorwort
«Als Vorsteher des Militärdepartements hatte ich die halbe Schweiz gegen mich. Als Vorsteher des Finanzdepartements hatte ich die ganze Schweiz gegen mich.»
Diese Sätze stammen von Kaspar Villiger, der von 1989 bis 2003 dem Bundesrat angehörte. Den zweiten Satz hätte wohl auch jeder andere Finanzminister in der Geschichte der Schweiz unterschrieben.
Finanzpolitik ist und war schon immer ein hartes Brot. Auf der Einnahmenseite macht sich die Finanzministerin oder der Finanzminister unbeliebt, weil Staatseinnahmen letztlich immer Zwangsabgaben von Bürgerinnen, Bürgern und der Wirtschaft bedeuten. Auf der Ausgabenseite wiederum fliegen dem zuständigen Mitglied des Bundesrats die Herzen nicht zu, weil es dem natürlichen Hang der Politik zum Geldverteilen entgegenhalten und deshalb so manches sachpolitisch gewünschte Projekt in Frage stellen muss.
Es ist eine Grundregel, dass verantwortungsvolle Politik es nie allen recht machen kann. Für die Finanzpolitik gilt das in ganz besonderem Mass. Sie hat es immer mit Knappheiten zu tun. Solange das Geld nicht vom Himmel fällt, muss ein Staat Prioritäten setzen. Enttäuschungen oder zumindest nicht erfüllte Erwartungen sind die logische Folge davon.
Umgekehrt sind falsche finanzpolitische Weichenstellungen etwas vom potenziell Gefährlichsten für einen Staat. Ein Gemeinwesen, das seine Mitglieder mit einer immensen Steuer- und Abgabenlast erdrückt, vernichtet oder verhindert Wohlstand; ein Staat wiederum, der über seine Verhältnisse lebt und das Geld mit vollen Händen ausgibt, häuft Schulden an, schwächt sich selbst und schmälert die Chancen künftiger Generationen.
Finanzpolitische Entscheidungen spielen sich nicht im luftleeren Raum ab. Sie sind abhängig von sachpolitischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wie das vorliegende Werk zeigt, sind sie häufig auch Reaktionen auf Krisen oder auf langfristige Entwicklungen. Die beiden Weltkriege waren genauso finanzpolitische Zäsuren, wie die Demographie heute ein Treiber ist. Überlagert wird dies durch Entwicklungen im Verhältnis zwischen Bund und Kantonen, dem Entstehen und stetigen Ausbau des Sozialstaats und einer zunehmenden internationalen Verflechtung und Abhängigkeit. Finanzpolitik ist, in anderen Worten, komplizierter und auch konfliktreicher geworden. Das Diktum des ersten Finanzministers des Bundesstaates, Henri Druey, der seine Zeit im Finanzdepartement noch als «Ruhepause» bezeichnete, kontrastiert denn auch scharf mit Kaspar Villigers oben zitierten Sätzen.
Geschichte wiederholt sich nicht und sie gibt uns keine Rezepte für die Zukunft an die Hand. Dennoch ist die Beschäftigung mit ihr sinnvoll. Nur wenn wir verstehen, woher wir kommen, erkennen wir auch, wo wir stehen und wohin wir gehen könnten. Im vorliegenden Buch etwa nimmt die Geschichte von Fiskalregeln breiten Raum ein. Kurz gesagt sind sie alle gescheitert – bis zur Einführung der Schuldenbremse vor gut 20 Jahren unter Kaspar Villiger. Es war ein finanzpolitischer Durchbruch, der massgeblich geholfen hat, unser Land von der Schuldenwirtschaft zu befreien und finanziell dauerhaft stark aufzustellen. Eine der Lehren der Geschichte ist es, an diesem Fundament für eine Politik der ausgeglichenen Haushalte, festzuhalten.
In diesem Punkt, da bin ich in Abwandlung des Satzes von Kaspar Villiger zuversichtlich, hätte man zwar nicht die ganze Schweiz für sich. Aber doch die grosse Mehrheit.
Karin Keller-Sutter Bundespräsidentin der Schweizerischen Eidgenossenschaft
2. Die Finanzgeschichte des Bundes – ein einleitender Überblick
Als Ausgangspunkt für diesen Überblick über die Finanzgeschichte des Bundes bietet es sich an, die Entwicklung der Staatsquote und der Einnahmenquote in Abbildung 1 zu betrachten, also die Ausgaben und Einnahmen des Bundes im Verhältnis zum BIP.
Abb. 1: Die Ausgaben und Einnahmen des Bundes (1849–2018)
Quellen: Eigene Berechnungen. Rechnungsabschlüsse: 1849–1912: BFS, Statistisches Jahrbuch 1935 (S. 326 f.); 1913–1954: EVF, Staatsrechnung 1955 (S. 44*); 1955–1989: EFV, Staatsrechnung 1990 (S. 102); 1990–2018: EFV Staatsrechnung (entspr. Jahrgänge). BIP: Stohr (2016); BFS (2019).
Bei der Betrachtung der Staatsquote fällt auf den ersten Blick auf, dass sie heute wesentlich höher liegt als bei der Bundesstaatsgründung: Während die Ausgaben des Bundes 1848 knapp ein halbes Prozent des BIP ausmachten, sind es mittlerweile rund zehn Prozent. Damit bestätigt sich für die Schweiz das «Wagnersche Gesetz der wachsenden Staatsausgaben». Diese These des deutschen Finanzwissenschaftlers Adolph Wagner aus dem Jahr 1876 besagt, dass «[…] eine immer grössere und wichtigere Quote der Gesammtbedürfnisse eines fortschreitenden Culturvolks […] durch den Staat statt durch andere Gemein- und Privatwirthschaften befriedigt [wird], […]».1
Allerdings verlief der Anstieg der Staatsquote nicht linear. Die Entwicklung lässt sich grob in vier Phasen unterteilen. Die erste Phase umfasst die Zeit von der Bundesstaatsgründung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Sie war von einer ruhigen Entwicklung und einem moderaten Anstieg der Aufwendungen des Bundes nach der Verfassungsrevision von 1874 geprägt. Die zweite Phase umfasst das «Katastrophenzeitalter» (Hobsbawm) von 1914 bis 1945. Die beiden Weltkriege markierten wichtige Wendepunkte in der Finanzgeschichte des Bundes. Sie brachten den Bundeshaushalt umgehend und grundlegend aus dem Gleichgewicht, weshalb sich der Bund neue Einnahmen beschaffte. Die Kriege hatten nicht nur einen markanten Anstieg der Staatsverschuldung, sondern auch eine starke und langfristige Erhöhung der Staatsquote zur Folge. Dabei zeigte sich der von Alan T. Peacock und Jack Wiseman beschriebene «Sperrklinkeneffekt»2 der Staatsausgaben, die von Krise zu Krise treppenartig ansteigen.3 Es folgte der Nachkriegsboom, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einsetzte und bis zum Ausbruch der Rezession 1974/76 anhielt. In dieser langen Phase des Aufschwungs schwankte die Staatsquote zwischen 6 und 7 Prozent und begann dann ab 1960 langsam zu steigen. Dabei verzeichnete der Bund teilweise hohe Rechnungsüberschüsse. Die letzte Phase umfasst die Zeit von 1974 bis heute. Diese Jahre waren von einem Ausbau der Staatstätigkeit und zwei langen Defizitperioden geprägt. Wie nach den Kriegen zeigte sich auch nach den beiden Defizitperioden ein Sperrklinkeneffekt. Erst nach der Jahrtausendwende gelang es, den Haushalt dank tiefgreifender institutioneller Reformen und insbesondere der Schuldenbremse wieder zu stabilisieren.
Die Bundesstaatsgründung: ein geglückter Start
In der Zeit von der Bundesstaatsgründung im Jahr 1848 bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs löste sich der Bund aus seiner finanziellen Abhängigkeit von den Kantonen und wurde zu einem eigenständigen Akteur mit starkem Einfluss auf die Kantone. Diese Entwicklung war bei der Bundesstaatsgründung noch nicht absehbar, denn die Kompetenzen, die dem Bund übertragen wurden, hielten sich in engen Grenzen. 1848 wurde die Landesverteidigung zu einer gemeinsamen Kompetenz von Bund und Kantonen. Die Landesverteidigung war die einzige Aufgabe, die dem Bund hohe Ausgaben verursachte: Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs wendete er dafür rund zwei Drittel seiner Mittel auf. Dies ist in Abbildung 2 ersichtlich, wo die Ausgabenstruktur des Bundes von 1850 bis 2020 abgebildet ist.
Abb. 2: Die Ausgaben des Bundes nach Aufgabengebiet (1850–2018)
Quellen: Eigene Berechnungen. 1850–1910: Halbeisen und Lechner (1990) in HSSO Tab. U.2a.; 1938: ESTV (1974); 1950–1980: EFV, Öffentliche Finanzen der Schweiz (1989); 1990–2018: EFV, Staatsrechnung (entspr. Jahrgänge). Anmerkung: Die Kantonsanteile an den Bundeseinnahmen sind in der Staatsrechnung unter Finanzen & Steuern aufgeführt und die Verwaltung unter «Übrige Aufgabengebiete».
In den Anfangsjahren verursachte die Verwaltung einen verhältnismässig grossen Teil der Bundesausgaben – allerdings ging ihr Anteil mit wachsenden Staatsausgaben schnell zurück: von 25 (1850) auf rund 10 Prozent (1870) (→ Abb. 2). Daneben verursachte noch die Vermögens- und Schuldenverwaltung (Zinskosten) mit 5 bis 10 Prozent regelmässig nennenswerte Ausgaben. Die übrigen Kompetenzen fielen finanziell kaum ins Gewicht. Für die Bildung wendete der Bund rund drei Prozent seiner Mittel auf, nachdem er im Jahr 1855 die Eidgenössische Technischen Hochschule eröffnete. Mit dem Recht zur Errichtung und Unterstützung öffentlicher Werke wurde dem Bund bei seiner Gründung ausserdem eine Subventionskompetenz übertragen, von der er bald Gebrauch machte und die Kantone bei Strassenbauten und Gewässerkorrektionen unterstützte.
Der Bund erhielt für die Erfüllung seiner Aufgaben fünf Einnahmequellen. Von finanzieller Bedeutung war insbesondere das Zollwesen, das ihm von den Kantonen übertragen worden war (→ Abb. 3).
Abb. 3: Der Anteil der Zölle sowie der Verbrauchs-, Einkommens- und Vermögenssteuern an den Bundeseinnahmen (1850–2018)
Quellen: Eigene Berechnungen. Zolleinnahmen: 1849–1912: EFV, Staatsrechnung (entspr. Jahrgang); 1913–1974: HSSO Tab. U.10a. und U.10b.; 1975–1920: EFV, Staatsrechnung (entspr. Jahrgänge); Verbrauchs-, Einkommens- und Vermögensteuern: 1913–1974: HSSO Tab. U.10a. und U.10b.; 1975–1989: Staatsrechnung (entsprechende Jahrgänge); 1990–2015: Angaben der EFV; Gesamteinnahmen: 1849–1912: BFS, Statistisches Jahrbuch (1935); 1913–1954: BFS, Statistisches Jahrbuch (1954); 1955–1989: Staatsrechnung (1990); 1990–2020: EFV.
Die Zölle machten über 90 Prozent (1848–1873), später über 80 Prozent (1874–1913) der Einnahmen des Bundes aus und waren damit seine wichtigste Einnahmequelle. Im Gegensatz dazu spielten die übrigen Einnahmequellen eine untergeordnete Rolle. Der Ertrag des Bundesvermögens und des Pulverregals fiel gering aus. Vom Ertrag des Postwesens, das dem Bund von den Kantonen bei Bundesstaatsgründung übertragen worden war, musste der Bund den Kantonen eine Entschädigung entrichten. Zudem war der Bund verpflichtet, allfällige Überschüsse für den Ausbau des Postnetzes und für Tarifsenkungen zu verwenden. In ausserordentlichen Situationen und nur auf Beschluss der Bundesversammlung konnte der Bund ausserdem Beiträge der Kantone («Geldkontingente») erheben. Dies geschah nur ein einziges Mal, als 1849 die Grenzbesetzung während der Revolution im Grossherzogtum Baden finanziert werden musste.
Mit der Übertragung des Zollwesens auf den Bund wurde einnahmeseitig ein Trennsystem geschaffen, das die Zölle dem Bund und die direkten Steuern den Kantonen zuwies. Allerdings hatte sich der Bund das Zollwesen teuer erkauft. Die «Zollentschädigung», die der Bund den Kantonen für die Übertragung des Zollwesens leisten musste, war höher als die kantonalen Zolleinnahmen vor der Bundesstaatsgründung. Dies hatte zur Folge, dass seine finanzielle Lage bei Staatsgründung mit Unsicherheit behaftet war. Jedoch zeigte sich bald, dass der Budgetausgleich dem Bund keine Probleme bereitete. Da mit der Schaffung des Bundesstaats als einheitliches Wirtschaftsgebiet ein wirtschaftlicher Aufschwung einherging, übertrafen die Zollerträge bald alle Erwartungen. Den Verfassungsvätern war es gelungen, die Kompetenzen des Bundes auf der Einnahmenseite gut auf die Aufgabenbefugnisse abzustimmen. Dabei setzten die geringen Mittel und Kompetenzen dem Finanzhaushalt des Bundes im ersten Vierteljahrhundert enge Grenzen. Der erste Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD), der Solothurner Freisinnige Josef Munzinger, war besonders auf ausgabenseitige Zurückhaltung bedacht.4 Sparsamkeit war ihm ein persönliches Anliegen: Als er sich einen neuen Stempel besorgen liess, bemerkte Munzinger, er «[…] hätte einen solchen mit verstellbarem Datum vorgezogen, aber er werde wohl zu viel kosten.»5 Die Ausgaben des Bundes blieben während des ersten Vierteljahrhunderts stabil bei rund einem halben Prozent des BIP und der öffentliche Haushalt war in den allermeisten Jahren ausgeglichen. Dies ist in Abbildung 4 ersichtlich, wo der Haushaltssaldo im Verhältnis zum BIP abgebildet ist.
Abb. 4: Der Haushaltssaldo des Bundes (1849–2018)
Quellen: Eigene Berechnungen. Rechnungsabschlüsse: 1849–1912: BFS, Statistisches Jahrbuch 1935 (S. 326 f.); 1913–1954: EVF, Staatsrechnung 1955 (S. 44*); 1955–1989: EFV, Staatsrechnung 1990 (S. 102); 1990–2018: EFV Staatsrechnung (entspr. Jahrgänge). BIP: Stohr (2016); BFS (2019).
Nur wenn ausserordentliche Militärausgaben getätigt wurden, war die Rechnung defizitär. Dementsprechend gering war auch die Arbeitsbelastung des Finanzvorstehers im Bundesrat. Der Waadtländer FDP-Bundesrat Henri Druey beschrieb seine Amtsjahre als zweiter Vorsteher des EFD gar als «Ruhepause in seiner Zeit als Bundesrat».6 Mit einer ersten grossen finanziellen Herausforderung wurde der Bund im Jahr 1870 konfrontiert, als der Deutsch-Französische Krieg ausbrach und er die Grenzbesetzung finanzieren musste. Dabei brachten die ausserordentlichen Militäraufwendungen den Bundeshaushalt zum ersten Mal aus dem Gleichgewicht: 1870 wurde ein Defizit in der Höhe von 0.6 Prozent des BIP verzeichnet (→ Abb. 7).
Die Verfassung von 1874: Erster Schritt in Richtung Zentralisierung
Die Verfassung von 1874 war ein Wendepunkt in der noch jungen Geschichte der Bundesfinanzen. Bei der Revision wurden die Kompetenzen des Bundes ausgebaut und es gab einen Zentralisierungsschub. Dabei wurde mit dem «Vollzugsföderalismus», der Umsetzung der Bundespolitik durch die Kantone, ein Weg gefunden, der die Übertragung von Kompetenzen auf den Bund möglich machte. Aus finanzpolitischer Sicht war insbesondere die weitgehende Übertragung des Militärwesens auf den Bund relevant, die wegen der schlechten Erfahrungen mit der Kriegsbereitschaft der Armee bei der Grenzbesetzung während des Deutsch-Französischen Krieges (1870/71) durchgeführt wurde. Da die Zentralisierung des Militärwesens für den Bund mit hohen Kosten verbunden war, wurden die Zoll- und die Postentschädigung für die Kantone aufgehoben. Ausserdem ging die Militärpflichtersatzsteuer von den Kantonen auf den Bund über. Da die Kantone weiterhin für die Erhebung der Steuer verantwortlich waren, wurden sie mit der Hälfte des Ertrags entschädigt. Dies war der erste Kantonsanteil an einer Bundessteuer in der Schweizer Steuergeschichte, dem später noch viele folgen sollten.
Wie sich herausstellte, reichten die zusätzlichen Einnahmen nicht aus, um die gestiegenen Militärausgaben zu decken. Nach drei Defizitjahren brachte erst eine Erhöhung der Zolltarife den Budgetausgleich (→ Abb. 4). Ab Mitte der 1880er-Jahre folgte der Bund dem Beispiel seiner Nachbarländer und ging vom Freihandel zu einer Schutzzollpolitik über. Er erhöhte die Zolltarife in drei Schritten (1884, 1887 und 1891), wodurch die Einnahmen, gemessen am BIP, bis Mitte der 1890er-Jahre um mehr als die Hälfte anstiegen (→ Abb. 1). Weil die Katholisch-Konservativen den Ausbau der Bundeskompetenzen dank dem 1874 eingeführten fakultativen Referendum erfolgreich blockierten, stiegen die Ausgaben zunächst nicht stark an. Erst als eine Verständigungspolitik zwischen den Konservativen und den Freisinnigen einsetzte, konnten die neuen Aufgaben des Bundes im Verbund mit den Kantonen umgesetzt werden. Um eine Aufgabenübertragung auf den Bund zu umgehen, wurde in vielen Fällen auch auf Subventionen zurückgegriffen. Dabei weckte die gute Finanzlage des Bundes immer mehr Begehrlichkeiten bei den Kantonen. Ausserdem forderten katholisch-konservative Kreise anstelle von Subventionen eine Beteiligung der Kantone an den Zolleinnahmen im Umfang von zwei Franken pro Einwohner. Sie bemängelten, dass die zweckgebundenen Subventionen an Pflichten gebunden waren, wodurch der Bund Einfluss auf die kantonale Sphäre erlangte. Jedoch war der Widerstand gegen die «Beutezuginitiative» gross. Der bis 1891 als Bundesrat amtierende Emil Welti war ein entschiedener Gegner der Vorlage und rief wenige Tage vor der Volksabstimmung in einer Rede zur Ablehnung auf:
«Wenn man die Eidgenossenschaft schwächen will, dann gibt es allerdings kein besseres Mittel, als die vorgeschlagene Initiative, eine Einrichtung, von der man zum vornherein weiss, dass man die Finanzen des Bundes damit auf Jahre hinaus aus dem Gleichgewicht bringt; […]» (Welti, zit. in: Weber, 1903, S. 155).
Die Initiative wurde im November 1894 von einer Mehrheit der Stimmenden und der Stände deutlich verworfen. Allerdings trug sie dazu bei, dass der Bund den Kantonen immer häufiger zweckgebundene Subventionen gewährte – genau das Gegenteil dessen, was die Initianten bezwecken wollten. Das Subventionswesen wurde als Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen institutionalisiert, somit war eine wichtige finanzpolitische Weiche gestellt. Subventionen entwickelten sich vor dem Ersten Weltkrieg zu einem wichtigen Instrument der Wirtschafts- und Sozialpolitik und es wurde die Grundlage für ein weitverzweigtes Bezuschussungssystem geschaffen: Der Anteil der Subventionen an den Bundesausgaben stieg von 5 Prozent (1870) auf beinahe 25 Prozent (1910). Indem der Bund den Kantonen Vorschriften bei deren Verwendung machte, trugen die Subventionen massgeblich zu einer kompetenzmässigen Zentralisierung bei. Dabei wurde der Bund zum finanziellen Unterstützer der Kantone, die immer mehr in eine finanzielle Abhängigkeit gerieten, wovor der Berner Finanzwissenschaftler Viktor Jacob Steiger bereits 1923 warnte:
«Die finanzrechtliche Abhängigkeit der Gliedstaaten vom Zentralstaat ist denn auch in der Schweiz besonders gross. Die Kantone haben die eigentliche Verwaltung der öffentlichen Aufgaben zu besorgen, sind aber in ihrer Durchführung vielfach zur Anwendung eidgenössischer Grundsätze verpflichtet, die von ihnen finanziell mehr verlangen als ihre eigenen früheren Grundsätze. Der Bund hat aber dafür zu sorgen, dass sie ihren Aufgaben gehörig nachkommen; er hat sie denn auch, sowie ihre finanziellen Kräfte nicht ausreichen, mit Beiträgen zu unterstützen.» (Steiger, 1923, S. 9)
Der stetig wachsende Strom an Transferzahlungen an die Kantone führte zu einer strukturellen Überlastung des Bundeshaushalts, dessen Budgetausgleich am Vorabend des Ersten Weltkriegs nicht mehr gesichert war.7 Im Mai 1912 fragte die NZZ ihre Leser auf dem Titelblatt:
«Glaubt der Bundesrat wirklich, es werde möglich sein, mit den blossen Zolleinnahmen, […], noch jahrelang den sich stets mehrenden Aufgaben des Bundes nachkommen zu können? […]. Hier müssen wir einmal den Optimismus unserer Finanzverwaltung bewundern. Kündigen sich nicht längst schon grosse Aufgaben des Bundes an, hört man die Rufe der Kantone nach weiterer Unterstützung nicht?» (NZZ, 07.05.1912)
Es wurden erste Massnahmen in Angriff genommen, wobei sowohl die Beschaffung von neuen Einnahmen als auch ein Abbau der Subventionen zur Diskussion stand. Als dann aber der Erste Weltkrieg ausbrach, stand der Bund umgehend vor einer finanzpolitischen Herausforderung, die schnell ein zuvor unvorstellbares Ausmass annahm.
Verstaatlichung der Eisenbahn
Ein weiterer finanzpolitischer Meilenstein vor dem Ersten Weltkrieg war die Verstaatlichung der Eisenbahnen im Jahr 1898. Mit dem Eisenbahngesetz von 1852 fiel der Entscheid zugunsten des Privatbahnsystems – ein Jahrhundertentscheid, der die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufschwung der Schweiz legte. Dank den privaten Bahngesellschaften holte die Schweiz den infrastrukturellen Rückstand gegenüber den Nachbarstaaten schnell auf und verfügte bereits um 1860 über das dichteste Bahnnetz Europas.8 Unternehmensbankrotte sowie Konflikte über Tariffragen und die Koordination von Fahrplänen führten dazu, dass der Bund zu einer Interventionspolitik überging und die Forderung nach einer Verstaatlichung trotzdem immer mehr Anhänger fand. Unternehmensbankrotte sowie Konflikte über Tariffragen und die Koordination von Fahrplänen führten dazu, dass der Bund zu einer Interventionspolitik überging und die Forderung nach einer Verstaatlichung trotzdem immer mehr Anhänger fand.9 Allerdings war der Rückkauf insbesondere auch aus finanziellen Gründen politisch stark umstritten. Der Bundesrat zeigte sich überzeugt, die Bahnschulden innert 60 Jahren abbezahlen zu können. Dies wurde von den Gegnern, zu denen auch der Neuenburger FDP-Altbundesrat Numa Droz gehörte, bezweifelt: «Man sagt dem Volk: Die Schweizerbahnen dem Schweizer! Wir antworten: Ja, aber als Folge auch die Schweizerschuld dem Schweizervolk!»10 Zu diesem Zeitpunkt war die Stimmung bereits deutlich zugunsten der Verstaatlichung umgeschlagen und eine grosse Mehrheit stimmte dem Rückkauf zu. Der Berner Professor Jakob Steiger bezeichnete die Eisenbahnverstaatlichung als die «bedeutsamste finanzpolitische Transaktion» des Bundes vor dem Ersten Weltkrieg: Die mit den Bahnen übernommenen Schulden in der Höhe von 1.2 Mrd. Franken waren mehr als zehnmal so gross wie jene des Bundes.11 Allerdings ging der Plan des Bundesrats nicht auf. Die Schulden der SBB stiegen während des Ersten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise markant an. Dies war nur zum Teil krisenbedingt. Vielmehr wurden die SBB vom Bund als «direktes oder indirektes Subventionswerkzeug» genutzt, wie es der Waadtländer Bundesrat und Verkehrsminister Marcel Pilet-Golaz trefflich formulierte.12 So mussten die Bundesbahnen nicht zuletzt, weil sie dem Bund die Möglichkeit für eine Flucht aus dem Budget boten, am Ende des Zweiten Weltkriegs zum zweiten Mal «zurückgekauft» werden, indem der Bund in grossem Umfang SBB-Schulden übernahm.
Fiskalschock Erster Weltkrieg
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs bereitete der verhältnismässig ruhigen Entwicklung des Bundeshaushalts ein jähes Ende und es begann eine neue Phase in der Schweizer Finanzpolitik. Die Ausgaben stiegen sprunghaft an, die Einnahmequellen wurden ausgebaut und die schuldenfreie Zeit war zu Ende. Auf diese Entwicklung war der Bund nicht vorbereitet. Zwar hatte sich ein bewaffneter Konflikt in Europa schon längere Zeit abgezeichnet, allerdings war der Bundesrat entsprechend einer weitverbreiteten Meinung der Überzeugung, dass ein Krieg nur von kurzer Dauer sein würde.13 Die Kriegsreserve, die nach Kriegsausbruch aus den Gewölben des Bundeshauses zur Nationalbank geschafft wurde, betrug gerade mal 10 Mio. Franken.14 Dies stand in keinem Verhältnis zu den Ausgaben, die unmittelbar in die Höhe schnellten. Bereits in den ersten Kriegsmonaten des Jahres 1914 verdoppelte sich die Staatsquote (→ Abb. 1). Gleichzeitig brachen die Zolleinnahmen ein. Ihr Anteil an den Bundeseinnahmen sank von 81 (1913) auf 13 Prozent (1918) (→ Abb. 3).
Die notwendigen Mittel verschaffte sich der Bund zunächst über Anleihen. Zudem griff er in grossem Umfang auf monetäre Staatsfinanzierung durch die SNB zurück, die sich als «Kriegsbank des Bundes» bezeichnete.15 Die monetäre Staatsfinanzierung trug massgeblich zu einer hohen Inflation bei, welche die Konsumentenpreise bis Kriegsende verdoppelte. Im Februar 1915 legte der Bundesrat dann eine Vorlage zur Erhebung einer einmaligen eidgenössischen Kriegssteuer16 vor. Die Kriegssteuer war populär und wurde von allen Parteien getragen. Für die NZZ war ihre Einführung eine Frage der Ehre der Nation:
«Schon weiss die Mehrheit der Schweizerbürger, dass sie auf den weissen Zettel ein ‹Ja› schreiben wird; und eine Minderheit, die sich vor einer mehr als sechshundertjährigen Geschichte an den Pranger stellen will, wird das schmählichste ‹Nein› hinsetzen, dass jemals in eidgenössische Urnen gefallen ist – denn jedes ‹Nein› kommt einem Schuss in den Rücken unserer Armee gleich.» (NZZ, 01.06.1915)
Die Zustimmung war ausserordentlich hoch: Im Juni stimmten alle Stände und über 94 Prozent der Stimmenden der ersten Kriegssteuer zu. Damit wurde der bisher befolgte Grundsatz gebrochen, der die direkten Steuern den Kantonen und die indirekten dem Bund zuwies. Die Kriegssteuer wurde 1916/17 durch die Kantone erhoben, wofür ihnen ein Anteil von 20 Prozent des Ertrags gewährt wurde. Der Kantonsanteil war einerseits eine Provision für die Steuererhebung. Andererseits war er als Entschädigung für den Eingriff in das kantonale Steuersubstrat durch den Bund gedacht, wie es der Aargauer FDP-Ständerat Emil Isler ausführte:
«Der Umstand, dass der Bund durch diese einmalige Kriegssteuer das Recht der Erhebung direkter Steuern für sich beansprucht, während dies sonst das alleinige Recht der Kantone ist, legt es ihm nahe, die Verhältnisse der Kantone zu berücksichtigen und sie am Ertrag partizipieren zu lassen.» (Amtl. Bull. SR 1915, S. 11)
Im September 1916 machte der Bundesrat auf Empfehlung der Neutralitätskommission vom Notrecht Gebrauch und führte rückwirkend eine Kriegsgewinnsteuer (1915/20)17 ein. Wiederum wurde die Steuer durch die Kantone erhoben, die einen Ertragsanteil von 10 Prozent erhielten. Im Mai 1917 stimmten die Stimmbürger ausserdem der Einführung einer Stempelsteuer18 zu, die ab 1918 erhoben wurde. Die Stempelsteuer blieb die einzige dauerhafte verfassungsmässige Erweiterung der Bundeseinnahmen. Da diese Steuer zuvor im Kompetenzbereich der Kantone lag, erhielten sie wiederum einen Ertragsanteil von 20 Prozent. Damit gelang zwar eine Steigerung der Einnahmen, jedoch reichte es nicht aus, um hohe Rechnungsdefizite zu verhindern. Die Defizite beliefen sich während des Krieges auf durchschnittlich 2.6 Prozent des BIP (→ Abb. 4). Das ganze Ausmass des Fiskalschocks im Ersten Weltkrieg wird in Abbildung 5 deutlich. Dort ist die Schuldenquote des Bundes dargestellt, also seine Schulden im Verhältnis zum BIP. Allein in den ersten vier Kriegsmonaten des Jahres 1914 verdoppelte sich die Schuldenquote auf 6.1 Prozent und als der Krieg 1918 zu Ende war, lag sie bei 15.1 Prozent.
Abb. 5: Die Schulden des Bundes (1849–2018)
Quellen: Eigene Berechnungen. Schulden: 1849–1912: EFV, Staatsrechnung (entspr. Jahrgänge); 1913–1941: ESTV, Finanzen von Bund, Kantonen und Gemeinden (1944/45); 1942–1970: ESTV, Finanzen von Bund, Kantonen und Gemeinden (entsprechende Jahrgänge); 1971–1989: EFV; 1990–2018: EFV, Staatsrechnung (entspr. Jahrgänge); BIP: Stohr (2016); BFS (2019).
Weil die Vermögenden aus Sicht der SP zu wenig für die Finanzierung der Kriegskosten beitrugen, reichten sie eine Initiative für eine dauerhafte direkte Bundessteuer ein. Dies stiess in konservativen Kreisen auf erbitterten Widerstand. Einer der härtesten Gegner der direkten Bundessteuer war der Tessiner CVP-Bundesrat und Vorsteher des EFD, Giuseppe Motta. Er warf der SP vor, lediglich ihre politischen Ziele zu verfolgen, und sah in der direkten Bundessteuer eine Bedrohung für den Föderalismus: «Die direkte Bundessteuer würde mit Notwendigkeit zu einer vollständigen Vereinheitlichung der ganzen Steuergesetzgebung führen und damit zu einer Zerstörung des bundesstaatlichen Charakters der Schweiz.»19 Allerdings genoss die direkte Bundessteuer angesichts der sozialen Lage im fünften Kriegsjahr auch im bürgerlichen Lager Sympathie. Um eine dauerhafte direkte Bundessteuer zu verhindern, kündigte der Bundesrat schliesslich eine Wiederholung der Kriegssteuer an, um die Kriegsschulden zu tilgen. Dies überzeugte den Souverän. Die direkte Bundessteuer wurde im Juni 1918 von 54 Prozent der Stimmenden und von 14.5 Ständen abgelehnt. Im Mai 1919 stimmten beinahe zwei Drittel der Stimmenden und 23 Stände der «neuen ausserordentlichen Kriegssteuer»20 zu.21 Sie wurde zwischen 1921 und 1932 dreimal von den Kantonen erhoben, wofür diese einen Anteil von 20 Prozent erhielten. Damit war der Grundsatz, der die direkten Steuern den Kantonen vorbehielt, endgültig gebrochen. Gleichzeitig wurde damit eine Verbundeinnahme zwischen Bund und Kantonen geschaffen.
Der Versuch einer Rückkehr zu den Vorkriegsverhältnissen
Die beiden wichtigsten finanzpolitischen Aufgaben der Nachkriegsjahre war die Sicherstellung des Budgetausgleichs und die Organisation der Schuldentilgung. Beides war aus währungspolitischen Gründen notwendig. Der Bundesrat wollte die Goldkonvertibilität des Schweizer Frankens wiederherstellen, die bei Kriegsausbruch aufgehoben worden war, um die Goldreserven der SNB zu schützen.22 Die politischen Entscheidungsträger strebten die Wiederherstellung der Vorkriegsverhältnisse an, jedoch bereitete der Ausgleich des Bundeshaushalts Probleme. Die Ausgaben gingen nach Kriegsende nicht auf das Vorkriegsniveau zurück. Vielmehr hatte sich die Staatsquote dauerhaft nach oben verschoben (→ Abb. 1). Sie war von durchschnittlich 1.8 Prozent in den zehn Jahren vor Kriegsausbruch auf durchschnittlich 4.2 Prozent in der Nachkriegsdekade angestiegen. Es war der von Peacock und Wiseman beschriebene «Sperrklinkeneffekt» eingetreten.23 Die ausserordentlichen Kriegsausgaben liessen sich nur langsam abbauen und zudem führten die sozialen Spannungen nach Kriegsende dazu, dass der Bund seine Ausgaben für die Verbilligung der Lebenshaltung stark erhöhte. Als die Schweiz dann in eine Rezession («Nachkriegskrise» 1921/23) geriet, ergriff der Bund Massnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Unterstützung von verschiedenen Wirtschaftszweigen. Ausserdem waren die Ausgaben für die Verzinsung und Tilgung bedingt durch die Kriegsschulden stark angestiegen. Ihr Anteil an den Ausgaben der Verwaltungsrechnung war von 4.1 (1913) auf 36.6 Prozent (1923) gestiegen.
Um den Haushaltsausgleich sicherzustellen, wurden unter der Leitung des Katholisch-Konservativen Vorstehers des Finanzdepartements, dem Freiburger Jean-Marie Musy, ab 1920 in mehreren Konferenzen unterschiedliche Steuerprojekte diskutiert. Allerdings scheiterte deren Umsetzung am Widerstand der Interessengruppen. Mittlerweile hatte sich die soziale Aufbruchstimmung, die nach Kriegsende herrschte, gelegt und die politischen Kämpfe wurden wieder mit mehr Härte geführt. Da die Wiederholung der Kriegssteuer beschlossen war, strebten die Bürgerlichen die Beibehaltung der bisherigen Ordnung an, was die Beschränkung des Bundes auf Zölle bedeutete. Die einzige Ausnahme bildete die 1921 eingeführte Couponsteuer. Im selben Jahr hiess die Bundesversammlung einen dringlichen Bundesbeschluss für einen neuen Zolltarif gut, mit dem die fiskalische Belastung der Importe an die Teuerung angepasst und wieder auf Vorkriegsniveau angehoben wurde. Die SP versuchte mit einer Volksinitiative die Aufhebung des Zolltarifs und das Verbot der Anwendung der Dringlichkeitsklausel in Zollfragen zu erwirken, scheiterte aber klar am Widerstand der Stimmbürger und der Kantone.
Auch im Rahmen der Einführung der AHV, die eines der vordringlichsten politischen Themen in der Nachkriegszeit war, machte sich der wachsende Steuerwiderstand bemerkbar. Während die Forderung nach sozialer Sicherheit durch den Staat politisch breit abgestützt war, war die Frage nach deren Finanzierung äusserst umstritten. Insbesondere eine Bundeserbschaftsteuer wurde aufgrund des Widerstands der Kantone, in deren Kompetenz die Erbschaftsteuern lagen, letztlich fallengelassen. Angesichts des schleppenden Verlaufs des Projekts wurden zwei Volksinitiativen zur Beschleunigung ergriffen. Jedoch wurde die Forderung der SP nach einer einmaligen, stark progressiven Vermögensabgabe zugunsten der AHV 1922 ebenso an der Urne abgelehnt wie 1925 der Vorschlag des freisinnigen Basler Nationalrats Christian Rothenberger, der 250 Mio. Franken vom Ertrag der Kriegsgewinnsteuer für die Sozialversicherung verwenden wollte. Als das Stimmvolk den Bund im Dezember 1925 zur Einführung der AHV verpflichtete, wurde schliesslich die Tabaksteuer sowie der Bundesanteil aus der künftigen fiskalischen Belastung gebrannter Wasser für ihre Finanzierung zweckgebunden. Allerdings blieb dies zunächst ohne direkte finanzielle Konsequenzen für den Bund, da das AHV-Gesetz erst 1948 in Kraft trat.
Mit der Hilfe des konjunkturellen Aufschwungs wurde 1927 der Haushaltsausgleich erreicht. Insbesondere die Zolleinnahmen waren angestiegen und wurden mit einem Anteil von rund 50 Prozent wieder zur wichtigsten Einnahmequelle des Bundes (→ Abb. 3). Aber auch die neue Kriegssteuer hatte sich zu einer tragenden Säule des Haushalts entwickelt. Zwar wurde sie vordergründig für die Tilgung der Schulden verwendet, da aber der ordentliche Haushalt gleichzeitig ein Defizit im gleichen Umfang verzeichnete, blieb der nominelle Schuldenstand stabil. Am 9. Oktober 1933 erklärte der freisinnige Solothurner Ständerat Hugo Dietschi im Parlament:
«Das System, die Schulden nur buchmässig abzuschreiben und nicht tatsächlich auch durch Rückzahlungen zu tilgen, war vom Standpunkt eines soliden und sichern Finanzgebahrens aus nicht unbedenklich, denn es führte dazu, die für die Tilgung bestimmten Mittel für anderweitige Zwecke zu verwenden.» (Amtl. Bull. SR 1933 III 269)
1927 stellte Bundesrat Jean-Marie Musy einen neuen Tilgungsplan auf, der den Abbau der gesamten Bundesschulden über 40 Jahre zum Ziel hatte. Dazu sollte neben den restlichen Einnahmen aus der neuen Kriegssteuer die aus dem Schuldenrückgang resultierenden Zinseinsparungen verwendet werden. Damit gelang es, die Bundesschulden bis 1932 um rund 200 Mio. Franken zu senken. Allerdings war der Rückgang der Schuldenquote von 23.1 auf 19.3 Prozent nach 1921 hauptsächlich auf das wirtschaftliche Wachstum zurückzuführen (→ Abb. 5).
Weltwirtschaftskrise: Die Finanzpolitik im Dienst der Währungspolitik
Nachdem der Ausgleich des Bundeshaushalts gelang und die Schuldentilgung eingeleitet wurde, bahnte sich mit dem Ausbruch der Grossen Depression im Oktober 1929 bereits die nächste finanzpolitische Herausforderung an. Während der Weltwirtschaftskrise wurde der finanzpolitische Handlungsspielraum massgeblich von der Währungspolitik bestimmt. Jean-Marie Musy wollte Defizite um jeden Preis verhindern, da sie die Stabilität des Frankens gefährdet hätten. Er setzte auf finanzpolitische Kontinuität und erklärte einen ausgeglichenen Bundeshaushalt zur obersten Priorität. 1932 hielt er in einer Denkschrift Folgendes fest:
«La situation brusquement ébranlée de nos finances publiques oblige aussi toutes nos administration fédérales, cantonales et communales à adopter courageusement un sévère régime d’économies. L’équilibre des finances fédérales rétabli au prix des plus durs sacrifices est de nouveau menacé. Et cependant il faudra poursuivre l’amortissement progressif de la dette publique, héritage de la guerre, sans retomber dans les déficits. Tâche rendue bien difficile par le brusque recul des recettes souvenant à l’heure où la crise impose d’inévitables nouvelles dépenses. Douloureuse mais fatale coïncidence!» (Musy, 1932, S. 28)
Nachdem Grossbritannien (1931) und die USA (1933) den Goldstandard verliessen und ihre Währungen abwerteten, hatte die Schweiz mit einem überbewerteten Franken zu kämpfen. Sie schloss sich 1933 mit Frankreich und vier weiteren Ländern zum «Goldblock» zusammen und hielt bis 1936 an der Goldparität fest. Anstelle einer Währungsabwertung versuchte der Bundesrat, die Wiederherstellung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit zunächst über eine Deflationspolitik («Anpassungspolitik») zu erreichen.24 Allerdings stellte sich das Stimmvolk 1933 gegen den Plan, die Löhne der Bundesangestellten um 15 Prozent zu senken. Dies veranlasste den Bundesrat dazu, sich auf das Fiskalnotrecht zu berufen. Noch im selben Jahr veröffentlichte er ein Finanzprogramm, dem das Parlament nach einer kontroversen Debatte über die Anwendung des Notrechts zustimmte. Auch das zweite Finanzprogramm von 1936, mit dem die Massnahmen verlängert und verschärft wurden, war dem Referendum entzogen. Dies machte beide Programme in den Augen des Finanzwissenschaftlers Eugen Grossmann von der Universität Zürich zu «höchst problematischen Rechtsgebilden».25
Der Schwerpunkt der Finanzprogramme lag auf der Einnahmenseite. 1934 wurde die Krisenabgabe26 als neue direkte Bundessteuer eingeführt. Der Bund hat den Kantonen diesen abermaligen Eingriff in ihre Steuerhoheit mit einem Ertragsanteil von 40 Prozent abgegolten, was mit der schlechten Lage der Kantonsfinanzen begründet wurde. Jean-Marie Musy hatte zunächst einen Anteil von einem Drittel vorgeschlagen, konnte sich aber nicht gegen das Parlament durchsetzen. Mit dem Verweis auf die steigenden Anteile der Kantone an den direkten Bundessteuern meinte er schlicht: «On dit que l‘appétit vient en mangeant.»27 Mit dem Finanzprogramm von 1933 wurde auch die Tabaksteuer eingeführt und die fiskalische Belastung gebrannter Wasser ausgedehnt. Zudem wurde bestimmt, dass beide Einnahmequellen, deren Ertrag verfassungsmässig für die AHV reserviert war, in den ordentlichen Haushalt fliessen sollen. Ausgabenseitig sah das Finanzprogramm eine Senkung der Löhne des Bundespersonals um 7 Prozent und der Subventionen um 20 Prozent vor. Ferner wurde die Verzinsung verschiedener Fonds eingestellt.
Trotzdem blieb der Deflationskurs moderat – gerade auch im Vergleich zum verhängnisvollen Austeritätskurs in Deutschland von 1931 und 1932 unter Reichskanzler Heinrich Brüning. Das stimmt insbesondere für die Ausgabenseite. Angesichts steigender Arbeitslosenzahlen begann der Bund in den frühen 1930er-Jahren zunehmend Ausgaben für die Krisenbekämpfung zu tätigen. Dazu gehörte an erster Stelle die Arbeitslosenführsorge, aber auch die Unterstützung der Bauern mittels umfangreicher Subventionen. Daneben förderte der Bund – wie bereits in der Nachkriegskrise – einzelne krisenbetroffene Industrien direkt, darunter die Uhren- und Textilindustrie und die Hotellerie. Zur Förderung des Exports wurde die Exportrisikogarantie eingeführt. Ausserdem griff der Bund zum Schutz der Exportindustrie und des Binnenmarktes stark in die Handels- und Gewerbefreiheit ein. Dabei wurde der Import beschränkt, um bei den Handelspartnern Exportkontingente zu erwirken. Dies wurde von einer Reihe von Massnahmen zur Wettbewerbsbeschränkung auf dem Binnenmarkt begleitet.
Trotz der krisenbedingten Mehrausgaben gelang es, die Rechnung des Bundes ausgeglichen zu halten. Einzig in den Jahren 1933 und 1934 wurden Rechnungsdefizite verzeichnet, die in ihrem Umfang 0.1 Prozent des BIP nicht überstiegen (→ Abb. 4). Die nominelle Verschuldung blieb weitgehend stabil. Allerdings führte der Rückgang der Wirtschaftsleistung zu einem Anstieg der Schuldenquote von 19.6 (1930) auf 29.4 Prozent (1936), die damit einen neuen, vorläufigen Höchststand erreichte (→ Abb. 5). Die erste Fiskalregel auf Bundesebene, die mit dem Finanzprogramm von 1933 eingeführt worden war, hatte allerdings nichts zur Haushaltsstabilisierung beigetragen. Die Deckungsklausel sah vor, dass neue Ausgaben durch vorhandene oder neu beschaffte Mittel gedeckt sein müssen, blieb in der Praxis aber wirkungslos. Dazu der Zürcher FDP-Bundesrat und Finanzvorsteher Albert Meyer, der 1934 die Nachfolge von Jean-Mary Musy antrat: «Man konnte nicht für jeden verhältnismässig kleinen Posten gleich eine Steuer vorsehen. Man würde uns wohl den Vorwurf gemacht haben, wir dekretierten Einnahmen ins Blaue hinaus.»28
Während der Budgetausgleich sichergestellt werden konnte, zeigte die Anpassungspolitik wenig Erfolg. Sie erwies sich in Anbetracht steigender Arbeitslosenzahlen und stagnierender Wirtschaftsleistung als untaugliches Mittel, um die Schweizer Wirtschaft wieder konkurrenzfähig zu machen. Die Preise blieben zu hoch – wofür nicht zuletzt auch die Ausgaben für die Krisenbekämpfung und die verschiedenen behördlichen Stützungsmassnahmen verantwortlich waren. Der Widerstand gegen die Anpassungspolitik wuchs. Der Gewerkschaftsbund wollte den Bund mit der «Kriseninitiative» 1934 zu einer aktiveren Konjunkturpolitik verpflichten. Allerdings scheiterte die Vorlage in der Volksabstimmung vom Juni 1935. Trotzdem setzte sich angesichts der steigenden Kosten und der geringen Wirkung der bundesrätlichen Wirtschaftspolitik je länger, je mehr auch im bürgerlichen Lager die Einsicht durch, dass man in eine Sackgasse geraten war. Als Frankreich der Schweiz mitteilte, dass eine Abwertung des Francs unmittelbar bevorsteht, tat es ihm die Schweiz nach und beschloss am 26. September 1936, den Franken um 30 Prozent abzuwerten.
Damit war der Weg für einen finanzpolitischen Kompromiss aus währungspolitischer Perspektive frei. Unter dem Eindruck des «Anschlusses» Österreichs an Deutschland konnten sich die Bürgerlichen und die Sozialdemokraten auf die Verknüpfung von Arbeitsbeschaffungsmassnahmen mit dem Ausbau der Landesverteidigung einigen. Die Programme wurden teilweise durch eine Ausgleichssteuer29 und mit einem Teil des Abwertungsgewinns der SNB finanziert. Diese Vorlage fand im Juni 1939 breite Zustimmung bei Volk und Ständen. Als der Bundesrat schliesslich 1938 eine Bundesfinanzordnungsvorlage präsentierte, fielen die Reaktionen negativ aus. Zwar wollte der Bundesrat zum Trennsystem zurückkehren und eine verfassungsmässige Grundlage für die Kriegssteuern schaffen. Weil damit der Budgetausgleich aber nicht erreicht werden konnte, erschien die Vorlage vielen Parlamentariern als Stückwerk, was massgeblich dazu beitrug, dass sie bereits im Nationalrat scheiterte. Als der Bundesrat darauf das Notrecht verlängern wollte, gelang den grossen Parteien die Einigung auf eine Übergangsfinanzordnung, mit der die Krisenabgabe an die Landesverteidigung gebunden und die Beiträge an die AHV wieder erhöht wurden. Dazu sagten Volk und Stände im November 1938 deutlich Ja.
Der Zweite Weltkrieg: Weichenstellung für die Bundesfinanzordnung
Der Zweite Weltkrieg war erneut ein Wendepunkt in der Bundesfinanzpolitik. Aus finanzpolitischer Sicht hatte man wichtige Lehren aus dem Ersten Weltkrieg gezogen. Der Bundesrat nahm den Ausbau des Steuersystems entschlossener in die Hand. Dabei griff er in grossem Umfang auf seine Vollmachten zurück. Noch während am Kriegsfinanzprogramm gearbeitet wurde, führte der Bundesrat eine Kriegsgewinnsteuer30 (1940) ein. Als sich die politische Lage zuspitzte, wurde auch der Rest des Programms per Vollmachtenbeschluss in Kraft gesetzt. Dazu gehörte die Wehrsteuer31 (1940) als Nachfolgerin der Krisenabgabe mit einem Kantonsanteil von 30 Prozent, das Wehropfer32 (1940), bei dessen Einführung erstmals eine Steueramnestie gewährt wurde, die Warenumsatzsteuer33 (1941) und der Auswandererwehrbeitrag34 (1941). Schon 1942 beschloss der Bundesrat ein zweites Kriegsfinanzprogramm, mit dem die Massnahmen des ersten verschärft wurden: Die Wehrsteuer und die Warenumsatzsteuer wurden erhöht und das Wehropfer (1945/47) wiederholt. Zudem wurde die Warenumsatzsteuer durch die Luxussteuer35 ergänzt. Der Bundesrat beschloss ausserdem die Einführung der Verrechnungssteuer36 (1944), deren Einführung ebenfalls von einer Steueramnestie begleitet wurde. Nach dem Krieg sollte sich zeigen, dass damit die Weichen für die Bundesfinanzordnung gestellt waren.
Im Unterschied zum Ersten Weltkrieg unternahm der Bundesrat früh wichtige Schritte, um die soziale Sicherheit auszubauen. Damit sollten soziale Spannungen, wie sie die Schweiz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erlebt hatte, möglichst vermieden werden. Für die «wirtschaftliche Landesverteidigung» wurden während des Zweiten Weltkriegs rund 1.5 Mrd. Franken ausgegeben. Dies war im Verhältnis zu den Ausgaben für die militärische Landesverteidigung, die bei rund 7 Mrd. Franken lagen, eine hohe Summe. Eine zentrale Massnahme war die Einführung der Lohnausfallsentschädigung für Aktivdienstleistende im Jahr 1939, die ein Jahr später zur Lohn- und Verdienstersatzordnung (LVEO) ausgebaut wurde. Sie sollte zur Grundlage für die 1948 eingeführte AHV werden.
Die Ausgaben des Bundes stiegen während des Zweiten Weltkriegs auf rund 20 Prozent des BIP und stellten damit jene des Ersten Weltkriegs in den Schatten (→ Abb. 1). Obschon der Bund besser auf den Krieg vorbereitet war und der Ausbau des Steuersystems entschlossener umgesetzt wurde, konnten hohe Defizite nicht verhindert werden. Sie waren mit durchschnittlich 7.2 Prozent des BIP mehr als doppelt so hoch wie während des Ersten Weltkriegs (→ Abb. 4). Die Folge war ein gewaltiger Anstieg der Staatsverschuldung: Mit 65.4 Prozent erreichte die Schuldenquote 1945 ihren historischen Höchststand (→ Abb. 5). Die Defizite deckte der Bund durch Anleihen – auch diesbezüglich hatte man wichtige Lehren aus dem Ersten Weltkrieg gezogen. Der Verzicht auf die monetäre Staatsfinanzierung in Kombination mit einer strengen Preiskontrolle trug dazu bei, dass die Teuerung mit rund 50 Prozent nur rund halb so hoch ausfiel wie im Ersten Weltkrieg.
Nach dem Kriegsende: eine Grundsatzdebatte über die Bundesfinanzordnung
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehörte die Neuordnung der Bundesfinanzen zur vordringlichsten finanzpolitischen Aufgabe. Noch bevor die neue Bundesfinanzordnung ausgearbeitet war, wurde 1947 mit den «Wirtschaftsartikeln» eine neue verfassungsmässige Grundlage für die Wirtschaftspolitik des Bundes geschaffen. Beeinflusst von den Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise und den Ideen von John Meynard Keynes wurde die Finanzpolitik in den Dienst der Konjunkturpolitik gestellt und der Bund zur Krisenvorsorge und Krisenbekämpfung verpflichtet. Derweil erwies sich die Neuordnung der Bundesfinanzen bald als langwieriger und mühsamer Prozess – schon 1949 meinte der SP-Bundesrat und seit 1944 amtende Finanzvorsteher Ernst Nobs: «Hat es jemals in der Geschichte des schweizerischen Parlamentarismus und des schweizerischen Referendums eine Lage gegeben, die so ausweglos erschienen wäre wie die Lage der Neuordnung des Finanzhaushaltes?»37 Zu den zentralen Fragen gehörte die Aufgaben- und Einnahmenverteilung zwischen Bund und Kantonen und dabei insbesondere die Frage nach einer direkten Bundessteuer. Von einer Trennung der Aufgaben wurde abgesehen, da Bund und Kantone nicht «Gegensätze und Konkurrenten», sondern «Mitarbeiter am gemeinsamen Ganzen» seien.38 Zudem stellte der Bundesrat die Schuldentilgung über die föderalistischen Bedenken gegen eine direkte Bundessteuer und schlug die Erhebung einer Tilgungssteuer für sechzig Jahre vor. Dies stiess insbesondere bei den Konservativen auf Widerstand:
«Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Bundesfinanzreform die letzte Chance für eine Aufhebung der direkten Bundessteuer bietet. Wird diese Gelegenheit verpasst, dann muss mit der Verewigung der Bundeseinkommens- und -vermögenssteuer […] gerechnet werden.» (Schweizerische Konservative Volkspartei, 1947, S. 26)
Der Ständerat pochte auf einer Lösung ohne direkte Bundessteuer und setzte stattdessen die Erhebung von kantonalen Geldkontingenten durch. Jedoch wurde diese Lösung 1950 an der Urne deutlich abgelehnt. Die zweite Vorlage von 1953 stammte aus der Feder des sozialdemokratischen Finanzvorstehers Max Weber, dem Nachfolger von Ernst Nobs. Er erklärte Wehrsteuer und Warenumsatzsteuer zu «siamesischen Zwillingen», die untrennbar vereint gleichbehandelt werden müssen. Er legte für beide Steuern Höchstsätze fest, um Erhöhungen der direktdemokratischen Kontrolle zu unterstellen. Ausserdem beschränkte er die Erhebung der beiden Steuern auf zwanzig Jahre, was später im Parlament auf zwölf Jahre gesenkt wurde. Trotz der Unterstützung von allen Landesparteien, den Gewerkschaften und dem Bauernverband brachten bürgerliche Kantonalparteien zusammen mit dem Handels- und Industrieverein («Vorort»), dem Gewerbeverband und den Arbeitgeberorganisationen die Finanzordnung in der Volksabstimmung vom Dezember 1953 zu Fall, die sie insbesondere wegen der Wehrsteuerprogression und des vorgesehenen Höchstsatzes bekämpften. Dies bewog Max Weber zum Rücktritt aus dem Bundesrat und seine Partei zum Gang in die Opposition. In seinem Rücktrittsschreiben hielt Weber fest:
«Nachdem es der vereinigten Opposition von Industrie, Gewerbe, Föderalisten und PdA mit den skrupellosesten Mitteln gelungen ist, die gut ausgewogene und als Werk der Verständigung zustandegekommene Bundesfinanzvorlage zu verwerfen, werde ich morgen dem Bundesrat meine Demission bekanntgeben.» (Weber, zit. in: Schmid, 1953, S. 273)
Die dritte Bundesfinanzordnungsvorlage von 1957 wurde unter Webers Nachfolger, dem Zürcher FDP-Bundesrat Hans Streuli, ausgearbeitet. Nachdem es bereits 1955 politisch breit abgestützte Steuersenkungen bei den immer noch auf bundesrätlichen Vollmachten fussenden beiden Hauptsteuern gegeben hatte, senkte Streuli die Wehrsteuer und Warenumsatzsteuer erneut und begrenzte sie auf zwölf Jahre. Der Kantonsanteil an der Wehrsteuer wurde auf 30 Prozent festgesetzt. Das Parlament senkte die Steuerbelastung der Wehrsteuer und der Warenumsatzsteuer nochmals und baute die Freiliste der Warenumsatzsteuer aus. Zudem halbierte es die zeitliche Begrenzung der beiden Steuern auf sechs Jahre. In dieser Form wurde die Vorlage von den bürgerlichen Parteien und den Wirtschaftsverbänden unterstützt. Die SP hingegen warnte, dass dem Bund nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen werden. Ähnlich argumentierte auch der Gewerkschaftsbund:
«Lasst Euch durch die Verlockungen eines Steuerabbaues, der Euch wenig einbringt, nicht dazu verführen, eine Finanzordnung anzunehmen, die den Bund unweigerlich in die Schuldenwirtschaft treibt. Diese Finanzvorlage verfolgt das doppelte Ziel, die grossen Einkommen und Vermögen zu begünstigen und zugleich den Bund finanziell kurzzuhalten. Der soziale Ausbau unseres Bundesstaates ist dadurch gefährdet, […].» (Gewerkschaftsbund, 1958, S. 98)
Trotz des Widerstands der Linken wurde die Bundesfinanzordnung in der Volksabstimmung vom Mai 1958 im dritten Anlauf nun doch noch angenommen. Bei ihrer ersten Verlängerung 1963 wurde die Wehrsteuer weiter abgebaut, wozu nun auch die Sozialdemokraten zustimmten, da sich ihre Befürchtungen einer Schuldenwirtschaft – nicht zuletzt dank des hohen Wirtschaftswachstums – nicht bewahrheitet hatten.
Bis zur Annahme der neuen Finanzordnung an der Urne griff der Bund zweimal auf Übergangsordnungen (1951/54 und 1955/58) zurück. Diese führten die Wehrsteuer und die Warenumsatzsteuer weiter, sodass der Bundeshaushalt bereits im ersten Nachkriegsjahr einen Budgetüberschuss verzeichnete (→ Abb. 4). Dabei entwickelte sich die Warenumsatzsteuer zum dritten Pfeiler der Bundesfinanzen. Der Anteil der Verbrauchsteuern lag nach Kriegsende bei rund einem Drittel. Die Zolleinnahmen schwollen dank des wirtschaftlichen Aufschwungs ebenfalls stark an, allerdings erreichten sie mit rund 20 Prozent anteilmässig nur noch rund die Hälfte des Vorkriegsniveaus. Der Anteil der Einkommensteuern an den Bundeseinnahmen ging nach dem Auslaufen der Kriegsgewinnsteuer (1939/46) und des Wehropfers (1945/47) sowie einem wiederholten Abbau der Wehrsteuer anteilmässig zurück von 19 Prozent (1950/51) auf 15 Prozent (1958/59) (→ Abb. 3).
Wie nach dem Ersten Weltkrieg wurden die höheren Einnahmen für neue Ausgaben verwendet und es trat ein Sperrklinkeneffekt ein: Die Staatsquote stieg von 4.4 Prozent in der Vorkriegsdekade auf 7.9 Prozent in der Nachkriegsdekade (→ Abb. 1). Als wichtigste neue Aufgabe wurde 1948 die AHV eingeführt. Sie trug massgeblich dazu bei, dass die Sozialausgaben anteilmässig um die Hälfte anstiegen: von 10 (1938) auf 15 Prozent (1950) (→ Abb. 2). Nach Kriegsende waren aber auch die im Rahmen der wirtschaftlichen Landesverteidigung eingeführten Sozialsubventionen erhöht worden. Sie sollten die Umstellung auf die Friedenswirtschaft erleichtern und wurden erst in den 1950er-Jahren wieder abgebaut. Angesichts des Kalten Krieges blieben die Verteidigungsausgaben der wichtigste Ausgabenposten des Bundes. Sie erfuhren einen moderaten Anstieg von 34 (1950) auf 37 Prozent (1960). Erneut wurden auch die Beiträge an die Landwirtschaft deutlich ausgebaut. Ihr Anteil an den Bundesausgaben stieg von 7 (1950) auf 13 Prozent (1960).
In Erwartung einer Krise ähnlich jener nach dem Ersten Weltkrieg verfolgte der Bund im Sinne der Krisenvorsorge eine zurückhaltende Ausgabenpolitik. Die Überschüsse wurden für die Schuldentilgung und einen Krisenfonds für Arbeitsbeschaffungsprojekte verwendet. Allerdings blieb die befürchtete Nachkriegskrise aus und die Schweiz erlebte eine Periode mit ausserordentlich starkem Wirtschaftswachstum, das bis zum Ausbruch der Rezession von 1974/76 anhielt. Dies hatte zur Folge, dass sich die finanzpolitischen Ziele weg von der Krisenvorsorge hin zur Konjunkturdämpfung verschoben. Zur Unterstützung der Geldpolitik hielt der Bund an der zurückhaltenden Ausgabenpolitik fest und verzichtete auf Investitionen, um einen Anstieg der Inflation zu verhindern. Aus demselben Grund ging der Bund auch dazu über, keine Schulden mehr zu tilgen und die Überschüsse stattdessen bei der Nationalbank zu sterilisieren (zinslos anzulegen). Dabei löste sich die Schuldenproblematik weitgehend von selbst, da es dank des Wirtschaftswachstums und der Inflation zu einem markanten Rückgang der Schuldenquote kam (→ Abb. 5).
Ausbau der Staatstätigkeit und Kampf gegen die Steuerhinterziehung
In den 1960er-Jahren geriet der Bund in einen wirtschaftspolitischen Zielkonflikt. Das anhaltend hohe Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum machte den in der vergangenen Dekade vernachlässigten Ausbau der Infrastruktur unumgänglich, obschon die antizyklische Wirtschaftspolitik angesichts steigender Wirtschaftsleistung mehr denn je ausgabenseitige Zurückhaltung geboten hätte. Angesichts der Herausforderungen, die sich im Rahmen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels stellten, schien eine Übertragung der Aufgaben an den Bund unumgänglich. Dank der guten Wirtschaftslage entwickelte sich die Einnahmensituation komfortabel, sodass neue Ausgaben kaum auf politischen Widerstand stiessen – dazu trug auch bei, dass der Bund die Durchführung der Aufgaben systematisch den Kantonen übertrug. Der Anteil der Übertragungen an öffentliche Haushalte an den Ausgaben des Bundes stieg zwischen 1960 und 1970 von 17.3 auf 31 Prozent.39
Dabei wurde die Staatstätigkeit mit grosser Geschwindigkeit vorangetrieben: Die Staatsquote stieg von 5.9 (1960) auf 7.6 Prozent (1973) – besonders gut sichtbar in Abbildung 6. Dieser Anstieg ging mit deutlichen Veränderungen in der Ausgabenstruktur des Bundes einher (→ Abb. 2). Zu den wichtigsten neuen Aufgaben gehörte der Aufbau des Nationalstrassennetzes, der gemäss dem Bundesrat «in grosszügiger Weise an die Hand genommen werden muss».40 In der Folge stieg der Anteil der Verkehrsausgaben an den Bundesausgaben von 1960 bis 1970 von 6 auf 16 Prozent. Auch bei den Sozialausgaben gab es einen hohen Nachholbedarf. In mehreren Schritten wurden die Altersrenten erhöht. Zusammen mit der Einführung der IV (1960) und den Ergänzungsleistungen (1966) führte dies im selben Zeitrahmen zu einem anteilmässigen Anstieg der sozialen Wohlfahrt von 17 auf 20 Prozent. Auch die Bildungsausgaben wurden ausgebaut. Ihr Anteil an den Bundesausgaben verdoppelte sich in den 1960er-Jahren beinahe von 4.3 auf 8.4 Prozent. Diese Entwicklung ging zulasten der Landesverteidigung, die einen Rückgang von 37 auf 26 Prozent verzeichnete.
Abb. 6: Die Ausgaben, die Einnahmen und die Wirtschaftsleistung (1849–2018)
Quellen: Eigene Berechnungen. Rechnungsabschlüsse: 1849–1912: BFS, Statistisches Jahrbuch 1935 (S. 326 f.); 1913–1954: EVF, Staatsrechnung 1955 (S. 44*); 1955–1989: EFV, Staatsrechnung 1990 (S. 102); 1990–2018: EFV Staatsrechnung (entspr. Jahrgänge). BIP: Stohr (2016); BFS (2019).
Mitte der 1960er-Jahre setzte eine Scherenbewegung bei Ausgaben und Einnahmen ein. Das Wachstum der Einnahmen stagnierte. Während die Erträge der Warenumsatzsteuer und die Wehrsteuer – insbesondere wegen der kalten Progression – konjunkturell bedingt weiter anstiegen, ging das Wachstum der Zolleinnahmen integrationsbedingt zurück (EFTA). Dahingegen wuchs die Staatsquote kontinuierlich an: «Nun wird das starke Anwachsen der Ausgaben gerne entschuldigt mit einem gewissen Nachholbedarf, aber vor allem mit der Entwicklung des Bruttosozialproduktes. […]. Der Anteil der Bundesausgaben an den Einkünften des gesamten Volkes wächst neuerdings rascher an. Diese Entwicklung dürfen wir nicht fatalistisch hinnehmen und erst recht nicht andauern lassen», stellte der Basler CVP-Nationalrat Josef Tschopp 1968 fest.41 Dies veranlasste den Bundesrat, die Finanzplanung auszubauen. Eine Expertenkommission unter der Leitung des St. Galler Finanzwissenschaftlers Walter Adolf Jöhr sagte dem Bund ab 1966 hohe Defizite voraus und empfahl die Beschaffung von neuen Einnahmen. Allerdings führte ein unerwarteter konjunktureller Aufschwung zum Budgetausgleich, woraufhin das Parlament das Massnahmenpaket verwarf. Trotzdem wurde die Finanzplanung 1968 als Daueraufgabe der Finanzpolitik institutionalisiert. Was allerdings nicht verhindern konnte, dass der Bundeshaushalt mit einer leichten Verzögerung ab 1971 in eine Defizitperiode fiel.
Haushaltskonsolidierung, Steuerharmonisierung und Aufgabentrennung
Mit Beginn der 1970er-Jahre hatte der Bund erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder mit schwerwiegenden fiskalischen Problemen zu kämpfen. Bereits 1973 schloss die Staatsrechnung mit einem für Friedenszeiten «alarmierenden Ausgabenüberschuss» ab, und als die Rezession von 1974/76 ausbrach, verschärfte sich die Situation deutlich.42 Bundesrat und Parlament versuchten den Haushalt in erster Linie durch die Beschaffung von neuen Einnahmen zu sanieren. Insbesondere die Verbrauchsteuern sollten erhöht werden, weil der Ertrag der direkten Steuern in den vergangenen Jahren wegen der kalten Progression überproportional angestiegen war (→ Abb. 3). Allerdings versagte der Souverän 1974 die Zustimmung zu einer Erhöhung der Wehrsteuer und lehnte 1977 und 1979 die Einführung der Mehrwertsteuer deutlich ab. Der Vorsteher des Finanzdepartements, der Waadtländer FDP-Bundesrat Georges-André Chevallaz, wechselte nach der dritten verlorenen Abstimmung das Departement und bedauerte, «[…] que le Conseil fédéral ne dispose pas, à l’occasion, des pleins pouvoirs qui lui ont permis, entre 1939 et 1945, de construire un système fiscal alors adéquat».43
Der Bundesrat reagierte auf die Abstimmungsniederlagen jeweils mit Sparpaketen – was den Souverän zumindest 1975 bewog, einer im Vergleich zu 1974 bescheideneren Wehrsteuererhöhung zuzustimmen. Jedoch liess sich das Ausgabenwachstum nicht bremsen, woran auch die 1975 vom Stimmvolk angenommene Ausgabenbremse nichts änderte. Zudem wurde die restriktive Finanzpolitik angesichts steigender Arbeitslosenzahlen wieder gelockert, als zwischen 1975 und 1976 drei Beschäftigungsprogramme mit einem Gesamtumfang von rund zwei Prozent des BIP lanciert werden mussten. Der Anstieg der Staatsquote wurde massgeblich von den Sozialausgaben verursacht. Ihr Anteil an den Bundesausgaben stieg von 17 (1970) auf 22 Prozent (1990), womit sie die Landesverteidigung als wichtigste Aufgaben ablösten (→ Abb. 2). Dieser Anstieg wäre noch viel grösser gewesen, wenn nicht Gastarbeiter als Konjunkturpuffer gedient hätten und damit die Arbeitslosigkeit «exportiert» werden konnte. Zudem wurde die obligatorische Arbeitslosenversicherung erst 1976 im Zuge der Krise eingeführt.44 Dennoch machte sich wie nach den Weltkriegen ein deutlicher Sperrklinkeneffekt bemerkbar: Die Staatsquote stieg von durchschnittlich 7 Prozent in den 1960er-Jahren auf 8.3 Prozent in den 1970er-Jahren (→ Abb. 1).
Der starke Ausbau der Transferzahlungen in den 1960er-Jahren hatte nicht nur den Bundeshaushalt aus dem Gleichgewicht gebracht, er provozierte auch eine Debatte über die gerechte Verteilung der Mittel unter den Kantonen sowie über die Rolle der Kantone im Rahmen der bundesstaatlichen Arbeitsteilung. Der Vollzugsföderalismus nahm in den 1960er-Jahren ein neues Ausmass an. Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen wurde immer mehr zu einem Grundsatzprinzip der öffentlichen Aufgabenerfüllung. Dabei übernahm der Bund Kompetenzen in Aufgabenbereichen, die gemäss dem Subsidiaritätsprinzip in die Zuständigkeit der Kantone gefallen wäre – etwa im Verkehr, in der Bildung und der Sozialpolitik. Um ihre Interessen dem Bund gegenüber durchsetzen zu können, begannen die Kantone die horizontale Zusammenarbeit auszuweiten, was gleichzeitig einen Harmonisierungsdruck brachte. Diese Entwicklung stiess im Verlauf der 1960er-Jahre eine Föderalismus-Diskussion an. Eine Expertenkommission unter dem Vorsitz des St. Galler CVP-Bundesrats Kurt Furgler kam zum Schluss, dass die «[…] Grundidee des schweizerischen Bundesstaates heute bedauerlicherweise in wesentlichen Teilen verschüttet […]» sei.45 Neben der Bürokratie und den Doppelspurigkeiten wurde insbesondere die Einschränkung des politischen Handlungsspielraums der Kantone sowie ihre wachsende finanzielle Abhängigkeit vom Bund bemängelt. Der SP-Bundesrat und Vorsteher des Finanzdepartements, Willi Ritschard, warnte in einer Rede im Jahr 1980:
«Die Folgen dieser Entwicklung zu einem Transferhaushalt sind: die Verschiebung der Verantwortlichkeiten; die Förderung der Illusion, der Bund könne das Geld für die vielen von ihm geförderten Werke beim Lieben Gott holen; die Gefahr der Überforderung, weil die Dinge zu weit weg sind vom Bürger und weil ein bedarfsgerechter und gezielter Einsatz der Mittel nicht immer gewährleistet ist.» (Ritschard, 1980, S. 4)
Um den Föderalismus zu revitalisieren, schien aus finanzpolitischer Sicht eine Verbesserung des Finanzausgleichs und eine Aufgabenentflechtung zwischen den Staatsebenen dringlich. Der von der Kommission Furgler erarbeitete Entwurf für die Verfassungsrevision scheiterte allerdings. Nicht zuletzt, weil der Bund angesichts der anhaltenden Defizitperiode eine Lastenverschiebung zu den Kantonen vorsah und weil viele Leistungsempfänger mit Einbussen rechneten, wurden die wichtigsten Massnahmen abgelehnt. Insbesondere konnten die oft von den Kantonen angestossenen Zentralisierungsvorhaben nicht gebremst werden.
Um mindestens den Finanzausgleich zu verbessern, sollte eine einheitliche Basis für die Messung der Finanzkraft der Kantone geschaffen werden, was durch die unterschiedlichen kantonalen Steuerordnungen massgeblich erschwert wurde. Aus diesem Grund sollten in einem ersten Schritt die kantonalen Steuern harmonisiert werden. Dabei war eine formelle Harmonisierung – beschränkt auf Steuerpflicht, Gegenstand und zeitliche Bemessung der Steuern sowie das Verfahrens- und Steuerstrafrecht – weitgehend unbestritten. Dahingegen lehnten das Stimmvolk und die Kantone eine materielle Harmonisierung, die eine gewisse Vereinheitlichung der Steuerbelastung zum Ziel hatte, in verschiedenen Ausprägungen ab. Nachdem eine Konkordatslösung für eine formelle Steuerharmonisierung gescheitert war, sagten das Stimmvolk und die Stände im Juni 1977 Ja zur Schaffung einer Bundeskompetenz. Nach langjähriger Arbeit verabschiedeten die Räte 1990 das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), womit der Bund den Kantonen erstmals Vorschriften über die Gestaltung ihrer Steuergesetze machte.
Die Haushaltskonsolidierung zeigte ab 1980 langsam Wirkung. Die Lage entspannte sich erst, als 1983 die wirtschaftliche Erholung einsetzte. Der konjunkturelle Aufschwung sorgte für steigende Einnahmen, wodurch der Finanzhaushalt ab 1986 wieder positive Rechnungsabschlüsse erzielte. Die Schuldenquote, die in den Defizitjahren von 10.4 (1971) auf 14.8 Prozent (1985) angestiegen war, sank dank des Wirtschaftswachstums und der Inflation bis 1990 wieder auf dem Stand von 1971 (→ Abb. 5). Allerdings wurden die strukturellen Probleme des Bundeshaushalts nur überdeckt. Anstelle einer Sanierung des Bundeshaushalts wurden die steigenden Einnahmen für neue Ausgaben verwendet, wodurch die Ausgabendynamik wieder stark zunahm. Gleichzeitig wurde die Wehrsteuerbelastung von Familien deutlich gesenkt, ohne dass die Einnahmeausfälle kompensiert wurden. Dies trug zur Verfestigung des Sockels des strukturellen Budgetdefizits bei.
Staatsschulden und finanzpolitische Reformwerke
Die 1990er- und 2000er-Jahre waren eine Schlüsselperiode in der Geschichte der Bundesfinanzen. Sie war von einer grossen finanzpolitischen Krise und tiefgreifenden strukturellen Reformen geprägt. Als 1991 eine dreijährige Rezession ausbrach, erlebte die Schweiz die grösste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die strukturellen Haushaltsprobleme rückten umgehend wieder in den Vordergrund. Nun waren sie auch im Vergleich zu den europäischen Nachbarn gravierend. Die Defizite nahmen mit bis zu 2 Prozent des BIP (1993) ein in Friedenszeiten nie erreichtes Ausmass an (→ Abb. 4). Die Folge war eine explodierende Staatsverschuldung: Die Schuldenquote stieg von 10.7 (1990) auf 25.6 Prozent (1998) (→ Abb. 5). Anders als während den 1970er-Jahren war die Krise durch eine hohe Arbeitslosigkeit geprägt, was massgeblich zu einem starken relativen Anstieg der Sozialausgaben beitrug: Ihr Anteil an den Bundesausgaben stieg von 22 Prozent (1990) auf 26 Prozent (2000). Die Ausdehnung der sozialen Wohlfahrt ging zulasten der Landesverteidigung, deren Anteil an den Bundesausgaben sich nach dem Ende des Kalten Kriegs halbierte und im Jahr 2000 noch bei 10 Prozent lag (→ Abb. 2).
Der SP-Bundesrat und Vorsteher des Finanzdepartements, Otto Stich, legte zwischen 1992 und 1994 drei Sanierungspakete vor. Substanzielle Mehreinnahmen brachte die Einführung der Mehrwertsteuer46, die 1993 im vierten Anlauf gelang. Dabei sagte der Souverän auch zu einem für die AHV reservierten Mehrwertsteuer-Prozent zu. Die wichtigste ausgabenseitige Massnahme war eine zehnprozentige Kürzung der Subventionen in den Jahren 1993 bis 1997. Allerdings liess sich das Ausgabenwachstum trotz der Sparmassnahmen, die sich zu einem grossen Teil aus blossen Finanzplanvorgaben zusammensetzten, nicht bremsen – wieder konnte die Ausgabenbremse (1995) nichts daran ändern. Trotz der Sanierungsanstrengungen verharrte die strukturelle Überlastung des Haushalts in den 1990er-Jahren auf hohem Niveau. Da es nicht gelang, das strukturelle Defizit des Bundes zu verkleinern, wurde vermehrt Kritik am Vorgehen des Bundesrates laut. In einer Ratsdebatte über ein drittes Sanierungspaket forderte der Walliser CVP-Ständerat Édouard Delalay mit deutlichen Worten einen Strategiewechsel:
«Mais nous sommes également d’avis que ces mesures ne suffiront pas et qu’il est indispensable pour le Parlement et pour le Conseil fédéral d’adopter une stratégie globale en matière de politique financière et de technique budgétaire. Nous n’échapperons pas non plus à la nécessité de nous doter de mesures institutionnelles, sans lesquelles nos dépenses ou le niveau de la dette publique sont étroitement liés à l’évolution du produit intérieur brut en un système à la fois cohérent et anticyclique.» (Amtl. Bull. SR 1995, 161)
Bei einer grossen Mehrheit der politischen Entscheidungsträger hatte sich die Einsicht durchgesetzt, dass die Ausgabenkompetenzen des Parlaments gerade in Phasen mit guter Konjunkturlage beschränkt und die Schulden langfristig stabilisiert werden müssen. Die Antwort des Bundesrats war ein 1999 veröffentlichtes Strategiepapier, das der damalige Luzerner FDP-Finanzminister Kaspar Villiger als «Ausgangspunkt der erfolgreichen Wende bei den Bundesfinanzen» bezeichnete.47 Anstelle der «unkoordinierten steuerpolitischen Projekte», die sich in den vergangenen Jahren gehäuft hatten, wurde die Finanzpolitik an einer Gesamtstrategie ausgerichtet. In einem ersten Schritt wurde der Budgetausgleich mit dem Haushaltsziel 2001 verfassungsmässig festgeschrieben, um dann eine Schuldenbremse einzuführen, welche die Bildung eines neuen strukturellen Defizits verhindern sollte. Als flankierende Massnahme war eine Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) geplant. Damit sollten der Föderalismus gestärkt und die bundesstaatliche Aufgabenerfüllung effizienter gestaltet werden.
Angesichts der finanziellen Situation des Bundes bestand auch bei Volk und Ständen erstmals in der Geschichte der Bundesfinanzen die Bereitschaft für grundlegende Reformen. Die Zustimmung zu allen Reformvorlagen war sehr hoch.48 Mit der Schuldenbremse wurde 2003 das wichtigste finanzpolitische Instrument des Bundes eingeführt. Wie der Bundesrat 1995 festhielt, galt es, ein grundsätzliches Problem der Finanzordnung zu verringern, die institutionelle Asymmetrie zwischen Einnahmen- und Ausgabenentscheidungen:
«Die Finanzordnung des Bundes zeichnet sich durch eine Asymmetrie zwischen einnahmen- und ausgabenseitigen Kompetenzen aus. Steuergegenstände und Steuersätze sind in der Verfassung verankert; die Ausgaben hingegen basieren auf nur fakultativ dem Referendum unterstellten Gesetzen und werden in der Regel in nicht referendumsfähigen Beschlüssen konkretisiert. Weder der Konjunkturartikel (Art. 31quinquies BV), der eine antizyklische Finanzpolitik verlangt, noch Artikel 42bisder Bundesverfassung, der vorsieht, dass der Fehlbetrag der Bilanz des Bundes abzutragen ist, stellen eine wirksame Schranke gegen die Verschuldung dar.» (Schweiz. Bundesrat, 1995, S. 214)
Die Schuldenbremse stellt sicher, dass Ausgaben und Einnahmen über einen Konjunkturzyklus hinweg ausgeglichen sind. So wird eine antizyklische Fiskalpolitik gewährleistet und gleichzeitig der nominelle Schuldenstand stabilisiert, was bei einer wachsenden Wirtschaftsleistung zu einem Rückgang der Schuldenquote führt. Indem ein Sanktionsmechanismus eingebaut wurde, konnte die Durchsetzung der Schuldenbremse sichergestellt werden, womit ein Hauptproblem der früher implementierten Fiskalregeln gelöst wurde.49 Rückblickend kann die Einführung der Schuldenbremse im Jahr 2003 als grosser Erfolg gewertet werden. Trotz der Finanzkrise 2007 ging die Verschuldungsquote von 26 (2003) auf 14.4 Prozent (2018) zurück (→ Abb. 5). Gleichwohl konnte ein erneuter Sperrklinkeneffekt nicht abgewendet werden. Vergleicht man die 1980er- mit den 1990er-Jahren, stieg die durchschnittliche Staatsquote treppenartig von 8.5 auf 10.2 Prozent an.
Mit dem zweiten grossen Reformprojekt NFA sollte der «Verschlammung des Föderalismus» entgegengewirkt werden, wie Kaspar Villiger die Entwicklung unter dem alten Finanzausgleich versinnbildlichte.50 Es galt, die bundesstaatliche Aufgabenerfüllung effizienter zu gestalten und den Kantonen dabei mehr Handlungsspielraum zu verschaffen sowie die finanziellen Unterschiede zwischen den Kantonen abzubauen. Mit der NFA wurden die Aufgaben zwischen Bund und Kantonen nach dem Prinzip der Subsidiarität in zwanzig Bereichen getrennt. Bei jenen Aufgaben, die weiterhin gemeinsam durchgeführt werden, erlauben es zweckfreie Mittel anstelle von zweckgebunden Einzelsubventionen den Kantonen, eigenständig Prioritäten zu setzen. Zudem wurden verschiedene Zentrumsleistungen als gemeinsame Kantonsaufgaben definiert und deren Gestaltung und Finanzierung geregelt, der Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen stark vereinfacht und von zentralen Fehlanreizen befreit. Anstelle von über hundert Einzelmassnahmen traten zwei Instrumente: Der Ressourcenausgleich