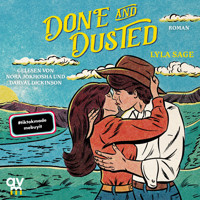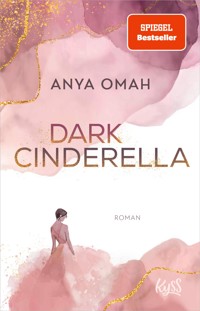9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Therese von Bayern – eine bemerkenswerte Frau, unerschrockende Reisende und leidenschaftliche Forscherin
Ende des 19. Jahrhunderts: Therese von Bayern erfüllt so gar nicht die Erwartungen, die ihre Zeit an eine Prinzessin hat. Sie weigert sich zu heiraten und interessiert sich brennend für Naturwissenschaften – und es zieht sie in die Ferne, in das Land ihrer Träume: Brasilien. Gemeinsam mit drei Begleitern reist sie über den Atlantik und taucht ein in eine tropische Welt voller Wunder. Therese ist wie gebannt von diesem Land, erlebt seine Schönheit und Vielfalt, aber auch Gefahren und Grausamkeit. Sie lernt einen Mann vom Volk der Tupí kennen, der ihr ein Leben näherbringt, das sich von ihrem gänzlich unterscheidet. So wird diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis – und zur Geschichte einer besonderen Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ZUMBUCH
Die bayerische Prinzessin Therese ist abenteuerlustig, klug – und sie will nicht heiraten, wie es Zeit und gesellschaftlicher Stand für sie vorsehen. Vielmehr zieht es sie in die Ferne. Nach Brasilien, das Land ihrer Träume. Im Jahr 1888 bereist sie mit vier Begleitern den Amazonas, wandert durch den tropischen Regenwald, sammelt außergewöhnliche Pflanzen und Tiere, erlebt Wunder und Gefahren dieser unbekannten Welt. Und sie verliebt sich in einen jungen Mann indigener Abstammung. Eine große, aber skandalöse Liebe entsteht. Kann sie diesen einen brasilianischen Sommer überdauern?
ZURAUTORIN
Katharina Innig wurde 1987 geboren und studierte Kunstgeschichte, worin sie auch promovierte. Ganz besonders liebt sie das 19. Jahrhundert und außergewöhnliche Frauenbiografien. Sie lebt und arbeitet als freie Schriftstellerin in Süddeutschland. Die Forscherin. Prinzessin Therese und der Ruf des Amazonas ist ihr erster Roman im Diana Verlag.
KATHARINA INNIG
Prinzessin Therese
und der Ruf
des Amazonas
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 09/2022
Copyright © 2022 by Diana Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München
Umschlagmotiv: © Shutterstock.com (Kateryna Yakovlieva, mamita)
Autorenfoto: © Anna Schaller
Redaktion: Antje Steinhäuser
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-29037-5V002
www.diana-verlag.de
Für meine Eltern, immer
Villa AmSee
Lindau, Bodensee, kurz vor Weihnachten 1924
Der Dezemberwind strich um das Haus, um die kahl gewordenen Zweige der alten Kastanienbäume im Garten, durch das Efeu, das die Hauswand an manchen Stellen einhüllte wie ein grüner Mantel. Er wehte durch die Büsche und über die streng eingefassten Blumenbeete, die im Winter wie im Schlaf dalagen. Der See am Ende des Grundstücks war blauschwarz und kalt. Merkwürdig, dachte Therese, die am Fenster des warm geheizten Salons stand und hinaussah. Merkwürdig, dass das Wasser an solchen Tagen ganz anders aussieht als im Sommer. Es war ihr schon oft aufgefallen, dass das Wasser sich veränderte, abhängig davon, ob es warm oder kalt war, ob die Sonne schien oder ein Gewitter aufzog. Jedes Mal wechselte das Wasser die Farbe, wirkte weich oder hart, kalt oder warm, dicht oder glasklar, egal ob es in Skandinavien oder in Brasilien war. Heute, an diesem kalten Tag in der Vorweihnachtszeit, war es undurchdringlich wie eine fast schwarze Fläche. Schade, dass Veronika den See nun mit dieser Anmutung sehen würde, nicht so freundlich und blau, wie er im Sommer war.
Therese hustete. Sie zog das Stricktuch, das sie über dem schlichten Wollkleid trug, enger um sich. In letzter Zeit fror sie häufig. Früher war sie so robust gewesen, noch vor ein paar Jahren war sie auf die Berge am See gestiegen, war geritten und frühmorgens schwimmen gegangen. Nun wurde sie mit jedem Tag älter und schwächer, sie konnte es förmlich fühlen. Der Husten wurde stärker, die Gelenke steifer, und um ihre Brust hatte sich seit einiger Zeit ein unsichtbarer Ring gelegt, der das Atmen schwerer machte.
Therese sah auf das Tischchen neben dem Sofa. Dort lag Der Zauberberg, ein neues Buch, das die Zeitungen in den letzten Wochen jubelnd besprochen hatten; die Geschichte von Tuberkulosekranken in einem Schweizer Lungensanatorium. Manche hätten es für geschmacklos gehalten, dass sie ausgerechnet dieses Buch sofort gekauft hatte. Aber es bereitete ihr eine merkwürdige Art von neugierigem Vergnügen, darin von Menschen zu lesen, die dieselbe Krankheit hatten wie sie. Nein, sie hatte keine Angst, auch nicht, als der Arzt ihr die Diagnose verkündet hatte. Es war der Lauf der Dinge.
Das Feuer im Kamin knackte. Martin, der Gärtner, hatte alle Öfen im Haus angefeuert, damit Therese und ihre Besucherin es mollig warm haben würden. Das zweite Geräusch im Raum war das Krächzen des Papageis in seinem Käfig. Therese wandte sich zu ihm um. »Na, Lora, bist du auch gespannt auf unseren Besuch?«, fragte sie den bunt gefiederten großen Vogel, der den Kopf schief legte und sie mit seinen schwarzen Knopfaugen aufmerksam ansah. Lora krächzte noch einmal. Vermutlich mochte sie es nicht, hinter Gittern zu sitzen. Gewöhnlich war die Käfigtür den ganzen Tag offen, und der Papagei konnte durchs Haus flattern, wie er wollte. Aber jetzt, nur vorsorglich, hatte Therese den Vogel wegen des Besuchs hinter Schloss und Riegel gesetzt.
»Nicht für lange«, sagte sie entschuldigend. »Wenn sie sich eingewöhnt haben, darfst du ganz bestimmt wieder fliegen.«
Veronika – wie lange hatten sie sich nicht mehr gesehen? Das letzte Mal musste vor dem Krieg gewesen sein, als Thereses Vater, der Prinzregent, noch lebte. Es war bei einem Ball gewesen, oder bei einem Bankett? Therese konnte sich nicht mehr genau erinnern. Veronika war damals mit ihrem Mann, Graf Rudolf von Löwenstein, gekommen. Ihre jüngste Tochter war auch dabei gewesen – Therese erinnerte sich verschwommen an ein aufgewecktes kleines Mädchen mit wachen Augen. Dieses kleine Mädchen musste inzwischen fast erwachsen sein. »Die Zeit rennt«, sagte sie zu Lora. Sie hielt den Zeigefinger durch die Gitterstäbe. Der Vogel pickte liebevoll daran herum und ließ sich den Kopf streicheln.
Die Idee, Veronika zu schreiben, war ihr vor ein paar Monaten bei einem Besuch in München gekommen. Sie war gerade dabei gewesen, in dem prächtigen Palais am Odeonsplatz, in dem sie aufgewachsen war, ihre Bestände zu ordnen. All die Schriften, Bücher, Präparate, Sammelobjekte, kurz ihr ganzes Münchner Leben. Wochen war sie beschäftigt gewesen und hatte gespürt, wie sehr es an ihren Kräften zehrte, die Arbeit ganz allein zu tun. In Lindau noch einmal von vorne anzufangen, alle Briefe und Objekte, die sich dort in den letzten zehn Jahren angesammelt hatten, zu sortieren und zu sichten, war ihr unmöglich erschienen. Sie brauchte Hilfe – und da war ihr Veronika eingefallen. Es hatte eine Weile gebraucht, bis sie überhaupt ihre Adresse gefunden hatte, aber dann hatte sie ihr sofort geschrieben. »Ich möchte Dich nach Lindau einladen – und Deinen Rudolf natürlich auch«, hatte in dem Brief gestanden, den sie nach Rosenheim geschickt hatte. »Aber ich will Dir nicht verschweigen, dass ich auch Deine Hilfe brauche. Du hattest doch damals schon so eine schöne Handschrift und ein Auge für Ordnung …«
Veronika hatte schon bald darauf geantwortet und versprochen, noch vor Weihnachten für eine Woche an den Bodensee zu reisen.
Therese sah wieder zum Fenster hinaus. Sie hoffte, dass es Veronika hier gefiel. Aber wie konnte man es auch nicht schön finden? Die sanften Hügel rund um Lindau, die hohen Berge am anderen Ufer des Sees, sie hatte diesen Ort immer geliebt. Ihre Mutter Auguste hatte vor über siebzig Jahren diese Villa gekauft, nachdem sie zum ersten Mal an den Bodensee gereist war. »Es sieht dort ein bisschen aus wie in meiner Kindheit in Italien«, hatte sie damals nach München geschrieben. Ihr Leben lang hatte Auguste behauptet, dass die Lindauer Landschaft sie an ihre italienische Heimat erinnerte. Therese hatte zwar später, bei ihren eigenen Reisen nach Rom und Neapel, kaum eine Ähnlichkeit erkannt, aber das änderte nichts daran, wie wohl sie sich hier fühlte. Die Villa war voller Erinnerungen an die Sommer, die sie als Kind mit den Eltern und den drei Brüdern hier verbracht hatte, später an die stillen Besuche, die sie zwischen ihren Reisen hier eingelegt hatte. Als vor zehn Jahren der Krieg ausbrach und sie aus München nur noch fort wollte, hatte sie keinen Augenblick überlegen müssen, wohin sie ziehen würde.
»Zehn Jahre, unglaublich«, murmelte sie nun.
Draußen zogen graue Wolken über den Himmel. Hoffentlich wird das Wetter noch ein bisschen schön in den nächsten Tagen, dachte sie. Sie wollte Veronika den Garten, den See und die Stadt so gerne bei Sonnenschein zeigen.
Ein Klopfen riss sie aus ihren Gedanken.
»Ja?«
Eine Frau streckte ihren Kopf durch die Tür; ihre von grauen Strähnen durchzogenen, kurzen Locken standen wie immer wild in alle Richtungen ab, und ihr bärbeißiges Gesicht wirkte missvergnügt.
»Die Maschine fährt heran.« Gundas Tonfall ließ keinen Zweifel daran, was sie von »der Maschine« hielt. Therese hatte das elegante, große Automobil vor etwas über einem Jahr erstanden. Ihre Begeisterung war allerdings so gar nicht auf ihre Haushälterin übergesprungen. »Was war denn falsch an Kutschen und Fahrrädern?«, hatte Gunda nur gebrummt und sich auch in der Zwischenzeit nicht überzeugen lassen, auch nur ein einziges Mal in dem Auto Platz zu nehmen.
Therese lächelte. »Danke, Gunda.«
Sie atmete tief durch. Es war so weit.
Der Wagen, der hupend in die Kiesauffahrt einfuhr, glänzte tiefschwarz, und die verchromte Kühlerhaube blitzte. Therese betrachtete ihn voller Besitzerstolz. Sie hatte schon immer eine Vorliebe für neue Erfindungen und Maschinen gehabt, und alles, was verhinderte, weiterhin in polternden, ruckelnden Kutschen sitzen zu müssen, die ihren zunehmend schmerzenden Knochen nicht bekamen, war ihr willkommen. Ihr Nachbar hatte sie beim Kauf beraten und ihr diesen Wagen empfohlen; sie hatte keine Minute gezögert.
Nun bremste »die Maschine« knirschend auf dem Kies, und einen Moment später sprang Martin heraus. Der Sohn des Lindauer Försters war seit Jahren nicht nur Thereses Gärtner und zuständig für den Park, sondern auch ihr Waldaufseher und spielte den Chauffeur. Selbst wenn Therese leicht seine Großmutter hätte sein können, teilten sie ihre Begeisterung für das Auto genauso wie die für Tiere und verstanden sich gut. »Er hält mich jung«, sagte Therese manchmal im Scherz, »nun ja, zumindest jünger.«
»Ging alles problemlos, Martin?«, rief sie nun.
»Aber ja, Prinzessin«, grinste er. »Zugegeben, ich habe zuerst nicht alles Gepäck der Gräfin in den Kofferraum bekommen, aber am Ende war es doch geschafft.«
Er öffnete die Tür zum Fond.
Die Frau, die ausstieg, sah aus wie aus einer Modezeitschrift entsprungen. Veronika hatte sich, stellte Therese nun verblüfft fest, trotz der vielen Jahre, die vergangen waren, kein bisschen verändert. Die drei Töchter, die sie bekommen hatte, sah man ihrer mädchenhaften Figur nicht an, und obwohl sie inzwischen Mitte fünfzig sein musste, wirkte ihr Gesicht glatt und jugendlich. Natürlich war sie sorgfältig geschminkt, die Lippen rot, und ihr Haar, das früher von Natur aus hellblond gewesen war, war nun in etwa demselben Farbton gefärbt. Es fiel nicht mehr in langen mädchenhaften Locken über ihre Schultern, sondern war modern frisiert, und der Schnitt passte gut zu dem ebenfalls modischen Mantel, den sie trug. Veronikas Füße steckten in eleganten Schuhen mit Pfennigabsatz, und auf dem Kopf saß ein Hut, der eindeutig teuer gewesen war. Sogar ihr charmantes Lächeln war dasselbe geblieben.
»Therese! Wie schön!«
Therese winkte ihr von der Haustür aus zu. Sie studierte Veronikas Miene. Ob sie wohl erschrickt, weil ich so alt und blass geworden bin?, fragte sie sich insgeheim.
Leichtfüßig, trotz der hohen Absätze, lief Veronika nun über den Kies auf sie zu und schloss Therese ohne viel Umstände in die Arme. Die wurde dabei in eine Wolke süßen Parfüms eingehüllt.
»Ach, ist das wundervoll, dass wir uns wiedersehen!«, rief Veronika und lachte. »Es ist wirklich viel zu lange her.«
»Das stimmt. Ich freue mich auch.« Therese sah sich erstaunt um. »Bist du allein? Wollte dich denn Rudolf nicht begleiten?«
Ein Schatten huschte für einen Moment über Veronikas Gesicht. »Ach nein, er mag es nicht mehr zu verreisen. Oder überhaupt auszugehen. Männer, nicht wahr?« Im nächsten Moment knipste sie wieder ihr Strahlen an. »Aber so ist es doch eigentlich ohnehin viel besser, nur wir beide. Wir haben uns bestimmt so viel zu erzählen …« Veronika unterbrach sich und legte den Kopf in den Nacken, wobei sie anmutig ihren Hut festhielt, und sah die Fassade der Villa empor.
»Das Haus ist traumhaft! Kein Wunder, dass du hierhergezogen bist und München keine Träne nachweinst.«
Wie immer, wenn jemand zum ersten Mal zur Villa kam, sah Therese das Anwesen mit den fremden Augen. Tatsächlich sah die Biedermeiervilla sehr hübsch aus mit ihrer in freundlichem Gelb gestrichenen Fassade und den weißen Sprossenfenstern. Das Efeu rankte an manchen Seiten bis unter das Dach, und auf der Seeseite gab es einen verglasten Balkon, um auch an kühlen Tagen in der Sonne sitzen zu können, dazu eine Terrasse, beschattet von Efeu, auf der man an heißen Sommertagen sitzen und durch einen Bogengang hinaus auf den See blicken konnte. Der Garten der Villa AmSee war großzügig angelegt und ging nach Blumenbeeten in einen üppigen Park mit alten Bäumen über. Er reichte bis hinunter an den See, was besonders schön war.
»Ich zeige dir später alles ganz genau«, schlug sie vor. »Aber jetzt komm erst einmal herein. Gunda hat gerade frischen Kaffee gemacht, und Plätzchen gibt es auch.«
»Gute Idee – ich sterbe vor Hunger.«
Mit dem letzten Blick zurück sah Therese, wie Martin fünf Hutschachteln aufeinandertürmte, wo schon zwei große Schrankkoffer standen. Sie verkniff sich ein Grinsen. Veronika hatte sich wirklich nicht verändert.
Das Feuer im Kamin prasselte. Ab und zu brach ein Scheit zu einem Häuflein glühender Kohlenstücke zusammen und entließ einige Funken in den Rauchfang. Die Wärme des Feuers ließ die Girlande aus Tannenreisig, die Gunda schon vor Tagen vor dem Kamin aufgehängt hatte, duften, und der Geruch mischte sich mit dem feinen Kaffeeduft, der von den beiden zarten Porzellantassen aufstieg.
»Wunderbar«, seufzte Veronika wohlig. »Genau das, was ich jetzt brauche. Die Fahrt war scheußlich lang – erst von Rosenheim nach München, dann von München nach Füssen, und dort hat mich ja dann dein charmanter Chauffeur abgeholt.« Sie lächelte und sah sich in dem Raum um. »Was für ein schöner Salon das ist. Er sieht russisch aus.«
»Ja, hier ist alles, was ich von meiner Russlandreise damals mitgebracht habe – und dazu einiges, was mir Olga im Laufe der Jahrzehnte geschenkt hat.«
»Olga, deine alte Jugendfreundin?«
»Ja, wobei sie immer gerne darauf hinweist, dass sie ein Jahr jünger ist als ich«, bemerkte Therese schmunzelnd. »Sie lebt nun in Rom, seitdem ihr Sohn als griechischer König abgesetzt wurde.«
»Warum ist sie nicht zurück nach Russland gegangen?«
Olga, die ehemalige Königin von Griechenland, war in Russland als Nichte des Zaren geboren worden.
»Ach, ich glaube, es war ihr zu kalt«, antwortete Therese trocken. »Und ich bin froh; Italien ist näher. Ab und an können wir uns sehen.«
Veronikas Blick glitt über die mit rotem Samt bezogenen Möbel, die kleinen Porzellanfiguren von Väterchen Frost und eleganten Schlittschuhläuferinnen, über die große Pendeluhr aus dunklem Ebenholz, das Gemälde der weiten Taiga, die russischen Lackminiaturen und über die Spitzenklöppeleien, die als Tischläufer und Untersetzer dienten. »Ich stelle mir Russland großartig vor«, seufzte sie. »Russische Weite, prächtige Paläste, das Bernsteinzimmer, Katharina die Große, Anna Karenina und Kutschfahrten durch den Schnee …«
Therese lachte auf. »Ich sehe schon, du bist immer noch so romantisch wie früher. In Brasilien warst du auch so und schrecklich verliebt in Rudolf. Du hast kaum von etwas anderem gesprochen als von ihm und eurer Hochzeit, die bevorstand, und ohne deinen Verlobungsring konntest du nicht sein.«
»Stimmt.« Veronika lächelte verlegen. »Ach, das ist alles so lange her, es ist kaum zu glauben.« Sie beugte sich vor und nahm sich ein Stück Gebäck vom Teller. Als sie hineinbiss, seufzte sie genießerisch. »Das schmeckt ja himmlisch – Aprikose?«
»Ja, Gundas berühmte Aprikosenplätzchen. Die kennt, glaube ich, halb Lindau.«
»Gunda ist deine Köchin?«
»Köchin und Haushälterin in einem.« Therese nahm sich selbst ein Plätzchen. »Außer ihr wohnt nur noch Martin hier, den hast du ja bereits kennengelernt.«
»Mehr Personal hast du nicht?«, fragte Veronika erstaunt. In der Münchner Residenz hatten ganze Heerscharen von Dienstboten für die Königsfamilie bereitgestanden.
»Ich muss jetzt mit dem Geld haushalten – Könige gibt es nicht mehr.« Therese lehnte sich zurück. »Außerdem ist es mir so viel lieber. Ich finde es schön, wenn mir nicht jeder Handgriff abgenommen wird.« Sie deutete durchs Fenster. »Die Balkonmöbel dort habe ich letzten Sommer selbst gestrichen.« Sie biss von ihrem Plätzchen ab. »Ruh dich noch ein bisschen aus, und dann zeige ich dir den Garten und den See, bevor es draußen endgültig dunkel geworden ist.«
»Gerne.«
Der Papagei krächzte in seinem Käfig und trat unruhig von einem Fuß auf den anderen. Er konnte es kaum erwarten, wieder fliegen zu dürfen.
Auf dem Atlantik
Juni 1888
Der Basstölpel schlägt am blaugrauen Himmel über mir kraftvoll mit seinen weiten Schwingen. Ich lege den Kopf in den Nacken und sehe ihm dabei zu, wie er sich vom Sturm mal hinauf und hinunter, mal nach rechts oder links wehen lässt. »Was machst du überhaupt hier? Du bist zu weit südlich«, sage ich zu ihm. Es stört ihn nicht, er schaukelt gut gelaunt im Wind. Seit gestern Nacht dauert der Sturm an. Der Wind zerzaust mir die Haare, die Veronika, meine neue Gesellschaftsdame, heute Morgen sorgfältig aufgesteckt hat. Er fährt mir unter den Mantel, lässt mein Kleid wehen. Ich liebe das Gefühl. Über mir krächzt der Basstölpel vergnügt; wir mögen wohl beide dieses Wetter.
Ich atme tief die salzige Luft ein, schaue den Wellen zu, die sich unter mir höher und höher schaukeln. Einige Passagiere sind inzwischen seekrank und liegen unter Deck in ihren Betten. Der Rest hat sich vor der Gischt und dem Wind ebenfalls hinunter in den Bauch der Manauense verzogen. Nur ich bin noch hier draußen, gemeinsam mit dem Basstölpel und einem scheppernden Blecheimer, den der Wind über die Bohlen des Decks kullern lässt. Ein junger Matrose jagt ihm nach, verliert dabei seine Mütze und flucht, bevor er mich sieht und ein derart erschrockenes Gesicht macht, dass ich lachen muss.
»Excuse me, Madam.« Er angelt nach seiner Mütze und verschwindet eilig. Nun bin ich ganz allein.
Es ist unglaublich, wie weit das Meer ist. Seit Tagen haben wir kein Festland mehr gesehen. Rings um das Schiff ist nur das tiefe Wasser, die Fische, die wir ab und zu von der Reling aus entdecken, und die Quallen, die manchmal in großen Schwärmen vorbeiziehen. Am weiten Himmel tauchen hier draußen nur noch selten Vögel auf. Die meiste Zeit ist er leer.
Vor sieben Tagen sind wir am Hafen von Lissabon an Bord gegangen, nach einer langen Reise mit Kutsche und Eisenbahn von München nach Portugal. Ich sehe den Hafen noch vor mir, sommerheiß und voller Menschen. Alle winkten zum Abschied, riefen irgendetwas – jetzt, nach so langer Zeit auf dem Atlantik ohne irgendeine Abwechslung, kommt mir eine solche große Menschenmenge und die große Stadt Lissabon unwirklich vor wie ein Traum.
Am ersten Tag passierten wir Madeira, die Insel, auf der es immer Frühling sein soll. Ich betrachtete sie eine ganze Weile mit meinem Fernglas – der Reisemarschall spottet schon, es sei an mir festgewachsen –, aber ich sah nur Grün und weiße Häuser, die sich an die Hänge der Insel schmiegten. Die Kanaren, die wir bald darauf erreichten, waren aufregender, irgendwie fremder mit ihren trockenen, weiten Sandstränden und dieser eigenartigen Vulkanlandschaft. Humboldt war einmal auf den Kanaren gewesen, ich kenne seine Berichte darüber. Er hat damals Teneriffa als Kontinent im Kleinen beschrieben und den Vulkan Pico del Teide bestiegen. Es war schade, dass die Manauense dort keinen Zwischenstopp eingeplant hat; ich musste wieder mit dem Fernglas vorliebnehmen. Entschädigt wurde ich allerdings von den Nautilussen, die am gleichen Abend bei Sonnenuntergang an unserem Schiff vorbeizogen, große Kopffüßer mit weiß-braunen Schneckenhäusern, die wie eine Erscheinung aus dem Blau auftauchten und dahintrieben.
Seitdem – nichts. Nur Wasser. Veronika langweilt sich, der Reisemarschall schreibt lange Briefe, und Max, mein Diener, sucht ständig neue Gesellschaft für seine geliebten Schafkopfrunden. Ich habe mir die Zeit in den letzten Tagen vor allem damit vertrieben, meine Geräte auszuprobieren – zumindest die, mit denen ich hier auf dem Schiff irgendetwas messen kann. Mein Sextant, das Barometer, das Magnetometer und das Cyanometer, das das Blau des Himmels bemisst. Ich schreibe alle meine Messungen auf, aber ganze Tage fülle ich damit nicht. Ich gebe es zu – ich kann es inzwischen kaum erwarten, endlich anzukommen.
Die Gischt brandet am Bug hinauf, der Sturm wird stärker. Ein paar feine Meereswassertröpfchen treffen mein Gesicht und schmecken nach Salz. Kalt sind sie nicht, auch nicht der Wind. Gestern haben wir den Äquator passiert; die Luft ist warm und das Wasser tropisch.
Die Manauense pflügt durch die Wellen. Dieser große Dampfer mit seinen beiden mächtigen runden Schloten fasziniert mich, seit ich ihn betreten habe. Er ist riesig und spuckt den ganzen Tag Dampf in die Luft, angefeuert durch die riesigen Heizkessel ganz unten im Schiffsbauch. Dort unten schippen die Heizer unablässig Kohle in die Feuer, um uns in Gang zu halten. Dreihundert Seemeilen schafft die Manauense bisher durchschnittlich am Tag. Dieser Sturm allerdings wird wohl für Verzögerung sorgen. Der Wind nimmt noch einmal Fahrt auf; das Meer brüllt nun geradezu unter mir, und ich muss mich an der eisernen Reling festklammern. Trotzdem habe ich nicht die geringste Lust hineinzugehen. Ganz bestimmt sitzt der Reisemarschall gerade dort unten in seiner Kabine und wütet, weil ich hier draußen stehe. »Seien Sie doch vernünftig«, ist sein Lieblingssatz. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich sicher jemanden anderen als Reisemarschall mitgenommen statt dieses überdisziplinierten jungen Offiziers, der ausschließlich in Uniform reist und ständig etwas zu bemängeln hat. Unglücklicherweise ist er der Sohn eines alten Jugendfreundes von Papa, und so hat er darauf bestanden, dass ich ihn auswähle. »Er ist zuverlässig, Therese«, hat er gesagt. »Bei ihm kann ich sicher sein, dass er alles dafür tun wird, dich heil wieder nach Hause zu bringen.« Das ist möglich, aber es ist genauso möglich, dass ich mich mit ihm auf dieser Reise irgendwann schrecklich in die Haare bekommen werde.
Der Reisemarschall ist nicht der einzige meiner Begleiter, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er die beste Wahl für diese Reise war. Veronika ist seit heute Morgen seekrank. Sie liegt im Bett und ist ganz blass; am Mittag habe ich ihr Pfefferminztee und Zwieback bestellt, aber sie wollte beides nicht anrühren.
»Wenn es nur aufhören würde, zu schaukeln«, hat sie gejammert. »Dieses Schaukeln macht mich ganz verrückt.«
»Sie sollten trotzdem ein bisschen essen und etwas trinken«, redete ich ihr zu, aber es war sinnlos. Ich dachte an die Gräfin Oberndorf, die mich eigentlich hätte begleiten sollen. Eine robuste Frau Mitte vierzig aus alter Militärfamilie, die ich schon lange kenne und die niemals seekrank werden würde. Aber am Tag vor unserer Abreise wurde ihre Mutter krank. Und weil eine Prinzessin nicht ohne Gesellschaftsdame reisen kann, schickte mir die Gräfin in letzter Minute ihre Nichte mit. Veronika ist nicht unbedingt ein Ersatz: Sie ist erst neunzehn, ist noch nie verreist und sieht aus wie eine Porzellanpuppe. Sie ist frisch verlobt mit einem schneidigen Offizier und redet über beinahe nichts anderes. Immerhin, das muss ich ihr lassen, kann sie sehr gut Haare frisieren. Trotz des Sturms hier draußen hat sich noch kaum eine Strähne gelöst.
»Prinzessin!« Ich höre den Ruf zuerst nur vage durch das Tosen der Wellen und das Pfeifen des Windes. »Prinzessin!« Ich drehe mich um. Ein kleiner Mann mit Backenbart und im einfachen dunklen Anzug kämpft sich in komischer Verzweiflung gegen eine Bö über Deck zu mir und fuchtelt mit den Armen.
Ich lächele. »Max!«, schreie ich dann. »Hast du den Sturm gesehen?«
»Mei, der is’ ja kaum zu übersehen.« Er hat mich erreicht und schüttelt grinsend den Kopf. »Hoheit, Ihr seid’s doch wirklich narrisch. Bei dem Wetter – bald bläst’s Sie’s über Bord.«
»Du weißt doch, wie sehr ich Sturm liebe.«
Er nickt und klammert sich neben mir an die Reling. »Allerdings. Schon als Madl war’s so, damals aufm Bodensee.«
Er hat recht. Schon als Kind bin ich am liebsten von der Sommervilla meiner Eltern am Bodensee aus auf das Wasser hinausgesegelt, wenn es stürmte und die Wellen hochschlugen. »Ein Abenteuer, Papa«, rief ich, wenn er am Ufer stand und mir wütend zuwinkte, dass ich zurückkommen sollte.
»Sie werden wohl nie vernünftig, Hoheit.«
Ich grinse. Keiner unserer Diener hat je so mit mir geredet wie Max. Die meisten sind schrecklich höflich und machen Kratzfüße und sagen »Jawohl, Hoheit« und »Selbstverständlich, Hoheit«, vollkommen egal, was sie in Wirklichkeit denken. Max ist anders, und genau deswegen mag ich ihn. Er ist ein waschechter Münchner, ein »bayerisches Urviech«, wie Papa sagt, und kennt mich schon lange. Als ich noch ein Kind war, half er dabei, meine Menagerie an Katzen, Hunden, Laubfröschen, einem Murmeltier und einer Mopsfledermaus zu betreuen. Später, als ich älter war, wurde er zu meinem Verbündeten bei meinen kleinen Fluchten aus dem engen Palast und vor meinen strengen Gouvernanten. Noch später wurde er zu meinem treuen Begleiter auf Reisen.
»Was gucken S’ so, Hoheit?«, fragt er mich jetzt.
»Ich dachte nur gerade, dass ich froh bin, dass du dabei bist, Max. Unsere erste Reise über den Atlantik.«
»Ja, Prinzessin«, nickt er, »wir beide aufm weiten Meer. Wer hätt’ des gedacht?«
Er hält seine ziemlich große Nase mit der gleichen Begeisterung wie ich in den nassen, salzigen Wind. Ein Weile stehen wir einfach nur einträchtig nebeneinander, über uns immer noch der Basstölpel und unter uns das Meer. Schließlich sagt er: »Hoheit, der Reisemarschall kriegt dort unten bald ’nen Herzanfall, wenn S’ net bald mal runterkommen.«
»Noch fünf Minuten, Max.« Ich lege meinen Kopf in den Nacken, sehe in den Himmel mit seinen vielen verschiedenen grau gefärbten Wolken. »Nur noch fünf Minuten.«
Die Kabinen der ersten Klasse sind geräumig und sauber, wenn auch nicht besonders luxuriös. Die Manauense ist kein Dampfer, auf dem die meisten Leute zum Vergnügen reisen, sondern ein Schiff für Händler, die zwischen Europa und Amerika hin- und herpendeln, und für Auswanderer im Goldfieber, die in den unteren Klassen mitfahren.
Wir haben zwei Kabinen, die einander direkt gegenüberliegen. Die linke teile ich mir mit Veronika, die rechte gehört Max und dem Reisemarschall. Auf der gleichen Etage befindet sich noch der Erste-Klasse-Speisesaal, eine Art Salon, in dem sich abends viele der Passagiere die Zeit vertreiben, und eine kleine Bibliothek, die allerdings vor allem aus englischen Andachtsbüchern und Liebesromanen besteht, weil die Manauense ein britischer Dampfer ist.
Der Gang, der alle Räume verbindet, ist sehr lang und dunkel, selbst abends sind die Deckenlichter nur gedämpft. Als ich jetzt die schmale Tür zu unserer Kabine öffne, blendet mich darum das Licht beinahe, das durch das Bullaugenfenster hereinfällt.
»Hoheit? Sind Sie das?«, fragt eine matte Stimme aus einem Berg von Kissen. Veronika liegt noch genauso da, wie ich sie vorhin zurückgelassen habe: zusammengekrümmt und halb unter der Decke vergraben.
»Natürlich bin ich es.«
Sie dreht sich halb zu mir um. Unglaublich, denke ich, dass man selbst seekrank noch so hübsch sein kann. Veronikas Nase ist klein, die Lippen voll und geschwungen, die Wangenknochen hoch. Ihre Augen sind groß und haben ein ungewöhnliches Veilchenblau. Sogar ihre Blässe, die sie jetzt wegen der Übelkeit hat, steht ihr und lässt sie rührend zerbrechlich aussehen. Die hellblonden Haare, die sie jeden Tag sorgfältig in Locken legt, umfließen jetzt offen ihr Gesicht.
»Zum Glück sieht mich zumindest Rudolf jetzt nicht so …«, murmelt sie matt. »Dann wäre er bestimmt nicht mehr in mich verliebt.«
Graf Rudolf von Löwenstein ist ihr Verlobter. Sie trägt seinen Verlobungsring, eine Kette mit Medaillon, in dem eine Haarsträhne von ihm steckt, und hat eine Fotografie von ihm auf dem Kabinennachttisch stehen, ein breitschultriger, gut aussehender Mann in Uniform – genau die Art heldenhafter Mann, für die Mädchen wie Veronika schwärmen.
»Nicht doch, ich bin mir sicher, er würde sich nur noch mehr in Sie verlieben.« Ich ziehe meinen nassen Mantel aus und hänge ihn auf.
»Warten Sie, Hoheit, das kann ich doch machen«, protestiert Veronika schwach. »Ich bin Ihre Gesellschaftsdame.«
»Nein, bleiben Sie ruhig liegen. Außerdem: Wenn Sie sich auf meinen Mantel übergeben, ist keinem von uns geholfen.« Mein Blick fällt auf das Tablett mit Tasse und Zwieback. »Haben Sie inzwischen wenigstens etwas Tee getrunken?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nein, dazu ist mir viel zu schlecht.«
Wie um ihre Worte zu untermauern, trifft im nächsten Moment eine besonders hohe Welle auf unser Schiff, das damit nur noch mehr zum Schaukeln gebracht wird. »O Gott«, stöhnt sie und wird noch blasser. »Wird der Sturm nicht bald nachlassen?«
Ich trete an den kleinen Tisch, auf dem meine Messgeräte liegen und den ich für die Überfahrt zu meinem Arbeitsplatz umfunktioniert habe. Keines davon zeigt etwas an, das auf baldiges gutes Wetter schließen lassen würde.
»Doch, ganz bestimmt wird er das«, lüge ich gnädig. Immerhin hilft es. Veronikas grünlicher Unterton weicht, sie seufzt erleichtert und dreht sich wieder zur Wand.
Ich wende mich meiner Arbeit zu. In den letzten Tagen habe ich immer wieder Wasserproben gesammelt, um die Temperatur des Meerwassers zu vergleichen, je weiter wir nach Süden und je näher wir der brasilianischen Küste kommen. Die heutige Probe hatte, trotz des Sturms, 26 Grad Celsius, und auch die Luft verändert sich. Sie wird zunehmend tropisch. Ich notiere die neuen Messdaten, dann arbeite ich weiter an meiner neuesten Skizze. Es ist die von einem Fisch, der gestern Vormittag, als der erste Wind aufkam, an Bord flog.
Ich war mit Veronika zu einem Spaziergang an Deck gewesen, als der kleine Spitz einer Amerikanerin laut zu kläffen begann. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass er etwas ganz Bestimmtes anbellte: einen Fisch. Ein Fisch, der mit Flügeln schlug.
»Veronika, sehen Sie – da!«
Wir hatten schon seit Tagen immer wieder fliegende Fische gesehen, allerdings weit unten, nur knapp über der Wasseroberfläche. Sie schnellten ab und zu heraus, segelten ein paar Meter über das Meer und verschwanden wieder. Nie konnte ich sie mir genauer ansehen; also war dieser Fisch an Deck ein Glücksfall. Ich verscheuchte schnell den Spitz und sah mir dann das Tier an. Der Körper selbst war unauffällig, fast ein wenig wie ein Hering, auch wenn die Augen um einiges größer waren. Das Interessante aber waren die Flossen. Es gab eine kleine gezackte Bauchflosse, eine lange Schwanzflosse, aber vor allem gab es die Flossen an den Flanken, mit denen das Tier weiter empört um sich schlug, als ich ihn nun aufnahm. Sie waren über die Maßen lang, mit einiger Kraft ausgestattet und klappten sich aus wie Vogelflügel, mit feinen Häuten.
»Igitt, das sieht merkwürdig aus.« Veronika schüttelte sich. »Ein Fisch und ein Vogel, alles auf einmal.«
Ich betrachtete den rötlichen Schmuckrand an den Flossen. »Das ist ein Schwalbenfisch«, sagte ich. Der Fisch schlug wieder mit den Flügeln, seine großen Augen sahen mich vorwurfsvoll an. »Ja, du kommst wieder ins Wasser.« Ich trug ihn zur Reling, betrachtete ihn noch einmal, versuchte, ihn mir so genau wie möglich einzuprägen, und warf ihn dann über Bord. Für einen kurzen Moment breitete er die Flügel aus, wie ich es schon zuvor gesehen hatte, und segelte auf diese Weise sanft zum Meer hinunter. Dort tauchte er ein und verschwand sofort, ein kleiner dunkler Schatten im weiten Blau.
Nun also liegt die Zeichnung vor mir, noch nicht fertig, aber schon so, dass zu erkennen ist, was es werden soll.
»Zeichnen Sie wieder an diesem Fisch?«, fragt Veronika vom Bett her schwach.
»Ja, bevor ich vergesse, wie er aussah.«
»Scheußlich sah er aus«, murmelt sie.
Ich lächele. Dann greife ich zu meinem Bleistift, spitze ihn noch einmal an und beuge mich über das Blatt Papier.
Das Interessante an einer solchen Schiffsreise, das habe ich bald festgestellt, ist weniger das Meer und der leere Himmel oder das Schiff selbst, es sind vor allem die Passagiere. Im Speisesaal sitzen vor allem Händler und Plantagenbesitzer, die Kakao, Zucker oder Kaffee anbauen. Dazu ein portugiesischer Diplomat, eine Art Rinderbaron, und zwei britische Adelige. Dann ist da die alte reiche Amerikanerin mit dem ständig kläffenden Spitz, die mir erzählt hat, dass sie das nasskalte Klima in New York nicht verträgt und darum immer der Sonne nachfährt. Es gibt ein französisches Paar in den Flitterwochen und eine Opernsängerin, die ihr nächstes Engagement in Rio de Janeiro hat. Insgesamt ist es eine bunt gemischte Gruppe, die sich jeden Tag zum Essen trifft. Wir sitzen immer an demselben Tisch, an dem ein Großteil Deutsch spricht. Neben Veronika sitzt Bertha Mosner, eine Wienerin, die in Brasilien einen Mann heiraten wird, den sie noch nie gesehen hat. Neben ihr ein junger Ingenieur, der in Berlin studiert hat, aber schon länger in Brasilien lebt. Er trägt einen interessanten Ring in Form einer Schlange und scheint eher liberalen Ideen anzuhängen, weswegen er öfter in Streit mit seinem Nebensitzer, Senhor Oliviera, gerät. Der Senhor, der eine deutsche Mutter hat, aber in Brasilien aufgewachsen ist und dort eine große Kaffeeplantage betreibt, hört sich selbst gern reden, was mich nicht stört, weil ich ihn gerne nach Brasilien und dem Leben dort ausfrage. Die langen Vorträge, die er uns dadurch bei jedem Essen hält, nehme ich in Kauf.
Die einzigen Personen an unserem Tisch, die kein Deutsch sprechen, gehören alle zur selben Familie; es ist ein brasilianischer Postbeamter und seine Frau, dazu seine Schwiegermutter, die, das hat am ersten Abend für einiges Tuscheln an den Tischen gesorgt, schwarz ist. Sie hören meist schweigend und verständnislos unseren Gesprächen zu, unterhalten sich untereinander auf Portugiesisch oder – mit Max, der neben ihnen sitzt – mit Händen und Füßen.
Der Speisesaal ist hübsch, zumindest hat man sich Mühe gegeben. Auf rotem Teppichboden verteilen sich zwölf recht große, weiß lackierte Speisetische, und es gibt kleine Palmen in Blumentöpfen, wohl um etwas exotischen Flair zu verbreiten. Die Kellner sind schnell und ziemlich geschickt, was das Ausgleichen von Wellengang mit schwappender Suppe in Tellern angeht. Für sehr stürmische Tage wie heute gibt es zudem auf den Tischen eine besondere Vorrichtung, die ich vorher noch nie gesehen habe. Es werden dann hölzerne Rahmen quer über die Tischplatte gespannt und so angeordnet, dass am Ende jeder vor sich einen Rahmen genau in der Größe eines Tellers hat. Wenn der Teller vom Kellner dort hineingestellt wird, kann er nicht mehr verrutschen, und es landet bei hohen Wellen keine Suppe auf dem Schoß.
Die Essenszeiten beginnen früh; um sechs läutet die Frühstücksglocke, und es gibt ziemlich dünnen Kaffee und ein bisschen Gebäck, dann um zehn das zweite Frühstück bestehend aus Eiern, Pilzen, Tomaten und geröstetem Brot. Um vier gibt es dann Dinner und um halb acht englischen Tee und Sandwiches. Anschließend gehen meist alle in den Salon hinüber, wo es Kaffee für die Damen und Cognac für die Herren gibt. Max lechzt seit Tagen nach einem Bier, aber alles, was man über englisches Bier sagt, stimmt.
Heute ist beim Dinner unser Tisch der einzige, an dem – abgesehen von Veronikas Platz – alle Stühle besetzt sind. An den anderen Tischen fehlt zum Teil die Hälfte der Gäste; die Seekrankheit hat um sich gegriffen, und der Sturm ist sogar noch einmal stärker geworden. Neben mir sitzt der Reisemarschall, der jetzt, wo ich wieder brav und wohlbehalten unter Deck sitze, für seine Verhältnisse geradezu gut gelaunt ist. Er hat ein etwas spitzes Gesicht, blonde, streng gescheitelte Haare, die ihn älter aussehen lassen als die zweiunddreißig Jahre, die er alt ist, außerdem hellblaue Augen, die mich immer ein wenig an die Schlittenhunde erinnern, die man am Polarkreis hält. Er ist aufgekratzt. Es stellt sich heraus, dass die gute Laune daher rührt, dass er mit dem Kapitän gesprochen hat. »Er sagt, wir können ruhig für diese eine Nacht an Deck bleiben, auch wenn sonst nur die Mannschaft auf dem Dampfer ist«, sagt er. »Er berechnet nur einen kleinen Aufpreis, viel weniger, als wir in diesem Hotel zahlen müssten.«
Ich seufze. Diese Diskussion führen wir schon seit Tagen. »Wir liegen einen ganzen Tag und eine ganze Nacht vor der brasilianischen Küste, und Sie erwarten, dass ich auf dem Schiff bleibe und warte, bis es weiterfährt? Nein, wir übernachten in Belém und sehen uns die Stadt an.«
»Aber Gräfin …«
Ich seufze noch einmal. Dass ich diesem Inkognito zugestimmt habe, das mir der Reisemarschall aufgedrängt hat – offiziell bin ich an Bord nicht als Prinzessin Therese von Bayern, sondern als eine gewisse Gräfin Elpen –, bereue ich inzwischen. Er hat bestimmt recht, dass es sicherer und besser für die Reise ist, wenn niemand weiß, wer ich bin. Aber die penible Art, wie er kein einziges Mal vergisst, mich sorgsam und absichtsvoll mit Gräfin anzusprechen, zerrt schon jetzt an meinen Nerven, und wir sind noch nicht einmal in Brasilien angekommen.
»… dieses Hotel ist teuer, und abgesehen davon wäre es bei Weitem sicherer, auf dem Schiff zu bleiben. Belém ist eine Handelsstadt. Gott weiß, welche Leute sich dort herumtreiben. Und es gab dort blutige Arbeiteraufstände!«
»Das war vor vierzig Jahren.«
»Belém ist wirklich eine schöne Stadt«, mischt sich nun der Ingenieur ein, der unsere Unterhaltung mit angehört hat. »Sie sollten sie sich ansehen.«
Der Reisemarschall funkelt ihn wütend an, während ich mir einen triumphierenden Blick über mein Weinglas hinweg nicht verkneifen kann. »Außerdem, lieber Reisemarschall, müssen wir doch ohnehin noch Währungen wechseln, habe ich nicht recht? In Belém gibt es sicher Wechselstuben.«
Es ist mein Trumpf im Ärmel. Der Reisemarschall ist für alles verantwortlich, was die Organisation der Reise betrifft – Fahrkarten, Reiserouten, Fahrzeuge und Übernachtungen –, und will unbedingt für jeden Fall vorbereitet sein. Da es in Brasilien eine Menge verschiedener Währungen gibt, die von Provinz zu Provinz wechseln, und er ganz sicher für jeden Fall das passende Geld in der Reisekasse haben will, kann er sich diesem Argument nicht verschließen.
»Oh, diese Geldwechselei, furchtbar«, dröhnt Senhor Oliviera, der ein paar Wörter aufgeschnappt hat. »Schon deswegen ist Brasilien ein grauenvolles Land. Alle paar Meter braucht man anderes Geld.« Ungefragt beginnt er einen seiner Vorträge, mich trifft derweil ein vorwurfsvoller Blick aus den Schlittenhundeaugen; ich zucke entschuldigend mit den Achseln. Die Suppe wird aufgetragen und in die Holzrahmen eingezurrt. Draußen vor den Fenstern haben sich die Wolken weiter verdunkelt; Bertha, die junge Wienerin, sieht selbst ein wenig grün im Gesicht aus, löffelt aber tapfer.
»Ich bin nur froh, wenn wir endlich an Land sind«, sagt sie in eine Atempause von Senhor Oliviera hinein. »Meine Cousine schrieb mir, dass das Wetter in Brasilien die ganzen nächsten Monate warm sein soll. Es ist doch schön, wenn man in eine Art ewigen Sommer hineinfährt. Und für meine Hochzeitsfeier ist es auch gut, dass es ganz bestimmt nicht regnet.« Der Reisemarschall neben mir stöhnt unterdrückt auf, und ich kann es ihm nicht verdenken. Bertha hat, ebenso wie Veronika, kaum ein anderes Gesprächsthema als ihre Hochzeit.
»Aber es stimmt doch.« Bertha sieht sich Beifall heischend um. »In Wien regnet es auch im Sommer. Man kann sich also nie sicher sein, was das Wetter angeht.«
»In Portugal heißt es, dass eine Regenhochzeit Glück bringt«, wirft der junge Ingenieur ein.
»Regen ist allemal besser als die verdammte brasilianische Hitze.« Senhor Oliviera lehnt sich zurück und tupft sich mit seiner Serviette Suppe aus dem Schnurrbart. »Wenn der Kaffee in Hamburg wachsen würde, würde ich ganz bestimmt dorthin ziehen. Kein Wunder, dass wir die Sklaven aus Afrika für die Ernte brauchen – kein normaler Mensch könnte in dieser Hitze arbeiten.« Er streift mit einem Blick die Schwiegermutter des Postbeamten am anderen Ende des Tischs. »Aber in Afrika ist es ja auch heiß.«
Der Kellner kommt und serviert uns den Hauptgang – heute Fisch und Gemüse. »Ist die Sklaverei aber nun nicht auch endlich in Brasilien abgeschafft, Senhor Oliviera?«, frage ich, während ich zu Messer und Gabel greife. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass es so ist. Es stand in den Zeitungen – die brasilianische Kronprinzessin hat endlich das entsprechende Dekret unterzeichnet, das dafür sorgt, dass Brasilien als letztes Land nun auch keine Sklaven mehr erlaubt.
»Endlich«, echot der Senhor aufgebracht. »Endlich? Das klingt, als sollte ich froh darüber sein. Es ist eine Katastrophe für Pflanzer wie mich. Wie stellt sich das der Kaiser vor – Plantagen ohne Sklaven? Wer soll die Arbeit nun tun? Und wer ersetzt mir das kleine Vermögen, das ich für die Sklaven ausgegeben habe?« Er schüttelt den Kopf. »Es ist eine Frechheit.«
Er greift wütend zu seinem Fischmesser.
»Ich bin mir sicher, die Menschen in Afrika fanden es auch eine Frechheit, gefangen und nach Brasilien verschleppt zu werden«, wirft der junge Ingenieur ein, der mir gegenübersitzt.
»Papperlapapp, liberales Gewäsch«, fährt ihm Senhor Oliviera über den Mund. »Brasilien geht vor die Hunde, das kann jeder sehen. Die Liberalen proben den Aufstand, und niemand greift durch. Der Kaiser ist alt und viel zu weichherzig.«
Der Kaiser ist tatsächlich sehr freundlich. Meine Mutter war eine Jugendfreundin der Kaiserin, und vor vielen Jahren habe ich beide einmal erlebt. Dom Pedro II. ist vielleicht alt und krank, aber auch klug und sanftmütig.
»Er ist ein alter Mann, der nicht versteht, dass ihn diese Revolutionäre und Demokraten eines Tages abschaffen werden«, sagt Senhor Oliviera.
»Was wäre so schlecht daran, wenn es eines Tages keine Monarchie mehr gibt?«, fragt der Ingenieur. »Es ist an der Zeit, dass sich die Dinge ändern, wenn Sie mich fragen.«
»Ich frage Sie aber nicht«, schnappt der Senhor.
»Er hat recht«, schalte ich mich ein. Alle sehen mich verblüfft an, auch der Reisemarschall und Bertha.
»Sind Sie nicht selbst eine Gräfin?«, fragt die.
»Bitte, um alles in der Welt, sprechen Sie nicht weiter«, zischt der Reisemarschall mir zu. Ich denke indessen gar nicht daran, dieser Bitte zu folgen. »Ich bin vielleicht eine … Gräfin, aber deswegen sehe ich trotzdem, dass die Leute mitbestimmen möchten. Sie wollen wählen. In Nordamerika tun sie das schon heute. Es ist ein großes Land und kommt völlig ohne König aus.«
Ich fange den Blick des Ingenieurs auf. Er zwinkert mir zu.
»Sei es, wie es sei.« Senhor Oliviera seufzt theatralisch. »Brasilien wird sich verändern. Keine Sklaven mehr und Aufstände. Dazu der Kautschuk – das neue weiße Gold mit seiner Metropole Manaus. Sagen Sie, haben Sie schon davon gehört? Ich muss Ihnen von Manaus erzählen; diese Stadt mitten im Regenwald. Ihre Könige sind die Kautschukbarone; allen voran César Scholz, sagenhaft reich geworden durch dieses Gummizeug …«
Er hebt zu einem seiner Vorträge an. Die Stimmung hat sich beruhigt, für den Rest des Essens plätschert das Gespräch dahin. Nach dem Nachtisch, als Senhor Oliviera sich endgültig den Schnurrbart ein letztes Mal säubert und offensichtlich in sanfterer Stimmung ist, sieht er mich an. »Aber Gräfin«, sagt er ernst und ein wenig weinselig, »wissen Sie, das brasilianische Licht – dieses Licht ist das schönste auf der ganzen Welt. Sie werden sehen.«
Veronika schläft immer noch oder schon wieder, als ich später in die Kabine zurückkomme, und ich lasse sie schlafen, was allerdings bedeutet, dass ich mich ohne Hilfe aus meinem Kleid schälen muss. Solange ich hier auf dem Dampfer bin, muss ich noch die komplizierten Kleider mit Mieder und Reifröcken tragen, und während ich mich leise schimpfend verrenke, um mich alleine auszuziehen, freue ich mich schon auf den Moment, in dem wir auf dem Amazonas ankommen, in den Regenwald eintauchen und ich endlich ungestraft meine einfachen Reisekleider tragen kann, die ich mir in München habe schneidern lassen. Keine Krinolinen, keine geschnürten Mieder, nur leichte lange Röcke, in denen man sich bewegen kann. Wenn ich ehrlich bin, ist es auch das, was mich am Reisen fasziniert – wenn ich weit fort bin, dann kann ich ich selbst sein. Nicht die Prinzessin, noch nicht einmal eine erfundene Gräfin, einfach nur Therese. Therese in einem einfachen Kleid.
Als ich es schließlich geschafft habe und auch mein Mieder über dem Bügel hängt, schlüpfe ich erleichtert in mein leichtes Nachthemd. Draußen, vor dem Bullaugenfenster, ist es mittlerweile endgültig Nacht geworden. Aus Rücksicht auf Veronika habe ich kein helles Licht aufgedreht, sondern nur die Gaslampe neben dem Toilettentisch. Die wirft einen gedämpften goldenen Schein in den Raum, als ich mich nun im Frisierspiegel betrachte. In dem weichen Schimmer sehe ich beinahe passabel aus, denke ich, die Gesichtszüge weicher als sonst. Nein, ich bin keine Schönheit, das weiß ich. Mein Kinn ist zu energisch, die Nase zu kräftig, die Stirn zu hoch, der Mund zu klein. Immerhin – Mamas nussbraune Augen, die ich geerbt habe, sind passabel. Das Hübscheste an mir sind wohl meine Haare, denke ich, während ich die Klammern aus meiner Frisur ziehe – dicht und honigblond. Sie fallen mir nun, wo ich sie aus ihrer Frisur befreit habe, schwer und lang über die Schultern.
»Wie flüssiges Gold.« Ich höre in meinem Kopf eine Stimme flüstern. Es ist Ottos Stimme. Damals im Sommer, als ich fünfzehn war und er zwei Jahre älter. Wir waren zusammen in Hohenschwangau zum Wandern; Ottos Bruder Ludwig war damals gerade bayerischer König geworden, und wir dachten, so würde es bleiben. Ludwig der König und Otto ein einfacher Prinz, ein netter, lieber Junge, den ich kenne, seit ich ein Kind war. In diesem Sommer sind wir durch die Berge gewandert, saßen im Gras, ruderten auf dem See. Es war alles so einfach und so vertraut. Und eines Tages strich Otto mir übers Haar und sagte, es sei wie Gold. »Therese«, fuhr er dann fort, »du weißt, dass wir eines Tages heiraten werden.« Ich sah ihn an und nickte. »Wen denn sonst?«, fragte ich, und er lächelte. »Ja, wen denn sonst?«
Wir waren glücklich in diesem Sommer und glaubten, dass alles ganz einfach werden würde. Aber alles kam anders. Ich greife zur Bürste und ziehe sie durch mein Haar. Ich denke an den Moment, in dem ich verstand, dass Otto, der hübsche junge Prinz, den ich liebte, seit ich denken konnte, krank war. Dass sein Geist sich verwirrte. Er fing an, schlechte Tage zu haben, an denen er niemanden erkannte, nicht einmal mich. Dann hatte er wieder gute Momente, in denen wir ins Ballett gingen oder an der Isar entlangspazierten. Aber die schlechten Tage wurden immer mehr und die guten immer seltener. Manchmal erkannte er mich. Dann sagte er leise meinen Namen. »Therese.« Und dann fragte er: »Liebst du mich noch?«
»Natürlich liebe ich dich. Ich liebe dich schon immer.«
»Wie kannst du mich lieben, wenn ich doch krank bin?«
»Ich liebe dich nur noch mehr deswegen.«
Ich höre unsere Worte als Echo durch die Jahre. Es ist wahr, ich liebe ihn immer noch, so wie ich ihn immer geliebt habe. Ich besuche ihn. Ich bin neben seiner Mutter die Einzige, die ihn noch besucht.
Ich stehe auf und gehe hinüber ans Fenster, sehe hinauf zum Mond. Wie es ihm jetzt wohl geht? Ich habe ihm bei meinem letzten Besuch erzählt, wohin ich reise, aber seine Augen waren trüb an diesem Tag, und ich glaube nicht, dass er verstanden hat. Ob er mich jetzt vermisst und sich fragt, wo ich bleibe? Mein Herz wird schwer, wenn ich daran denke.
Die Nacht ist tintenschwarz, die Wellen haben sich beruhigt, und der Sturm hat sich gelegt. Über der Manauense funkeln die Sterne, und der Mond scheint klar. Ich suche ein bestimmtes Sternbild, das vor ein paar Tagen zum ersten Mal aufgetaucht ist, der Beweis, dass wir nun in den Tropen sind. Da – das Kreuz des Südens. Es leuchtet zu mir herunter.
Schließlich lösche ich die Lampe und krieche in mein Bett. Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen gilt den riesigen Tieren, die in der Tiefe unter uns ihre Bahnen ziehen; Wale, Kraken, Quallen und Wesen, die noch niemand kennt. Weit über ihnen dampfen wir auf diesem weiten Meer durch die Nacht Brasilien entgegen.
Villa AmSee
Lindau, Bodensee, kurz vor Weihnachten 1924
Das Tageslicht war inzwischen schwächer geworden und lag mit einem leichten Blauschimmer über den Blumenbeeten, während Therese und Veronika in ihren warmen Mänteln über die Gartenwege gingen. Während Veronika wieder ihre eleganten Schuhe trug, steckten Thereses Füße in Gummistiefeln.
»Du müsstest den Garten im Sommer sehen«, sagte sie gerade. »Wenn die Rosen blühen, ist er am schönsten.«
Die Rosenstöcke, die sich über die Beete verteilten, waren im Winter angehäufelt worden und von Martin säuberlich in weiße Mulltücher gehüllt. »Es sieht aus, als würden sie schlafen. Sie träumen dem Frühjahr entgegen.« Therese zupfte an einer Pflanze die Mulldecke zurecht. »Ein paar von ihnen hat schon Mama gepflanzt, aber die meisten sind in den letzten zehn Jahren dazugekommen.«
Veronika lächelte. »Ich kaufe auch ständig Rosen.«
»Du?«
»Ja, ob du es glaubst oder nicht – ich bin unter die Gärtner gegangen. In den letzten Jahren ist es so still geworden bei uns. Wilhelmina und Sophie sind aus dem Haus, Pauline ständig in der Schule, und Rudolf, nun ja … er sitzt meist nur noch in seinem Arbeitszimmer und will seine Ruhe haben.« Wieder dieser Schatten, dachte Therese. Sie erinnerte sich an Veronika als Braut, die so schrecklich verliebt gewesen war.
»Na ja … da habe ich mich eben auf den Garten gestürzt«, plauderte Veronika weiter. »Rosen mochte ich ja schon immer – kannst du dich noch an meinen Brautstrauß erinnern? Da wollte ich erst Dahlien, und am Ende mussten es doch Rosen sein, weil sie einfach die romantischsten Blumen sind.« Sie lächelte. »Nun, jedenfalls haben wir inzwischen einen richtigen Rosengarten. Im Sommer duftet das ganze Schloss danach, wenn die Fenster offen stehen.«
Therese sah sie belustigt von der Seite an. »Du und Gärtnern, das kann ich kaum glauben.«
Veronika lachte und hängte sich bei ihr ein. »Tja, vielleicht sind es die späten Auswirkungen der Brasilienreise mit dir. Jemanden Pflanzenverrückteres als dich habe ich noch nie erlebt, ein bisschen musste das schließlich abfärben.«
Sie gingen unter den alten Eichen, den hohen kahlen Buchen und Kastanien durch den Park. Der Wind trieb ein paar vergessene Herbstblätter über den grünen Rasen. Von Weitem war ein kleiner Pavillon zwischen dem Schilf zu sehen.
»Was ist das dort?«, fragte Veronika neugierig.
»Der Türkische Kiosk. Aber wenn du nicht böse bist, dann zeige ich ihn dir wann anders. Zuerst musst du unbedingt das hier sehen.« Therese steuerte auf ein großes Gewächshaus zu. Die Seiten waren mit roten Backsteinen gemauert, der lang gestreckte Körper aber vollkommen aus Glas. »Das hier ist meine Schatzkammer, wenn du so willst.« Thereses Augen blitzten vergnügt. »Außerdem ist es dort drinnen warm.«
Tatsächlich schlug ihnen angenehm milde Luft entgegen, als sie das Gewächshaus betraten. Mehrere kleine ausrangierte Kanonenöfen waren angefeuert und strahlten ihre wohlige Wärme ab.
»Hier wachsen meine exotischen Lieblinge.« Therese breitete die Arme aus. »Na gut – und ein paar Karotten.«
Sie hatte recht, im Gewächshaus wuchs ein buntes Durcheinander: Karotten, Tomaten, Salat und Kohlrabi, aber auch Zitronen, Orangen, Mangos, und in einer Ecke gediehen mehrere prächtige Bananenstauden. Außerdem gab es ein kleines Hibiskusstämmchen mit roten Blüten, mehrere Orchideen und Gewürzpflanzen.
»Das hier ist mein neuester Zugang.« Therese betrachtete zufrieden eine Pflanze mit ledrig-grünen Blättern und einer kindskopfgroßen Blüte. Die Blütenblätter sahen aus wie aus merkwürdig weichen Stacheln in allen erdenklichen Rosatönen zusammengesetzt. In der Mitte lag ein samtig-schwarzer Stempel umgeben von pudrigweißen Fiederblättern. »Eine Protea cynaroides, eine Königsprotea aus Südafrika. Ich habe sie erst vor ein paar Wochen geschenkt bekommen.«
Veronika sah sich im Gewächshaus um. »Hast du denn auch brasilianische Pflanzen hier drinnen?«
»O ja, die Helkonie dort drüben. Sie ist tatsächlich noch von unserer Reise damals. Unglaublich, dass sie immer wieder blüht nach all den Jahren. Oh, und warte, die Tahiti-Gardenie muss ich dir auch unbedingt zeigen …«
Als sie schließlich wieder aus dem Gewächshaus in die kühle Abendluft traten, war die Dämmerung schon fortgeschritten. Sie beschlossen, einen Bogen nach rechts zu schlagen und zum Haus zurückzugehen. Dabei kamen sie an zwei kleinen Häuschen vorbei, die idyllisch zwischen den Bäumen lagen. In einem davon waren zwei Fenster erleuchtet, das andere war vollkommen dunkel.
»Dort drüben, wo Licht brennt, wohnt Martin«, erklärte Therese.
»Und wer wohnt in dem zweiten Haus?«
»Niemand. Während des Kriegs war dort mein Lazarett, aber seitdem steht es leer. Vielleicht sollte ich es instand setzen lassen und vermieten. In Lindau sucht schließlich immer jemand eine Wohnung, und seit der Inflation können sich viele kaum noch etwas leisten.«
Veronika musterte sie überrascht. »Warte – du hattest ein Kriegslazarett hier?«
Therese nickte. »Gleich im Herbst 1914 habe ich es eingerichtet. Ein paar Frauen aus der Nachbarschaft und aus Lindau haben mir geholfen. Wir haben viele Soldaten hier gepflegt, bis zum Kriegsende hindurch.«
»Großartig!« Veronika klang bewundernd. »Meine Mutter hat das auch immer gesagt – es ist wichtig, dass wir Frauen hier in der Heimat genauso heldenhaft mitkämpfen wie die Soldaten auf den Schlachtfeldern.« Sie rieb sich die kalt gewordenen Hände. »Ich habe in Rosenheim eine Nähstube während des Krieges geleitet. Dort haben wir Offiziersfrauen warme Kleidung genäht und Socken gestrickt. Ich fand es richtig aufregend, man hatte beinahe das Gefühl, auch für unser Vaterland beim Krieg dabei zu sein.«
Therese musterte die Freundin verstohlen. Nein, Veronikas Naivität hatte sich nicht verändert. Sie war immer noch durch und durch die patriotische Tochter aus guter Offiziersfamilie und Ehefrau eines Generals. Therese dagegen hatte während des Krieges nicht nur ein Lazarett für deutsche Soldaten geleitet, sondern war auch in die Gefangenenlager gegangen, hatte mit französischen und russischen Kriegsgefangenen gesprochen, sogar den verfeindeten Ländern dabei geholfen, Vermisste zu suchen. Sie überlegte, ob sie das Veronika erzählen sollte, aber nein, sie würde es bestimmt nicht verstehen.