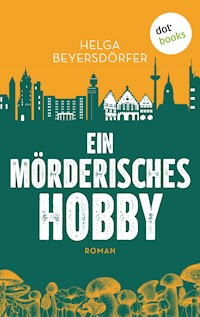2,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wem kann sie jetzt noch trauen? Der psychologische Spannungsroman »Die Frau im blauen Kostüm« von Helga Beyersdörfer jetzt als eBook bei dotbooks. Ein gefährliches Spiel mit der Wahrheit … Ihr Leben lang hat Doris Klees hart gearbeitet. Nun, mit Mitte 50, hofft sie, endlich die Hand nach dem Glück ausstrecken zu können: Der ebenso vermögende wie pflegebedürftige Henning Borsig hat versprochen, ihr sein Haus zu vermachen, wenn sie ihn als Haushälterin durch seine letzten Jahre begleitet. Doris sorgt für ihn, sie erträgt seine Launen, sein herrisches Benehmen … und ist geschockt, als sie erfährt, dass er das Grundstück hinter ihrem Rücken seinem Sohn überschrieben hat. Mit nie gekannter Überzeugung weiß Doris, dass sie sich dies nicht gefallen lassen darf – und beginnt, Recherchen anzustellen und Fäden zu spinnen. Aber wie weit darf sie dabei gehen? Was, wenn sie plötzlich Gegenspieler hat, die alles tun werden, um Doris’ Wunsch nach Gerechtigkeit zu ersticken? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Kriminalroman »Die Frau im blauen Kostüm« von Helga Beyersdörfer ist clevere Psycho-Spannung für die Fans von Ingrid Noll und Patricia Highsmith. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein gefährliches Spiel mit der Wahrheit … Ihr Leben lang hat Doris Klees hart gearbeitet. Nun, mit Mitte 50, hofft sie, endlich die Hand nach dem Glück ausstrecken zu können: Der ebenso vermögende wie pflegebedürftige Henning Borsig hat versprochen, ihr sein Haus zu vermachen, wenn sie ihn als Haushälterin durch seine letzten Jahre begleitet. Doris sorgt für ihn, sie erträgt seine Launen, sein herrisches Benehmen … und ist geschockt, als sie erfährt, dass er das Grundstück hinter ihrem Rücken seinem Sohn überschrieben hat. Mit nie gekannter Überzeugung weiß Doris, dass sie sich dies nicht gefallen lassen darf – und beginnt, Recherchen anzustellen und Fäden zu spinnen. Aber wie weit darf sie dabei gehen? Was, wenn sie plötzlich Gegenspieler hat, die alles tun werden, um Doris’ Wunsch nach Gerechtigkeit zu ersticken?
Über die Autorin:
Helga Beyersdörfer studierte Germanistik in Frankfurt am Main und machte danach eine Ausbildung zur Journalistin. Zunächst war sie als freie Autorin u.a. für das ZEIT-Magazin, dann als Redakteurin bei der Frankfurter Rundschau, STERN und SAT1 tätig. Helga Beyersdörfer lebt in Hamburg und ist Mitglied der Autorengruppe deutschsprachige Kriminalliteratur »Das Syndikat«, sowie der »Hamburger Autorenvereinigung«.
Bei dotbooks erscheint bereits ihre Krimi-Reihe um die Journalistin Margot Thaler mit den Bänden »Die Reporterin und der falsche Mörder«, »Die Reporterin und der faule Zauber« und »Die Reporterin und der tote Maler«.
Außerdem veröffentlichte sie bei dotbooks den Kriminalroman »Ein mörderisches Hobby«.
Die Website der Autorin: www.helga-beyersdoerfer.de/
***
eBook-Neuausgabe Mai 2023
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung eines Motives von Dmitry Elagin / shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-613-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Frau im blauen Kostüm«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Helga Beyersdörfer
Die Frau im blauen Kostüm
Kriminalroman
dotbooks.
Prolog
Am liebsten mochte sie ihre Tagträume. In ihnen erfüllte sich alles genau so, wie sie es sich wünschte. Wie leicht sie sich dann fühlte, getröstet, glücklich. Manchmal, wenn sie sich wieder für eine Stunde oder auch zwei zurückgezogen hatte, lag sie mit offenen Augen auf ihrem Bett, und die Möbel, die sie umgaben, erschienen ihr fremd, kalt, feindselig. Dann musste sie sich beherrschen, um sich nicht in der besseren Welt ihrer Träume zu verlieren.
Es half, wenn sie an ihr Ziel dachte. O ja, an dieses Ziel zu denken, das war wichtig. Wichtiger sogar, als davon zu träumen, wie es sein würde, wenn sie es erreicht hatte. Endlich einmal würde sie es sein, die triumphiert. Wenn sie nur keinen Fehler machte.
Wieder und wieder ging sie ihren Plan durch, es stimmte alles daran, sie hatte an alles gedacht, nichts konnte schiefgehen. Mitunter staunte sie darüber, zu welcher Disziplin und Zielstrebigkeit sie fähig war.
Das machte sie stolz, und mit dem Stolz wuchs ihre Entschlossenheit.
Anfangs war das nicht so gewesen, um ein Haar hätte sie sogar den schönen Plan wieder fallen lassen, weil sie an sich gezweifelt hatte. Alle zweifelten an ihr; niemand traute ihr etwas zu, am wenigsten sie sich selbst.
Ihr Leben lang hatte sie sich geduckt, gefügt, verzichtet und den Zorn darüber hinuntergeschluckt. Sie hatte geglaubt, es würde immer so weitergehen. Bis zu jenem Tag, an dem ihre Duldsamkeit ein Ende fand. Als sie wieder einmal abgedrängt, zur Seite geschoben werden sollte – kalt, zynisch, mitleidlos. Da beschloss sie, dass sie beseitigen musste, was sie peinigte. An jenem Tag war ihr Plan geboren worden. Von nun an dienten ihr jede Herablassung, jede Missachtung anderer als Antrieb. Ihre Zweifel wichen dem Trotz, der Trotz wurde zur Bestimmtheit.
Niemand, wirklich niemand konnte sie noch aufhalten.
Die Vorarbeiten waren geleistet, nun konnte sie an die Ausführung gehen. Jeden Schritt hatte sie akribisch in einer Kladde festgehalten, hatte abgewogen, überprüft, entschieden.
Sie hatte den Tag herbeigesehnt, an dem es endlich losgehen konnte. Heute war es so weit. Donnerstag, 19. Mai.
Sie holte die Kladde hervor und strich über den schwarzen Lackeinband. Ruhig und gefasst schlug sie die erste Seite auf, sah den verhassten Namen. Als sie die darunterstehende Telefonnummer las, bewegten sich ihre Lippen lautlos mit. Sie setzte sich auf ihr Bett, griff sich das Telefon und wählte.
Kapitel 1
Heike Horst nahm ihren letzten Telefonanruf gegen sechs Uhr abends entgegen. »Sie?«, rief sie aus, hörte dann eine Weile zu, sah ungeduldig auf die Uhr, schüttelte mehrmals verständnislos den Kopf und gab schließlich nach. »Also gut. Wenn es denn so wichtig für Sie ist, treffen wir uns meinetwegen gegen halb zehn heute Abend am Anleger, früher kann ich beim besten Willen nicht.«
Heike Horst hatte nicht die Absicht, sich durch den Anruf die Stimmung verderben zu lassen. Dumm genug, dass sie überhaupt ans Telefon gegangen war, sie schaffte es einfach nicht, das Ding zu ignorieren, wenn es läutete. So war es nun mal. Andererseits würde sie der kleine Abstecher ans Wasser nicht lange aufhalten, eine Bagatelle, das würde schnell erledigt sein.
Immer noch gut gelaunt ging sie ins Badezimmer, drehte die Dusche auf, verstaute ihre langen, blonden Haare unter einer Haube und stellte sich mit Behagen unter den Wasserstrahl. Die Dinge ließen sich bestens an, dachte sie, während sie sich mit dem neuen Gel einseifte, das nach Pfingstrosen duftete. Sie hatte allen Grund, sich auf eine sorgenfreie Zukunft zu freuen. Kein schlechter Ausblick für eine attraktive Vierzigjährige, die noch das halbe Leben vor sich hatte. Während sie sich abtrocknete, betrachtete sie ihren nackten Körper im Spiegel. Auch damit konnte sie zufrieden sein. Sie warf das nasse Badetuch in die Wanne und begann, sich anzukleiden. Als sie das blütenweiße T-Shirt über den Kopf zog und sich anschließend in ihre Reithosen zwängte, musste sie über sich selbst lächeln. Frisch geduscht in den Pferdestall. Es würde keine zehn Minuten dauern, bis sie nach Mist und Pferd riechen würde. Na und? Würde sie eben noch mal duschen, wenn sie nach diesem kleinen Umweg über den Anleger wieder nach Hause käme: Umso kuscheliger würde es dann sein, wenn sie sich anschließend mit ihrem Schmöker und wahrscheinlich einem ordentlichen Muskelkater ins Bett legen würde. Das Wochenende versprach noch anstrengend genug zu werden. Morgen Vormittag wollte sie anfangen, die ersten Kisten zusammenzupacken.
Jetzt musste sie aber los, sie wollte zu ihrer zweiten Reitstunde nicht zu spät kommen. Sie schulterte ihre Umhängetasche und sah sich nach ihren Reitstiefeln um, bis ihr einfiel, dass sie die nach der letzten Stunde im Kofferraum liegen gelassen hatte, ungeputzt natürlich, das würde ganz schön miefen. Aber ihre gute Laune konnte auch diese kleine Schusseligkeit nicht trüben. Aus dem Schuhschrank in der Diele kramte sie ein Paar altgediente Flachtreter heraus, in die sie trotz ihrer dicken Socken mühelos hineinschlüpfen konnte.
Im Hinausgehen warf sie einen letzten prüfenden Blick zurück in die kleine Wohnung, die sie bald gegen eine größere, sehr viel schönere tauschen wollte. Die drei Tage schaffe ich auch noch, dachte sie, bevor sie die Wohnungstür zuschloss.
Gut zwei Stunden später stieg sie, verschwitzt und mit dem Gefühl, nahezu jeden Muskel ihres Körpers trainiert zu haben, wieder in ihren blauen BMW. Der neunzehnte Mai verabschiedete sich mit milden Temperaturen und einem tiefen, grauen Himmel. Sie schaltete das Licht ein, ließ ihr Seitenfenster nach unten surren und fuhr los. Es roch nach Frühling.
Der Wagen rumpelte über den unebenen Feldweg, der vom Reiterhof wegführte. Erst als sie auf die Landstraße stieß, fiel ihr ein, dass sie ja einen Umweg über den Mainanleger machen, mithin nach rechts anstatt nach links abbiegen musste. Ungeduldig kroch sie hinter einem Traktor her, bevor der endlich nach ein paar Minuten in die Zufahrt zu einem Bauernhof einbog. Wenn sie pünktlich sein wollte, musste sie sich beeilen. Sie griff das Lenkrad fester und beschleunigte.
Im Autoradio spielten sie Hits der Achtzigerjahre. Sie hupte zwei Radfahrer an, die gemächlich und ohne Licht nebeneinander herradelten, und zog kopfschüttelnd an ihnen vorbei. Lebensmüde, diese Typen.
Fast hätte sie deswegen die Abfahrt nach Seligenstadt verpasst. Mit quietschenden Bremsen nahm sie eine Rechtskurve und war wenige Minuten später an der Ortseinfahrt. Sie ließ die Fenster hochsurren, strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn und fragte sich nicht zum ersten Mal, welche unerklärlichen Launen des Zufalls oder des Schicksals sie wohl hierhergeführt hatten, in diese südhessische Region und in diese Kleinstadt mit dem mittelalterlichen Flair, die offenbar dazu ausersehen war, auf unbestimmte Zeit ihre Heimat zu werden.
Sie griff sich an den Nacken, es war kühl geworden im Wagen.
Kurz hinter der Ortseinfahrt wies ein weißes Schild nach links zum Anleger der Fähre. Sie bog ab, rollte ein abfallendes Gässchen hinunter zum Main, verlangsamte und kniff die Augen zusammen. Die Dämmerung ging schon in Dunkelheit über. Mein Gott, war das einsam hier. Am Ufer parkte nur ein Auto, ein silbergrauer Volvo. Die Fähre fuhr nicht mehr um diese Zeit. Jenseits des Uferstreifens, zur Landseite hin, waren schemenhaft die Umrisse eines Restaurants zu erkennen, dessen einzige Lichtquelle an diesem Abend eine funzlige Laterne war, die über dem Treppenaufgang hin und her schwankte.
Es sah nicht so aus, als verirrten sich viele Leute an einem Donnerstagabend im Mai hierher. Heike Horst parkte neben dem Volvo. In der einbrechenden Dunkelheit verschwammen Uferbegrenzung und Fluss in einer einzigen schwarzen Ebene. Ihr fiel ein, dass Henning ihr von einem schrecklichen Unfall erzählt hatte, der vor einiger Zeit nicht weit von hier geschehen war. Vielleicht sogar genau hier. Eine Frau war in ihrem Wagen ertrunken, weil sie den falschen Gang eingelegt hatte. Erschrocken zog sie die Handbremse. Musste sie jetzt wirklich an so etwas denken? Sie löste den Gurt und wollte aussteigen, als sich im selben Moment die Beifahrertür öffnete und sie ihren Namen nennen hörte.
Ungefähr zwanzig Minuten später pfiff ein älterer Mann seinen Boxer zurück, der mit Ausdauer und Genuss sein Bein gegen den Reifen eines silbergrauen Volvo hob.
»Die Luft ist feucht heute Abend«, sagte der Mann zu seiner Frau, die verdrossen neben ihm hertrottete und wie zur Bestätigung die Kapuze ihres Anoraks über die kurzen, grauen Locken zog. »Lass uns heimgehen«, sagte sie, »das ist so duster hier, direkt unheimlich.« Mit zusammengekniffenen Augen versuchte sie, ihren Hund auszumachen, der zwischen den zwei einsam am Ufer geparkten Autos verschwunden war. Der Mann pfiff erneut nach dem Hund, dann rief er ihn.
»Lucky, hier.« Die Stimme verhallte. Vom Ufer hörten sie das Platschen des Wassers, dann ein Knurren. »Jetzt komm endlich her!«, rief der Mann ärgerlich, in seiner Stimme schwang nun auch Unbehagen mit. Rasch liefen sie vor zum Fluss. Der Hund stand noch immer zwischen den Autos, hatte aber von dem Volvo abgelassen und knurrte mit hochgezogenen Lefzen den anderen Wagen an. Der Mann trat noch einen Schritt näher und schüttelte den Kopf.
»Die werden auch immer schamloser«, sagte er über die Schulter zu seiner Frau und deutete auf den BMW. »Guck dir mal an, wie die zwei da drin übereinanderhängen.«
Die Frau rieb fröstelnd ihre Hände aneinander. »Stier da nicht so hin, das macht man nicht. Außerdem, wir waren auch mal jung.«
»Aber nicht so«, brummte ihr Mann. Er griff nach der Leine, die um seinen Hals baumelte, ging in die Hocke und lockte seinen Boxer zu sich. Diesmal gehorchte der Hund, blieb aber auf dem Weg zurück noch mehrmals mit gespreizten Beinen stehen.
Wann genau der Wagen in den Fluss gerollt war, konnte später nicht mehr festgestellt werden, nur wann er geborgen wurde: gegen sechs Uhr morgens. Die Identität der Fahrerin hingegen war schnell geklärt. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen auf und gab bereits am nächsten Tag bekannt, dass keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden gefunden worden seien.
»Und wo ist er?«, fragte der Mann mit dem Boxer seine Frau, nachdem er von dem Unglück gehört hatte.
»Wer er?«, fragte die zurück.
»Na, der noch mit drin gesessen hat.«
»Was weiß denn ich.«
»Sollten wir das nicht der Polizei sagen?«
»Ach was. Wir haben doch gar nichts gesehen in der Dunkelheit. Vor allem will ich keine Scherereien.«
Kapitel 2
Das Unglück sorgte ein paar Tage lang für Gesprächsstoff, am meisten natürlich am Ort des Geschehens, aber da kaum jemand in Seligenstadt Heike Horst gekannt hatte, war die persönliche Anteilnahme gering. Die Untersuchung des Autos der Verstorbenen hatte nichts Spektakuläres ergeben. Fest stand, dass die Handbremse nicht angezogen und auch der Gang nicht eingelegt gewesen war, was den Schluss nahelegte, dass die Fahrerin auf dem leicht abschüssigen Uferstreifen ins Rollen geraten war und wegen der Dunkelheit die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt hatte. In den örtlichen Zeitungen wurde die Frage aufgeworfen, wie gefährlich das Parken am Fluss sei und wann endlich eine Begrenzung zwischen Fluss und Ufer errichtet werde, um weitere tragische Unfälle zu vermeiden. Die örtlichen Parteien versicherten, diese Frage gewissenhaft zu prüfen.
Der Mann mit dem Boxer beteiligte sich nicht an solchen Spekulationen, überhaupt vermied er nach Möglichkeit Gespräche über das Unglück. Seit jenem Abend mieden er und seine Frau auch die Stelle, wo es passiert war, mit ihrem Hund gingen sie nun weiter flussaufwärts spazieren. Von ihrer Beobachtung hatten sie niemandem etwas erzählt.
Als die sterbliche Hülle der Heike Horst endlich in ihre Geburtsstadt Weimar überführt und sie dort genau zwei Wochen nach dem tragischen Ereignis beerdigt wurde – am zweiten Juni, wieder ein Donnerstag –, war sie in Seligenstadt fast schon in Vergessenheit geraten.
Eine Frau allerdings gab es, die immer wieder an die Ereignisse zurückdachte, sie war Heike Horst mehrmals begegnet.
»Heute wird die junge Frau beerdigt«, sagte sie zu ihrer Vermieterin, die im Erdgeschoss wohnte und der sie donnerstagmorgens immer die Zeit vom Kiosk mitbrachte. »Da kann man wieder einmal sehen, wie schnell alles zu Ende sein kann.« Die Vermieterin, eine pragmatische, bodenständige Person, pflügte mit zwei Fingern den Inhalt ihrer Geldbörse um und pickte endlich ein Zwanzigcentstück und drei Euro heraus. »Hier, danke.« Sie wollte sich schon umwenden, um in ihre Wohnung zurückzugehen, besann sich dann aber doch auf eine Antwort. »Es ist halt, wie es ist, Doris. Du musst dir nicht immer um alles einen Kopf machen. Du lebst ja noch.« Mit einem aufmunternden Zwinkern verschwand sie hinter ihrer Wohnungstür und ließ Doris Klees alleine im menschenleeren Treppenhaus zurück.
Das metallene Klacken der Briefkästen draußen am Eingang durchbrach die Ruhe. Doris sah durch die Milchglasscheibe die verschwommenen Konturen des Briefträgers, der sich hinunterbeugte, um Post in die Schlitze zu stecken. Für mich ist sowieso nichts dabei, dachte sie betrübt, nahm ihren Einkaufsbeutel mit der Tageszeitung und den abgepackten Brotscheiben für das heutige Abendbrot vom Boden auf und stieg die Treppen hinauf zu ihrer Dachwohnung. Wie meist begegnete ihr niemand auf dem Weg nach oben.
Es war ein ruhiges Haus, Kinder gab es hier keine, jeder war mit sich beschäftigt. Man grüßte sich freundlich, mehr nicht. Manchmal, wenn sie sich danach sehnte, wenigstens ab und zu Geräusche zu hören, die Nähe von Leben zu spüren, wies sie sich selbst in die Schranken. Sie sollte in dreiundfünfzig Lebensjahren wahrlich gelernt haben, alleine zu sein. Kränklich, zart, klein, war sie ohne Geschwister aufgewachsen, unter den Augen einer überängstlichen Mutter, auf Distanz gehalten von einem Vater, der enttäuscht gewesen war von diesem mickrigen, schreckhaften Wesen. Doris hatte nicht vergessen, wie nervös und fahrig sie geworden war, sobald er in ihre Nähe kam. Heute ging es ihr mit Henning oft ähnlich.
Ach je, Henning. Doris sah auf die Uhr und erschrak. Henning erwartete sie wie immer um zwölf, und sie hatte noch nicht einmal den abgerissenen Knopf an ihrer Kostümjacke angenäht. Normalerweise erledigte sie notwendige Arbeiten wie diese umgehend und mit der Präzision, die alle von ihr erwarteten, am meisten sie selbst. Dies galt auch für ihre Kleidung. Abends pflegte sie Kostüm und Bluse für den nächsten Tag von außen an die Schranktür zu hängen. Lange Hosen besaß sie nicht, sie bevorzugte knielange Röcke von solider Qualität mit einer passenden Jacke, vorzugsweise in Blau oder weiß-blau gemustert. Dazu schlichte, klassische Pumps, die ihren ein Meter fünfzig immerhin sechs Zentimeter dazumogelten. Insgeheim fand sie, dass ihre Beine sich sehen lassen konnten, aber das mochte ein Irrtum sein, denn noch nie hatte irgendwer ein Wort darüber verloren. Auch Henning nicht, natürlich nicht. Als sie beide noch jung waren, da hätte sie viel darum gegeben, gerade von ihm ein anerkennendes Wort zu hören, vielleicht sogar ein wenig mehr. Aber das war lange her, das waren Träume, die sich nie erfüllt hatten, Träume, die sie sich verbot. Schließlich war Henning mittlerweile ihr Chef. Andererseits war er nicht einfach nur Chef. Etwas persönlicher war ihre Beziehung schon. Weil sie sich so lange kannten, wussten sie, was sie voneinander erwarten konnten. Sie trauten sich nicht nur, sie vertrauten sich.
Sie ging in ihr Schlafzimmer, wo auf der Kommode die Holzschatulle stand, in der sie neben anderen Utensilien auch ein Kästchen mit Knöpfen in allen Farben und Größen verwahrte, suchte den passenden Knopf heraus und verschloss alles wieder. Sie tat das mit großer Sorgfalt, denn diese Schatulle war etwas Besonderes und durfte keinesfalls beschädigt werden. Hennings Vater hatte sie ihr zum achtzehnten Geburtstag geschenkt. Das war nun schon fast vierzig Jahre her.
Ihre Eltern waren damals schon tot, und sie war nicht eben verwöhnt worden mit Geschenken. Sie erinnerte sich noch gut an das Glücksgefühl, als er ihr das Päckchen, so groß wie ein Schuhkarton, überreichte und sie es fast andächtig auspackte. Ihre Hände fuhren über das glatte Rosenholz und berührten vorsichtig die Federn, mit denen der Deckel geschmückt war. Drei königsblaue Federn, ein schöneres Blau hatte sie nie gesehen. Als sie den Deckel hob, sah sie, dass das Innere mit blassblauer Seide ausgeschlagen war. Die Seide war inzwischen dünn und brüchig geworden, und die Scharniere hatten sich im Laufe der Jahrzehnte ein wenig verzogen. Das Holz aber war ohne jeden Makel, und die Federn hatten ihre Farbe bewahrt.
Sie beugte sich hinunter und pustete dagegen, so wie sie es jeden Tag tat, um zu verhindern, dass sich Staub ansetzte, nähte danach mit geübten Handgriffen den Knopf an und goss noch rasch die Alpenveilchen am Fenster. Es regnete schon wieder. Einen Moment sah sie nachdenklich in den grauen Himmel. Wenn sie es genau bedachte, war Henning nach dem Tod seines Vaters der vertrauteste Mensch, den es für sie gab.
Sie schlüpfte in ihre Pumps, griff nach dem Regenmantel und schloss die Tür hinter sich.
Während Doris Klees eilends den Marktplatz überquerte, um wie gewohnt pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, saß im fünfhundert Kilometer entfernten Berlin eine junge Frau in einem Arbeitsraum im Untergeschoss der Freien Universität Berlin und schrieb ihren Namen auf einen Protokollbogen: Julia Stromberg.
Noch war nichts von dem, was die Gemüter in einem ihr völlig unbekannten hessischen Städtchen erhitzt hatte, bis zu ihr vorgedrungen. Selbst wenn die Nachricht von der Toten im Main es bis in den Berliner Blätterwald geschafft hätte, wäre sie an ihr vorbeigerauscht. Julia hatte andere Sorgen. Tag für Tag tauchte sie in den Strom der namenlosen Studenten, die auf den Fluren von hier nach da zogen und sich bemühten, nicht abzusaufen in der Anonymität des Molochs Universität, nun war sie es leid. Julia knallte den Kugelschreiber auf den Tisch, lehnte sich zurück und streckte ihre langen Beine unter dem Tisch aus. So konnte es nicht weitergehen, es musste sich etwas ändern. Aber was? Und wie?
Vom Flur draußen hörte sie Stimmen und das Scharren von Stühlen. Ihre Versuchspersonen waren eingetroffen. Julia erhob sich, zog ihre Jacke über, steckte die blonden Haare am Hinterkopf fest und kontrollierte noch einmal sorgfältig die Geräte, die sie für das Eye Tracking brauchte. Nichts Aufwendiges, es ging nur darum, die Reaktion der Augen auf optische Reize zu testen. Die Ergebnisse benötigte sie für ihre Semesterarbeit, wenn etwas schiefging, würde sie alles wiederholen müssen – eine nicht eben verlockende Aussicht.
Verdammt, was sollte denn schiefgehen! Sie schüttelte den Kopf. Diese Schwarzseherei passte nicht zu ihr, noch dazu blockierte sie jeden Funken Energie. So viel zumindest sollte sie gelernt haben in drei Semestern Psychologie. War sie etwa drauf und dran, zu resignieren?
Reglos stand sie in der Mitte des kleinen, dunklen Raumes und ballte unwillkürlich die Hände zu Fäusten. Niemals! Aufgeben kam nicht infrage. Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich nun endlich Taten sehen. Sie stutzte. Faust, Leistungskurs Deutsch. Wieso mischte der sich ungefragt ein? Super, jetzt mogelten sich schon Klassiker in ihre Selbstgespräche. Fehlte nur noch, dass sie sich mit Nordic-Walking-Stöcken am Halensee wiederfand oder in einem Batikkurs an der Volkshochschule.
Sie schrak zusammen, als es klopfte und einer der Wartenden seinen Kopf durch den Türspalt schob. »Was ist nun, passiert heute noch was?«
Julia sah ihn zuerst überrascht, dann geradezu dankbar an. »Ich hoffe doch«, antwortete sie – und das war die reine Wahrheit.
Kapitel 3
Henning Borsig saß in seinem Wohnzimmer vor dem großen Blumenfenster, durch das er einen freien Blick über den Gartenweg hinweg zur Pforte hatte. Dicke Regentropfen perlten an den Rosenstöcken im Garten ab, am Himmel formten sich schon wieder neue graue Wolken.
»Scheißwetter«, knurrte er. Die feuchtkalte Witterung machte alles noch schlimmer. Schon beim Aufwachen hatte ihm geschwant, dass er an diesem Tag wieder auf dieses zusammengeklappte schwarze Ding angewiesen sein würde, das griffbereit neben seinem Bett lehnte. Das Wort Rollstuhl würde er nicht einmal denken, geschweige denn aussprechen, genauso wenig wie das Wort Arthrose. Arthrose! Lächerlich! Er war gerade mal Mitte fünfzig. Die Quacksalber in Frankfurt hatten ja keine Ahnung. In sechs Tagen würde er auf eigene Faust nach Lüdenscheid fahren in die Sportklinik. Dort waren sie spezialisiert auf Kerle wie ihn. Baumlange, kräftige Männer humpelten da auf Krücken herum, alle mit kaputten Gelenken oder mit künstlichen, die ihnen die Ärzte kurz zuvor eingepflanzt hatten. Fußballer, Basketballer oder Handballer wie er. Die harten Hallenböden waren Gift für die Gelenke. Na, das wusste er inzwischen selbst. Jedenfalls sollten die ihn da wieder zurechtflicken, und wenn alles gut ging, würde er dieses Dings hier anschließend eigenhändig auf den Müll werfen.
Das Telefon läutete, er hatte es oben im Schlafzimmer liegen lassen. Als es verstummte, spürte er die Stille im Haus. Das in Weiß gehaltene Wohnzimmer, dessen einziger Schmuck die freigelegten Balken in den Wänden waren, das dahinterliegende Arbeitszimmer mit Schreibtisch und Computer, der blank polierte antike Eichentisch mit den geraden Stühlen, all das wirkte auf ihn wie ein eingefrorenes Bild.
Seine Lippen pressten sich noch eine Spur fester aufeinander. Er kam zu sehr ins Grübeln, zum Beispiel über das Alleinsein. Herrje, er war doch sonst auch nicht sentimental. Und doch schweiften seine Gedanken schon wieder ab. Ob sie den Sarg schon in die Erde gelassen hatten? Richteten sie auf dem frischen Grab bereits die Kränze und Schleifen? Er versuchte, sich die Szene vorzustellen, aber er wusste ja nicht einmal, wo ihr Grab lag, den Friedhof von Weimar hatte er nie gesehen. Wie auch, er war in seinem ganzen Leben gerade mal zwei Tage in Weimar gewesen. War unerfreulich genug gelaufen. Sehr unerfreulich. Bis auf eine Ausnahme: Heike. Hervorragend, wie sie seine Aufträge erledigt hatte. Sie hatte Biss, war ehrgeizig, das hatte er sofort gemerkt, sie war der Typ, der eine Gelegenheit beim Schopf packt. Na, hatte sie ja auch getan, hatte nicht lange gedauert, da hatte sie begriffen, dass er ihr mehr Zukunft bieten konnte, als ihr in diesem verschlafenen Büro in Weimar jemals zuteilgeworden wäre. Und nun hatte sie keine Zukunft mehr. Aus. Vorbei. Henning räusperte sich, sein Hals fühlte sich trocken an.
Das Quietschen des Gartentors zeigte ihm an, dass es zwölf Uhr sein musste. Er stützte sich mit den Armen auf, um sich zum Fenster hin vorbeugen zu können. Inzwischen hatte ein feiner, dichter Nieselregen eingesetzt. Vom Tor her lief Doris mit kleinen, schnellen Schritten auf das Haus zu.
Wie immer hatte sie um kurz nach halb zwölf ihre Wohnung verlassen, hatte gegen Viertel vor zwölf den Marktplatz in Seligenstadt überquert, hatte im Gemüseladen rasch noch frisches Obst und Milch eingekauft und war dann in die winklige Seitengasse eingebogen, die zu Hennings Haus führte, ein altes Fachwerkhaus, dessen Modernisierung und Restaurierung viel Zeit und Geld verschlungen hatten.
Sie war jetzt unter dem hölzernen Vordach angekommen, schüttelte ihren Schirm, stellte ihn zum Abtropfen aufgespannt neben die Eingangstür und schloss auf.
Wie alle alten Fachwerkhäuser hatte auch dieses niedrige Decken, aber Henning hatte einige Wände herausnehmen lassen, und helle Farben sowie ein zusätzliches Fenster in der Dachschräge über der Treppe sorgten für mehr Weite.
Vom Eingang aus reichte der Blick bis ans gegenüberliegende Ende in Hennings Arbeitszimmer hinein, die gläserne Schiebetür stand offen.
Am Schreibtisch sitzt er jedenfalls noch nicht, dachte Doris, während sie ihren Regenmantel an den runden Garderobenständer hängte. Ein Blick links zur Treppe zeigte ihr, dass der Treppenlift unten war, Henning war also nicht mehr oben im Schlafzimmer oder in seinem Whirlpool. Ein komplettes Zimmer hatte er geopfert, um dieses Monstrum einbauen zu lassen. Nun konnte er zwar keine Gäste mehr einquartieren, dafür hätte aber eine halbe Fußballmannschaft Platz in seinem neuen Lieblingsspielzeug. Na gut, das war vielleicht übertrieben, aber letztlich war das egal, da Henning seit Langem schon keine Gäste mehr einlud, geschweige denn Fußballmannschaften.
Sie seufzte, betrachtete den Stapel Post, den sie vorne am Tor aus dem Briefkasten genommen hatte, und wendete jeden einzelnen Brief. Beim letzten Absender stutzte sie. »Was zum Kuckuck«, entfuhr es ihr, aber sie hielt sich schnell die Hand vor den Mund, lauschte eine Sekunde und schob den Brief, ohne viel nachzudenken, in die Tasche ihrer Kostümjacke.
»Was treibst du denn da draußen?« Hennings Stimme klang ungeduldig, beinahe schroff. Aber das war sie gewohnt.
»Ist ja schon gut«, rief sie zurück, »bin gleich so weit.« Widerwillig tauschte sie ihre Pumps gegen die Mokassins, die in der Diele für sie bereitstanden, eine Anordnung von Henning als Schutz für seine empfindlichen Holzböden. Sie hatte sich nicht widersetzt, obwohl sie seit ihrem sechzehnten Lebensjahr grundsätzlich Pumps trug, sechs Zentimeter hoch und fußfreundlich gearbeitet natürlich, nicht diese spitzen Dinger, auf denen die meisten Frauen herumstaksten wie auf rohen Eiern. Missmutig sah sie hinunter auf die ungeliebten Mokassins, die so gar nicht zu ihrem Kostüm passten. Auch wenn Henning gelegentlich darüber lästerte, ihre Art, sich zu kleiden, konnte selbst er ihr nicht ausreden. »Doris!«
»Ja doch.« Sie tastete nach ihrer Jackentasche, in der sie den Brief hatte verschwinden lassen. Durfte sie das überhaupt? Ich will ja nur nachsehen, was drinsteht, weil Henning sich nicht aufregen soll, beruhigte sie ihr Gewissen. Jede zusätzliche Aufregung muss vermieden werden. Wenn der Brief harmlos ist, klebe ich ihn wieder zu und gebe ihn ihm. Wenn nicht, muss ich überlegen, was ich mache. War Henning nicht schon unglücklich genug?
Sie zögerte nicht länger und ging rasch mit der übrigen Post in der Hand zu ihm. Er saß am Fenster und starrte hinaus. Nicht zum ersten Mal dachte sie, dass dem Raum Wärme fehlte. Ärgerlich betrachtete sie die kahle Fensterbank. Ihr Angebot, ein paar Töpfe mit Frühlingsblumen aufzustellen, hatte Henning brüsk zurückgewiesen. Überhaupt wurde er immer ruppiger in letzter Zeit. Manchmal befürchtete sie, dass er nur noch für seine Geschäfte lebte, dass ihm das Geld die Menschen ersetzte. Seine Bewunderung für diese skrupellose, kalte Karrieristin Heike Horst hatte diese Befürchtung bestätigt. Diese Frau hatte einen verhängnisvollen Einfluss gehabt. Sie hatte Macht über ihn gewinnen wollen. Selbst im Privaten. Wie ein Krake hatte sie ihre Tentakel ausgefahren. Erst wenige Tage vor ihrem Tod war sie ins Haus geschneit, hatte die Nase gerümpft und ein paar »vernünftige Änderungen« angeregt. Tja, Pech gehabt.
Dieser Kelch, dachte Doris, während sie Henning die Post reichte, ist immerhin an uns vorübergegangen.
Er griff hastig danach, blätterte alles durch, als erwarte er etwas Bestimmtes. Rechnungen, Reklame, Einladungen. Enttäuscht ließ er die Hände in den Schoß sinken und starrte wieder hinaus in den Regen.
Doris betrachtete ihn mit einer Mischung aus Verständnis und Ratlosigkeit. Sie war versucht, ihm eine Strähne aus der Stirn zu streichen. Er hatte noch immer das gleiche feine, dunkelblonde Haar wie als junger Mann. Auch seine sportliche Figur hatte er sich lange bewahren können. Erst seit er vor einem Vierteljahr sein geliebtes Handballtraining endgültig hatte aufgeben müssen, zeigte sich ein leichter Bauchansatz da, wo vorher nur Muskeln gewesen waren. Es war ein Jammer. Sie suchte in ihrer Jacke nach einem Taschentuch und zog ihre Hand erschrocken zurück, als sie den Brief ertastete.
Das Läuten des Telefons durchbrach die angespannte Ruhe. Doris sah sich suchend um. »Es liegt noch oben im Schlafzimmer«, sagte Henning. Sie nickte, huschte mit ihren kleinen, kurzen Schritten den Flur entlang und die Treppe hinauf und zog das Telefon unter einem Kopfkissen hervor.
»Bei Borsig.«
»Hier ist Maria Dormann aus Weimar. Ich muss mit Herrn Borsig sprechen.«
So, musst du, dachte Doris, wollen wir erst mal sehen, ob er das auch so sieht. »Ich sehe mal nach, ob er noch da ist«, antwortete sie kurz angebunden, zum einen, weil sie noch ein wenig außer Puste war, zum anderen, weil sie den Namen dieser Person noch nie gehört hatte. Sie eilte die Treppe wieder hinunter zu Henning. »Eine Frau Dormann«, flüsterte sie ihm zu. Er hob abwehrend die Hände. Das war eindeutig.
»Tut mir leid. Herr Borsig hat das Haus bereits verlassen.« Sie hörte die Frau atmen, offenbar war sie unschlüssig, was sie nun tun sollte. »Richten Sie ihm bitte aus, dass ich angerufen habe«, sagte sie endlich. Dann klackte es in der Leitung. »Einfach aufgelegt.« Doris reichte den Apparat empört an Henning weiter. »Das ist ja ein Benehmen. Wer war das überhaupt?«
Henning schüttelte unwillig den Kopf. »Nicht wichtig, vergiss es.« Er bemerkte nicht, dass Doris sich abwandte, um zu verbergen, wie gekränkt sie wieder einmal war. Er schloss sie immer weiter aus seinem Leben aus, wurde von Tag zu Tag unnahbarer. Sie schluckte. »Wann willst du essen?«
»Nicht vor drei«, raunzte er, wendete den Rollstuhl und trieb ihn energisch durch den breiten Durchbruch ins angrenzende Arbeitszimmer. An seinem Schreibtisch warf er die Post achtlos auf die Ablage und beugte sich vor, um den Computer einzuschalten. Es wurde Zeit für die tägliche Kontaktaufnahme mit seinem Kompagnon. Die Geschäfte der Immobilienagentur Borsig und Co. mussten schließlich weiterlaufen.
Doris zog sich in die Küche zurück, den einzigen Ort in diesem Haus, an dem sie sich behaglich fühlte. Die Küche, die gleich rechts hinter dem Eingang lag, war der Modernisierung entgangen, weil Henning nach seiner Scheidung vor fast elf Jahren keinen Sinn darin gesehen hatte, sie auf den neuesten Stand zu bringen. So war der grüne, frei stehende Schrank aus massivem Holz ebenso erhalten geblieben wie das steinerne Spülbecken unterhalb des Fensters, flankiert von Herd und Kühlschrank, den einzigen Zugeständnissen an die Moderne. An der Seite gegenüber dem Fenster stand ein robuster Holztisch, unter den zwei Hocker geschoben waren. Einen davon zog sie jetzt hervor, setzte sich und lehnte sich gegen die Wand. Da Henning sicherlich beschäftigt war, bis sie ihn zum Essen rief, konnte sie sich nun ungestört dem Brief widmen. Sie schob die Einkaufstasche beiseite, die noch immer auf dem Tisch stand, nahm den Brief und las noch einmal den Absender: Thorsten Borsig. Der Junge hatte sich seit elf Jahren nicht gemeldet. Wieso jetzt? Das konnte nichts Gutes bedeuten. Geld! Sicher wollte er Geld. Thorsten musste mittlerweile um die zweiundzwanzig sein. Die brauchten doch alle Geld in diesem Alter, für ihre teuren modischen Fummel, für Handys, Discos, Alkohol, am Ende gar Drogen. Henning würde sich fürchterlich aufregen. Das konnte sie nicht zulassen. Nicht jetzt, wo es ihm so schlecht ging. Sie zögerte nicht länger, öffnete den Umschlag behutsam und stutzte bereits bei der Anrede:
An Henning Borsig, Ex-Vater.
Du meinst wohl, ich falle Dir um den Hals, nur weil Du Dich nach elf Jahren bequemt hast, mir zu schreiben. Tu ich nicht. Und wenn Du glaubst, Du kannst mich kaufen, liegst Du erst recht falsch. Du bist genau der geile Geldhai, den ich mir immer vorgestellt habe. Deshalb glaube ich auch, dass Dein großartiges Angebot einen Haken hat. Und weil ich den finden will, guck ich mir das Objekt an. Aber auch nur, weil ich demnächst sowieso in Weimar bin.
Doris ließ das Blatt sinken. Weimar? Schon wieder Weimar? Eine ungute Ahnung ließ ihre Hände zittern, sodass sie sich regelrecht zum Weiterlesen zwingen musste. Schon nach wenigen Zeilen riss sie empört die Augen auf, las noch einmal, ungläubig, mit wachsender Wut. »Das darf Henning nicht«, brach es aus ihr heraus, »das kann er mir nicht antun.«