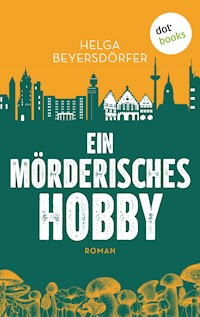4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der eigenen Vergangenheit kann man nicht entfliehen … Der packende Regio-Krimi »Die Toten von Worpswede« von Helga Beyersdörfer als eBook bei dotbooks. Eine tödliche Kälte liegt über dem Teufelsmoor … Als er hört, dass sein bester Freund Valentin überraschend verstorben ist, tritt John Magnus ohne zu zögern den langen Weg von England nach Worpswede an, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Doch auf dem Friedhof macht er eine schockierende Entdeckung: Eine kryptische Botschaft, notiert auf Kunstdrucken der Malerin Paula Modersohn-Becker, offenbart, dass Valentin keines natürlichen Todes gestorben ist … und dass der unbekannte Mörder einen Rachefeldzug führt, der noch nicht beendet ist! Rache? Wofür? Erst widerwillig, dann immer faszinierter, forscht John nach und kommt allmählich einem gut gehüteten Geheimnis in der Geschichte der Worpsweder Künstlerkolonie auf die Spur, das seine tiefen Schatten bis in die Gegenwart wirft …! »Ein höchst gelungener Kriminalroman, der fasziniert.« NDR Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der atmosphärische Kriminalroman »Die Toten von Worpswede« von Helga Beyersdörfer bietet fesselnde Spannung für alle Fans der Bestseller von Romy Fölck. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine tödliche Kälte liegt über dem Teufelsmoor … Als er hört, dass sein bester Freund Valentin überraschend verstorben ist, tritt John Magnus ohne zu zögern den langen Weg von England nach Worpswede an, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Doch auf dem Friedhof macht er eine schockierende Entdeckung: Eine kryptische Botschaft, notiert auf Kunstdrucken der Malerin Paula Modersohn-Becker, offenbart, dass Valentin keines natürlichen Todes gestorben ist … und dass der unbekannte Mörder einen Rachefeldzug führt, der noch nicht beendet ist! Rache? Wofür?
Erst widerwillig, dann immer faszinierter, forscht John nach und kommt allmählich einem gut gehüteten Geheimnis in der Geschichte der Worpsweder Künstlerkolonie auf die Spur, das seine tiefen Schatten bis in die Gegenwart wirft …!
»Ein höchst gelungener Kriminalroman, der fasziniert.« NDR
Über die Autorin:
Helga Beyersdörfer studierte Germanistik in Frankfurt am Main und machte danach eine Ausbildung zur Journalistin. Zunächst war sie als freie Autorin u.a. für das ZEIT-Magazin, dann als Redakteurin bei der Frankfurter Rundschau, STERN und SAT1 tätig. Helga Beyersdörfer lebt in Hamburg.
Bei dotbooks erscheint bereits ihre Krimi-Reihe um die Journalistin Margot Thaler mit den Bänden »Die Reporterin und der falsche Mörder«, »Die Reporterin und der faule Zauber« und »Die Reporterin und der tote Maler«.
Außerdem veröffentlicht sie bei dotbooks die Kriminalromane »Ein mörderisches Hobby« und »Die Frau im blauen Kostüm« sowie ihren Regio-Krimi »Die Morde von Worpswede«.
Die Website der Autorin: www.helga-beyersdoerfer.de/
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Dieses Buch erschien bereits 2009 unter dem Titel »Moornächte« bei Knaur.
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/U-Design und AdobeStock/jag
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-752-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Helga Beyersdörfer
Die Toten von Worpswede
Kriminalroman
dotbooks.
Kapitel 1
John Magnus war nicht der Ansicht, dass er in seine augenblickliche Umgebung passte. Er wischte ein paar Blattkrümel von dem Ärmel seines dunkelblauen Mantels, dessen durchfeuchteter Stoff roch wie ein nasser Hund. Bei jeder Bewegung der Füße schmatzte der weiche Lehmboden und saugte sich aufdringlich an den Schuhen fest.
John spürte, wie die Feuchtigkeit dieses nebligen norddeutschen Oktobertages allmählich in seine Knochen und in sein Gemüt kroch. Es würde bald dunkel werden, und es war totenstill. Nur wenige Menschen bewegten sich lautlos zwischen den Grabreihen, gesichtslos wie Schattenrisse.
John schob die Hände tief in die Manteltaschen. Verdammt, Valentin, wie konntest du nur?, dachte er und erschrak, weil er den Gedanken laut ausgesprochen hatte und seine Stimme über die Gräber hinweggetragen wurde bis zu den angrenzenden Feldern und Wiesen. Er zog den Kopf ein und starrte vorwurfsvoll dahin, wo er Valentin vermutete, unter einem abgezirkelten, mit Steinen umfassten Rechteck, dessen einziger Schmuck ein lieblos in die Erde gepfropftes Bündel gelber Rosen war. Hierhin also hast du dich aus dem Staub gemacht, rief John ihm zu, diesmal aber lautlos, und hast dich nicht mal von mir verabschiedet. Geht man so mit einem Freund um? Er schüttelte den Kopf, einerseits, um seine Position in dieser Frage zum Ausdruck zu bringen, andererseits wegen der Rosen. Die waren auf Valentins Grab eindeutig fehl am Platze. John ging in die Hocke, auf Augenhöhe mit dem weißen Stein, auf dem in schwarzen Lettern der Name Valentin Kerner eingraviert war. Jetzt erst fiel ihm auf, dass der Stein die Form eines halben Herzens hatte, das aber mit der Schnittstelle nach unten aufgestellt war, sodass es ganz und gar unmöglich wäre, eine zweite Hälfte hinzuzufügen. Was hatte Vera sich dabei gedacht?
Er kniff angestrengt die Augen zusammen, als er an den bevorstehenden Besuch bei Valentins Frau dachte. Stammten die Rosen etwa von ihr? Nein, das konnte nicht sein, unmöglich. Jeder wusste, dass Valentin auf Rosen allergisch war, dass er in ihrer Nähe zu einem triefenden, schniefenden Häufchen Elend wurde, hilflos seinen Amok laufenden Schleimhäuten ausgeliefert. Er hatte diese Blumen gehasst, und jetzt machten sie nicht einmal vor seinem Grab halt, reckten ihre Köpfe dem in Stein gemeißelten Namen entgegen, verhöhnten ihr wehrloses Opfer.
Zornig beugte John sich vor, umfasste die Stängel und zog und zerrte. Seine Erbitterung hatte endlich einen Gegenstand gefunden, an dem sie sich entladen konnte. Er wütete gegen die Zumutung, die der Tod allgemein für alle Lebenden bedeutete, und gegen die Zumutung, die Valentins Tod für ihn im Besonderen darstellte. Er wütete gegen den Verlust seines Freundes und der Erinnerungen, die sie miteinander geteilt hatten und die er ab jetzt alleine bewahren würde, bis auch er unter einem Haufen Erde endete.
Keuchend bückte er sich tief über das Schlachtfeld und nahm beide Hände zu Hilfe, bis das Erdreich endlich nachgab, sich aufwölbte und sowohl einen schmierigen, braunen Blumentopf freigab als auch darunter ein ebenso verdrecktes, zusammengerolltes Etwas, das John zunächst für eine zerdrückte Plastikflasche hielt. Während er mit ausgestrecktem Arm den herausgerissenen Rosenstock festhielt, zog er mit spitzen Fingern die vermeintliche Flasche heraus, die sich als eine dick mit Folie umwickelte Rolle entpuppte. Er widerstand dem Impuls, sie in das neu entstandene Erdloch zurückzubefördern, sondern legte sie fürs Erste auf den Weg. Allmählich begann er, sich zu fragen, ob es jemandem Spaß machte, Valentin mit befremdlichen Grabbeigaben zu ärgern.
John richtete sich auf, wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn, betrachtete die Reste des geschundenen Rosenstocks und schleuderte sie mit einer Geste der Verachtung und des Ekels von sich, wobei er sich, einem Diskuswerfer vergleichbar, halb um die eigene Achse drehte. Noch während er die Flugbahn des Geschosses verfolgte und dessen Aufklatschen auf dem matschigen Weg ein paar Meter weiter, bemerkte er, dass er nicht allein war. Ruhig und unbeeindruckt kam eine Person in klobigen Gummistiefeln herangeschlurft, verpackt in eine unförmige gelbe Regenjacke, deren Kapuze tief ins Gesicht gezogen war, in den Händen eine langstielige Schaufel und einen braunen Müllsack, der etwa zur Hälfte gefüllt war. Da hinein ließ sie im Vorbeigehen die Überbleibsel des Blumentopfes verschwinden.
John richtete sich auf, säuberte, so gut es eben möglich war, seine Hände mit einem Papiertaschentuch und strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn. Von den Schmutzspritzern auf seinem Mantel abgesehen war er nun wieder der gut aussehende Mann in den besten Jahren mit den attraktiven silbernen Fäden im braunen Haar.
Die Person in dem Regenfummel kam auf ihn zu. Sollte sie ihm Vorwürfe machen wollen wegen Störung der Friedhofsordnung oder Ähnlichem, wäre er nun wieder beherrscht genug, ihr den Vorfall mit angemessener Höflichkeit zu erklären.
Als sie dann aber vor ihm stand, sagte sie erst einmal gar nichts, sondern sah ihn nur an – mit einer Mischung aus Neugierde und Ernst. Sie war eine gedrungene, relativ kleine Frau von etwa vierzig Jahren mit einem runden, ungeschminkten Gesicht, in dem das Markanteste ein knopfrundes Grübchen in der Mitte des Kinns war. Worauf wartete sie? Auf eine Erklärung? Oder darauf, dass er endlich ging und sie das Erdloch wieder zuschaufeln konnte? War sie die Friedhofsgärtnerin? John betrachtete das zerknüllte, verschmutzte Taschentuch in seiner Hand und sah sich suchend um.
»Tun Sie das hier rein«, sagte sie und hielt ihm den Müllsack hin, »zu den Rosen.«
»Mach ich, danke. Es ist übrigens sonst nicht meine Art, mit Gegenständen zu werfen.« Er hoffte, damit klarzustellen, dass weitere Ausbrüche von ihm nicht zu erwarten waren.
Sie nickte und reckte ihr Grübchenkinn in Valentins Richtung. »Ein Angehöriger?«
John schüttelte den Kopf. »Ein Freund. Tatsächlich schon so etwas wie ein großer Bruder, mehr als zwanzig Jahre lang, bis fast zum Schluss, bis …« Er unterbrach sich abrupt, so genau brauchte das diese fremde Frau nicht zu wissen. Er deutete auf das aufgegrabene Stück Erde. »Müll und die falschen Blumen, das konnte ich nicht zulassen«, fügte er ohne Überleitung hinzu.
»Ja«, sagte die Frau nur, drückte ihm die Schaufel in die Hand und zeigte auf eine Holzhütte, die an der Begrenzungsmauer des Friedhofs stand. »Wenn Sie fertig sind, stellen Sie die Schaufel da rein.«
Ohne ein weiteres Wort raffte sie ihre Utensilien zusammen, wandte sich im Gehen aber noch einmal um. »Sie sind Engländer, nicht wahr?«
John nickte nur. Er wusste, dass er auch nach vielen Jahren in Deutschland noch immer einen Hauch von britischem Akzent hatte, und eine Frage wie diese war ihm gewiss schon tausendmal gestellt worden. Sie schien keine weitere Antwort zu erwarten, sondern ging ohne Eile den Weg zurück, den sie gekommen war, bevor sie hinter der kleinen, weiß verputzten Einsegnungskapelle abbog und seinen Blicken entschwand.
In der einbrechenden Dämmerung war das Licht von Milchig-Grau zu Blaugrau gewechselt. Es roch nach nassem Holz, nach verwelkenden Blättern und nach Moor. Ein schwerer, erdiger Geruch. John atmete tief ein. Er war sich sicher, dass er jetzt alleine war zwischen all diesen Gräbern. Von der nahen Kirche, die auf dem höchsten Punkt des Hügels stand, auf dem auch der Friedhof lag, begann das Sechsuhrläuten.
John rammte die Schaufel in die Erde und bückte sich nach der Rolle. Entschlossen riss er die nasse, klebrige Folie auf. Sie offenbarte ein handgeschriebenes Stück Papier, in das jemand ein weiteres Blatt gerollt hatte, offensichtlich den Computerausdruck eines Schwarz-Weiß-Fotos. Es zeigte eine lächelnde Frau, an deren Hals sich ein schlafender Säugling schmiegte. Beide lagen auf einem Kissen, dessen Stickerei ebenso altmodisch war wie das hochgeschlossene Rüschenhemd der Frau. Wer war sie?
John betrachtete ihre großen, knopfrunden Augen mit den schweren Lidern, die in die Linse des Fotografen und durch sie hindurch direkt auf den Betrachter zu blicken schienen. Diese Augen hätten das schmale, fast mädchenhafte Gesicht der Frau vollends dominiert, wären da nicht die lange, spitze Nase gewesen und ein kräftiger Unterkiefer, der ihr einen Ausdruck von Willensstärke und Stolz verlieh. Stolz auf das schlafende Kind, das sie im Arm hielt?
John suchte vergebens nach einem Hinweis, einer Erklärung, auf der Rückseite war lediglich ein Datum notiert: 20. November. Das Datum sagte ihm nichts. Ratlos hielt er beides nebeneinander, das Foto und den Zettel mit den kleinen, runden Druckbuchstaben, die auf eine Frau als Absender schließen ließen. Es handelte sich um einen Brief.
Valentin, las John und neigte das Blatt, um die Reste des Tageslichts einzufangen, Du sollst wissen, dass keiner vergessen ist. Du nicht, auch wenn Du mittlerweile in der Hölle brätst. Erst recht nicht die, über die Du Unglück gebracht hast. Und auch nicht die, die Dir dabei behilflich waren – sie haben es verdient, Dir Gesellschaft zu leisten da, wo Du jetzt bist. Und sie sollen bekommen, was sie verdienen. Die Zeit heilt keine Wunden. Darauf zu vertrauen, war Zeitverschwendung. Römer 12, 19: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr.
»Dreck«, zischte John, zerknüllte beide Papiere und warf sie in das Erdloch zurück, wo er sie unter ein paar kräftigen Schaufelladungen verschwinden ließ. Weg damit, weg. Was immer es war, das Valentin veranlasst hatte, sich plötzlich und ohne jede Vorwarnung ins Teufelsmoor zurückzuziehen, es hatte ihm kein Glück gebracht.
Nachdem er die Oberfläche geglättet hatte, legte John die Schaufel hinter dem Grabstein ab und ging.
Inzwischen war es fast dunkel. Die Silhouette der Kirche verschwamm im blaugrauen Abendlicht. Er blieb stehen, als er ihr Hauptportal erreicht hatte, eine schlichte, grüne Holztür. Hatten sie hier Valentins Totenfeier abgehalten? Obwohl John seit Jahren keine Kirche mehr betreten hatte, wollte er in diesem Augenblick nichts lieber als hinein, wollte sich in eine Bank setzen, die Beine ausstrecken, die Wölbung der hohen Decke über sich und die Backsteinmauern wie einen Schutzwall um sich herum haben. Er wollte deren lautloses Echo aus in Jahrhunderten angesammelten Stimmen spüren und das Knacken des Gestühls hören. Er wollte sich betäuben lassen von dem modrigen Geruch kaltnasser Steine, um endlich zur Ruhe zu kommen. Denn gegen seinen Willen gingen ihm weder der Brief noch das Foto aus dem Kopf. Spinnerei, versuchte ihm sein Verstand einzuhämmern, eine Drohung, sagte ihm sein Gefühl, ein angekündigtes Verbrechen womöglich. Sein Gewissen grätschte dazwischen, was, wenn jemand in Gefahr war? Aber er wich aus, widersprach. Wer sollte denn in Gefahr sein? Es gab keine Namen, keine Anhaltspunkte, nur das Foto einer Unbekannten, vermutlich schon vor Jahrzehnten aufgenommen. Ihr drohte gewiss kein Unheil mehr, selbst der abgebildete Säugling dürfte bereits alle Gefahren bewältigt haben oder in ihnen umgekommen sein. Eben, Spinnerei, attestierte der Verstand und gewann kurzfristig die Oberhand, bevor das Gewissen den Satz hervorholte, der sich ihm eingeprägt hatte: Und sie sollen bekommen, was sie verdienen.
John schüttelte sich, ihm war kalt. Mit wenigen Schritten war er an der Kirchenpforte, drückte die Klinke hinunter, rammte seine Schultern gegen das Holz, drückte erneut die Klinke.
»Um siebzehn Uhr schließen wir hier ab«, hörte er jemanden sagen, der jetzt neben ihn trat und ihn mit nüchterner Sachlichkeit musterte. Er war ein Mann jenseits der fünfzig, groß, hager mit einem weißen, zerzausten Haarkranz. In der Hand hielt er einen Schlüssel, den er nun ins Schloss steckte. »Aber wo Sie schon mal da sind, kommen Sie in Gottes Namen mit hinein. Wir erleben es nicht mehr allzu oft, dass uns die Leute die Tür eintreten, um in die Kirche zu kommen.«
Er ließ John den Vortritt, schloss hinter ihm wieder ab und folgte ihm den Mittelgang entlang vor zum Altar, der, von zwei Säulen eingerahmt, das Schmuckstück der ansonsten nahezu schmucklosen Kirchenhalle war. Es war nicht genau das, was John erwartet hatte, aber er war froh um die klaren, geraden Linien. Auch das Grau und Blau der Decken und Wände, das sich in dem Geländer der Empore auf beiden Seiten wiederholte, ließ ihn ruhiger werden.
An der vordersten Bankreihe blieb er stehen und wandte sich zu dem Fremden, bei dem er sich noch nicht einmal bedankt hatte. Doch bevor er das Wort ergreifen konnte, kam ihm der Mann zuvor: »Das hier ist die evangelisch-lutherische Zionskirche, und ich bin der Pastor. Sie kommen wohl nicht aus Worpswede, nehme ich an?«
John schüttelte den Kopf. »Nein. Ich bin sogar zum ersten Mal hier. Obwohl ich zwanzig Jahre in Hamburg gelebt habe, nur eine Autostunde entfernt.«
Der Pastor setzte sich in die vorderste Bank. »Da sind Sie keine Ausnahme«, antwortete er und machte John ein Zeichen, sich zu ihm zu setzen. »Viele Hamburger finden den Weg zu uns ins Teufelsmoor erst spät, wenn überhaupt.«
Valentin hat das Moor gefunden, dachte John bitter, und der Teufel ihn. »Vielleicht liegt es am Namen«, sagte er müde.
»Teufelsmoor?« Der Pastor winkte ab. »Es sind zwar viele Menschen hier im Hochmoor umgekommen, als es noch wild und unwegsam war, seinen Namen verdankt es dennoch nicht dem Teufel, sondern dem niederdeutschen Wort ›duven‹, was so viel bedeutet wie taub, unfruchtbar. Aber so genau wollen Sie das wohl gar nicht wissen. Sie wirken …«, er stockte, suchte nach dem passenden Wort, »… besorgt. Kann ich Ihnen vielleicht helfen?«
John ließ sich Zeit mit der Antwort. Der Mann, der da freundlich abwartend neben ihm saß, war es gewohnt, Hilfe anzubieten. Er selbst aber war ungeübt darin, Hilfe anzunehmen. Und welche Hilfe sollte das auch sein? Mein Freund ist vor sechs Monaten gestorben, hätte er sagen können, und ich war nicht bei ihm, er ist hier beerdigt worden, und ich war nicht dabei, er hatte Probleme, und ich habe sie ignoriert, jemand hasst ihn aus tiefstem Herzen, und ich frage nicht, wer und warum. Valentin hätte mich zu Lebzeiten eingeweiht, wenn er gewollt hätte.
Doch in seinen letzten Lebensmonaten hatte er sich zurückgezogen von seinem bisherigen Leben und auch von mir. Ohne es zu wollen, bin ich heute an seinem Grab dem, was er verbergen wollte, ein Stück näher gekommen. Es soll verborgen bleiben. In ein paar Stunden reise ich wieder ab. Worin also sollte Ihre Hilfe bestehen, Herr Pastor?
Sie schwiegen nun schon seit Minuten. John legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben. Die Säulen, auf denen die Emporendecke ruhte, mündeten in blauen Zwickeln, zwischen denen kleine, goldene Putten hervorlugten. Darunter waren, in der einbrechenden Dunkelheit nur schwach zu erkennen, Blumen und Gräser gemalt, nicht anders, als hätte ein Schulkind seinen Tuschkasten geöffnet und drauflosgepinselt.
»In katholischen Kirchen fällt die Malerei opulenter aus«, sagte John. Das Hilfsangebot war damit ausgeschlagen.
Der Pastor blieb ungerührt. »Weniger ist nicht immer unbedeutend. Und das da«, er deutete mit ausgestreckter Hand nach oben, »ist immerhin eine bleibende Erinnerung an zwei der bedeutendsten Künstlerinnen unserer Gemeinde. Die Putten stammen von der Bildhauerin Clara Westhoff, als sie noch nicht Rilke hieß, und die Blumen hat Paula Becker gemalt, als sie noch nicht Modersohn hieß. Beide haben das im Übrigen ohne Bezahlung gemacht, es war sozusagen eine kirchliche Strafarbeit, weil sie gemeinsam nach einer durchfeierten Nacht aus Übermut die Glocken geläutet und das ganze Dorf damit in Panik versetzt hatten.« Er stand auf und sah in Erwartung einer Reaktion auf seinen Besucher hinunter. »Na ja«, fügte er an und runzelte nun doch die Stirn, »das ist auch schon wieder über hundert Jahre her. Tut mir leid, ich muss jetzt abschließen, ehe es hier drin stockdunkel wird.«
John folgte ihm schweigend zum Ausgang. Als sie sich zum Abschied die Hand gaben, hatte er das Gefühl, dem Mann eine Erklärung schuldig zu sein. »Es stimmt schon, dieser Besuch ist mir nahegegangen«, sagte er und sah zu den Gräbern hinüber. »Dabei habe ich nicht einmal Blumen mitgebracht. Ich habe die verdammte Gärtnerei nicht gefunden.« Der Pastor nickte nur, zog einen Block und einen Stift aus der Manteltasche, notierte etwas darauf, riss einen Zettel ab und reichte ihn John. »Meine Telefonnummer, falls Sie mein Angebot doch noch annehmen wollen. Und die verdammte Gärtnerei suchen Sie hier vergebens. Wir sind auf dem Lande, da pflegen die meisten ihre Gräber selbst. Aber natürlich gibt es auch hier Gärtnereien, nur sind die da, wo sie produzieren, ein Stück außerhalb also. Jetzt muss ich aber los.«
John hörte den sich entfernenden Schritten nach, bis sie verklangen und um ihn herum eine so totale Stille war, wie er sie noch nie empfunden hatte. Eine Stille, als hätte die Welt aufgehört, sich zu drehen, als sei jedes Tier und jedes Blatt zur Bewegungslosigkeit erstarrt. Er spürte sie, sie waren da, aber sie rührten sich nicht.
Den Zettel steckte er achtlos in die Tasche. Er rieb die klammen Finger aneinander und versuchte, Stille und Dunkelheit in sich aufzunehmen und seine Gedanken darin zu versenken. Die Gedanken, die nicht aufhören wollten, um den einen Satz zu kreisen: Und sie sollen bekommen, was sie verdienen.
Unterhalb der Kirche tauchte ein Lichtkegel auf und verschwand wieder, um diese Zeit fuhren nicht viele Autos die Dorfstraße entlang. Vera kam ihm in den Sinn, die sicher schon auf ihn wartete.
Kapitel 2
Sie öffnete weder nach dem ersten noch nach dem zweiten Läuten. John trat zurück, bis er in der Mitte des kleinen Vorgartens stand. Er suchte in den Fenstern nach einem Lichtschein oder einer Bewegung, aber hinter den Scheiben blieb es dunkel und ruhig, nur über dem Eingang spendete eine Kugellampe mattes Licht.
Das unscheinbare, zweistöckige Klinkerhaus mit seinem spitzen Giebeldach war Teil eines Doppelhauses, dessen rechte Hälfte von einer Außenlampe beleuchtet wurde, während die linke vollkommen im Dunkeln lag. John stieg über knotige, winterharte Grünpflanzen hinüber zu dem Eingang des Zwillingshauses, knipste sein Feuerzeug an und suchte nach einem Namensschild.
»Was tust du da drüben?« Sie stand mit gekreuzten Armen unter der Kugellampe, als habe sie bereits Stunden auf ihn gewartet. Ihre Arme schienen ihm knochiger, als er sie in Erinnerung hatte. Wie immer trug sie ein Kleid von schlichter Eleganz, darüber die doppelreihige Perlenkette mit einer schwarzen Perle in der Mitte – Veras Markenzeichen schon zu ihren Hamburger Zeiten. Mit ein paar Schritten war er bei ihr und umarmte sie wortlos.
Sein erster Eindruck bestätigte sich, Vera war abgemagert, ihr ohnehin schmales Gesicht kantig und hart. Sie schob ihn durch einen Windfang ins Haus und von dort aus geradeaus weiter in einen karg möblierten Raum. Links hinter der Tür befand sich ein länglicher Glastisch mit vier weißen Stühlen, in der Ecke eine Jugendstilvitrine. An der Wand gegenüber waren weiße Regale angebracht, auf denen nur wenige Bücher standen.
Vera deutete auf die Sitzecke vor dem Fenster, eine geschwungene Couch und zwei zierliche rote Sessel, zwischen denen ein ovaler Tisch stand mit einer angebrochenen Flasche Rotwein darauf und einem benutzten Glas.
»Setz dich. Ich hol dir auch ein Glas.« Während sie hinauslief, sah John sich beklommen in dem Zimmer um. Nichts erinnerte an Valentin, kein Möbelstück, kein Foto, kein Buch. Ungläubig trat er an das fast leere Regal heran.
»Ich habe alle seine Sachen in Kisten verstaut.« Vera beobachtete ihn von der Tür aus, in der einen Hand eine Schale mit Pistazien, in der anderen ein Weinglas, unter dem Arm eine volle Flasche Wein. »Würdest du etwa gerne in einem Museum leben? Jetzt komm endlich.« Sie schlüpfte an ihm vorbei, stellte Glas und Schale auf den Tisch, entkorkte die Flasche und machte ihm ein Zeichen, sich zu ihr zu setzen. Sie tranken beide einen Schluck, bevor sie beinahe gleichzeitig zu sprechen begannen. Vera brach mitten im Satz ab. »Welche Frau?«, fragte sie irritiert.
John wiederholte seine Frage: »Mir ist heute an Valentins Grab eine seltsame Frau begegnet, und ich würde gerne wissen, wer sie ist. Zuerst habe ich sie für die Friedhofsgärtnerin gehalten, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Vielleicht kennst du sie ja. Sie ist mittelgroß, gedrungen, rundes Gesicht mit Grübchen im Kinn, und sie trug einen gelben Regenumhang und Gummistiefel. Sagt dir das was?«
Vera lachte, aber es war kein belustigtes Lachen, eher ein zurechtweisendes. »In dieser Region, mein Lieber, hat jeder seinen Ostfriesennerz hinter der Tür hängen, meist sogar in Gelb, und Gummistiefel besitzt auch jeder. Was interessiert dich an der Frau? Das Grübchen?« Sie lachte wieder auf, wegwerfend, verächtlich.
John stierte in sein Weinglas und ärgerte sich über sich selbst, dass er die fremde Frau überhaupt erwähnt hatte. Er würde mit Vera nicht über das sprechen können, was ihn seit dem Nachmittag bedrückte. Sie war ihm fremd geworden. Möglicherweise hatte Valentins überraschender Tod vor sechs Monaten dazu beigetragen, dass aus der souveränen, stets höflichen Frau diese abweisende, unfrohe Person geworden war, als die er sie heute empfand.
Er schüttelte unmerklich den Kopf. Nein, das allein war es nicht. Schon bevor zuerst Valentin und dann Vera Hamburg beinahe überstürzt verließen, hatten sie begonnen, sich zurückzuziehen. Alle hatten es bemerkt, niemand hatte nachgefragt. Auch er nicht. Zu sehr war er von der traurigen Gewissheit in Anspruch genommen gewesen, seine Arztpraxis am Stadtrand von Hamburg aufgeben zu müssen. Obwohl er immer mehr arbeitete, war sein Einkommen stetig gesunken, während ihm gleichzeitig eine ausufernde Bürokratie jegliche Energie und Motivation raubte. Er wusste, wie willkommen die in Deutschland ausgebildeten Ärzte in nahezu jedem europäischen Land waren, besonders in Skandinavien. Für ihn aber lag es nahe, einen Neuanfang in England zu wagen. So hatte er sich schweren Herzens und nach reiflicher Überlegung darangemacht, seine Übersiedelung nach England einzuleiten.
Es hatte dann noch viele Monate der Vorbereitung gebraucht, in denen er zwischen beiden Ländern hin- und hergependelt war und Unmengen Papiere hüben wie drüben hatte ausfüllen müssen. Nun war er nach Hamburg zurückgekommen, um seine Praxis endgültig aufzulösen, nachdem auch der letzte Versuch gescheitert war, einen Nachfolger zu finden. Zum Jahresanfang würde er seine neue Arbeit in einer Gemeinschaftspraxis in einer Kleinstadt in Südengland aufnehmen. Was in dieser turbulenten Zeit mit Valentin geschehen war, hatte er kaum wahrgenommen. Die Todesnachricht hatte ihn erreicht, als er gerade in England war.
John schreckte auf, da Vera plötzlich neben ihm stand und ihm eine Platte mit belegten Broten unter die Nase hielt. Er hatte nicht einmal bemerkt, dass sie aufgestanden war.
»Träumst du?« Ihre Stimme klang jetzt weicher, sie lächelte sogar ein wenig, sah aber unendlich erschöpft aus. »Seit wann bist du wieder in Deutschland?« Sie stellte den Brotteller in die Mitte des Tisches und setzte sich.
»Seit heute. Ich habe mir am Flughafen in Hamburg einen Mietwagen genommen und bin sofort hierhergefahren.« John nippte erst, dann trank er einen herzhaften Schluck Wein.
»Warum?«, fragte sie.
Er sah sie verständnislos an. »Warum? Weil Valentin mein Freund war, weil ich weit weg war, als er starb, weil ich nicht weiß, wie und woran er gestorben ist, weil ich nicht einmal weiß, wieso er hier war und wie er hier gelebt hat.« Außerdem habe ich Drohungen und Flüche irgendeiner Verrückten in seinem Grab gefunden, und das macht mir Sorgen, hätte er hinzufügen können, entschied sich aber dagegen.
Sie lehnte sich zurück und schloss für einen Moment die Augen. »Das sind viele Fragen auf einmal. Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen, aber ich will es versuchen.«
Stockend begann sie zu erzählen.
Obwohl John sehr bald den Eindruck hatte, dass Vera mehr verbarg, als sie preisgab, verzichtete er darauf, sie mit Fragen zu unterbrechen. Immerhin erfuhr er gleich zu Beginn ein Detail, das ihm nicht bekannt gewesen war. Valentins Rückzug hach Worpswede war nicht so überstürzt erfolgt, wie es ihm erschienen war. Monatelang hatte ein Konflikt zwischen Valentin und seinem Kompagnon Dr. Heinrich von Zahn geschwelt, mit dem zusammen er eine angesehene und erfolgreiche Anwaltskanzlei betrieben hatte. Der Konflikt hatte zu einem handfesten Streit und schließlich zu einem endgültigen Zerwürfnis geführt. Über die Gründe wollte Vera sich offenkundig nicht äußern, allerdings ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie die Schuld mehr bei Valentin sah als bei seinem Kompagnon.
Mehrmals betonte sie, dass Valentin in jener Zeit reizbar und unzugänglich geworden sei. Die Situation eskalierte in seinem Entschluss, alle Brücken hinter sich abzubrechen und Hamburg zu verlassen.
»Zwei Jahre ist das jetzt her. Weihnachten haben wir damals getrennt verbracht, Silvester auch. Am Neujahrstag bin ich ebenfalls hierhergezogen.« Vera straffte sich und sah John nun direkt an. »Und das war ein Fehler. Hier wurde alles nur noch schlimmer.«
John legte die Fingerspitzen aneinander und wartete, dass sie weitersprach, dass sie endlich erzählte, wie Valentins Leben ausgesehen hatte bis zu jenem Tag im April dieses Jahres, der sein letzter wurde. Aber Vera nippte gedankenversunken an ihrem Wein, fast schien sie ihren Besucher vergessen zu haben.
Er musterte sie, ungeduldig und beunruhigt zugleich. Zweifellos hatte Vera nur Bruchstücke dessen erzählt, was wirklich geschehen war. Doch auch wenn das Bild unvollständig blieb, so war es doch ausreichend, um zu erkennen, dass Valentin nicht in Frieden mit sich gestorben war und er gewiss nicht nur Freunde hinterlassen hatte. Aber konnte man eine Frau, die vor wenigen Monaten ihren Mann verloren hatte, unumwunden nach dessen Feinden fragen? Heute nicht, beschloss John, und auch den obskuren Fund im Grab wollte er lieber nicht erwähnen. Dass Vera ihm aber eine Antwort auf die Frage, die ihm am Herzen lag und deretwegen er sich mit ihr verabredet hatte, bisher verweigerte, das wollte er nicht akzeptieren.
Er beugte sich vor. »Vera«, sagte er eindringlich, »wie und wo ist Valentin gestorben?«
Ihr Gesicht blieb unbewegt, während ihr Arm in eine ungefähre Richtung wies. »Nebenan«, antwortete sie, »in seinem Atelier.« Sie lachte auf, es klang diesmal nicht nur unfroh, sondern zynisch.
John horchte auf. »Im Atelier? Er hat gemalt?«
»Hat er nicht. Aber er hat so getan.«
»Warum?«
»Er hat sich eingeredet, als Maler in Worpswede einen erstklassigen Neustart hinlegen zu können.«
»Ohne Bilder?«
Sie lachte wieder auf. »Natürlich nicht. Da drüben stauben noch reihenweise Bilder vor sich hin, die er sich besorgt und als seine eigenen ausgegeben hat. War Beschiss, aber egal, Schwamm drüber. Wo er doch jetzt mausetot ist.« Sie nahm ihr Glas und trank es leer. »Willst du es mal sehen? Das Atelier.« Sie spuckte jeden einzelnen Buchstaben des Wortes aus wie eine saure Frucht, während sie sich umständlich aus ihrem Sessel schraubte und endlich schwankend auf ihren stelzendünnen Beinen zum Stehen kam.
Mit einem schnellen Blick auf die Flaschen stellte John fest, dass beide leer waren. Die für Autofahrer zulässige Promillezahl überschritt er wahrscheinlich bereits, auch wenn er im Gegensatz zur Witwe seines Freundes noch standfest war.
Er vertagte die Entscheidung, wie er unter diesen Umständen mit seinem Mietwagen noch nach Hamburg kommen sollte, und folgte Vera, die schon durch die Haustür geschlüpft war und im Begriff stand, das sperrige Gewächs zu übersteigen, das die beiden Grundstücke voneinander abgrenzte. Gerade noch rechtzeitig bot John ihr seinen Arm als Halt, und ein paar Schritte weiter standen sie vor Kälte zitternd vor dem düsteren, verlassenen Zwillingshaus. Vera steckte ihre Hand durch den Briefkastenschlitz an der Eingangstür und zog an einer offenbar von innen angebrachten Schnur, an deren anderem Ende ein Schlüssel zum Vorschein kam. »Voilà«, sagte sie und schloss auf.
Kapitel 3
Wenige Kilometer weiter südlich hatte Hanne ihre verschmutzte Arbeitskleidung abgelegt und band sich eine frische Schürze um. Es war fast acht, und in Vorfreude auf die kommende Stunde lächelte sie zu dem Baby hinüber, das geduldig in seinem Laufgitter auf dem Rücken lag und an seiner Abendflasche nuckelte.
Hanne ging in die Hocke, öffnete die gusseiserne Klappe am Herd und schob einige Scheite Holz nach. Der Schein des Feuers zauberte für Sekunden eine zarte Röte in ihr Gesicht, und die Hitze wirkte noch angenehm nach, als sie sich erhob und über den großen Topf beugte, der auf dem Herd stand. Sie vergewisserte sich, dass der Kartoffel-Gemüse-Eintopf sanft vor sich hin brodelte, jederzeit als Mahlzeit bereit. Hanne konnte sich an keinen Tag erinnern, an dem nicht warmer Eintopf auf dem Herd gestanden hätte. Ihre Großmutter hatte es schon so gehalten, dann ihre Mutter und nun sie.
Die Küche war das Zentrum des Hauses, hier brannte immer ein Feuer, hier wurde gekocht, gegessen, geklönt. Es war eine altmodische Küche mit einem nahezu antiken Herd und einer Anrichte, in der schon ihre Großeltern Geschirr und Besteck aufbewahrt hatten. Nur den langen Tisch gegenüber dem Herd mitsamt der Eckbank und den Holzstühlen hatte sie erst vor ein paar Jahren schreinern lassen. Wie jeden Tag nach dem Abendmelken hatten hier gerade noch ihre drei Mitarbeiter schweigend Wurstbrote und Eintopf verzehrt. Es wurde nie viel gesprochen während dieser Essenspausen. Kurt, gelernter Landwirt und Eigenbrötler, war ohnehin wortkarg, und die beiden Stallhelfer sprachen kaum ein Wort Deutsch. Der Jüngere, Gregori, stammte aus der Ukraine, und Baschtel, der auf die siebzig zuging, war Pole. Er hatte schon für die alten Bauern gearbeitet und stand Hanne zur Seite, seit sie den Hof hatte übernehmen müssen. Sie schätzte sein Improvisationstalent und seine stoische Ruhe. Wann immer sie Unterstützung brauchte, wandte sie sich als Erstes an ihn. Zwischen ihnen hatte sich im Laufe der Zeit ein Vertrauensverhältnis entwickelt, das ohne viel Worte auskam. Erst kürzlich hatte Baschtel ihr eine sehr scharfe, sehr fette Dauerwurst aus Polen mitgebracht, ein Gunstbeweis, der sie gerührt hatte. Im Gegenzug hatte sie ihm einen Becher mit seinem Namen darauf geschenkt, den er seither mit vorsichtiger Andacht bei jeder Mahlzeit benutzte.
Hanne sortierte das restliche Geschirr in die Spülmaschine, zog die Ärmel ihres Pullovers glatt, die sie während der Küchenarbeit hochgekrempelt hatte, und beugte sich über Lilly, die ihr erwartungsfroh die Ärmchen entgegenreckte.
»Du hast schon wieder zugenommen, kleiner Mops«, flachste sie, als sie das Kind zu sich hochzog. Um ihren ständig schmerzenden Rücken zu entlasten, setzte sie Lilly auf ihre linke Hüfte und legte fest den Arm um sie. »Erst alles abschließen«, flüsterte sie ihr ins Ohr.
Die Küche hatte zwei Ausgänge. Der eine führte zur sogenannten Schleuse, einem Durchgangszimmer, in dem jeder, der draußen vom Hof kam, Kleidung und Schuhe wechseln und sich an einem Waschbecken Hände und Gesicht reinigen musste. Hanne pochte unerbittlich auf das Einhalten dieser Regelung. Obwohl sie auf dem Hof aufgewachsen war, peinigte sie der scharfe Geruch nach Kuhstall und Gülle, der sich in Haaren und Kleidung festsetzte und, wenn sie nicht aufpasste, in jeder Ritze des Hauses.
Sie verschloss die Tür und wandte sich der schräg gegenüberliegenden zweiten zu, die in eine Diele und von dort über eine Treppe in ihre Wohnung führte. Gerade weil ihr Leben sich hauptsächlich auf dem Hof und in der Küche abspielte, hatte sie viel Energie und Sorgfalt in ihr Refugium investiert, hatte es, soweit das ihre sehr begrenzten Mittel erlaubten, renoviert und eingerichtet. Schritt für Schritt, geduldig und zielstrebig. Als Letztes hatte sie, um zusätzlichen Platz zu gewinnen, den Wintergarten umfunktioniert in ein Arbeitszimmer.
Das war vor vier Monaten gewesen, als Lilly in ihr Leben getreten war. Deren Zimmer lag gleich links neben der Treppe. Hanne hatte es hellblau gestrichen und über dem Kinderbett unter der Dachschräge einen Sternenhimmel gemalt. Als sie eintrat, klimperten die Glasperlen des Mobiles, das vor dem Fenster hing. Sie trug Lilly zu der Spielecke, in der allerlei Rasseln, Klötze und Stofftiere ausgebreitet waren, und setzte sie auf eine Decke. Ihre gemeinsame, ganz private Stunde konnte beginnen. Sie lief zur Kommode und holte das Foto.