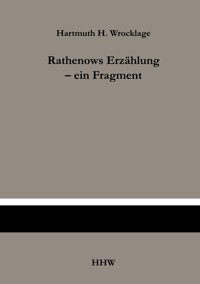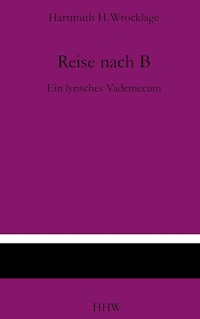Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Liebe und Politik: Ein Mann, Staatsminister für Migrationsfragen, und eine Frau, Deutschlandkorrespondentin eines französischen Magazins in Berlin, beide glücklich, aber nicht miteinander verheiratet, erleben die große Liebe. Zwischen ihnen entsteht ein prinzipieller Konflikt, der für sie den Rang einer Gewissensentscheidung gewinnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die, die es angeht
Inhalt
Annäherungen
Ein Ineinandergreifen
Gemeinsamer Tag
In der Staatsoper
Politische Schachzüge
Eine Auszeit mit Folgen
Exekutive Vorbereitungen
Chancen einer offenen Beziehung
Schwerwiegende Probleme
Eine klare Entscheidung
Der Lauf der Dinge
Aufeinandertreffen
Ein kalter Januarabend an der Spree
Metamorphose
Anderes Leben
Zwischenfall
Finale
1.
Annäherungen
Zeiten wie diese erlebt wohl jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben. Wenn er dieses zweifelhafte Glück hat, verliert die Welt alle Selbstverständlichkeit. Die Erde, die uns bis dahin leicht und freundlich getragen hat, zeigt ihr zweites Gesicht. Die Doppelbödigkeit unserer Existenz, von der wir bis dahin nur eine abstrakte Ahnung hatten, tritt uns konkret entgegen. Unser bis dahin fröhliches Lachen klingt falsch. Das grausame Auge im Antlitz des Schicksals betrachtet uns gleichgültig. Dessen direkter Blick, den wir zu suchen gezwungen sind, lässt uns erstarren. Unsere Gespräche, auch die, in denen wir uns um Tiefe mühen, klingen flach. Und selbst gut gemeinte Trostworte wirken phrasenhaft und verächtlich. Ein Anderes tritt uns entgegen. Eine andere Wesenhaftigkeit, männlich, weiblich oder ungewiss, verfremdet das gewohnte Geflecht menschlicher Beziehungen.
In Zeiten wie diesen besinnen wir uns auf unsere Vergänglichkeit. Und während das bisherige Leben noch normal weiter zu laufen scheint, verliert es seinen Zauber, seinen Zusammenhalt und alle Zukunft. Wir bewegen uns auf den steinernen Treppen und Fluren der sicheren Gebäude, die wir errichtet haben, wie Drahtseiltänzer, die in großer Höhe ohne Netz arbeiten.
Was für den individuellen Menschen katastrophal erscheint, ist gleichgültig für das Leben an sich, ja, bereits für den nicht betroffenen Nachbarn. Aber macht das die Sache besser? Für den Einzelnen ist dies der entscheidende Augenblick. Stirbt er nicht an der Vorahnung seines Unglücks, z.B. durch Kummer und Krankheit, bleibt ihm nur, entweder sich fallen zu lassen (im schlimmsten Falle ins Nichts) oder den Schlag einzustecken, aufzustehen und um sein Leben, seine Ziele und insbesondere um seine Liebe zu kämpfen. Dabei streiten manche bis zum Schluss – selbst dann, wenn sie in Wirklichkeit schon verloren sind.
Welchen Weg jemand geht, hängt ab von äußeren Faktoren wie Herkunft, Erziehung, erworbenes oder verlorenes Gerechtigkeitsgefühl, ist aber abhängig vor allem von seiner spezifischen körperlich-seelischen Verfassung. Man muss sich immer im Klaren darüber sein, dass der Einzelne in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedlich reagieren kann – wie letztlich, das hängt von seiner inneren Freiheit oder Unfreiheit ab, man könnte auch sagen vom jeweiligen Schicksal. Das gilt gleichermaßen für uns beide, die wir uns hier und jetzt stark vorkommen. Ja, auch Sie als junger Mann können jederzeit dem Verdikt des Scheiterns ausgesetzt sein. Gedenken wir einen Moment lang voller Mitleid derer, die den Kampf gar nicht erst haben aufnehmen können oder ihn aufnehmen, in ihm jedoch unterliegen und untergehen. Ihnen gehört jedenfalls meine Solidarität und mein Mitgefühl.“
So begann der Staatsminister außer Dienst, Wolf Wega-Wagemann. Wegen seines anfangs übertrieben feierlichen, manchmal theatralischen Tones schriebe ich am liebsten: ‚So hub er an’; aber lassen wir das. Denn nach dieser, wie ich herauszuhören glaubte, vorbereiteten und etwas gekünstelten Eingangsrede schlug er nun glücklicherweise einen natürlichen Ton an. Das hatte ich von Wolf Wega-Wagemann auch erwartet, obwohl ich ihn nur mühsam zu diesem Gespräch bewegt hatte. Jetzt konnte ich ihn genauer beobachten. In diesem Moment wirkte er fast wie abwesend, als erhole er sich von seinem vorbereiteten Text. Dabei verfiel er lange Zeit in Schweigen. Aber es arbeitete in ihm. Ich nahm all meine Geduld zusammen und wartete, ohne eine Frage zu stellen. Schließlich seufzte der Mann auf und sagte in schwerer Diktion: „Was nun die Geschichte angeht, nach der Sie mich am Telefon gefragt haben: die ganze Wahrheit über die Motivation der handelnden Personen zu kennen, wage ich nicht zu behaupten. Ich kann Ihnen dieses Stück Leben nur so erzählen, wie ich es erlebt und wahrgenommen habe. Und ob ich Ihnen alles werde berichten können, muss ich entscheiden, während ich zu Ihnen spreche. Intime Details gebe ich sowieso nicht preis. Wenn Sie es darauf abgesehen haben, nein danke, dann gehen Sie bitte lieber gleich.“
Er schwieg wieder und sah mich mit einem hypnotisch wirkenden Blick an. Er versuchte, mich einzuschätzen. Es war ein starker Blick. Hinter seinen Pupillen loderte es wie abgedunkeltes Feuer.
Ich hütete mich davor, eine Antwort zu geben, wich seinem Blick aber auch nicht aus, sondern hielt ihm sehr bewusst stand, ohne mich provozieren zu lassen. Es war wie eine Prüfung, die ich offenbar bestand. Denn nach einer ganzen Zeit hörte ich Wega sagen: „Gut denn.“ Und nun erst nahm er den Faden der eigentlichen Geschichte auf, deretwegen ich ihn aufgesucht hatte.
Einen Augenblick hatte ich gedacht, ein möglicherweise wichtiger Teil meines Beitrags zum „Zusammenwirken von etablierter Politik und Nichtregierungsorganisationen (NGO) mit Blick auf die menschlichen Beziehungen der Akteure zueinander“ sei gefährdet. Dieses Thema hatte ich im Rahmen eines Forschungsvorhabens der EU „The Human Factor in Politics“ zu betreuen. Nun war ich sehr erleichtert. Als gelernter Journalist hätte ich es sehr bedauert, wenn meine konkrete Recherche gerade in Sachen Wega-Wagemann gescheitert wäre. Denn die zu erwartende Fallgeschichte, obgleich wohl nicht gerade exemplarisch, schien mir nach meinen Vorkenntnissen gut in den Zusammenhang meines Themas zu passen. Die Gefahr des Scheiterns meiner Recherche gleich zu Anfang war jedenfalls zunächst einmal gebannt. Denn Wolf Wega-Wagemann äußerte sich bereits.
Im Bildergarten
„Es fing an, wie viele solcher Geschichten beginnen: mit einer zufälligen Begegnung. In diesem Fall auf einer Vernissage in der Neuen Nationalgalerie von Berlin. Zum ersten Mal fiel mir die Frau von etwa Mitte 40 auf, wie sie völlig in sich gekehrt dastand, versunken in die Betrachtung des inzwischen weltbekannten Bildes von Fabricius mit dem Titel „Die Frau mit dem französischen Namen“. Dieses Gemälde hängt inzwischen übrigens im Museum of Modern Art in New York.
Die dort abgebildete Dame, ganz in ein Blau gekleidet, das mich an Yves Klein erinnerte, aber dunkler wirkte, wendet sich mit einer halben Drehung nach hinten einem ganz in Schwarz gekleideten Herrn mit Zylinder zu. Man sieht ihr hochgestecktes blondes Haar, nicht aber ihre Augen. Der Herr in Schwarz blickt sie respektvoll und zugleich so fasziniert an, als habe ihn ein coup de foudre getroffen. Man erkennt ein gewisses Leuchten in seinen Augen, das tief von innen her den Blick der Frau widerzuspiegeln scheint. Über dem ganzen Gemälde liegt ein unterschwelliges gegenseitiges Verlangen, unterstrichen noch von mohnroten Motiven im Bildhintergrund. Der Spannungsbogen in diesem Bild kommt dadurch zustande, dass der Mann und die Frau sich fremd und distanziert gegenüberstehen und sich dennoch zugleich in fast obszöner Weise zu gefallen, ja, sich zu begehren scheinen: Man spürt geradezu ihre Spontaneität, ihre Wildheit und etwas Unabwendbares, das sich zwischen ihnen anbahnt.
In diesem Gemälde ist im Grunde ein wesentlicher Teil unserer Geschichte enthalten. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Dabei hat sich der Prozess der Annäherung zwischen uns, der Frau vor dem Bild und mir, im Ganzen gesehen, eher rational und geradlinig entwickelt, dabei mit viel Empathie natürlich.“
Ich war überrascht, denn ich hatte eher eine sachliche Abhandlung über die Ausländerpolitik erwartet. Das hörte sich hier aber ganz anders an. Mir sollte es recht sein. Denn ohne eine persönliche Note würde ich mein Thema verfehlen. Es sollte ja gerade um die menschlichen Beziehungen gehen. Als könne er Gedanken lesen, richtete sich Wega-Wagemann auf und sagte, sich von der Vergangenheit lösend: „Wenn ich Sie bei unserem letzten Telefonat richtig verstanden habe, interessiert Sie ja unabhängig von dem eigentlichen Anliegen Ihres Forschungsvorhabens, dem menschlichen Faktor, besonders der Blick des Anderen und überhaupt der ‚Andere’ in Beziehungen. Hier finden Sie die Basis unserer Geschichte, die sich organisch weiter entwickelte, bis ein Vertrauensbruch alles in Frage stellte.“
Wega-Wagemann machte eine Pause. Dass er inzwischen über siebzig war, sah man ihm nicht an. Sein Gesicht hatte den heiteren, aber auch ernsthaften Ausdruck eines Menschen, der sich auf sich selbst besonnen und seine Mitte gefunden hat. Während er redete, verfinsterte sich seine Miene allerdings zunehmend. „Die Erinnerungen, die bei mir hochkommen, sind schmerzlich“, sagte er. „Nehmen Sie doch einfach das Bild und machen Sie Ihre eigene Geschichte daraus. Das Ende kennen Sie ja.“
„Der Ausgang der Geschichte ist mir zwar bekannt“, antwortete ich, „aber vor allem interessiert mich der Weg, den Sie beide beschritten haben; und hier insbesondere die jeweilige Motivlage der handelnden Personen. Aus welchen Gründen ist wirklich geschehen, was passiert ist? Darum geht es“. Und nach einer Pause brachte ich ein leises, aber nachdrückliches „Bitte!“ hervor. Dabei sah ich Wega offen an.
Den Schluss kannte ich in der Tat. Es war damals ein beginnender Skandal gewesen, der ihn sein Ministeramt gekostet hatte. Wega-Wagemann, der sich selbst als Vollblutpolitiker sah, dem manchmal allerdings sein unbedingter Wille zur Sachlichkeit im Wege gestanden und ihn nicht gerade beliebt gemacht hatte, war seinerzeit von einflussreichen Journalisten trotz oder wegen seiner Sperrigkeit als künftige politische Führungskraft eingeschätzt worden. Und ausgerechnet dieser Mann hatte „aus persönlichen Gründen“ seinen Rücktritt von seinem Ministeramt erklärt. Und zwar, soweit ich wusste, in derselben Nacht, in der ihn die Frau verlassen hatte, die man oft „an seiner Seite“ gesehen hatte, von der aber nur seine engste Umgebung sicher wusste, dass sie seine Geliebte und mehr noch: ‚seine Liebe’ war. Sie jedenfalls war spurlos untergetaucht. Es hatte nach einer anonymen Anzeige ein kurzes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft ‚gegen unbekannt’ gegeben. Auch der Ex-Minister war befragt worden. Er hatte aber jegliche substantielle Frage mit dem Argument ‚Nichtwissen’ pariert und sich auch später jeden Kommentars enthalten. Das Ermittlungsverfahren war überraschend schnell eingestellt worden.
Das nachfolgende Schweigen zwischen uns war wiederum ein Albtraum für mich. So ausgeglichen und heiter, wie er zu Anfang schien, war Wega-Wagemann wohl doch nicht. Ich sah seinem Gesicht an, dass er mit einem großen Schmerz kämpfte. Wahrscheinlich fragte er sich, warum er sich ‚das hier’ antun solle. Diese Frage hatte er schon bei unserem ersten Telefonat gestellt. Ich spürte, dass ein Element meines Forschungsprojekts auf der Kippe stand. Dabei brauchte ich ein paar markante Beispiele aus dem wirklichen Leben und glaubte, hier eines gefunden zu haben. – „Kommen Sie“, sagte Wega-Wagemann schließlich, „wir setzen uns nach drüben an den Couchtisch.“ Er wuchtete sich hinter seinem Schreibtisch hoch. Darauf lagen Textentwürfe und Bücher chaotisch über- und untereinander. – Ich wusste, dass er seine Erinnerungen aufarbeitete („Ich schreibe nicht an meinen Memoiren“, hatte er allerdings gesagt). Mir war auch bekannt, dass er nebenher Zeitungsartikel und literarische Texte verfasste.
„Was wollen Sie trinken? Wein? Wasser?“, fragte er. Ich riss mich vom Anblick seines chaotischen Schreibtisches los, der mich vom ersten Augenblick an fasziniert hatte. „Nur Wasser, bitte“, erwiderte ich.
Sodawasser und eine Anzahl von Gläsern standen schon bereit. Er schenkte uns ein, wobei er sich selbst zusätzlich mit einem nicht zu knappen Schuss aus der Wodkaflasche bediente, die er plötzlich wie durch Zauberei in der Hand hielt. Er setzte sich auf einen Sessel, der offenbar sein Stammplatz war, jedenfalls lag dort ein die Wirbelsäule stützendes schwarzes Keilkissen: Von diesem Sitz aus konnte er den Großteil der Bücher überblicken, die sich aus völlig überfüllten Regalen in das Innere des Raumes drängten.
Ich nahm unter den Bildern an den wenigen freien Wandflächen nur ein einziges Gemälde wahr. Zu erblicken war eine verfremdete Frau, deren Verletzlichkeit schon durch die feingliedrige Struktur umrisshafter Körperlinien deutlich wurde. Dieser Eindruck verstärkte sich noch durch ein dunkles Rot, das, wie eine Verletzung oder eine Wunde wirkend, an ihrer linken Seite unter dem angewinkelten Arm hervortrat.
Entlang der breiten Fensterfront standen Stelen mit Frauenfiguren. Eine davon war das Fragment einer Tanzenden, die andere eine Liegende, die ihre Nacktheit offensichtlich genoss, bei der dritten handelte es sich um eine Trauernde, der sich ein tröstender Arm um die Schulter legte.
Mir wies Wega den ihm gegenüberstehenden Ledersessel zu – und schwieg. Wieder dauerte es eine Weile. Dann hörte ich seine Stimme, eher leise, fast wie von fern, dann aber präsent.
Erster Blickwechsel
Sie stand mitten vor dem Bild von Fabricius, in der Hüfte leicht nach links eingeknickt, mit der rechten Hand ihr Kinn abstützend. Ihr langes dunkelblondes Haar trug sie offen. Ihr schwarzer, eleganter, seidig schimmernder und doch sportlich wirkender Hosenanzug – kurz geschnittene Jacke, enge Hosenbeine –, gab den Blick frei auf ein violettes Hemd, das, wie es gerade Mode war, knapp bis zu den sehr weiblichen Rundungen ihrer Rückseite reichte. Sie musste bei dem Andrang, der vor dem Bild herrschte, lange gewartet haben, um sich in diese zentrale Blickposition zu bringen. Gelassen stand sie da, ganz in das Bild vertieft. Obgleich ich eigentlich nur auf Blicke reagiere, war ich, der ich sie von schräg hinten und auch nur durch eine zufällige Lücke wahrgenommen hatte, vom ersten Moment an von dem Magnetismus ihres Erscheinungsbildes angezogen.
Das Gemälde selbst hatte ich schon zu einem früheren Zeitpunkt gesehen und brachte einfach nicht die Geduld auf zu warten, bis ich mich der Frau in Schwarz unauffällig hätte nähern können. Ich drehte daher eine Runde, schaute mir gemächlich andere Gemälde an und kehrte nach einiger Zeit, von der anderen Seite her kommend, zu dem Fabricius zurück, inzwischen neugierig, ob ich die Frau noch immer unter den Betrachtern fände, und gespannt, wie ihre Augen auf mich wirken würden. Und da stand sie wirklich noch in fast unveränderter Haltung. Ich konnte sie auf meinem Rückweg sehr gut von links vorn sehen, weil der Fabricius neben einem breiten Durchgang hing.
Die Frau hatte sich von dem Bild noch nicht lösen können. – So war es mir beim ersten Anblick dieses Werkes auch ergangen. Warum Fabricius dem Bild den Titel ‚Die Frau mit dem französischen Namen’ gegeben hatte, war mir nicht ganz klar – vielleicht wegen der lässigen Eleganz, die seine Frauengestalt ausstrahlte. Aber was mir in diesem Augenblick viel wichtiger war: Je näher ich kam, desto besser konnte ich das Gesicht und dann die Augen der Frau vor dem Bild erkennen, d.h. eigentlich nur ihren Blick, aus dem, obwohl er eine Anmutung von Blau zeigte, eher ein lichter Schatten sprach. Ich konnte nicht anders. Fasziniert suchte ich unverwandt ihre Augen.
Sie musste meinen Blick gespürt haben. Denn als ich sehr dicht an sie herangekommen war, wandte sie mir ihre Augen direkt zu, ohne ihren Blick schweifen zu lassen: distanziert zwar, aber nicht abweisend, eher interessiert und ein wenig amüsiert. Sie erwiderte meinen Blick mit einem, wie mir schien, freien Gegenblick. Ich lächelte sie nicht an, sondern nickte ihr nur kurz zu und ging weiter, an ihr vorbei. Unsere Begegnung musste auf sie rein zufällig wirken.
Als brauchte mein Unterbewusstsein einen Namen für die Schöne, fiel mir der Bildtitel für sie ein: „Die Frau mit dem französischen Namen“. Mit dieser Kennzeichnung kam ich vorerst aus.
Cafeteria
Später traf ich sie in der Cafeteria des Museums wieder. Sie hatte sich in den hinteren Teil des Raumes zurückgezogen und saß allein an dem rückwärtigsten Tisch in einer durch eine Zimmerpalme geschützt wirkenden Ecke. Vor sich einen Espresso mit einem Glas Wasser, blätterte sie, ohne aufzusehen, in einem Buch, das von fern wie ein Katalog aussah.
Wieder einmal geriet ich in eine jener Situationen, in denen sich alles entscheidet: ‚Spring oder lass es ganz’. Entweder man sucht den Kontakt oder man geht vorüber, als wäre nichts; und dann ist und wird auch nichts. Eine mögliche Geschichte verfehlt ihren Beginn, der Kairos ist vertan. Nun bin ich von jung auf eher der Draufgängertyp. Das ‚Herangehen’ als Verhaltensmaxime hatte ich in einem Buch kennen gelernt, das ich schon in meiner Jugend gelesen hatte. Es handelte von dem berühmten Jagdflieger Bölkow. Dessen Devise: ‚Ran gehen ist alles!’ hatte ich mir für alle möglichen Lebenslagen zu Eigen gemacht.
„Darf ich mich zu Ihnen setzen?“, fragte ich sie. Mit meinem Milchkaffee in der Hand stand ich vor ihr und suchte erneut ihren Blick. Sie sah auf und sagte mit einem leisen Lächeln: „Offen gestanden, habe ich Sie erwartet. Vorhin haben wir einen bestimmten Blick getauscht. Und passiert es mir, dass ein Mann mir nicht nur auffällt, sondern ich mich ein paar Blicksekunden auf ihn einlasse, wird es interessant. Für Sie oder für mich oder für uns beide. Denn wenn ich mich unter solchen Umständen“ – sie lächelte mir halb im Ernst, halb im Scherz, dabei völlig natürlich zu – „für einen Moment verliere, wird man mich so schnell nicht wieder los. Ich warne Sie also.“ Immer noch lächelnd wies sie mit einer Handbewegung voller Grandezza auf einen der freien Stühle an ihrem Tisch und fügte ein „Bitte“ hinzu. Sich aber gleich wieder distanzierend, hörte ich sie leise sagen: „Wenn Sie es denn gar nicht lassen können.“ Sie legte das Buch, in das sie sich so vertieft hatte, zur Seite. Nun sah ich, worin sie in Wirklichkeit gelesen hatte: Es handelte sich um ein bebildertes, mit Notenbeispielen versehenes Textbuch von Wagners ‚Tristan und Isolde’.
‚Eine Jagdfliegerin’, dachte ich, ‚eine von meiner Art’. Und so ging ich auf ihr freies Spiel gleich zu Beginn unserer Begegnung ein: „Darf ich mich vorstellen? – Tristan“, sagte ich keck, selbst noch immer überrascht von ihrer Unbefangenheit, mit der sie sich gleich zu Beginn als selbstbewusste und emanzipierte Frau auswies.
„Isolde“, lächelte sie zurück.
Ich wählte den Stuhl ihr gegenüber, stellte meinen Milchkaffee ab und setzte mich. Wir sahen uns an. Und dann mussten wir beide lachen. „Das fängt ja gut an“, sagte sie, „wollen Sie mich wie Tristan seine Isolde etwa auch gleich verkuppeln?“
„Nein“, antwortete ich, „erst möchte ich mich von Ihnen heilen lassen – während ich Ihnen dabei unrettbar verfalle. Oder soll ich uns zunächst einen Giftbecher besorgen?“
„Nicht schlecht“, sagte sie, „ein Glas mit einem guten Gift-Wein, bitte. Ich bin dabei.“
Kurze Zeit später war ich wieder bei ihr, ein Glas Frankenwein in jeder Hand. Sie erwartete mich mit ihrem aufmerksamen Blick.
„Wovon soll ich Sie heilen? Und warum wollen Sie mir gleich unrettbar verfallen?“, fragte sie, kaum dass ich mich hingesetzt hatte. – Ich blickte sie nur kurz an. „Für beide Fragen gibt es nur eine Antwort“, sagte ich, „eigentlich geht es immer nur um eins: Sehnsucht.“
„Sehnsucht?“, ihre Stimme klang belustigt und fast ein wenig spöttisch. „Sehnsucht wonach?“
„À votre santé!“, ich sah ihr über den Rand des Glases in die Augen. Sie prostete mir in gleicher Weise zu. Nun erst ihre Frage aufnehmend, erwiderte ich: „Vermutlich von Sehnsucht nach dem, was meines Erachtens aus dem Blick der ‚Frau mit dem französischen Namen’ spricht, aus dem Blick, den sie, wie ich vermute, dem Zylindermann zuwirft. Für mich spiegeln dessen Augen diesen Blick. Sie haben das Bild sehr gründlich betrachtet, ganz versunken waren Sie; wie interpretieren Sie es?“
„Ich glaube“, antwortete sie, „die beiden erkennen sich gerade; vielleicht als für einander bestimmt, oder?“ Dieses ‚Oder?’ schwebte zwischen uns und schuf eine besondere Art von Nähe.
„Passt jedenfalls ausgezeichnet zu Tristan und Isolde“, ich wies auf das Textbuch.
Darauf sie: „Andere Zeiten, aber die Sehnsucht nach Liebe und das Liebesverlangen sind wohl immer gleich, wenn zwei aufeinander treffen, ich meine, einander wirklich begegnen.“
„Sehen Sie“, sagte ich, „genau das ist meine Sehnsucht.“
Wir sahen uns an und tranken uns erneut zu. Eine Pause trat ein. Beide hingen wir unseren Gedanken nach.
„Was verstehen Sie unter wirklicher Begegnung?“, fragte ich.
„Das wissen Sie doch: Wenn man den Blick empfängt, der einen mitten ins Herz trifft. Und wenn man selbst mit einem entsprechenden Gegenblick antworten kann, auch wenn eine Frau diesen Blick meist zu camouflieren pflegt.“
„Und wie bewerten Sie nun unser beider Blickwechsel?“ Ich wusste schon vorher, meine Frage würde sie nicht akzeptieren.
„Erstens fragen Sie zuviel und zu direkt, zweitens bin ich keine Auskunftei, drittens sollten erst einmal Sie selbst diese Frage beantworten“, sagte sie.
Ihre Antwort war keineswegs spitz, zeigte mir aber erneut, dass sie offenbar wirklich diese freie und selbstbestimmte Frau war, als welche sie sich von Anfang an gezeigt hatte. Wir sahen uns lange an. Es war eine Art Blickwechsel in freundlicher Absicht, der sich zu ‚friendly fire’ entwickelte, vielleicht aber auch nur ein zugewandtes gegenseitiges Abtasten blieb. Sie hatte dunkelblaue Augen mit kleinen goldenen Einsprengseln in der Iris, aber das Prägende an ihrem Blick waren ihre großen, dunklen Pupillen, in denen sich ein hintergründiges Licht spiegelte. Mir fiel der unterschiedliche Ausdruck ihrer Augen auf: das linke blickte fröhlich in die Welt, im rechten waltete ein Schmerz oder vielleicht auch Sehnsucht nach Verlorenem.
„Sind Sie verheiratet?“, fragte ich.
“Sind Sie der große Fragemeister?“, kam es schlagfertig zurück, und dann erwiderte sie: „Ja, lange und sehr glücklich. Und Sie?“
„Ja, lange und sehr glücklich.“ Ich versuchte den gleichen Ton zu treffen, den sie angeschlagen hatte.
„Keine Affären?“, fragte sie und lächelte entwaffnend.
Ich gab keine Antwort, sondern bemerkte nur leichthin: „Ich habe Sie angeblickt.“
„Sie haben mich mit den Augen fast ausgezogen und sich gefragt, lässt die sich in meinen Blick fallen? Wie wäre es mit der?“
„Stimmt“, antwortete ich schnell und atmete tief durch.
„Also auch so ein sehnsüchtiger Don Juan, der alle Frauen mit den Blicken testet, ob und wie sie sich wohl als Bettgenossinnen eignen“, stellte sie in gleichmütigem Ton fest. Ihre Stimme wirkte leicht desinteressiert.
„Stimmt nicht“, erwiderte ich, „daran denke ich erst, wenn ich einen Gegenblick erhalten habe, wie den von Ihnen vorhin.“
„Und? Wie ist Ihre Beurteilung über mich ausgefallen?“, fragte sie. Ihre Pupillen weiteten sich kurz, dann aber erschien das Lächeln eines perfekt gespielten Unschuldsengels auf ihren Zügen. Ich sah sie nur an, antwortete aber nicht. – „Nun reden Sie schon“, drängte sie.
„Ich vermute“, entgegnete ich in einer Mischung aus Irritation und Amüsement, „wir würden uns wunderbar verstehen.“
„Auch im Bett?“
„Gerade im Bett!“
„Und nun wollen Sie das ausprobieren.“ Das klang wie eine selbstverständliche Tatsachenfeststellung.
„Ehrlich gestanden am liebsten ja, aber nur, wenn wir uns näher kennen gelernt haben und auch dann erst, wenn Sie selbst sich ganz sicher sind.“
„Dann lassen Sie uns gehen, mon Chevalier.“ Sie stand auf und ging ohne jedes Zögern dem Ausgang zu. Ich legte einen 20 €-Schein auf den Tisch, beschwerte ihn mit einem Weinglas und folgte ihr. Sie ging vor mir: schnell, mit elastischen Schritten, die für eine Frau sehr raumgreifend waren. Fast unmerklich wiegte sie sich in den Hüften. Sie wirkte auf mich faszinierend attraktiv.
Im Hotel
Auf der Straße winkte sie ein vorbeifahrendes Taxi heran. „Zum Hotel Passagère, bitte“, sagte sie dem Chauffeur in einem bestimmten, aber sehr freundlichen Ton. Mir lächelte sie zu, äußerte sich aber nicht.
Das „Passagère“ ist ein stadtbekanntes First Class Hotel. Absoluter Luxus mit entsprechenden Preisen. Für mich war so etwas nicht erstrebenswert. Ich rückte innerlich ein wenig ab von ihr. Sie bemerkte das und lächelte mir liebenswürdig, aber auch irgendwie untergründig zu.
Im Hotel angekommen, fuhren wir in einem vollständig verspiegelten Fahrstuhl hinauf in das 14. Stockwerk. Sie öffnete die Tür zu einer sog. ‚Hanseaten Suite’. „Bitte“, sie machte eine einladende Handbewegung. Eine geräumige Garderobe öffnete sich zu einem von Licht durchfluteten Wohnraum, der auf eine Freiluftterrasse hinauslief. Zur rechten Hand war eine hohe und breite doppelseitige Schiebetür zu sehen, die halb offen stand. Dort mussten sich die Schlaf- und Sanitärräume anschließen.
„Ich mache uns schnell einen Kaffee“, schlug sie vor. „Und den trinken wir draußen unter freiem Himmel. Dieser Junitag ist zu schön, um drinnen zu sitzen.“ Ich nickte nur. – „Gehen Sie, setzen Sie sich einen Augenblick nach draußen in die Sonne, ich ziehe mich nur eben mal um.“
Wenig später stand sie vor mir. In meiner Männerphantasie hatte ich mir vorgestellt, sie werde in einem hauchzarten, fast durchsichtigen Sommerkleid erscheinen, mit einem leichten Schmollmund und einem träumerischen Blick. Sie aber stand vor mir mit lustigen Augen, in weißer Hemdbluse, Jeans und Sportschuhen. In jeder Hand hielt sie einen Becher mit dampfendem Kaffee.
Ein Lachen platzte aus ihr heraus, als sie meinen Blick sah. Und ich lachte mit.
„Sie haben doch nicht wirklich erwartet, ich würde sogleich mit Ihnen in die Kiste springen“, bemerkte sie lachend.
„Natürlich habe ich ein bisschen darauf spekuliert“, antwortete ich nur halb im Ernst, „Mann ist Mann. Aber ich liebe jede Form der Überraschung.“
„Wenn überhaupt je, dann müssten wir uns erst einmal kennen gelernt haben“, hielt sie dagegen. „Ich kenne ja noch nicht einmal Ihren wirklichen Namen. Ich heiße nicht Isolde, sondern bin Claire“, fügte sie an.
„Und ich bin nicht Tristan, sondern Wolf“, antwortete ich, „Wolf Wega-Wagemann. Meine Freunde nennen mich meist einfach ‚Wega’.“ – „Wega wie das Sternbild?“, fragte sie. – „Wie der Hauptstern im Sternbild ‚Leier des Orpheus’. Der ‚Herabstoßende’ lautet eine Übersetzung aus dem Arabischen, genauer wohl ‚der fallende Adler’“, erklärte ich. – „Das hört sich gefährlich an“, antwortete sie und, formell werdend, fügte sie hinzu: „Gleichwohl, sehr angenehm. Claire Verte – nein, nicht Französin, sondern Deutsche mit einem französischen Namen. Mein Vater litt nämlich unter einer unheilbaren Gallomanie, wohl wegen seiner großen Liebe zu einer Französin, die auch Claire hieß. Er hat dafür gesorgt, dass nun auch ich diesen Namen trage. Der Feigling hat schließlich jedoch eine Germanin geehelicht, eine urdeutsche Ursula. Von ihr habe ich die blauen Augen und die blonden Haare. Aber wenigstens ich habe einen Franzosen geheiratet.“ Sie lachte wieder, aber dieses Lachen klang ein wenig verhalten.
Seine Erzählung unterbrechend, räusperte sich Wolf Wega. Er wandte sich mir zu und stellte fest: „Das war der Beginn. Und so wie dieser Anfang gestaltete sich unsere ganze Beziehung, bis wir...“ Seine Stimme schwebte im Raum. „Es war ein beiderseitiges Aufeinander-Zugehen. Für mich eine Art Sucht, sich selbst verstärkend, offenbar auch darauf gerichtet, den Anderen als Anderen zu erfahren und im Anderen sich selbst zu erkennen. Jedenfalls mir ging es so.“ Und, nachdenklich werdend, fügte er hinzu: „Ich habe lange überlegt, worin die eigentliche Triebkraft bestand, die uns aneinander zu fesseln begann. Gibt es so etwas wie Sehnsucht nach dem Anderen, wenn der Blick in das schillernde eigene Selbst keine Klarheit schaffen kann? Wenn aus einer Begegnung mit einer oder einem Fremden die Hoffnung auf eigene Selbstfindung im Anderen entspringt? Oder war es einfach eine spontane Liebessehnsucht in einer kühler werdenden Welt der objektiven Sachen, Sehnsucht nach Wärme und Nähe – Erotik und Sexualität eingeschlossen?“ Wega hing lange Zeit seinen Gedanken nach. Dann stöhnte er auf. Seine offenbar selbstquälerischen Fragen beschwerten ihn. „Oh“, schrak er auf, „ich glaube, ich bin zu ausführlich. Aber Sie wollten ja auch die menschlichen Begleitumstände erfahren; und für mich sind diese Begegnung und die daraus folgenden Ereignisse sehr gravierend für mein Leben geworden. Ich bitte um Verständnis.“ Dann nahm er seine Erzählung wieder auf.
Ja, der Anfang offenbart alles. Wir trafen und verstanden uns von Beginn an in unseren Blicken. Es war eine Passion, die uns beide zu packen begann und uns hielt und uns nicht mehr los ließ. Und so nahm unsere Geschichte ihren Lauf.
Wir saßen also auf einer Freilichtterrasse hoch über Berlin in der Junisonne, tranken einen starken Kaffee, sahen uns an und tauschten uns aus. Es gab erstaunliche Parallelen. Claire war mit einem Maler, André Verte, verheiratet. „André lebt die meiste Zeit des Jahres in Forcalquier im Luberon (Provence)“, sagte sie. „Wegen des Lichts und der Pigmente, die man dort findet. Er liebt die besonderen Farben.“ – Meine Frau Susan war ebenfalls Malerin und Bildhauerin und betrieb – nach öffentlicher Lehrtätigkeit – seit vielen Jahren eine private Kunstschule in Hamburg.
Claire und ich hatten dagegen beide praktische Berufe: Sie war Journalistin („Zeilenschinderin“ nannte sie sich), die vorwiegend für eine französische Wochenzeitung von Berlin aus über Deutschland berichtete. Ich selbst stellte mich vorsichtshalber als Jurist im öffentlichen Dienst vor. Beide interessierten wir uns für Musik, Literatur, Lyrik, bildende Kunst, für Psychologie (sie), für Philosophie (ich) und für Politik (wir beide). Wir machten eine regelrechte tour d’ horizon. – Beim Thema Malerei kamen wir noch einmal auf den Fabricius zurück. Claire sagte, auch sie interpretiere das Leuchten in den Augen des Zylindermannes als Reflex des Blickes der Frau. „Ich komme darauf, weil ich nicht weiß, woher bei dem gewählten Bildaufbau sonst dieser Lichtreflex kommen sollte“, sagte sie. – „So ähnlich habe ich es auch empfunden“, antwortete ich, „obwohl ich mir diesen Reflex nicht so rational erklären konnte, wie Sie es jetzt getan haben.“
So ging es weiter. Das einmalige Fluidum der ersten Begegnung erfasste uns beide. Zwischen uns entstand ein kaum erklärliches Gefühl von Magnetismus. Wir fühlten uns zusammengehörig. Dabei verlief unser Gespräch, abgesehen vielleicht von zu langen Blicken, in völlig sachlichen Bahnen.
Irgendwann kamen wir auf die wirtschaftliche Seite des Kunstbetriebs zu sprechen und schimpften auf die Kostgänger der Kreativen, die Galeristen, die viel zu große Anteile der Verkaufserlöse kassieren. Halb belustigt, halb fragend erlaubte ich mir die Bemerkung, dass ihr Mann trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen ja ganz schön im Geschäft sein müsse, wenn er sich „das hier“, ich deutete auf das Appartement hinter uns, leisten könnte. – „Nur keine Fehleinschätzung“, sagte sie sichtlich amüsiert, „ich habe schon im Auto gemerkt, dass Sie etwas gegen diese Luxusherberge haben. Die Suite hier hat uns ein Millionär und Kunstliebhaber zur temporären Nutzung überlassen. Der hat einen Narren an André gefressen und ist brennend an dessen Malerei interessiert. Wir könnten uns dieses Hotel niemals leisten. André gehört nicht zu der Ausnahmeklasse von Künstlern, die von Paris über London bis New York Millionen machen.“
Sie amüsierte sich immer noch, als sie sagte: „Wir sind bescheidene Leute – aber immerhin habe ich ein kleines Wochenendhaus geerbt, an einem See gelegen, gut eine Stunde Autofahrt von hier.“ Und dann fragte sie mich in ihrer sehr spontanen Art: „Wollen wir hin?“ Sie sah mich an. – Ungläubig erwiderte ich ihren Blick. Ich hatte mir drei Tage Urlaub genommen. ‚Welch’ Glück’, dachte ich. Laut und gut gelaunt sagte ich: „Eine sehr gute Idee!“
Die Fahrt in ihr ‚grünes Paradies’, so nannte sie es, war Claires spontane Idee gewesen. Unser Umgang damit zeigte, wie offen wir füreinander waren.
Eine kurze Autofahrt
Wenig später saßen wir in Claire Vertes’ schwarzem Golf. Schon mit der Inbetriebnahme des Wagens erklang die leise Anfangssequenz der Tristanouvertüre. Claire hatte die CD-Anlage in ihrem Auto nach ihrer vorangegangenen Fahrt nicht abgeschaltet. „Karajan“, erklärte sie nur.
‚Tristan und Isolde’ war für mich immer schon eine Ausnahmeerscheinung in der Welt der Oper gewesen – das absolute Liebesdrama, in dem Musik, Wort und Sinn ineinander verschmolzen wie Menschen im Liebesakt. Claire teilte die Liebe zu Tristan aus eigener Nähe zu diesem Werk. Auf dem Weg in die alte Mark Brandenburg hörten wir das gesamte Vorspiel.
Überhaupt schien alles wie selbstverständlich zwischen uns zu sein, leicht und harmonisch. Aus Blicken, scheinbar unbeabsichtigten gegenseitigen Berührungen, aus dem Klang unserer Stimmen entwickelte sich wie von selbst eine erotische Atmosphäre, die uns beide ergriff, ohne dass sie in Worten Ausdruck suchte. Wie sich in unserem Gespräch auf der Fahrt in Claires Paradies schon bald herausstellte, waren wir beide aber keineswegs auf Wagner fixiert. Genau so liebten wir, die Werke anderer Komponisten wie Puccinis ‚Manon Lescaut’, damit hatte dieser seinen Durchbruch als Komponist gefeiert, oder Verdis ‚La Traviata’ und Musiktheater überhaupt (auch z.B. Henze oder Nono). Aber dennoch: Wagners Tristan war unser beider erklärte Lieblingsoper.
„Ich habe Karten für den Tristan“, sagte Claire wie nebenher und fügte mit entschiedener Stimme sofort hinzu; „wir gehen zusammen hin.“ Ich blickte sie ungläubig an: „Sie werden doch bestimmt schon verabredet sein“, entgegnete ich. – „Stimmt, aber mit einer Freundin, die sich nicht so viel aus Wagner macht. Sie ist nur meinetwegen mitgekommen. Sie wird froh sein, wenn sie nicht hin muss.“ Ich sah sie zweifelnd an. – „Ja, wirklich, so ist es“, fügte sie hinzu, als sie mein grenzenloses Erstaunen bemerkte. – „Aber... “, brachte ich hervor. – „Nichts aber“, unterbrach sie mich und lächelte mich an. „Es ist die Premiere in der Staatsoper für die diesjährigen Sommerfestspiele. Übermorgen.“
Ich schwieg. Für mich war das alles wie ein Traum. Eingehüllt in die ewige Musik von Liebessehnsucht und Weltenschmerz, von Aufstieg und Untergang, fehlten mir die Worte, die ich jetzt hätte sagen können. Neben mir, der ich damals Anfang 60 war, eine junge, vitale, attraktive Frau, die mich mit jedem Atemzug mehr in ihren Bann zog. Vor mir die Aussicht auf ein gemeinsames Musikerlebnis der Extraklasse. Und in mir eine große Schwermut, mit der ich lebte, nachdem ich der zweiten großen Liebe meines Lebens (nach meiner Frau) begegnet war und am eigenen Leibe erfahren hatte, was Liebe sein kann mit all ihren Himmeln und Höllen. – An dem Scheitern dieser Liebe wäre ich seinerzeit fast zerbrochen. Und damals hatte ich mich noch viel intensiver als jemals zuvor mit Wagners Werk beschäftigt. Seither wusste ich, was sich zwischen Tristan und Isolde ereignet haben musste. Wusste, was es auf sich hatte mit dem innigen Blick zwischen zwei Menschen, jenem Blick, der der Liebe Bahn bricht. Wusste von dem verzweifelten Kampf der beiden Liebenden gegen die Konventionen und von dem Widerstreben, sich selbst und einander eine schicksalhafte Liebe einzugestehen – bei Tristan und Isolde erst möglich in der vermeintlichen Stunde ihres Todes.
Ich hatte gelernt, was es auf sich hatte mit der alle Grenzen sprengenden Hingabe an die Liebe zu einem Anderen, einer Liebe, die bis an den Tod heranreichen und darüber hinausgehen konnte – Liebe eben und nicht der leichte Flirt oder das frivole Abenteuer. Ich, der ich bereits glückliche Jahre verheiratet gewesen war, hatte die Liebe damals als Verhängnis erlebt. Und gleichzeitig war mir die Absurdität einer jeden Liebe aufgegangen, die Besitzansprüche geltend macht. Und in der Tat: Wer Besitz ergreifend von großer, von ewiger Liebe spricht, hat nichts begriffen. Bei lebendigem Leib droht er Schaden zu nehmen an der eigenen Seele. ‚Ich bin eben ein verfluchter Romantiker’ – dieser Satz geht mir seit jener Zeit öfter durch den Sinn. Aber ich stehe auch dazu.
Manchen Menschen, und zwar einer nicht geringen Anzahl von ihnen, ist eine unerschöpfliche Sehnsucht nach Liebe eingepflanzt, die sie ein ganzes Leben nach eben dieser Liebe suchen lässt – selbst dann, wenn man sie gefunden zu haben glaubt, dann aber doch feststellt, dass man sie nicht so, wie erwartet, leben kann. Und das sogar auch, wenn man sich lange vormacht, den ‚ersten Durst’ gestillt zu haben. Mein Durst jedoch blieb zu groß, er erwies sich immer nur als vorläufig gestillt.
Mein Problem bestand eigentlich darin, dass ich das Gefühl von Liebeserwachen immer wieder neu erleben wollte, nein, musste – gegen alle Vernunft, gegen jedes Maß. Ich jagte dem Traum vom Leben in immer währender Liebe hinterher. Es war wie eine Sucht. Und dabei lief das Drama der Vergänglichkeit und Vergeblichkeit ab – gleich einem Uhrwerk.
Ich erlebte, wie die Liebe sich veränderte, in der Ehe immer tiefer wurde in Hinblick auf Verständnis und Vertrautheit, dabei jedoch im Intimbereich an Intensität verlor. Und parallel dazu ging eine neue Liebe auf, die zeitlich verschoben denselben Gesetzen unterliegen würde, aber unwiderstehlich für mich mit einer faszinierenden Wachstumsphase begann. Naturrecht stand hier gegen Normgeltung.
Solche Konflikte zehren an dem Ehepartner, aber auch an einem selbst, auch wenn man damit nach außen ruhig und sachlich umzugehen weiß. – Sollte ich mit Claire ein neues Spiel, nein, eine neue Liebe beginnen, die schnell kein Spiel mehr war, wenn zwei sich erst einmal als Liebespaar gefunden hatten? Ich zögerte und zweifelte. Es gab immer eine Dritte oder einen Dritten, der sich verletzt fühlen konnte. Von dem Prinzip der Toleranz auf dem Gebiet der Erotik war die Gesellschaft und waren die jeweiligen Ehepartner in aller Regel weit entfernt. Nur wenige Menschen hielten eine Dreier- oder Viererkonstellation aus, aber sie gab es. Das ließ sich an konkreten, keineswegs nur literarischen Beispielen ablesen (etwa an Jean Paul Sartre und Simone de Beauvoir). Überall jedoch traten früher oder später Widersprüchlichkeiten und Verletzungen zu Tage.