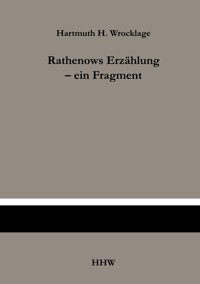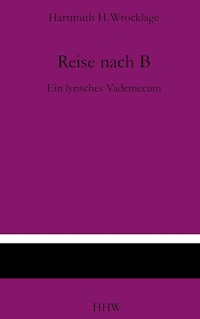Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Dieses Buch versammelt in kurzen Geschichten reale und fiktive Begebenheiten, die existentielle Situationen menschlichen Lebens auf den Punkt bringen. Die einzelnen Geschichten und Szenen sind Momentaufnahmen. Im Ganzen gesehen, versteht sich das Buch als eine Flaschenpost für die Menschen, die es finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Narretei
2. Wenn einer sich umdreht
3. Auf Suche
4. Tamme
5. Einen Punkt setzen
6. Michas Weihnacht
7. Regen
8. Eine Art Neuanfang
9. Vom Wachsen eines Pferdefußes
10. Nachtjäger
11. Notausgang
12. Auf dem Rand
13. Himmelrot
14. Lichtkraut
15. On verra
16. Betonkopf
17. Weißer Elefant
18. Im Café Blue zur romatischen Liebe
19. Schwarze Dame
20. Voran allem Abschied
21. Mitten in Zentraleuropa am Rande der Welt
22. Herzland
23. Situatives aus einem Dreieck
24. Mutmaßung eines alten Existentialisten
25. Alle Farben – schwarz
26. Tango Argentino
27. Eine Selbstorientierung
Nachwort
„Ich will ihn nicht allein lassen.“ Früher hätte mir das nichts ausgemacht: wir liebten uns so, wie wir lebten, wir waren von der Ewigkeit umgeben. Aber jetzt weiß ich, dass wir nur ein Leben haben, von dem uns nicht mehr viel Zeit bleibt und das von der Zukunft bedroht ist.
Simone de Beauvoir, Les Mandarins
1. Narretei
Träte dieser Clown, der auf dem Plakat lacht, mit seinem breiten, roten Mund lacht, als wolle er die Welt, die er doch liebt, verspotten, träte er heraus aus seinem Litfaßsäulen-Schattendasein hin vor einen der Passanten und fragte ihn, was das sei: Wahrheit – er würde Überraschung ernten, ein Achselzucken, das die lästige Frage abgleiten ließe von den Schultern, ein herablassendes Lächeln, das in den Gesichtern anderer stehen würde, die jede Frage beantworten können; vielleicht aber auch eine hilflose Bewegung, die jemand machen könnte, um zögernd und schwer weiterzugehen, wie alle weitergehen.
Die Augen in dem weißgeschminkten Antlitz des Clowns würden leer werden, leer, als vermöchten sie nicht zu weinen, und ihr dunkler Blick tief von innen würde fortgetragen werden, weit fort, so als suche er einen, der vielleicht noch kommen könne. Dann aber würde er sich umdrehen, der Narr, und gehen, langsam und zaudernd Fuß vor Fuß setzend, so als wolle er zurückgerufen werden. Und die ganze Zeit würde er nicht aufhören zu lachen, zu lachen mit seinem breiten, roten Mund.
Doch da ist einer, der dies alles aus seinem Versteck beobachtet hat, ein Denker oder Dichter vielleicht. Der steht betroffen im Gelächter des Clowns. Auch er würde keine Antwort wissen auf die Frage nach Wahrheit, nichts wissen, obwohl er doch die Blumen blühen sieht, das Kindergeschrei vom Spielplatz hört, ohne sich gestört zu fühlen, und nachts dem Winde nachlauscht, der durch die Zweige der Bäume geht. Ja, obwohl er die romantische Liebe kennt, würde auch er nichts zu sagen wissen auf die Frage des Clowns. Nichts. Auch er nicht, der Unglück, Krankheit, Leid, Krieg und Tod gesehen und erlebt hat, wüsste nicht zu sagen, was Wahrheit ist.
Zuletzt würde auch er einfach weggehen in die farblose Welt des Schweigens, ohne sein Wort dorthin zu richten, wo es keine Hölle gibt und kein Paradies, sondern nur nichts: die Leere eben.
2. Wenn einer sich umdreht
Auch so kann erstaunlicherweise eine echte, innige Liebe beginnen: mit einer allerdings eher skurrile Geschichte, die – gegen alles, was man erwartet – zu einer lebenslang glücklichen Beziehung führt.
Es klingelt. Der Mann steht auf, legt die Zeitung, in der er gelesen hat, auf den Tisch, und geht zur Tür seiner eher ärmlich ausgestatteten Hochhauswohnung. „Ach, du bist es“, sagt er, „komm rein.“ Er geht ohne ein weiteres Wort zurück in sein Wohnzimmer, lässt sich nachlässig in seinen Sessel fallen und wendet sich ungeduldig zum Flur hin, in dem sie offenbar den Mantel auszieht. „Na, endlich“, sagt er, als sie erscheint. Er blickt ihr abwartend entgegen.
‚Sie sieht nicht mehr so aus wie früher‘, denkt er. Sie hat in letzter Zeit ihre Frische und fröhliche Unbefangenheit verloren und viel von dem Charme, der ihn ursprünglich verzaubert hatte. Ihre Augen liegen tief wie in dunklen Höhlen. Ihr Gesicht ist bleich unter einem Puderhauch. – ‚Liebt er sie überhaupt noch? Jedenfalls nicht mehr derart leidenschaftlich wie früher‘, denkt er. Dabei hat er sich damals nachhaltig in ihr ganzes Wesen, in ihren Liebreiz und ihren Herzenstakt verliebt. ‚Oder könnte es sein, dass er sich geirrt, sich seine Liebe nur eingebildet hat? Schon wahr, Spaß hat es gemacht, sie zu erobern, mit ihr durch die Stadt zu bummeln.‘ Es ist ihm immer ein Vergnügen gewesen, wenn die Blicke der Passanten sie als ein schönes Paar verfolgt haben. Sie ist hübsch gewesen, hat sich attraktiv anzuziehen gewusst. Sie ist bestimmt auch heute noch eine sehr gute Tänzerin. Sie hat ihn gereizt. Er hat sie haben wollen und hat sie erstaunlich schnell gehabt.
‚Und nun? Empfinde ich das alles immer noch so?‘ Im Wesen ist sie sich gleich geblieben. Und das ist viel. Aber sonst ist eigentlich nichts Besonderes mehr an ihr. Nicht einmal, dass sie trotz allem gut aussieht. Aber sie hat sich irgendwie verändert. ‚Und überhaupt – ist es nicht an der Zeit, in aller Behutsamkeit gütlich Schluss zu machen mit ihr?‘, fragt er sich. „Setz dich doch“, sagt er ein wenig freundlicher. Seine Stimme aber klingt eher gleichgültig, als er fragt: „Was bringt dich zu so ungewohnter Zeit her zu mir? Kann ich etwas für dich tun?“
Nicht wie früher emanzipiert und voll von fröhlichem Selbstbewusstsein, sondern eher schüchtern wie ein junges Mädchen geht sie zu dem andern Sessel und setzt sich ihm gegenüber hin. Ganz vorn auf der Kante sitzt sie, als wolle sie nur einen kurzen Besuch machen und gleich wieder gehen.
„Was ist los?“, fragt er.
Sie öffnet den Mund und will etwas sagen.
„Nun sag schon“, sein Ton ist sachlich, aber seine Ungeduld ist nicht zu überhören.
Sie öffnet den Mund, ihre Lippen zittern.
„Was ist denn nur?“, fragt er nach. ‚Warum sagt sie nichts? Er hat etwas anderes zu tun, als hier nutzlos herumzusitzen und zu warten. Sie sieht wirklich ziemlich elend aus‘, denkt er. Er blickt in ihr Gesicht, in dem angstvoll und groß ihre Augen stehen. Und plötzlich fühlt er eine Art von Mitleid, ja, von Sympathie, die ihn ergreift. Er wundert sich über sich selbst.
„Du“, sagt sie, ohne ihn anzusehen.
Er merkt, wie sie sich müht, ihrer Stimme einen festen Halt zu geben.
„Hör mal“, sagt sie – und dann kommen ihre Worte erst stoßweise, dann schnell, so etwa als wolle sie sich einer unangenehmen Entschuldigung entledigen. „Ich, ich bin schwanger, ich kriege ein Kind von dir. Wir müssen reden. Und dann entscheiden, was wir wollen.“ – Jetzt sieht sie ihm plötzlich wie befreit, frei wie früher in die Augen.
„Nein“, sagt er tonlos, und ein hilfloses Zucken läuft über sein Gesicht. „Das war nicht abgemacht.“
Sie sehen sich direkt an. Eine ganze Zeit blicken sie einander in die Augen. Sie erkennt seine Hilflosigkeit, vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen und beginnt zu schluchzen.
Er steht auf, geht zum Fenster, starrt hinaus. Er hat ihr den Rücken zugekehrt. Ihm ist heiß, und er lehnt seine Stirn an das kühle Glas. Die ganze Vergangenheit ihrer jungen Beziehung steht ihm vor Augen. Ihre Hingabefähigkeit, seine Werbung um ihr Vertrauen, die Versprechen, die er ihr für alle Zeit gegeben hat. Und dann wird sein Atem plötzlich ruhig. Die Entscheidung, die sie will, ist eindeutig. Aber sie fällt in ihm wie von allein.
Er tritt vor sie hin, reicht ihr beide Hände und zieht sie hoch an seine Brust. „Wir schaffen das schon“, sagt er mit einer Festigkeit und Eindeutigkeit, die ihn selbst überrascht. Er verkneift es sich, ein Oder anzuhängen.
Sie sieht ihn unter Tränen an, dann verzieht sich ihr Mund, es sieht aus wie ein ungläubiges Lächeln. Ganz leise flüstert sie: „Und ich dachte schon, du wolltest mich hängen lassen.“
Da zieht er sie ganz fest an sich. Und sagt mit fester und ruhiger Stimme: „Was denkst du denn von mir. Jetzt sind wir doch fast schon eine Familie.“
Sie wiegen sich hin und her. Für beide ist es beinahe wie früher.
3. Auf Suche
Vor dem Glas
In der Kneipe trifft ihn schon wieder der Blick des Clowns. Hier lacht er von der Wand neben dem Eingang, aber er tritt nicht aus der Wand heraus. ‚Bleib, wo du bist, verdammter Narr‘, denkt der Mann ‚was willst du, hat ja doch keinen Zweck.‘ Und dann weiß er plötzlich nicht, ob er zu dem Clown oder zu sich gesprochen hat.
Er sitzt da, starrt in das leere Glas, das vor ihm auf der blank gescheuerten Tischplatte steht, in dieses widerlich leere Glas. Ihn stört die dumpfe Stumpfheit, die ihn umgibt, das laute Geschwätz, die aufdringiche Schlagermusik aus dem veralteten Musikautomaten, überhaupt der hohe Lärmpegel des Kneipenbetriebs und ganz besonders das selbstgefällige Lachen der Anderen, das von Zeit zu Zeit wie ein Geschwür aufbricht aus dem allgemeinen Stimmengewirr. Und dann meint er auch noch das Geräusch kauender Kinnläden herauszuhören.
Dem Mann wird schlecht. Ein Zwangsgefühl legt sich auf ihn. Er muss sich mit dem ausgetrunkenen Glas da vergleichen, das vor ihm auf der Tischplatte steht wie eine wortlose Aufforderung. ‚Ein ausgetrunkenes, ekelhaft leeres Glas‘, denkt er, ‚das man in die Ecke stellt, um es irgendwann einmal abzuwaschen.‘ Und während er das Glas von sich fort stößt, weg von sich, ruft er nach einem neuen Schnaps.
Heiß rinnt der Alkohol durch seine Kehle. Er hebt das leere Glas. „Noch einen Schnaps“, ruft er zur Theke. Und wieder fällt der Blick des lachenden Clowns auf ihn. ‚Du bist schuld mit deinen dämlichen Fragen nach Wahrheit und so‘, denkt der Mann, ‚du hast mir die Stimmung versaut, du alter Clown. Aber total. Was soll das auch? Guck dir doch die Ausbeuter an, die die Welt beherrschen und alles dem Marktwert und dem Geld unterwerfen, sogar die Kultur und die Medien‘. „Und noch einen“, ruft er, und als er das neue Glas in den Händen hält, prostet er dem Clown zu. „Kotz!“, ruft er durch die Kneipe. Einige Leute lachen. „Mann, ist der besoffen“, sagt einer zu seinen Kumpeln, und die lachen noch einmal auf.
„Schnauze!“, ruft der Mann, und gleich darauf: „Zahlen!“
Auf dem Bahnsteig
Der Mann beobachtet eine Frau und fühlt sich an eigene Abschiede erinnert. Typisch, dieser hochgereckte Arm, die lebhafte Bewegung ihrer Hand, jenes letzte heftige verabschiedende Winken, das immer weiter abebbt und erstirbt; das merkwürdige Zucken, das über ihr Gesicht läuft, ein verirrtes Lächeln, das Tränen zu verbergen sucht. Seltsam und verloren steht ihre Hand noch immer im Raum. Sie blickt einem wehenden Taschentuch nach; dieses tanzt vor dem schmutzigen Braun des ausfahrenden Zuges, ein Weiß, das sich vor bösartig glitzernden Scheiben zu Tode flattert. Sie starrt den sich scheinbar verwirrenden Schienen nach, bis die Ferne leer geworden ist. Dann wendet sie sich abrupt ab und geht.
Ein Vorortzug lärmt vorbei. Ein paar Leute sitzen darin. Seine Augen suchen noch einmal nach der Frau. Er sieht, wie sie auf den Ausgang zugeht. Ihr Schritt wirkt jetzt entschlossen.
Er dreht sich um und blickt auf die Bahnsteigsuhr, dann auf seine Armbanduhr. Zeitvergleich. Auf der Anzeigentafel steht zu lesen, dass der Zug nach H., sein Zug, voraussichtlich fünfzig Minuten später eintrifft. ‚Zeit noch auf den Bahnhofsvorplatz hinauszugehen und sich die Beine zu vertreten‘, denkt er. Aber er irrt sich.
So geht es einem, der zu lange in der Kneipe hockt. Die Anzeige ist überholt. Der Anschluss ist verpasst. Es besteht keine Möglichkeit mehr, nach H. zu kommen. Diese Nacht fährt kein Zug mehr. Der Mann wird hier bleiben müssen. Er sieht auf die Uhr. Der große Zeiger zuckt über das weiße Feld, steht über dem Strich an der Zwölf, als gehöre er dazu, und springt doch weiter. Die Zeit ist ein Karussell. ‚Ein Fünfziger pro Person‘, schreit der Kassierer. ‚Wer einen Schimmel reitet, gibt Trinkgeld.‘
Der Mann nimmt das erstbeste Hotel in Bahnhofsnähe. Das Zimmer ist einfach. Eine trockene Hitze liegt in der Luft, treibt ihm den Schweiß auf die Stirn. Er reißt das Fenster auf: Luft. Er blickt auf den Vorplatz des Bahnhofs. Draußen fällt wieder dieser Schneeregen. Wildes Wirrwarr von Flocken und Regentropfen. Dahinter immer mehr Nacht.
Erstaunlich viele Menschen sind es, die um diese Zeit zum Bahnhof streben oder gerade angekommen sind. Sie wirken wie vom Wind getrieben. Begegnungen sind kaum wahrzunehmen. In dieser Situation wären diese wohl auch belanglos und unnütz. Ihm fällt eine einsame Prostituierte auf Freierfang auf, zu erkennen an ihrem wiegenden Gang, an ihren umherschweifenden, suchenden Blicken, an der Handtasche mit einem überlangen Schulterriemen. Aber in der Hauptsache sieht er dahineilende Passanten mit blass scheinenden Gesichtern unter dem Neonlicht des Vorplatzes. Sie erinnern ihn an unbeschriebene Papierblätter, nein, eher an Konfetti. Ihm fällt eine Konfettiparade in New York ein. Der Präsident hebt die Arme und winkt. Die Menge johlt vor Begeisterung. Aber der Attentäter liegt schon da, Präzisionsgewehr im Anschlag.
Von fern her klagend das Signal eines Zuges. Der Mann tritt in den Raum zurück, wäscht sich die Hände. Während er sich abtrocknet, betrachtet er sein Gesicht im Spiegel: sachlich, unbeteiligt, gleichgültig, aber ohne Gleichmut.
Ohne sich auszuziehen, legt er sich auf das Bett. Noch immer strömt kalte Luft in das Zimmer. Wohltuend kühlt sie seine Stirn, nimmt den Schweiß fort. Aber auch mit geschlossenen Augen spürt er die Nacht hinter dem Fenster, schwarz, anonym, vielleicht traurig. ‚Alle Wege führen ins Nichts. Aber was heißt das schon.‘
Ehe er einschlafen kann, denkt der Mann noch: ‚Ich hätte nicht dem Clown mit „Kotz“ zuprosten sollen – der kann ja nichts dafür –, sondern besser gleich dem lieben Gott in seiner Nullexistenz. In dieser Domstadt hätte das doch so richtig gut gepasst.‘ Ein wilder Lachanfall schüttelt ihn. „Also Prost, lieber Gott“, sagt er ein wenig vornehmer in den Raum und fällt übergangslos in einen bleiernen Schlaf.
Aufenthalt
Der Mann wacht sehr früh auf. ‚So geht es einem, wenn man zu lange in einer Kneipe hockt’, denkt er selbstkritisch. In ihm hämmert der Gedanke: ‚Du hast den Anschluss verpasst. Zu dieser frühen Zeit besteht keine Möglichkeit, rechtzeitig nach H. zu kommen. Auch in den Nachtstunden ist kein Zug mehr gefahren. Er hat diese Nacht zwangsläufig hier bleiben müssen.‘ Er sieht auf die Wanduhr in seinem Zimmer. Auch da zuckt der große Zeiger ruckhaft weiter wie auf der großen Uhr auf dem Bahnsteig. ‚Alles dreht sich im Kreis.‘ Er ist ungeduldig, mag nicht mehr auf irgendetwas warten und nimmt sich einen schnellen Mietwagen.
Straße
Es hat zu regnen aufgehört. Die Autobahn ist zu dieser frühen Stunde noch wenig befahren, fast leer. Die Betonpiste liegt sauber und wach vor ihm wie ein breites, blaugraues Band, das sich von selbst immer und immer wieder von neuem vor ihm ausrollt wie eine scheinbar endlos sich öffnende Zukunft.
Der Motor läuft ruhig und gleichmäßig. Der Mann tritt das Gaspedal durch. Das Weiß der Leitlinien rast auf ihn zu wie böse Fetzen Lichts. ‚Du spielst ja verrückt in deiner Ungeduld‘, denkt der Mann und nimmt das Tempo zurück.
Brief aus H.
Während der Fahrt erinnert er sich an eine Begebenheit aus dem vorigen Jahr: an einen Urlaubstag, den er allein angetreten hatte.
Die Vorhänge des Fensters sind nur halb zugezogen, aber der Spalt ist groß genug, um Licht ins Zimmer strömen zu lassen, nicht irgendwelches Licht, sondern das helle, warme Frühlingslicht eines Sonntags im April. Es ist gut, aufzuwachen und einem Tag entgegenzusehen, zu dem man ‚Ja‘ sagen muss: ‚Ja‘ sagen, weil der Himmel, das leugnen auch die schmutzigen Fensterscheiben nicht, ein Versprechen trägt, ein alles offen lassendes Versprechen, das zuversichtlich macht. Die stehen gebliebene alte, schwarz geteerte Telegraphenstange außer Dienst passt dazu als Kontrapunkt. Ihre weißen Isolatoren aus Porzellan wirken im Sonnenlicht wie matt schimmernde Perlen. Manchmal ziehen kleine Wolken aus Silber über den Himmel wie kleine Melancholien. Schwerelos der Gesang einer wohl eines Stars, der sich in seinem Lied verliert. ‚Narr sein, sich der Welt verschreiben, weil man trotz allem das Leben liebt: Das ist nicht die schlechteste Illusion.‘
Der Mann sieht sich durch einen Park gehen. Überall blühen blau, weiß und gelb Krokusse, frohe Farbtupfer im verheißungsvollen Dunkel der erwachenden Natur. Über einer Brücke lehnend, beobachtet er die schweigende Erhabenheit eines Schwanenpaares, das gelassen durch das laute, lustige Geschnäbel des Entengesindels schwebt: stille Würde und laute Jahrmarktsdreistigkeit auf engstem Raum.
Ein Spiegel ist das Wasser, und irgendwann begegnet der Mann dort im Schwarz unter ihm seinem eigenen Gesicht, das blicklos neben dem Himmel schwimmt. Er weiß, dass alles Schicksal Begegnung ist, Begegnung mit anderen, Begegnung mit dem eigenen Selbst. ‚Dem Himmel begegnet man, wenn man träumt‘, denkt er. Solche kleinen Verlorenheiten sind für ihn so etwas wie erlaubte Sünden.
Aber in der Realität und deren Absurditäten kann er keinen Sinn von Sein erkennen – wie denn auch in Ansehung der Ausbeutung von Mensch und Natur durch ‚den Menschen‘, wie angesichts des Unrechts in der Welt, angesichts von Hungersnot, Wassermangel und Epidemien, wie erst recht mit Blick auf die vorsintflutlichen, ja atavistischen Kriege von Autokraten, die selbst aus der Zeit gefallen sind, aber immer noch ihre historisch überholten Großmachtträume und eigene Machtgelüste realisieren wollen; und wie endlich auch im Angesicht der vielen anderen schweren politischen Interessenkonflikte von Staaten und Völkern oder Bevölkerungsgruppen. Diese müssten sich extremistischer Kriminalität erwehren, entziehen sich aber oft einem friedlichen, dabei fairen Interessenausgleich und üben stattdessen aus Zorn und Wut, Angst und Hilflosigkeit selbst Terror aus. Überhaupt fehlt es generell an Wahrhaftigkeit und Freiheitswillen. ‚Alternativ‘ dazu ist in der aktuellen Politik auch noch eine Unterströmung aus Profit- und Machtgier und aus kriminellen Lügen auf dem Weg, sich mit Hilfe der sog. Social Media zu etablieren. Überwiegend sind die Influencer auf ihren eigenen geldwerten Vorteil aus und betreiben damit eine Profitwirtschaft, die resoluten Widerstand im Meinungskampf erfordert. Stattdessen aber herrscht ein weit übertriebener Parteienstreit in aller Öffentlichkeit und teilweise abschreckende Inkompetenz: ein Zuwenig an politischer Führung und ein Zuviel an Blindgängerei.
Das alles spielt sich – kein Wunder – in einer Zeit ab, in der die Menschheit an sich selbst zu ersticken droht, weil der von ihr gemachte Klimawandel die ersten Kipp-Punkte in Richtung auf eine Unumkehrbarkeit zu überschreiten droht oder schon überschritten hat. Verantwortung dafür tragen in allererster Linie die sog. zivilisierten Industriestaaten mit ihren zumeist in Wohlstand lebenden Bevölkerungen. Hier herrscht dennoch eine fast uneingeschränkte Konsummentalität nach dem Prinzip Eigennutz vor, die trotz beachtlicher Proteste außer Kontrolle geraten ist. Es wirkt, als habe ein Elementargeist die Menschheit zum sukzessiven Selbstmord verurteilt.
Ein Spatz fliegt heran und setzt sich auf das Brückengeländer, über das der Mann sich gebeugt hat. Für Spatzen hat er sehr viel übrig: Sie sind so grenzenlos unnütz.
Zu Hause
Nach Rückkehr in sein Haus wühlt er in seinen Papieren. Begegnungen in Worten und Gedankenfetzen, flüchtig hingeworfen wie Wesenloses und doch Teil von ihm. Gedichte, Geschichten von Kobolden und weinenden Königen oder die Tragödien von Expräsidenten, die nicht mehr auf Macht und Einfluss haben verzichten können. Und alles ist wie eine Tanzparty geängstigter Schatten, die ihre schwarzen Ziertänze auf der geschichtlichen Bühne, dieser größten Show des Lebens, aufführen und sich so ganz vergeblich herrlich, ja fast herrschaftlich wichtig nehmen.
Aber auch gute Worte und Sätze tanzen vor seinen Augen. Seine Gedanken kommen nicht zur Ruhe, sie bewegen sich von innen nach außen und wieder zurück. Erinnerungen einerseits an Zauberberge oder an verhexte Erfolge, andererseits vorauseilemde Blicke auf das notwenige Scheitern von Großreichen, Staaten, Bündnissen und nicht zuletzt eines jeden einzelnen Menschen im Leben, spätestens im Augenblick des Todes. Es stimmt schon, was Altmeister Goethe seinen Mephisto sagen lässt: „Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.“
Von wegen ‚Weltherrschaft irgendeines Gottes‘, von wegen ‚Vernunft der Geschichte‘, von wegen ‚ewiges Leben‘ und dergleichen Wunschbilder. Wann gesteht der Mensch sich endlich ein, dass er in einer für ihn undurchschaubaren Fremde lebt, in der er sich sein ureigenstes Selbst nur schwer, ja, letztlich nicht erklären kann.
Und dennoch, auch daran erinnert er sich, witzigerweise immer in gleichartigen Formulierungen: Es gibt Tage, zu denen man ‚Ja‘ sagen muss: ‚Ja‘ sagen, weil der Himmel ein Versprechen zu tragen scheint, ein stummes, alles offen lassendes Versprechen, das mit seinem harmlosen Rauschmittel Hoffnung zuversichtlich macht.
So kommt es, dass für ihn manchmal Wolken, wie aus feinstem Silber gemacht, schwerelos, ja geradezu lässig über das Blau des Himmels segeln wie kleine Melancholien, die von selbst vorbeigehen.
Orpheus holt sich Eurydike zurück
Andere Szenarien gehen ihm durch den Kopf. Erst haben sie sich nicht mehr umarmt, wenn sie sich begegneten, dann haben sie sich kaum mehr die Hand gegeben und sich nur mit unsicheren Blicken gegrüßt, zuletzt sehen sie sich kaum noch an und gehen schließlich aneinander vorbei als wären sie Fremde. Die Erosion einer Beziehung hat sich bei ihnen langsam fortschreitend ereignet wie ein von fremder Hand verhängtes Schicksal. Aber die Verursacher sind sie selbst. Beide.
Schon der Morgen nach dieser selbst verschuldeten Trennung hat anders ausgesehen: ein Morgen ohne Himmel. Ohne Himmel sind auch manche Tage und viele Nächte, wenn du nicht vergessen kannst und aus Erinnerung Sehnsucht wird. In solchen Zeiten wachsen Mauern um dich herum, kalt und abweisend, werden höher und höher. Die Stille um dich herum lässt dich in dir erzittern. Und du wunderst dich, dass alles stumm wird. Selbst die Steine scheinen sich abzuwenden. Deine Träume verkümmern in dieser Öde ohne Begegnung, ohne jedes wirkliche Gespräch, ohne Kommunikation. Hier beginnt das Nichts, wäre das Nichts nicht nur eine nichtige Leere, sondern noch ein Etwas, das unterzugehen hat. Das Nichts aber ist eben nichts – vielleicht ist es zu verstehen nur als ein prozesshafter Vorgang, eine Erosion, die zuerst möglicherweise ganz unbewusst einsetzt, wie eine Trennung ohne wirklichen Abschied: das Absterben vielleicht einer Beziehung, die einmal eine Große Liebe zu werden oder zu sein versprochen hat.