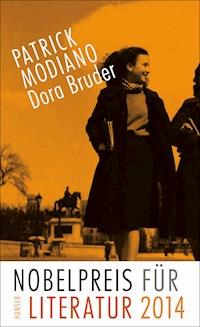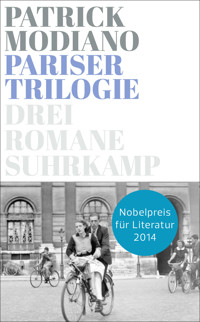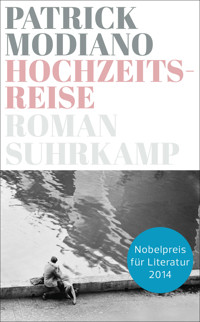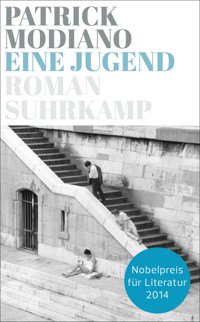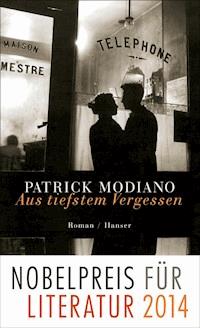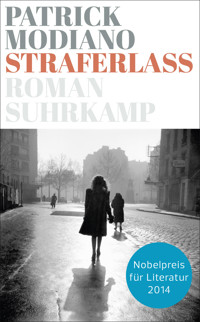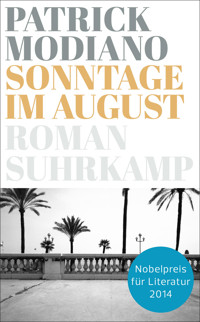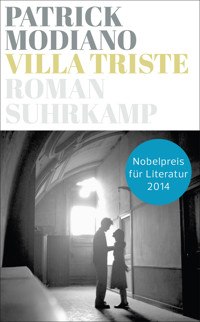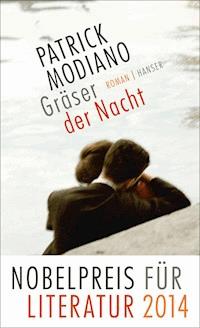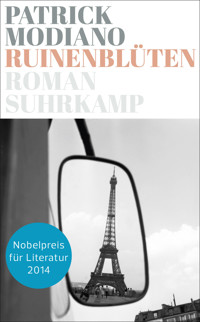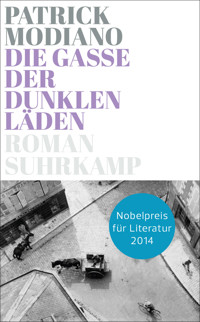
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paris nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Mann erinnert sich nicht mehr. Die einzigen Anhaltspunkte für seine Suche: ein altes Foto, eine Todesanzeige. Er trifft auf eine kleine Gruppe von Emigranten, die in dunkle Geschäfte verwickelt sind. Darunter ein Barpianist, ein Gärtner, ein Fotograf. Eine russische Tänzerin taucht auf – und verschwindet wieder. Ein englischer Jockey kreuzt seinen Weg – und ein griechischer Nachtbummler, der von einer Zufallsbekanntschaft ermordet wird. Wer ist dieser Suchende? War er tatsächlich mit dem Mannequin Denise verheiratet, das auf geheimnisvolle Weise verschwand? Und was geschah nach Kriegsende an der Grenze zur Schweiz?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Paris nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Mann erinnert sich nicht mehr. Die einzigen Anhaltspunkte für seine Suche: ein altes Foto, eine Todesanzeige. Er trifft auf eine kleine Gruppe von Emigranten, die in dunkle Geschäfte verwickelt sind. Darunter ein Barpianist, ein Gärtner, ein Fotograf. Eine russische Tänzerin taucht auf – und verschwindet wieder. Ein englischer Jockey kreuzt seinen Weg – und ein griechischer Nachtbummler, der von einer Zufallsbekanntschaft ermordet wird.
Wer ist dieser Suchende? War er tatsächlich mit dem Mannequin Denise verheiratet, das auf geheimnisvolle Weise verschwand? Und was geschah nach Kriegsende an der Grenze zur Schweiz?
Patrick Modiano, geboren 1945 bei Paris als Sohn einer Schauspielerin und eines jüdischen Emigranten, publizierte bereits im Alter von 22 Jahren seinen ersten Roman. 1978 erhielt er für Die Gasse der dunklen Läden den Prix Goncourt. 2014 wurde Modiano der Nobelpreis verliehen.
Im Suhrkamp Verlag sind von ihm u.a. erschienen: Eine Jugend (st 4615), Villa Triste (st 4616), Pariser Trilogie (st 4618), Straferlaß (st 4619), Sonntage im August (st 4620) sowie Hochzeitsreise (st 4621).
Patrick ModianoDie Gasse der dunklen Läden
Roman
Aus dem Französischen vonGerhard Heller
Die Originalausgabe erschien 1978 unter dem Titel
Rue des Boutiques Obscures
bei Gallimard.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4617
© Suhrkamp Verlag Berlin 1988
© Éditions Gallimard, 1978
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: bpk/CNAC-MNAM/André Kertész
Umschlag: hißmann, heilmann, hamburg
Die Gasse der dunklen Läden
1
Ich bin nichts. Nichts als eine blasse Silhouette, an diesem Abend, auf der Terrasse eines Cafés. Ich wartete darauf, daß der Regen aufhörte, ein Schauer, der in dem Augenblick eingesetzt hatte, als Hutte sich von mir verabschiedete.
Einige Stunden zuvor waren wir zum letzten Mal in den Räumen der Detektei zusammengekommen. Hutte hatte, wie gewöhnlich, hinter dem schweren Schreibtisch Platz genommen, ohne jedoch seinen Mantel abzulegen; es sah wirklich nach Aufbruch aus. Ich saß ihm gegenüber, in dem Ledersessel, der für die Kunden bestimmt war. Die Milchglaslampe verbreitete grelles Licht, das mich blendete.
»Tja, Guy … Es ist Schluß …«, sagte Hutte und seufzte.
Ein Aktenstück lag auf dem Schreibtisch. Vielleicht war es das von dem kleinen, dunkelhaarigen Mann mit dem verstörten Blick und dem gedunsenen Gesicht, der uns beauftragt hatte, seine Frau zu beschatten. Sie traf sich nachmittags immer mit einem anderen kleinen, dunkelhaarigen Mann in einem Haus mit möblierten Wohnungen in der Rue Vital, einer Nebenstraße der Avenue Paul-Doumer. Auch der andere hatte ein gedunsenes Gesicht.
Hutte strich sich nachdenklich den Bart, einen kurzen, graumelierten Bart, der seine Wangen halb bedeckte. Seine großen hellen Augen starrten ins Leere. Links vom Schreibtisch der Rohrstuhl, in dem ich während der Arbeitsstunden zu sitzen pflegte. Hinter Hutte Regale aus dunklem Holz, die die halbe Wand einnahmen, darin aufgereiht Adreß- und Telefonbücher der letzten fünfzig Jahre. Hutte hatte mir öfter gesagt, daß dies unerläßliche Arbeitsutensilien seien, von denen er sich nie trennen würde. Und daß diese Adreß- und Telefonbücher die wertvollste und aufregendste Bibliothek wären, die man sich vorstellen könne, denn auf ihren Seiten waren unzählige Menschen und Dinge verzeichnet, entschwundene Welten, von denen nur sie Zeugnis gaben.
»Was werden Sie mit all diesen Adreßbüchern machen?« fragte ich Hutte und wies mit weit ausholender Bewegung auf die Regale.
»Ich lasse sie hier, Guy. Ich behalte die Wohnung.«
Er blickte sich kurz um. Die beiden Flügel der Tür, die zu dem kleinen Nebenraum führte, standen offen, man sah das abgewetzte Plüschsofa, den Kamin und darüber den Spiegel, in dem sich die Bücherreihen und Huttes Gesicht spiegelten. Oft haben unsere Kunden in dem Raum gewartet. Ein Perserteppich lag auf dem Parkettboden. An der Wand neben dem Fenster hing eine Ikone.
»Woran denken Sie, Guy?« fragte Hutte.
»An nichts. Sie behalten also die Wohnung?«
»Ja. Von Zeit zu Zeit werde ich nach Paris kommen, und dann wird die Detektei mein Absteigequartier sein.«
Er hielt mir sein Zigarettenetui hin.
»Ich finde es etwas weniger traurig, wenn alles bleibt, wie es immer war.«
Mehr als acht Jahre hatten wir zusammengearbeitet. 1947 hatte er das Detektivbüro gegründet und vor mir einen Haufen anderer Leute beschäftigt. Unsere Aufgabe bestand darin, den Kunden – wie Hutte es nannte – »gesellschaftliche Auskünfte« zu beschaffen. Alles geschah, wie er immer wieder betonte, unter »Leuten aus vornehmen Kreisen«.
»Glauben Sie, daß Sie es in Nizza aushalten werden?«
»Gewiß.« »Werden Sie sich nicht langweilen?«
Er stieß den Rauch seiner Zigarette aus.
»Irgendwann muß man Schluß machen, Guy.«
Hutte erhob sich schwerfällig. Er wog sicherlich mehr als hundert Kilo und war einen Meter fünfundneunzig groß.
»Mein Zug geht um 20 Uhr 55. Wir haben noch Zeit, ein Glas miteinander zu trinken.«
Er ging mir voran in den Korridor, der zur Diele führte, einem Raum von merkwürdig ovaler Form, mit Wänden von verblichenem Beige. Eine schwarze Aktentasche, so vollgepackt, daß sie sich nicht schließen ließ, stand auf dem Fußboden. Hutte nahm sie unter den Arm.
»Haben Sie keine Koffer?«
»Ich habe alles vorausschicken lassen.«
Hutte öffnete die Eingangstür, und ich knipste das Licht in der Diele aus. Auf dem Treppenabsatz zögerte er einen Augenblick, ehe er die Tür schloß. Das metallische Geräusch beim Zuklappen gab mir einen Stich ins Herz; es setzte den Schlußpunkt hinter einen langen Abschnitt meines Lebens.
»Das tut weh, nicht wahr, Guy«, sagte Hutte. Er zog ein großes Taschentuch aus seinem Mantel und wischte sich die Stirn.
An der Tür hing noch die schwarze rechteckige Marmorplatte, auf der in glänzenden Goldbuchstaben zu lesen war:
C. M. HUTTEPrivatdetektei
»Ich lasse sie dran«, sagte Hutte.
Dann schloß er ab.
Wir gingen die Avenue Niel entlang bis zur Place Pereire. Es war dunkel, und die Luft war milde, obwohl der Winter vor der Tür stand. An der Place Pereire setzten wir uns auf die gedeckte Terrasse des »Café des Hortensias«. Hutte ging gern in dieses Lokal, weil hier noch Thonetstühle standen, »wie früher«.
»Und Sie, Guy, was werden Sie tun?« fragte er mich, nachdem er aus einem Glas einen Schluck Cognac mit Wasser getrunken hatte.
»Ich? Ich suche eine Spur.«
»Eine Spur?«
»Ja. Eine Spur meiner Vergangenheit …«
Ich sprach diese Worte in etwas feierlichem Ton, worüber er lächeln mußte.
»Ich bin immer sicher gewesen, daß Sie eines Tages Ihre Vergangenheit wiederfinden werden.«
Er sagte das sehr ernst, und das rührte mich.
»Aber wissen Sie, Guy, ich frage mich, ob es wirklich die Mühe lohnt …«
Er schwieg eine Weile. Woran dachte er? An seine eigene Vergangenheit?
»Ich gebe Ihnen einen Schlüssel zur Detektei. Sie können ab und zu hingehen, wenn Sie wollen. Das würde mich freuen.«
Er reichte mir den Schlüssel, ich steckte ihn in die Hosentasche.
»Und rufen Sie mich in Nizza an. Halten Sie mich auf dem laufenden … über Ihre Vergangenheit …«
Er stand auf und drückte mir die Hand.
»Soll ich mit zum Bahnhof kommen?«
»Nein … nein … Das ist immer so traurig …«
Mit einem Satz hatte er das Café verlassen, ohne sich umzudrehen, und ich empfand ein Gefühl der Leere. Dieser Mann bedeutete mir viel, und ich fragte mich, was vor nunmehr zehn Jahren, als ich plötzlich mein Gedächtnis verloren hatte und wie durch einen Nebel tappte, aus mir geworden wäre, ohne ihn, ohne seine Hilfe. Mein Fall hatte ihn erschüttert, und dank seiner weitläufigen Beziehungen hatte er mir sogar Personalpapiere beschaffen können.
»Hier«, hatte er zu mir gesagt und mir einen großen Umschlag überreicht, der einen Ausweis und einen Reisepaß enthielt. »Sie heißen jetzt Guy Roland.«
Und der Detektiv, den ich gebeten hatte, sein ganzes Können einzusetzen und Zeugen oder Spuren meiner Vergangenheit zu suchen, hatte hinzugefügt:
»Mein lieber Guy Roland, blicken Sie von nun an nicht mehr zurück, sondern denken Sie an die Gegenwart und die Zukunft. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag: Werden Sie mein Mitarbeiter …«
Daß er Sympathie für mich empfand, hatte einen besonderen Grund, aber das erfuhr ich erst später: Auch er hatte seine Spur verloren, ein ganzer Abschnitt seines Lebens war wie mit einem Schlag ausgelöscht, es gab nicht den geringsten Hinweis, nicht den kleinsten Anknüpfungspunkt, der ihn noch mit seiner Vergangenheit hätte verbinden können. Welcher Zusammenhang sollte auch zwischen diesem alten, gliedersteifen Mann, den ich in seinem abgetragenen Mantel und der dicken, schwarzen Aktentasche in der Dunkelheit verschwinden sehe, und dem einstigen Tennisspieler, dem schönen, blonden baltischen Baron Constantin von Hutte bestehen?
2
»Hallo? Monsieur Paul Sonachitzé?«
»Am Apparat.«
»Hier spricht Guy Roland … Sie wissen doch, der …«
»Ja, ich weiß! Können wir uns treffen?«
»Wenn Sie wollen …«
»Vielleicht … heute abend gegen neun Uhr, Rue Anatole-de-la-Forge? … Paßt es Ihnen?«
»Mir ist's recht.«
»Ich warte auf Sie. Bis nachher.«
Er hatte schon wieder aufgelegt, mir rann der Schweiß die Schläfen herunter. Um mir Mut zu machen, hatte ich ein Glas Cognac getrunken. Wie kann eine so harmlose Sache wie das Wählen einer Telefonnummer mir so viel Mühe bereiten, mich so beunruhigen?
In der Bar der Rue Anatole-de-la-Forge war sonst niemand, kein Gast, nur er stand im Straßenanzug hinter dem Tresen.
»Sie kommen gerade richtig«, sagte er. »Jeden Mittwoch abend habe ich frei.«
Er kam auf mich zu und legte mir die Hand auf die Schulter.
»Ich habe oft an Sie gedacht.«
»Danke.«
»Das beschäftigt mich wirklich sehr, glauben Sie mir …«
Ich hätte ihm gern gesagt, er solle sich meinetwegen keine Sorgen machen, aber ich fand nicht die richtigen Worte.
»Mir ist, als hätte ich Sie in Gesellschaft von jemandem gesehen, mit dem ich damals oft zusammen war …«, sagte er, »aber wer war das?«
Er hob fragend die Schultern!
»Können Sie mir nicht auf die Sprünge helfen?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Ich habe kein Gedächtnis mehr.«
Er glaubte, ich machte einen Scherz, und als handelte es sich um ein Spiel oder ein Rätsel, sagte er:
»Na gut. Dann muß ich es eben allein versuchen. Lassen Sie mir freie Hand?«
»Selbstverständlich.«
»Dann nehme ich Sie gleich mit zu einem Abendessen bei einem Freund.«
Beim Herausgehen zog er mit scharfem Ruck den Griff einer Sicherung am elektrischen Zähler herunter und verschloß dann hinter uns mit ein paar Umdrehungen des Schlüssels die massive Holztür.
Sein Wagen parkte auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig. Er war schwarz und noch neu. Höflich hielt er mir die Tür auf.
»Mein Freund ist Geschäftsführer eines netten kleinen Hotels, es liegt außerhalb, zwischen Ville-d'Avray und Saint-Cloud.«
»Und dorthin fahren wir?«
»Ja.«
Aus der Rue Anatole-de-la-Forge kommend, bogen wir in die Avenue de la Grande-Armée ein, und mich überkam plötzlich die Versuchung, aus dem Wagen zu springen. Die Fahrt bis nach Ville-d'Avray stand wie ein Berg vor mir. Aber ich durfte jetzt nicht den Mut verlieren.
Bis zur Porte de Saint-Cloud kämpfte ich gegen die panische Angst an, die mich gepackt hatte. Ich kannte diesen Sonachitzé kaum. Lockte er mich etwa in eine Falle? Nach und nach, während ich ihm zuhörte, beruhigte ich mich. Er zählte mir die verschiedenen Etappen seines beruflichen Werdegangs auf. Zuerst hatte er in russischen Nachtlokalen gearbeitet, dann im Langer, einem Restaurant in den Grünanlagen der Champs-Elysées, dann im Hôtel Castille, Rue Cambon, und noch in anderen Lokalen, ehe er die Bar in der Rue Anatole-de-la-Forge übernahm. Und jedesmal war er mit Jean Heurteur zusammen, dem Freund, zu dem wir fuhren, und so hatten sie ungefähr zwanzig Jahre lang ein Zweiergespann gebildet. Auch Heurteur besaß ein gutes Gedächtnis. Gemeinsam würden sie sicherlich »das Rätsel« lösen, das ich ihm aufgegeben hatte.
Sonachitzé war ein äußerst vorsichtiger Fahrer, und so brauchten wir nahezu eine Dreiviertelstunde, um ans Ziel zu gelangen.
Eine Art Bungalow, auf der linken Seite von einer Trauerweide verdeckt. Rechts stand dichtes Gebüsch. Der Speiseraum war ziemlich groß. Von hinten, wo alles hell erleuchtet war, kam ein Mann und trat auf uns zu. Er streckte mir die Hand hin.
»Freut mich, Monsieur. Jean Heurteur.«
Und zu Sonachitzé gewandt:
»Grüß dich, Paul.«
Er ging mit uns weiter in den Raum hinein, zu einem Tisch mit drei Gedecken. In der Mitte des Tisches stand ein Blumenstrauß.
Er wies auf eine der Glastüren:
»Im anderen Bungalow habe ich Gäste. Eine Hochzeit.«
»Sind Sie schon mal hier gewesen?« fragte mich Sonachitzé.
»Nein.«
»Dann zeig ihm mal die Aussicht, Jean.«
Heurteur ging voraus, zu einer Terrasse. Davor lag ein Teich. Links führte eine kleine gewölbte, chinesisch anmutende Brücke zu einem zweiten Bungalow auf der anderen Seite des Teichs. Hinter seinen hellerleuchteten Glastüren sah ich tanzende Paare. Musikfetzen drangen zu uns herüber.
»Es sind nur wenige«, sagte er, »ich habe den Eindruck, daß diese Hochzeit in einer Orgie enden wird.«
Er zuckte mit den Achseln.
»Sie müßten einmal im Sommer kommen. Dann wird auf der Terrasse gegessen, das ist sehr hübsch.«
Wir gingen in den Speiseraum zurück, Heurteur schloß die Terrassentür.
»Ich habe ein einfaches Abendessen vorbereitet.«
Er lud uns mit einer Handbewegung ein, Platz zu nehmen. Sie setzten sich nebeneinander, mir gegenüber.
»Was für einen Wein möchten Sie trinken?« fragte mich Heurteur.
»Welchen schlagen Sie vor?«
»Château-petrus?«
»Eine gute Idee, Jean«, sagte Sonachitzé.
Ein junger Mann in weißer Jacke bediente uns. Das Licht von einer Wandleuchte fiel direkt auf mich. Ich war geblendet. Die beiden anderen saßen mit dem Rücken zum Licht. Wahrscheinlich hatten sie mich hierher gesetzt, um mich besser beobachten zu können.
»Nun, Jean?«
Heurteur aß sein Fleisch in Aspik und sah mich von Zeit zu Zeit forschend an. Er war ein brünetter Typ, wie Sonachitzé und wie der färbte er sich die Haare. Grieslige Haut, schlaffe Wangen, schmale Gastronomenlippen.
»Ja, ja …«, murmelte er.
Ich blinzelte gegen das Licht. Er goß Wein ein.
»Ja … ja … Ich glaube, ich habe den Herrn schon gesehen …«
»Das ist wirklich eine harte Nuß«, sagte Sonachitzé. »Er weigert sich, uns irgendwelche Hinweise zu geben.«
Ihm schien etwas einzufallen.
»Aber vielleicht wollen Sie gar nicht, daß wir darüber sprechen? Möchten Sie lieber inkognito bleiben?«
»Keineswegs«, sagte ich lächelnd.
Der junge Mann servierte Kalbsbrieschen.
»Was haben Sie für einen Beruf?« fragte Heurteur.
»Acht Jahre lang habe ich in einer Detektei gearbeitet, in der Agentur C. M. Hutte.«
Sie sahen mich überrascht an.
»Aber das hat bestimmt mit meinem früheren Leben nichts zu tun. Sie können es also außer acht lassen.«
»Merkwürdig«, sagte Heurteur und starrte mich an, »es ist schwer zu sagen, wie alt Sie sind.«
»Wahrscheinlich wegen meines Schnurrbarts.«
»Ohne Schnurrbart«, sagte Sonachitzé, »würden wir Sie vielleicht sofort wiedererkennen.«
Er streckte den Arm aus und hielt seinen Finger unter meine Nase, dann kniff er die Augen zusammen wie ein Maler vor seinem Modell.
»Je länger ich ihn betrachte, desto mehr bin ich der Meinung, daß er zu einer Schar von Nachtschwärmern gehörte …«, sagte Heurteur.
»Aber wann war das?« fragte Sonachitzé.
»Oh … das ist lange her … Wir arbeiten ja schon seit einer Ewigkeit nicht mehr in Nachtlokalen, Paul …«
»Meinst du, daß es in unserer Tanagra-Zeit war?«
Heurteur sah mich unverwandt an, sein Blick wurde immer eindringlicher.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte er, »könnten Sie wohl einen Augenblick aufstehen?«
Ich erhob mich. Er musterte mich eingehend von oben bis unten.
»Ja, natürlich, Sie erinnern mich an einen Kunden. Ihre Statur … Warten Sie …«
Er hatte die Hand erhoben und verharrte in dieser Haltung, als wolle er etwas festhalten, das ihm jeden Moment entgleiten konnte. »Warten Sie … warten Sie … Paul, ich hab's …«
Er lächelte triumphierend.
»Sie können sich wieder hinsetzen …«
Er frohlockte. Er war sicher, daß das, was er zu sagen hatte, große Wirkung hinterlassen würde. Er goß Sonachitzé und mir feierlich Wein nach.
»Also … Sie waren stets in Begleitung eines Mannes, der genauso groß war wie Sie … Vielleicht etwas größer … Sagt dir das nichts, Paul?«
»Von welcher Zeit sprichst du?« fragte Sonachitzé.
»Von der im Tanagra natürlich …«
»Ein Mann, der ebenso groß war wie er«, wiederholte Sonachitzé nachdenklich. »Im Tanagra? …«
»Du erinnerst dich nicht?«
Heurteur sah ihn wartend an.
Endlich setzte Sonachitzé ein triumphierendes Lächeln auf. Er nickte mit dem Kopf.
»Ich erinnere mich …«
»Nun?«
»Stioppa.«
»Selbstverständlich. Stioppa …«
Sonachitzé hatte sich zu mir gewendet.
»Haben Sie Stioppa gekannt?«
»Vielleicht«, antwortete ich zögernd.
»Doch …« warf Heurteur ein. »Sie waren oft mit Stioppa zusammen. Ich bin ganz sicher …«
»Stioppa …«
Nach der Art zu urteilen, wie Sonachitzé den Namen aussprach, offensichtlich ein russischer Name.
»Das war der, der das Orchester immer bat, ›Alaverdi‹ zu spielen …«, sagte Heurteur. »Ein Lied aus dem Kaukasus …«
»Erinnern Sie sich daran?« fragte Sonachitzé und faßte mich fest am Handgelenk. »Alaverdi …«
Mit glänzenden Augen pfiff er die Melodie. Auch ich war auf einmal bewegt. Mir war, als kannte ich sie.
In diesem Augenblick kam der Kellner, der uns das Diner serviert hatte, auf Heurteur zu und zeigte mit dem Finger auf irgend etwas hinten im Raum.
Im Halbdunkel saß dort eine Frau allein an einem Tisch. Sie trug ein blaßblaues Kleid und stützte das Kinn in die Hände. Worüber mochte sie nachdenken?
»Die Braut.«
»Was macht sie da?« fragte Heurteur.
»Ich weiß nicht«, antwortete der Kellner.
»Haben Sie sie gefragt, ob sie etwas möchte?«
»Nein. Nein. Sie will nichts.«
»Und die anderen?«
»Sie haben noch einmal zehn Flaschen Krugg bestellt.«
Heurteur zuckte mit den Schultern.
»Mich geht's ja nichts an.«
Und Sonachitzé, der weder die »Braut« beachtet noch gehört hatte, was sie sagten, wiederholte:
»Also … Stioppa … Erinnern Sie sich an Stioppa?«
Er war so aufgeregt, daß ich mit einem Lächeln, dem ich etwas Geheimnisvolles gab, schließlich antwortete:
»Ja, ja. Ein wenig …«
Er wandte sich an Heurteur und sagte in feierlichem Ton zu ihm:
»Er erinnert sich an Stioppa.«
»Habe ich mir gleich gedacht.«
Der Kellner in der weißen Jacke stand reglos neben Heurteur, er sah verlegen aus.
»Monsieur, ich glaube, die wollen Zimmer haben … Was soll ich machen?«
»Ich ahnte schon, daß diese Hochzeitsfeier so enden würde …«, sagte Heurteur. »Ja, mein Guter, sie sollen ihren Willen haben. Uns geht das nichts an …«
Die Braut saß unbeweglich hinten an ihrem Tisch. Sie hatte die Arme gekreuzt.
»Ich frage mich, warum sie eigentlich ganz allein dort sitzt«, sagte Heurteur. »Aber schließlich hat uns das überhaupt nicht zu interessieren.«
Und mit der Hand machte er eine Bewegung, als wolle er eine Fliege verjagen.
»Wo waren wir stehengeblieben?« fragte er. »Sie erinnern sich also, Stioppa gekannt zu haben?«
»Ja«, hauchte ich.
»Folglich gehörten Sie zu derselben Bande … Ein verdammt lustiger Haufen, nicht wahr, Paul?«
»Oh …! Sind alle verschwunden«, sagte Sonachitzé mit trauriger Stimme. »Außer Ihnen, Monsieur … Ich bin wirklich froh, daß ich Sie … Sie habe ›lokalisieren‹ können … Sie gehörten zu Stioppas Bande … Ich gratuliere Ihnen … Das waren bessere Zeiten als heute, und vor allem waren die Menschen besser als heute …«
»Und vor allem, wir waren jünger«, warf Heurteur lachend ein.
»Wann ist das gewesen?« fragte ich mit klopfendem Herzen.
»Wir bringen die Daten durcheinander«, sagte Sonachitzé. »Jedenfalls liegt es so weit zurück wie die Sintflut …«
Plötzlich sah er niedergeschlagen aus.
»Manchmal gibt es doch merkwürdige Zufälle«, sagte Heurteur.
Er stand auf, ging zu einer kleinen Bar in einer Ecke des Raums und brachte uns eine Zeitung, in der er blätterte. Schließlich reichte er sie mir und wies mit dem Finger auf die folgende Anzeige:
»Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht, den Tod von Marie de Rosen anzuzeigen, der am 25. Oktober erfolgte, in ihrem zweiundneunzigsten Lebensjahr.
Im Namen ihrer Tochter, ihres Sohnes, ihrer Enkel, Neffen und Großneffen.
Und im Namen ihrer Freunde Georges Sacher und Stioppa de Djagoriew.
Die Trauerfeier, der die Bestattung auf dem Friedhof von Sainte-Geneviève-des-Bois folgt, findet am 4. November um 16 Uhr in der Friedhofskapelle statt.
Das Seelenamt des neunten Tages wird am 5. November in der russisch-orthodoxen Kirche, Rue Claude-Lorrain 19, 75 016 Paris, gehalten.
Die vorstehende Anzeige wurde anstelle der üblichen Trauerkarten gewählt.«
»Stioppa lebt also?« fragte Sonachitzé. »Sehen Sie ihn noch?«
»Nein«, erwiderte ich.
»Sie haben recht. Man muß in der Gegenwart leben. Jean, gieß uns einen Schnaps ein?«
»Sofort.«
Von diesem Augenblick an schienen sich die beiden nicht mehr für Stioppa und meine Vergangenheit zu interessieren. Aber das war auch ganz unwichtig, denn endlich war ich auf einer Spur.
»Darf ich die Zeitung behalten?« fragte ich mit gespielter Gleichgültigkeit.
»Selbstverständlich«, antwortete Heurteur.
Wir stießen mit den Gläsern an. So ist also von dem, der ich einst gewesen bin, nur ein Schatten im Gedächtnis zweier Barkeeper geblieben, noch dazu halbverdeckt von dem Schatten eines gewissen Stioppa de Djagoriew. Und von diesem Stioppa hatten sie »seit der Sintflut«, wie Sonachitzé sagte, nichts mehr gehört.
»Sie sind also Privatdetektiv?« fragte mich Heurteur.
»Jetzt nicht mehr. Mein Chef ist gerade in den Ruhestand getreten.«
»Und Sie? Machen Sie weiter?«
Ich zuckte mit den Schultern, ohne Antwort zu geben.
»Auf jeden Fall würde ich mich freuen, Sie wiederzusehen. Kommen Sie, wann immer Sie wollen.«
Er stand auf und reichte uns die Hand.
»Ich bitte um Entschuldigung … Aber ich setze Sie jetzt vor die Tür, ich muß noch die Abrechnung machen … Und die anderen da mit ihrer Orgie …«
Er zeigte zum Teich hinüber.
»Auf Wiedersehen, Jean.«
»Auf Wiedersehen, Paul.«
Heurteur sah mich nachdenklich an. Ganz langsam sagte er:
»Jetzt, da Sie stehen, erinnern Sie mich an etwas anderes …«
»Woran erinnert er dich?« fragte Sonachitzé.
»An einen Kunden, der jeden Abend sehr spät zu uns kam, als wir im Hôtel Castille arbeiteten …«
Auch Sonachitzé betrachtete mich von Kopf bis Fuß.
»Durchaus möglich«, sagte er, »daß Sie ein ehemaliger Kunde vom Hôtel Castille sind …«
Ich lächelte verlegen.
Sonachitzé nahm mich beim Arm, wir durchquerten den Speiseraum, der noch dunkler war als bei unserer Ankunft. Die Braut im blaßblauen Kleid saß nicht mehr an ihrem Tisch. Draußen hörten wir Fetzen von Musik und Gelächter, es kam von der anderen Seite des Teichs.
»Bitte«, sagte ich zu Sonachitzé, »könnten Sie mir noch einmal sagen, was das für ein Lied war, das immer gewünscht wurde von diesem … diesem …«
»Stioppa?«
»Ja.«
Er pfiff die ersten Takte, und hielt dann inne.
»Werden Sie Stioppa aufsuchen?«
»Vielleicht.«
Er preßte meinen Arm.
»Sagen Sie ihm, daß Sonachitzé noch oft an ihn denkt.«
Er sah mich unverwandt an:
»Möglicherweise hat Jean doch recht, und Sie waren Kunde im Hôtel Castille. Versuchen Sie sich zu erinnern … Hôtel Castille, Rue Cambon …«
Ich wandte den Kopf ab und öffnete die Wagentür. Auf dem Vordersitz kauerte jemand, der Kopf lehnte an der Windschutzscheibe. Ich beugte mich hinunter und erkannte die Braut. Sie schlief, ihr blaßblaues Kleid war bis zum Oberschenkel hinaufgerutscht.
»Sie muß da raus«, sagte Sonachitzé.
Ich schüttelte sie sanft, aber sie schlief weiter. Ich faßte sie um die Taille, und es gelang mir, sie aus dem Wagen herauszuziehen.
»Wir können sie doch nicht einfach auf der Erde liegen lassen«, sagte ich.
Ich trug sie ins Hotel. Ihr Kopf lag auf meiner Schulter, ihre blonden Haare kitzelten mich im Nacken. Sie roch nach einem scharfen Parfüm, das mich an etwas erinnerte. Aber woran?
3
Es war Viertel vor sechs. Ich bat den Taxichauffeur, in der kleinen Rue Charles-Marie-Widor auf mich zu warten, und ging zu Fuß zur Rue Claude-Lorrain, wo sich die russische Kirche befand.
Ein einstöckiges Gartenhaus mit Tüllvorhängen an den Fenstern. Rechterhand ein ziemlich breiter Weg. Ich hatte mich auf dem Bürgersteig gegenüber aufgestellt.
Zuerst sah ich zwei Frauen, die vor dem Eingang an der Straßenseite stehenblieben. Eine hatte kurze dunkle Haare und trug einen schwarzen Wollschal; die andere, eine stark geschminkte Blonde, hatte sich einen grauen Hut aufgesetzt, der aussah wie die Kopfbedeckung der Musketiere. Ich hörte, daß sie Französisch sprachen.
Aus einem Taxi wälzte sich ein alter, beleibter Mann heraus, sein Schädel war völlig kahl, unter den geschlitzten Mongolenaugen hingen dicke Tränensäcke. Er betrat den Gartenweg.
Von links, aus der Rue Boileau, kam eine Gruppe von fünf Personen auf mich zu. Voran zwei Frauen reiferen Alters, die zwischen sich einen Greis am Arm führten. Er sah so weiß und gebrechlich aus, daß man meinen konnte, er sei aus Gips. Dahinter zwei Männer, die sich sehr ähnlich sahen, sicher Vater und Sohn, beide trugen graue gestreifte Anzüge von elegantem Schnitt, der Vater ganz Schönling, der Sohn mit blondem, gewelltem Haar. In diesem Augenblick bremste ein Wagen neben der Gruppe, aus dem ein anderer Greis stieg, straff und behende, umhüllt von einem Lodencape, das graue Haar im Bürstenschnitt. Er hatte etwas Militärisches an sich. War das Stioppa?
Alle traten durch eine Seitentür vom hinteren Gartenweg in die Kirche. Ich wäre ihnen gern gefolgt, doch meine Anwesenheit hätte vermutlich Aufsehen erregt. Ich empfand ein immer stärker werdendes Angstgefühl bei dem Gedanken, daß ich Stioppa nicht identifizieren könnte.
Ein Auto hielt und parkte in einiger Entfernung auf der rechten Seite. Zwei Männer stiegen aus, dann eine Frau. Einer der Männer war sehr groß und trug einen dunkelblauen Mantel. Ich überquerte die Straße und wartete auf sie.
Sie kommen näher, sie kommen näher. Mir schien es, daß der hochgewachsene Mann mich musterte, ehe er mit den anderen in den Gartenweg einbog. Hinter den bunten Fenstern, die zum Gartenweg blicken, brennen Kerzen. Er muß sich bücken, um durch die für ihn viel zu niedrige Tür zu treten, und ich bin sicher: Das ist Stioppa.
Der Motor des Taxis lief, aber es saß niemand am Steuer. Eine Wagentür war angelehnt, als ob der Fahrer gleich zurückkommen wollte. Wo mochte er sein? Ich blickte um mich und beschloß dann, einmal um den Wohnblock zu gehen, um ihn zu suchen.
In einem nahegelegenen Café in der Rue Chardon-Lagache fand ich ihn. Er saß an einem Tisch, vor ihm stand ein Glas Bier.
»Wird es noch lange dauern?« fragte er mich.
»Oh … ungefähr zwanzig Minuten.«
Ein Blonder mit heller Haut, feisten Wangen und blauen hervorquellenden Augen. Ich glaube, ich habe nie einen Menschen mit so fleischigen Ohrläppchen gesehen.
»Kann ich den Zähler weiterlaufen lassen?«
»Das können Sie«, antwortete ich.
Er lächelte erfreut.
»Haben Sie keine Angst, daß Ihr Taxi gestohlen wird?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Wissen Sie …«
Er hatte ein Sandwich bestellt und kaute bedächtig, dabei sah er mich trübsinnig an:
»Worauf warten Sie eigentlich?«
»Auf jemanden, der aus der russischen Kirche kommen soll, dort hinten.«
»Sind Sie Russe?«
»Nein.«