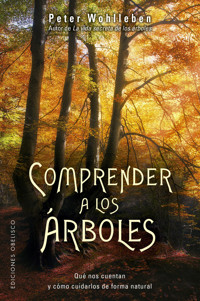Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: pala
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sind frei laufende Hühner glücklich? Wovon träumen Fruchtfliegen und Hunde? Welches Zeitgefühl hat ein Schmetterling? Peter Wohlleben schreibt kurzweilig über Gefühlsleben, Intelligenz und Bewusstsein der Tiere und fordert, ganz ohne erhobenen Zeigefinger, zu ethischem Handeln auf. Dabei macht er wenig Unterschiede zwischen liebenswerten Hunden, Milch gebenden Ziegen oder lästigen Fliegen. Und er scheut sich nicht, Parallelen zu menschlichen Gefühlen zu ziehen und provokante Thesen zu vertreten. Seine Ansichten zu Liebe, Mitgefühl, Trauer und Schmerz bei Tieren belegt der Autor anhand aufsehenerregender Studien von Verhaltensforschern und Biologen, aber auch durch viele Beobachtungen der Wildtiere im Eifeler Forst und seiner eigenen Haustiere. Das Buch räumt mit Vorurteilen über böse Wölfe, ängstliche Hasen oder blöde Ziegen auf und regt vor allem zum Nachdenken über die Konsequenzen unseres alltäglichen Handels an. Seite für Seite wird dabei immer klarer, warum ein achtsamer Umgang mit unseren Mitgeschöpfen auch uns Menschen glücklich macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Peter Wohlleben
Die Gefühle der Tiere
Von glücklichen Hühnern, liebenden Ziegen und träumenden Hunden
illustriert von Margret Schneevoigt
Mit Gefühl und Verstand
Sind frei laufende Hühner glücklich? Wovon träumen Fruchtfliegen und Hunde? Welches Zeitgefühl hat ein Schmetterling?
Peter Wohlleben schreibt leicht verständlich über Emotionen, Intelligenz und Bewusstsein der Tiere und fordert zu ethischem Handeln auf. Dabei macht er wenig Unterscheide zwischen liebenswerten Katzen, Milch gebenden Ziegen oder lästigen Fliegen. Und er scheut sich nicht, Parallelen zu menschlichen Gefühlen zu ziehen und provokante Thesen zu vertreten.
Seine faszinierenden Ansichten zu Liebe, Mitgefühl, Trauer und Schmerz bei Tieren belegt der Autor anhand aktueller Studienergebnisse von Verhaltensforscher und Biologen, aber auch durch viele Beobachtung der Wildtiere im Eifeler Forst und seiner eignen Haustiere. Der bekannte Förster und Naturschützer beleuchtet dabei auch zahlreiche Vorurteile, wie die Märchen vom bösen Wolf oder der blöden Ziege und das Bild vom scheuen Reh.
Das Buch ruft zum Nachdenken über die Konsequenzen unseres alltäglichen Handelns auf. Es geht den Fragen nach, mit welchem Recht wir Tiere für Versuche quälen, massenhaft einsperren und töten, oder ob eine artgerechte Tierhaltung moralisch vertretbar ist. Seite für Seite wird immer klarer, warum ein achtsamer Umgang mit den Mitgeschöpfen auch uns Menschen glücklicher macht.
Inhalt
Cover
Titel
Vom Glück, mit Tieren zu leben
Dumpfe Kreaturen oder fühlende Wesen?
Primitiv oder anspruchsvoll?
•Auf der Suche nach dem scheuen Reh
Spaß beim Sex
Und wie steht es mit der Liebe?
•Von wegen blöde Ziege!
Trauer und Tod
Empathie im Tierreich
Freude und Glück
•Wunschbild »glückliches Huhn«
Einfach nur böse?
•Die Angst vor aggressiven Hornissen
Neues aus dem Oberstübchen
Gehirngrößen und Intelligenz
•Die Fabel vom schlauen Fuchs
Der Spiegeltest
Können Tiere träumen?
Kulturelle Traditionen
Fähigkeit zur Kommunikation
•Vorbild fleißige Biene?
Staatenbildung und gezähmte Emotionen
Spiritualität und religiöses Empfinden
Zeit ist relativ
•Der Mythos vom dummen Schaf
Tiere im Reich des Menschen
Normal ist tausendfach verschieden
•Vorsicht: gemeine Zecke?
Von Sklaven und willigen Dienern
•Das Märchen vom bösen Wolf
Das große Geschäft
Symbiosen zwischen Mensch und Tier
Angsthasen und Jäger
•Die Mär vom ängstlichen Hasen
Mehr Achtsamkeit mit Tieren
Gespanntes Verhältnis zu unseren Mitgeschöpfen
•Die Legende von der diebischen Elster
Ein Ausflug ins Reich der Pflanzen
Die Büchse der Pandora
•Besser als ihr Ruf: die dreckige Sau
Der Hund in der Handtasche
Ich sehe was, was Du nicht siehst
•Beliebtes Vorurteil: der störrische Esel
Verhungern aus Mitleid?
Rücksichtnahme – ein praktischer Versuch
Epilog
Der Autor
Weitere Bücher
Impressum
Vom Glück, mit Tieren zu leben
Patsch! Erwischt. Die Fliege, die schon seit Stunden brummend durch unser Haus geflogen ist, liegt unter der Fliegenklatsche. Heimliches Jagdglück breitet sich in mir aus. Mit spitzen Fingern packe ich die ekeligen Überreste an den Flügeln und befördere sie in den Mülleimer.
In den letzten Jahren mischen sich nach jeder derartigen Aktion mehr und mehr zweifelnde Gefühle in den kleinen Triumph. Denn der Gedanke beschleicht mich immer öfter, dass ich die individuelle Welt dieser winzigen Wesen unwiderruflich auslösche. Warum gilt mir das Lebensrecht dieser Fliege weniger als das unseres Hundes? Ich muss sie nicht mögen, aber sollte ich mir nicht wenigstens die Mühe machen, sie zu fangen und wohlbehalten an die frische Luft zu setzen? Hat nicht auch solch ein nerviges Etwas Freude am Leben, einen festen, vorgezeichneten Weg, der es über die Jugend und eigenen Nachwuchs bis zu einem Alterstod führen soll? Oder ist das alles völlig übertrieben und sentimental?
Der Mensch ist schließlich etwas Einzigartiges. Nur unsere eigene Spezies hat ein Selbstbewusstsein, kann detailliert über Sprache kommunizieren, empfindet Glück und Trauer und stellt damit eine absolute Ausnahme im Reich der Tiere dar. Wirklich? Schon in der Vergangenheit gab es mit Charles Darwin und Konrad Lorenz einzelne Forscher, die auf Gefühle von Tieren hinwiesen. Damals war die Zeit offensichtlich noch nicht reif für solches Gedankengut. In den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein jedoch geändert. Immer mehr Wissenschaftler widmen sich dem Gefühlsleben unsere Mitgeschöpfe, und im Zuge dieser Forschungen taucht eine Überraschung nach der anderen auf.
Es ist wie bei einem Puzzlespiel, bei dem mit jedem Stück das Bild klarer wird. Und obwohl schon genug zu erkennen ist, scheint es, als wollten wir nicht sehen, was sich da vor unseren Augen abzeichnet. Es ist eine wunderbare Welt von Mitgeschöpfen, die offenbar zu weitaus mehr in der Lage sind, als wir ihnen zugestehen wollen, zugestehen können. Denn wenn wir vorbehaltlos akzeptieren würden, dass wir nicht nur von vollautomatischen Biorobotern, sondern von fühlenden, fröhlichen Wesen umgeben sind, müssten wir den Umgang mit ihnen drastisch ändern.
Respekt und Rücksichtnahme bedeuten jedoch gleichzeitig eine Einschränkung unseres bisherigen Lebensstandards. Dürfen wir Tiere überhaupt noch töten oder anderweitig nutzen? Und falls wir dies dennoch machen, müssten wir dann nicht wenigstens die Nutzung auf das wirklich Notwendige beschränken und ihnen dabei so viel an Lebensqualität wie möglich zugestehen? Das würde beispielsweise die Massentierhaltung und damit auch billige Lebensmittel in der heutigen Form ausschließen und eine artgerechte Haltung aller Haustiere notwendig machen.
Gewinnen könnten wir dafür an Vergnügen. Eine Tierwelt, die witzig ist, die Kulturen hervorbringt, meisterhafte Bauwerke errichtet oder einfach nur glücklich ist: Ist das nicht ein unfassbares Glück, mit solchen Wesen gemeinsam unseren Planeten zu bevölkern und sie bei ihrem Treiben zu beobachten? Etliche der Geschöpfe mögen uns sogar ausgesprochen gern, warten nur auf eine freundliche Geste und sind bereit, all das Ungerechte der Vergangenheit sofort zu vergessen. Geben Sie anderen Arten die Chance, zu zeigen, was in ihnen steckt, und begleiten Sie mich auf eine Entdeckungsreise zu den Gefühlen der Tiere und ziehen Sie Ihre eigenen Konsequenzen daraus. Dabei werden Sie vielleicht auch ein paar interessante Aspekte der menschlichen Spezies überdenken.
Dumpfe Kreaturen oder fühlende Wesen?
Können Tiere glücklich sein? Glück ist schon beim Menschen schwer zu fassen, obwohl es als eines der erstrebenswertesten Güter überhaupt gilt. Nicht umsonst wird es von Gratulanten bei jedem freudigen Anlass gewünscht und ist bei den meisten Mitbürgern Lebensziel Nummer eins.
Bevor wir uns mit Trauer und Freude, Liebe und Glück beschäftigen, sollten wir uns aber dem Sammelbegriff dieser ganzen Kategorien zuwenden: den Gefühlen. Diese werden anderen Arten häufig abgesprochen, und entspräche das den Tatsachen, so könnten wir jeden Gedanken an eine sympathische Welt von Mitgeschöpfen gleich mit über Bord werfen. So gesehen, handelt es sich um die zentrale Frage dieses Buches: Haben Tiere Gefühle? Dazu müssen wir erst einmal herausfinden, was das überhaupt ist.
Rein wissenschaftlich unterscheidet man Sensibilität und Emotionen. Ersteres beschreibt das Fühlen mit den Sinnesorganen, also das Schmecken mit der Zunge, das Hören mit den Ohren, das Tasten mit den Fingern und so weiter. Das reine Fühlen wird demnach dem Körper zugeordnet. Davon getrennt gesehen werden die Emotionen, unter ihnen die bereits genannten Vertreter, allen voran das Glücklichsein. Ich persönlich halte nichts von dieser Zweiteilung. Denn sie verschleiert, dass beides in Wahrheit demselben Mechanismus zuzuweisen ist: der Steuerung des Körpers durch unsere Instinkte. Gefühle sind nämlich nichts anderes als die Sprache unseres Unterbewusstseins, eine Sprache, die ohne Schule oder langes Üben sofort und von jedem verstanden wird. Für bestimmte Situationen hat das Unterbewusstsein Handlungsanweisungen parat, die ohne Wenn und Aber zu befolgen sind: eben die Instinkte, die uns durch eindeutige Botschaften ins Bewusstsein übersetzt werden. Fassen Sie beispielsweise einmal auf eine heiße Herdplatte. Müssen Sie noch lange überlegen, ob es sinnvoll ist, Ihre Hand minutenlang brutzeln zu lassen? Nein, denn ein heftiger Schmerz durchzuckt Sie, und egal, was Ihr Verstand sagt, Sie müssen die Hand zurückziehen. Die Pein ist ein formulierter Befehl, die Finger sofort von der Platte zu nehmen, weil das Unterbewusstsein aufgrund der Hitzeeinwirkung erkennt, dass Ihre Haut ansonsten irreparabel geschädigt würde.
Etwas subtiler, aber nicht minder fordernd sind die Befehle, Nahrung aufzunehmen. Steht ein entsprechendes Angebot in Form attraktiver Lebensmittel in Reichweite, so gelingt es nur den wenigsten, standhaft zu bleiben und den eigenen Body-Mass-Index im grünen Bereich zu halten. Schließlich ist Hunger bis heute einer der Hauptauslesefaktoren der menschlichen Evolution, auch wenn wir das in der westlichen Zivilisation kaum noch bemerken. Unzählige Diätvarianten bekunden, dass der Stein der Weisen noch nicht gefunden ist und das Diktat der Instinkte auch im Bereich der Gewichtskontrolle nach wie vor gilt.
Das Befolgen dieser Befehle aus den Tiefen des zentralen Nervensystems begleitet unser ganzes Leben, ja bestimmt es möglicherweise sogar zu großen Teilen.
Da die Erforschung derartiger Prozesse erst ganz am Anfang steht, kann man noch nicht sagen, wie viel Prozent und welche Art der Entscheidungen dergestalt ablaufen. Dass zumindest ein Teil unserer Handlungen instinktgesteuert abläuft, steht jedoch außer Frage. Und weil unser wacher Verstand das nicht immer akzeptieren will, liefert er manchmal einfach eine Begründung, warum die Anweisung aus dem Unterbewusstsein in Wahrheit doch seine Entscheidung wäre. So zum Beispiel, weshalb man sich trotz gewichtsreduzierender Ernährung nun doch zwischendurch ein Stück Schokolade gönnen darf (obwohl man insgeheim weiß, dass dies kontraproduktiv ist). Der Verstand liefert hier eigentlich nur noch eine Entschuldigung für unser leicht kränkbares Ego, welches sich, dermaßen bestätigt, jederzeit als uneingeschränkter Herr der Lage fühlt.
Die Verhaltenssteuerung über Instinkte ist also selbst bei der Krone der Schöpfung, dem Menschen, etwas ganz Alltägliches. Kein Wunder, gehört er doch, biologisch gesehen, zu den Tieren, und diese greifen alle auf solche Mechanismen zurück. Nicht nur der sprichwörtliche Raubtierinstinkt, der beispielsweise bei der Flucht potenzieller Beutetiere ausgelöst wird (und im übertragenen Sinn etwa bei knallharten Geschäftsleuten vermutet wird), nein, das ganze tierische Leben ist davon geprägt. Und genau hier haben wir unser erstes Glied in der Kette der Beweise.
Noch einmal zur Zusammenfassung: Aktives Handeln kann nur durch freie Entscheidung mithilfe von intelligentem Nachdenken und daraus folgenden Entschlüssen eingeleitet werden oder aber durch Instinkte, vorprogrammierte Handlungsanweisungen des Unterbewusstseins, für die es keinerlei Abwägungen bedarf. Wenn wir den Tieren keine Intelligenz, keinen Verstand zugestehen, so muss ihr Handeln zwangsläufig rein instinktgeprägt sein. Und die Sprache des Unterbewusstseins sind nun einmal die Gefühle.
Primitiv oder anspruchsvoll?
Kommen wir zu der eingangs erwähnten Zweiteilung der Gefühle zurück: dem Fühlen im Sinne von Sensibilität und von Emotionen. Diese Zweiteilung ermöglicht der Wissenschaft eine Differenzierung in Klassen, in primitiv und anspruchsvoll.
Sie meinen, den Tieren würde seitens der Wissenschaft die niedrigere Kategorie, also lediglich die der Sensibilität, die bloßes Fühlen mit Sinnesorganen beinhaltet, zugestanden? Furcht, Glück, Freude oder Trauer als Königsdisziplinen der Gefühle blieben dem Menschen vorbehalten? Leider gefehlt! Noch nicht einmal Schmerz als eine der primitivsten Äußerungen des Unbewussten wird den Mitgeschöpfen vorbehaltlos eingeräumt. Und bevor wir auf die sonnigeren Aspekte tierischen Gefühlslebens eingehen, müssen wir uns daher dieser unangenehmen Seite zuwenden, denn zur Klärung der Frage, ob Tiere wirklich fühlen können, eignet sich Schmerz am besten.
Schmerz ist eines der ursprünglichsten Signale, welches nach neuestem Stand der Kenntnis sogar Pflanzen kennen. Wird noch nicht einmal dieses anerkannt, so spricht man den Tieren schlichtweg ihre Funktionsfähigkeit ab. Denn der Erhalt des Körpers hat oberste Priorität im Wettrennen der Evolution um die Sicherung der eigenen Gene und deren Weitergabe an die nächste Generation. Wenn etwas wehtut, so bedeutet dies nichts anderes, als dass der Organismus in Mitleidenschaft gezogen wird – sei es durch Stiche in die Haut, durch Knochenbrüche oder Verletzungen innerer Organe. Je stärker der Schmerz, desto weniger fallen andere Bedürfnisse wie etwa Hunger ins Gewicht.
Auf der Suche nach dem scheuen Reh
Große dunkle Augen, ein sympathisches Gesicht, dazu ein schlanker Hals und dünne Beine: Rehe sind anmutige Tiere. Mit der Leichtigkeit von Gazellen hüpfen sie durchs Unterholz und überspringen Zäune bis 1,50 Meter Höhe. Dabei können wir sie allerdings nicht allzu oft beobachten, denn sie meiden Menschen. Schon unsere Vorfahren jagten die kleinen Pflanzenfresser, und aktuell werden pro Jahr allein in Deutschland über eine Million geschossen. Kein Wunder, dass sie ihre Aktivität in die Nacht verlagert haben und am Tage auf Distanz bleiben. Dabei wirken sie aber nicht so ängstlich wie Hasen, und das liegt an ihrem besonderen Fluchtverhalten. Rehe halten keine langen Strecken bei vollem Tempo durch. Das brauchen sie in ihrem ursprünglichen Lebensraum, dem Waldrand, auch nicht. Bei verdächtigen Bewegungen oder Geräuschen sprinten sie zunächst rund 100 Meter weit, um dann wieder stehen zu bleiben und sich erst einmal umzusehen. Manchmal rufen sie dabei hundeartig (das wird »Schrecken« genannt). Werden sie nicht verfolgt, setzen sie ihren Weg dann in ruhigem Trab oder gar im Schritt fort. Mit der wilden, hakenschlagenden Hasenflucht hat das wenig zu tun – wobei: Geradlinig ist der Weg in solchen Situationen auch nicht. In einem großen Bogen, der langsam und oft mehr als eine Stunde Zeit in Anspruch nimmt, bewegen sich die Rehe wieder auf ihren ursprünglichen Standort zu. Der Grund ist ihr Revier: Hier haben sie sich gegenüber Artgenossen behauptet, hier sind sie zuhause. Und wird ein Reh doch einmal von einem Hund verfolgt, so kreuzt es mehrfach seine eigene Spur, sodass der nach der Nase jagende Hund den roten Faden verliert. Daher kann er ein gesundes Reh im Wald auch nicht fangen.
Als typische Einzelgänger schließen sich Rehe nicht dem Menschen an. Auch wenn sie in unsere Vorgärten kommen (dort wird schließlich nicht gejagt) und dort ein wenig ihre Scheu vor uns ablegen – ein Rest davon bleibt.
Tiere, die kein Schmerzempfinden hätten, würden von der gnadenlosen Natur sofort aussortiert. Wird beispielsweise ein verletztes Bein nicht geschont, sondern rücksichtslos weiter belastet, so fällt es schließlich ganz aus – und der Besitzer wird ein leichtes Opfer von Raubtieren. Ein trauriges Beispiel für die Wichtigkeit dieses Signals bei uns Menschen lieferte ein pakistanischer Junge, auf den Forscher aufmerksam wurden. Er trat als Straßenkünstler auf, lief über glühende Kohlen und bohrte sich Messerklingen in die Arme. Kein Wunder, stellten die Wissenschaftler doch einen Gendefekt fest, der jedes Schmerzempfinden unmöglich machte. Sechs weitere Kinder mit gleichen Erbschäden wurden in der Verwandtschaft des Jungen entdeckt, alle mit zahlreichen blauen Flecken, Schnittwunden, Quetschungen und Knochenbrüchen. Das Leben des Jungen endete wenig später während eines Auftritts mit einem Sturz vom Dach.
Ohne Schmerz ist das Überleben für uns kaum möglich. Täglich würden wir uns verletzen und aus diesen Verletzungen wenig lernen. Unangenehme Erinnerungen an die auslösenden Situationen gäbe es ja nicht, von dem abstoßenden Anblick einmal abgesehen. Warum sollte das für Tiere anders sein? Wie, wenn nicht durch Schmerz, könnten sie sofort Verletzungen feststellen, sich außer Gefahr bringen und diese künftig meiden?
Selbst primitivste Arten müssen demnach über Gefühle verfügen. Angenommen, Fliegen hätten kein Bewusstsein (was sich, wie später noch erwähnt wird, als Irrtum erweisen könnte). Fühlte sich dann Schmerz für die Winzlinge trotzdem ähnlich an wie für uns? Wäre es nicht möglich, dass Schmerz in diesem Fall nur ein biochemischer Auslösereiz ist, der eine Kettenreaktion von Reflexen in Gang setzt? Der keine Qualen auslöst, sondern nur einen Schalter eines Bioroboters darstellt? Wäre es so, so würden Fliegen aus unangenehmen Erfahrungen nichts lernen. Sie würden wieder und wieder dieselben Fehler machen, wenn Schmerz nichts Abschreckendes hätte. Dass sie ihr Verhalten ändern, können Sie beispielsweise beim Fliegenfangen sehen: Die kleinen Flieger werden mit jedem Versuch, mit jedem Erschrecken vorsichtiger, starten bereits, wenn sich Ihre Hand nur nähert. Es muss also selbst bei winzigen Insekten positive und negative Gefühle geben, Belohnungen und Bestrafungen für Handlungen, die einen Lernerfolg zum Ziel haben.
Das Bewusstsein, so vorhanden, lässt das Individuum höchstens zum Beobachter eines kaum beeinflussbaren Prozesses werden. Denken wir an uns selbst und die Herdplatte. Ist das Bewusstsein hier nicht vollkommen überflüssig? Die Hand zieht sich auch ohne Denkprozesse rasch zurück, und unsere Wahrnehmung erhöht nur die Qual, weil wir den Schmerz in allen Facetten auskosten müssten. Das Bewusstsein als unbeteiligter Beobachter könnte höchstens die Rolle eines Verstärkers übernehmen, der die negativen Gefühle fester verankert und so Fehler konsequenter vermeiden hilft.
Werden Wirbeltiere verletzt, so wird bei ihnen das gleiche Areal im zentralen Nervensystem aktiv wie bei uns, nämlich das Endhirn. Selbst bei Fischen, die entwicklungsgeschichtlich sehr weit von uns entfernt sind. Wenn sie am Haken des Anglers zappeln, muss nach neuestem Stand der Forschung von einem quälerischen Akt ausgegangen werden, denn ihr Endhirn läuft dabei ebenfalls zu Höchstleistungen auf.
Das Schmerzempfinden als elementare Warnfunktion muss bei jedem Tier vorhanden sein, ob unbewusst oder bewusst. Anscheinend gilt diese Erkenntnis aber nicht für bürokratische Wissenschaftler (oder wissenschaftliche Bürokraten). Anders ist es nicht vorstellbar, dass unserem Schutz unterstellten Tieren so viel zugemutet werden darf. Fleisch von männlichen Schweinen mag niemand kaufen, weil sie voller Sexualhormone sind und das Fleisch daher unangenehm riecht. Was liegt da näher, als einfach den Quell des Übels, die Hoden, zu entfernen? Und damit das schnell und billig abläuft, werden die wenige Tage alten Ferkel ohne Betäubung operiert. Aus angeblichen Tierschutzgründen(!) sind auch das Ausbrennen der Hörner bei Kälbern und das Abschneiden der empfindlichen Schnabelspitzen bei Hühnerküken in der modernen Landwirtschaft Alltag – selbstverständlich ohne Narkose. Ansonsten würden sich die Tiere in der Enge der Ställe gegenseitig verletzen. Klingt brutal und ist es wohl auch, aber von offizieller Seite nimmt man einfach an, dass zumindest ganz junge Tiere kein Schmerzempfinden haben. Erst ab 2017 (Hühner) und ab 2019 (Ferkel) soll sich dies ändern – nach diesen Terminen darf amtlicherseits Gnade walten.
Selbst die Nachkommen unserer eigenen Art, eben erst geborene Säuglinge und vor allem Frühchen, wurden früher medizinisch als schmerzunempfindliches Etwas angesehen. Bis in die 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts operierten Chirurgen sogar am offenen Herzen von Babys, und zwar (aus Angst vor Nebenwirkungen) ohne Narkosemittel; das herzzerreißende Schreien und Strampeln wurde von ihnen eher als harmloser Reflex gedeutet.
Mittlerweile weiß man, dass Neugeborene selbstverständlich Schmerzen fühlen, und daher setzt man bei Operationen solch junger Patienten heute routinemäßig Schmerz- und Narkosemittel ein. Tierbabys wird das leider oft immer noch abgesprochen. Dabei ist auch bei ihnen das beobachtbar, was allen Wesen auf unserem Planeten gemein ist: Werden sie verletzt, so zeigt der Körper eine Abwehrreaktion. In diesem Fall ein heftiges Strampeln und Schreien, was vermutlich nur deshalb als unerheblich abgetan wird, damit die Halter weiterhin ohne Skrupel Ferkel und Küken für die Massentierhaltung tauglich machen können.
Noch einmal: Schmerz ist ein Körpersignal, welches dem Gehirn die drohende oder eingetretene Schädigung des Körpers meldet – dieses Gefühl muss jedes Wesen kennen. Damit ist gleichzeitig geklärt, dass Tiere grundsätzlich fühlende Geschöpfe sind. Allerdings haben wir bisher erst den wissenschaftlich »minderwertigeren« Teil, die Sensibilität, abgedeckt. Um zu zeigen, wie es mit den anspruchsvolleren Gefühlen, den Emotionen, aussieht, muss ich auch in diesem Zusammenhang zunächst in die Kiste der negativen Gefühle greifen. Sie rufen viel heftigere Reaktionen hervor und sind daher besser nachzuvollziehen.
Emotionen sind komplizierte Vorgänge zwischen Körper und Verstand, die unser Bewusstsein in Form von Gefühlen erreichen. Eines der stärksten ist die Angst. Sie signalisiert dem Gehirn eine so heftige Bedrohung, dass Blutdruck und Puls ansteigen und der ganze Organismus in den Zustand höchster Leistungsfähigkeit versetzt wird. Mit der Angst spricht das Unterbewusstsein meistens Verbote aus, dieses und jenes zu tun. Aktives Handeln wird in aller Regel nur für eine Flucht ausgelöst. Ein Teil der Ängste ist angeboren, andere werden erlernt. Für Letzteres habe ich täglich ein Beispiel vor Augen: einen Elektrozaun. Unsere Milchziegen genießen die warme Jahreszeit auf der Sommerweide. Alle zwei Wochen ist die Teilparzelle abgegrast, und das nächste Wiesenstück ist an der Reihe. Um die Ziegen zu hüten, hat sich ein Elektrozaun bewährt. Er ist nicht so gefährlich wie Stacheldraht und kann leicht versetzt werden. Die Stromschläge sind zwar schmerzhaft, aber ungefährlich. Die älteren Tiere berühren den Zaun schon jahrelang nicht mehr, während die Lämmer zwei, drei Mal die unangenehme Erfahrung machen, dass die Litzen eine Grenze darstellen, die man besser meidet.
Wie sich die Ziegen fühlen, kann ich gut nachvollziehen. Denn auch ich habe den Zaun schon mehrmals unabsichtlich berührt. Der Stromschlag wirkt wie ein fester Schlag mit der flachen Hand, verbunden mit einem den Körper durchzuckenden Schmerz. Nach einem solchen Missgeschick vergewissere ich mich bei den nächsten Weidebesuchen mehrfach, ob auch wirklich der Strom abgeschaltet ist. Und selbst dann ist mir mulmig zumute, wenn ich den Zaun zwecks Umsetzen anfassen muss. Meine Angst vor dem nächsten Stromschlag ist also stärker als mein Verstand, der Harmlosigkeit signalisiert. Und diese Angst ist den Tieren sicher gleichermaßen bewusst.
Bei unseren Pferden, die ebenfalls mittels Elektrozaun auf der Weide gehalten werden, kann man dieses Bewusstsein sogar beobachten. Sie sind, was Stromimpulse anbelangt, besonders empfindlich. Daher empfehlen die Gerätehersteller die Wahl einer geringen, Strom sparenden Stufe des Weidezaungeräts. Übersetzt heißt dies, dass Pferde außergewöhnlich ängstlich sind. Wie bewusst sie die Vorgänge um den Zaun (und damit die schmerzhaften Lektionen) wahrnehmen, zeigt unsere Stute Bridgi. Sie ist besonders verfressen, und das saftigste Gras wächst natürlich immer außerhalb der Umzäunung. Bridgi registrierte, dass jedes Mal, wenn ich komme, der Strom abgeschaltet wird. Und seit diesem Moment der Erkenntnis handelt sie wie folgt: Sobald ich die Weide betrete, schiebt sie ihren Hals unter dem Zaun hindurch. Mit dem Elektroband im Nacken grast sie den Nachbarstreifen genüsslich ab, bis ich die Koppel wieder verlasse. Wäre die Angst rein unbewusst, so würde die Stute den Kontakt zum Zaun durchgehend vermeiden. So aber schaltet ihr Bewusstsein die Furcht in dem Augenblick ab, wenn ich den Strom abschalte. Von außen gesehen, kann man weder dem Pferd noch mir die Angst ansehen. Lediglich die Vermeidung der Zaunberührung deutet darauf hin.
Dieses Gefühl darf man sicher den meisten, wenn nicht allen Tierarten unterstellen. Unangenehme Erfahrung macht nun mal jeder, und jedes Wesen muss daraus lernen können, um zu überleben. Lernen und Angst sind demnach fest miteinander verknüpft. Der Schluss »alle lernfähigen Wesen können auch Angst empfinden« muss somit zulässig sein. Und selbst Fliegen mit ihren klitzekleinen Hirnen lernen. Das kennen Sie sicher auch: Wenn Sie in Ihrer Wohnung auf Jagd nach den Plagegeistern gehen, so werden die Winzlinge immer gewiefter, je öfter Sie daneben schlagen. Es ist eine Art Training der besonderen Art, denn jeder Fehler der Fliegen wird sofort mit dem Tod bestraft. Warum weichen sie unserer Hand aus? Weil sie Angst haben, Todesangst, und das lässt sie auch außergewöhnlich schnell lernen.
Spaß beim Sex
Ich erinnere mich nur noch schemenhaft an die Zoobesuche der Kindheit. Anfangs war alles interessant, ich bestaunte jedes Tier, aber mit der Zeit wurde es mir langweilig. Spätestens nach einer Stunde interessierten mich nur noch die Highlights, etwa große Raubtiere oder Elefanten. An andere Arten kann ich mich heute nicht mehr erinnern. Mit einer Ausnahme: Was mir noch recht lebhaft vor Augen steht, ist die Besichtigung des Pavianfelsens. Auf diesem künstlichen Betongebilde tummelte sich stets eine froh gelaunte Gesellschaft der afrikanischen Savannenbewohner, die sich zu Zeiten der Fütterung laut kreischend um Brotreste und Früchte zankten.
Deutlicher noch als die Nahrungsaufnahme ist mir allerdings der wilde, ungehemmte Sex in Erinnerung. Die Paviandamen stellten ihre knallroten, geschwollenen Hinterteile zur Schau, und ob Herdenchef oder Jüngling, immer wieder waren schnelle Kopulationen zu bestaunen. Gerne wäre ich länger dort am Gehege stehen geblieben, aber ich war hin- und hergerissen zwischen widerstreitenden Gefühlen. Einerseits war ich sehr neugierig, andererseits peinlich berührt, da ich in sexuellen Dingen eher konservativ erzogen wurde. Eines war jedoch offensichtlich: Die ganze Horde schien das alles prächtig zu genießen.
Zwischenzeitlich erfuhr ich in der Schule, wie Tiere bis in die kleinsten Abläufe mehr oder weniger automatisch reagierten. Diese Sezierung der Vorgänge im Sexualkundeunterricht war für mich so ernüchternd, dass ich mich lange fragte, ob auch der Mensch so berechenbar funktionierte. Konnte die Biologielehrerin mit diesem Wissen noch entspannten Sex haben oder entzauberte ihre Kenntnis von den Details die ganze Sache? Heute stelle ich mir umgekehrt eher die Frage, warum nur der Mensch mehr an der Paarung finden sollte als eine rein mechanische Betätigung.
Handlungen von Tieren werden von der Wissenschaft meist als rein zweckorientiert gesehen. Ein Instinkt A löst eine Tat B aus und führt zum Ergebnis C. Können Tiere zweckfrei handeln, einfach nur Spaß haben? Dies zu bejahen würde gleichzeitig bedeuten, ihnen Lebensfreude und damit auch so etwas wie Glück zuzugestehen.
In den letzten Jahren mehrten sich die Indizien, dass dem tatsächlich so ist. So zeigte das Naturhistorische Museum in Oslo mit einer Ausstellung unter dem Titel »Wider die Natur?«, dass Homosexualität unter Tieren weiter verbreitet ist als allgemein vermutet. Bisher soll die Wissenschaft rund 1500 Arten kennen, bei denen derartiges Verhalten beobachtbar sei. Ob Schimpansen, Delfine, Hunde, Nashörner oder sogar Fliegen, offensichtlich gibt es diese Sexvariante bei den meisten Spezies. Auch unsere heimische Tierwelt mischt kräftig mit: Immer wieder berichten Jäger etwa von Hirschen, die sich in der Brunftzeit zu »Männerpaaren« zusammenschließen und sich miteinander vergnügen.
Das Problem: Findet Sex unter gleichgeschlechtlichen Partnern statt, kann es logischerweise keinen Nachwuchs geben. Solches Verhalten läuft aber dem Grundprinzip der Natur zuwider, nachdem alles Streben der Weitergabe eigener Gene zu dienen hat. Jedes Abweichen davon ist unnötige Energieverschwendung und wird von der Evolution mit dem Aussterben bestraft. Demzufolge müsste also auch Homosexualität einen tieferen Sinn haben. Und tatsächlich formulierten Wissenschaftler erste Ansätze dazu. So sollen gleichgeschlechtliche Paare quasi der soziale Klebstoff innerhalb von Sippen sein. Ihre friedvolle Art und die Mithilfe bei der Aufzucht des Nachwuchses ihrer Verwandtschaft, etwa von Brüdern und Schwestern, dienten auch dem Erhalt der eigenen Gene, die denen ihrer Nichten und Neffen ja sehr ähnlich seien.
Würden diese Theorien zutreffen, so hätte Homosexualität einen biologischen Sinn, wäre unter evolutionären oder vielmehr wissenschaftlichen Gesichtspunkten endlich legitim. Genau dieser Punkt macht auch in der menschlichen Gesellschaft gleichgeschlechtliche Liebe so problematisch. Sie gilt als unnormal, weicht vom Heile-Welt-Familienschema ab, da sie nicht reproduktionsorientiert ist. Könnten Schwule schwanger werden, sähe das möglicherweise ganz anders aus. Aber Sex nur so zum Vergnügen? Das zu akzeptieren, fällt der Gesellschaft schwer. Vielleicht kann uns die Tierwelt hier eine goldene Brücke bieten. Zum einen ist es sicher richtig, dass die Evolution nur und ausschließlich an dem Erhalt der Gene arbeitet. Homosexualität ist in diesem Sinne eine Sackgasse. Dennoch kommt sie bei vielen Tierarten vor, darf mithin als normal gelten.
Warum treiben Tiere oder auch Menschen Sex? Fortpflanzung ist das Wichtigste im Leben, zumindest aus der Sicht der Evolution. Die Weitergabe der eigenen Gene, optimalerweise gemischt mit besonders guten Erbanlagen des anderen Geschlechts, ist das Ziel aller Mühen des Lebens. Nein, nicht nur aller Mühen, sondern auch aller Freuden. Besonders der des lustvollen Orgasmus. Dieser kurze Moment einer schwer zu beschreibender Gefühlswelle, die je nach Veranlagung Sekunden oder Minuten dauert, ist die Belohnung des Gehirns für ein langes Werben um den Partner. Zugleich stellt es eine Vorauszahlung für den kommenden Lebensabschnitt dar, der mit der Aufzucht des Nachwuchses mannigfaltige Entbehrungen bereithält. Für all dies ist ein flüchtiger Augenblick höchster Wonnen ein wenig gering bemessen, finden Sie nicht? Natürlich gibt es auch vorher und nachher wunderschöne Momente, etwa das Glück, die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen, ihre bedingungslose Zuneigung zu spüren. Auf die Liebe kommen wir aber später noch zu sprechen.