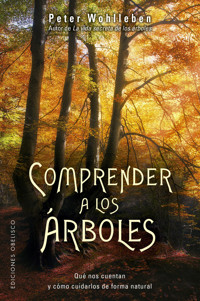10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie sehr sind wir überhaupt noch mit der Natur verbunden? Peter Wohlleben ist überzeugt: Das Band zwischen Mensch und Natur ist bis heute stark und intakt, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind: Unser Blutdruck normalisiert sich in der Umgebung von Bäumen, die Farbe Grün beruhigt uns, der Wald schärft unsere Sinne, er lehrt uns zu riechen, hören, fühlen und zu sehen. Umgekehrt reagieren aber auch Pflanzen positiv auf menschliche Berührung. Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und seiner eigenen jahrzehntelangen Beobachtungen öffnet uns Peter Wohlleben die Augen für das verborgene Zusammenspiel von Mensch und Natur. Er entführt uns in einen wunderbaren Kosmos, in dem der Mensch nicht als überlegenes Wesen erscheint, sondern als ein Teil der Natur wie jede Pflanze, jedes Tier. Und er macht uns bewusst, dass es in unserem ureigenen Interesse ist, dieses wertvolle Gut zu bewahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Haben Menschen, ähnlich wie manche Tiere, eine Art siebten Sinn für Gefahr? Ist es möglich, dass unser Geruchssinn der Spürnase eines Hundes überlegen ist? Warum spricht unser Immunsystem auf die Farben und den Duft des Waldes an?
Und umgekehrt: Kann es sein, dass Bäume atmen? Dass sogar eine Art Herzschlag messbar ist? Und müssen wir Pflanzen womöglich als intelligente Wesen betrachten?
Erneut öffnet uns Peter Wohlleben anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen die Augen für die erstaunlichen Phänomene der Natur – und zeigt, wie nah und auf vielerlei Art eng verwoben wir Menschen mit der Natur sind.
»Wohllebens Bücher erweitern unsere Wahrnehmung von der Welt.«
Denis Scheck in Der Tagesspiegel
PETER WOHLLEBEN
DAS
GEHEIME BAND
ZWISCHEN MENSCH UND NATUR
Erstaunliche Erkenntnisse über die 7 Sinne
des Menschen, den Herzschlag der Bäume und
die Frage, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Ludwig Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angelika Lieke
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München,
unter Verwendung der Fotos von Ramon Haindl
und Shutterstock/Smileus (Vorderseite)
und Bigstock/DenisNata (Rückseite)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-20706-9V002
www.ludwig-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Warum ist der Wald eigentlich grün?
Gehörtraining in der Natur
Der Darm – die verlängerte Nase
Natur schmeckt nicht immer lecker
Tasten hilft beim Denken
Training für den sechsten Sinn
Das Wildschwein – der Weiße Hai des Waldes
Wir sind besser, als wir glauben
Auf Tuchfühlung mit Bäumen
Am Anfang war das Feuer
Bäume unter Strom
Der Herzschlag der Bäume
Wenn Regenwürmer reisen
Der Baum als Kultobjekt
Die Grenze zwischen Tier und Pflanze fällt
Die Sprache des Waldes
Waldbaden – tief eintauchen bitte
Erste Hilfe aus der Naturapotheke
Wenn der Baum zum Arzt muss
Sehnsucht nach der heilen Welt
Von Kindern lernen
Alles unter Kontrolle?
Das Landleben-Stadtleben-Paradoxon
Auch Bäume gehen mit der Mode
Der schwierige Weg zurück
Dem Klimawandel begegnen
Gut Ding will Weile haben
Auf der Suche nach Ursprünglichkeit
Białowieza – ein schwieriger Fall
Hambi bleibt!
Eine Sache des Herzens
Dank
Anmerkungen
Vorwort
Seit einigen Jahren ist in vielen Ländern eine Renaissance des Naturerlebens zu beobachten. So tauchte das Waldbaden als eine Therapieform auf, die es in Japan sogar auf Krankenschein gibt. Gleichzeitig werden weiter rücksichtslos Wälder abgeholzt, wodurch der Klimawandel befeuert wird. In all dieser Widersprüchlichkeit ist es manchmal schwer, zu unserem Platz in der Natur zurückzufinden. Niemand will vorsätzlich die Umwelt zerstören, und dennoch sind wir in unserem konsumorientierten Alltag gefangen.
Schuldzuweisungen und Schwarzseherei sind in diesem Zusammenhang allerdings das Letzte, was hilfreich ist. Der drohende Zeigefinger, der in Richtung Apokalypse weist, die Kipppunkte, nach deren Überschreiten es angeblich keinen Weg mehr zurück in geordnete Klimaverhältnisse gibt, sind Instrumente, die eher an die Inquisition erinnern und weit entfernt von einer so dringend nötigen positiven Motivation sind.
Begleiten Sie mich stattdessen einfach in den Wald, um zu schauen, wie intakt das alte Band zwischen uns und der Natur noch ist. Und es ist noch intakt!
Wir sind keine degenerierten Wesen, die nur mithilfe der modernen Technik noch in der Lage sind, langfristig zu überleben. Lassen Sie sich auf der Reise in die Wälder überraschen, wie gut Ihre Sinne funktionieren! So gibt es zum Beispiel Gerüche, die Sie besser wahrnehmen können als Hunde. Daneben werden wir auf elektrische Phänomene an Bäumen stoßen, die Spinnenhaare zu Berge stehen lassen. Im Grünen gibt es eine gut bestückte Apotheke, aus der sich nicht nur alle Tiere, sondern auch Sie sich bedienen können. Darüber hinaus umweht Sie ein Kommunikationscocktail, der Ihren Kreislauf und Ihr Immunsystem stärkt.
Viele Menschen nehmen all dies nicht mehr wahr. Doch es sind nicht die verkümmerten Sinne, die uns daran hindern; nein, die sind noch alle vollständig intakt, wie ich Ihnen anhand verschiedener Beispiele beweisen werde. Der Grund liegt vielmehr in einer merkwürdigen Sichtweise durch Philosophie und Naturwissenschaft, die zwischen uns und unseren Mitgeschöpfen unnötige Hürden aufbaut: Hier ist der Mensch, da die Natur; hier wirkt der Verstand, dort ein ausgeklügeltes, vermeintlich fast mechanisches System ohne Seele.
Die Erkenntnis, dass wir immer noch Teil dieses wundervollen Systems sind und nach denselben Regeln funktionieren wie alle anderen Arten, setzt sich aber zum Glück langsam durch. Und erst dann funktioniert Naturschutz: Wenn wir begreifen, dass es dabei nicht nur um die anderen, sondern zuallererst um unsere eigene Art geht.
Warum ist der Wald eigentlich grün?
Es gibt mehr und mehr naturbegeisterte Menschen, die den Wald nicht nur sehen, sondern auch intensiv spüren möchten, mich selbst eingeschlossen. Oft beneiden wir dabei die Tiere um ihre unverfälschten Sinne. Doch wie sieht es eigentlich mit unseren eigenen Sinnen aus? Wozu sind wir nach Jahrhunderten einer Zivilisation, die uns im Alltag der Notwendigkeit einer wachen Aufmerksamkeit der Natur gegenüber beraubt, überhaupt noch fähig?
Wenn man den vielen vergleichenden Berichten über die fantastischen Fähigkeiten von Tieren Glauben schenken darf, dann sind wir eine Art, die außer ihrem scharfen Verstand nicht mehr viel zu bieten hat. Gegen fast jede andere Spezies scheinen wir in Bezug auf die Sinne schlecht abzuschneiden, und fast hat man den Eindruck, wir gefallen uns sogar noch in der Rolle der evolutionären Verlierer. Das Band der Natur zu uns Menschen scheint unwiderruflich gerissen, und wir können nur noch neidisch auf die Fähigkeiten der Tiere schielen.
Dieser Eindruck ist allerdings absolut falsch: Der Mensch ist durchaus in der Lage, mit seiner belebten Umwelt mitzuhalten. Schließlich mussten sich unsere Vorfahren vor gar nicht allzu langer Zeit noch durch die Wälder schlagen und dabei jede mögliche Gefahr oder Beute frühzeitig registrieren. Und weil sich seither unser Bauplan nicht geändert hat, können wir getrost davon ausgehen, dass alle Sinne noch intakt sind. Das Einzige, was vielleicht fehlt, ist etwas Training, und das kann man nachholen.
Widmen wir uns zuerst unseren Augen und hier zunächst der Frage, wodurch wir überhaupt in der Lage sind, Bäume farbig zu sehen.
Der Anblick grüner Bäume ist entspannend und sogar gesundheitsfördernd, so viel ist gewiss, doch warum sehen wir sie überhaupt grün? Schließlich haben die meisten anderen Säugetierarten diese Fähigkeit nicht. Ihre Welt ist farblich recht beschränkt, wie etwa die der hochintelligenten Delfine: Sie sehen nur schwarz-weiß, da sie in ihren Augen (wie alle Wale, aber auch Robben) nur einen Zapfentyp in der Netzhaut haben. Zapfen sind Zellen, die das Farbsehen ermöglichen. Um jedoch zwischen zwei Farben unterscheiden zu können, braucht es mindestens zwei verschiedene Zapfenarten. Delfine und Co. besitzen paradoxerweise lediglich einen Zapfen für Grün. Das reicht gerade mal zur Unterscheidung verschiedener Helligkeitsstufen, und Delfine sind damit noch nicht einmal in der Lage, blaues Licht zu verarbeiten, das im Meerwasser nicht nur reichlich vorhanden ist, sondern auch besonders tief ins Wasser eindringt.
Unsere vierbeinigen Mitgeschöpfe wie Hunde und Katzen oder Waldtiere wie Rehe, Hirsche oder Wildschweine können schon deutlich mehr als ein Delfin. Bei ihnen gesellen sich zu den grünen auch noch blaue Zapfen, was immerhin schon ein schwaches Farbenspektrum ermöglicht. Allerdings verschmelzen Rot, Gelb und Grün in all ihren Abstufungen zu einer einzigen Farbe. Um Grün sehen zu können, reicht das allerdings immer noch nicht. Dazu bräuchten sie noch rotempfindliche Zapfen – so wie wir und viele Affenarten sie haben. Die Erkenntnis, dass die Farbe Grün beruhigend für die Psyche und unterstützend bei Heilungsprozessen ist, kann bei den meisten Säugetieren also keine Rolle spielen.
Doch warum braucht man grün- und rotempfindliche Zapfen, um Grün zu sehen? Es liegt an der Wellenlänge des Lichts. Blaue Farbtöne sind kurzwellig, grüne und rote langwellig. »Langwellige« Farbtöne stimulieren also nur die Grünzapfen – egal ob grünes, gelbes oder rotes Licht auf sie trifft. Die Blauzapfen werden gar nicht angeregt. Ein Tier, das nur Zapfen für Blau oder Grün besitzt, kann also streng genommen nur zwischen »Blau« und »nicht Blau« unterscheiden. Erst wenn ein weiterer Zapfentyp hinzukommt, der in einem anderen Bereich des langwelligen Lichts empfindlich ist, kann ein Wald grün werden. Und – o Wunder – wir Menschen besitzen in unserer Netzhaut einen solchen Zapfentyp.1 Er ist empfindlich für rotes Licht, und erst so können wir klar sagen, ob das Laub der Bäume grün, gelb oder rot ist. Nicht umsonst sind die kleinen LED-Punkte in Ihrem Computer- oder TV-Bildschirm aus winzigen Blau-grün-rot-Zellen zusammengesetzt. Damit lassen sich alle Farben darstellen.
Wälder grün sehen zu können ist also eine echte Besonderheit im Reich der Säugetiere. Doch warum haben ausgerechnet wir Menschen diese Fähigkeit entwickelt? Forscher vermuten, dass es weniger mit der Farbe Grün als vielmehr mit Rot zu tun hat. Rot sind zum Beispiel viele reife Früchte, die sich zwischen den Blättern von Bäumen und Sträuchern befinden. Auf die haben es allerdings nicht nur wir abgesehen, sondern auch viele Vogelarten, die Rot noch viel besser sehen können als wir. Auf diesen Umstand haben die Pflanzen reagiert: So gehen Früchte, die von Säugetieren gefressen werden, mehr ins grünliche Rot, während die Früchte, die für Vögel als Nahrung dienen, intensiv rot gefärbt sind.2
Dass wir Rot sehen können, klingt also plausibel. Aber warum finden wir gerade Grün so schön, warum bemerken wir es überhaupt? Verwirrt Sie diese Frage? Denn immerhin besitzen wir in unseren Augen ja Zapfen für Grün; es erscheint also logisch, dass wir es im Wald permanent und bewusst registrieren. Doch das muss nicht so sein, wie das Beispiel der Farbe Blau zeigt: Unsere Vorfahren haben sie möglicherweise überhaupt nicht bemerkt oder sie für unwichtig erachtet. Lazarus Geiger, ein deutscher Sprachforscher des 19. Jahrhunderts, fand heraus, dass es in vielen alten Sprachen gar kein Wort für Blau gab. Selbst in den Texten Homers, eines geheimnisumwitterten griechischen Dichters, der vermutlich im 8. Jahrhundert vor Christi gelebt hat, war die Farbe des Meers weindunkel; andere Texte späterer Jahrhunderte definierten Blau als Schattierung von Grün. Erst die Entwicklung und der Handel mit blauen Farbstoffen läuteten die Geburt des Begriffs »Blau« ein, seitdem unterscheiden wir es als eigenständige Farbe und nehmen es bewusst wahr.
Sehen wir also manche Farben nur, weil es dafür einen kulturellen Grund gibt? Oder anders ausgedrückt: Können wir Blau nur deshalb sehen, weil es ein Wort dafür gibt? Jules Davidoff, Professor der Psychologie an der Goldsmiths University of London, veröffentlichte dazu ein beeindruckendes Experiment. Er reiste mit seinem Team zu den Himba, einem Stamm in Namibia, der kein Wort für Blau kennt. Dort zeigte er den Probanden auf einem Monitor einen Kreis mit 12 Quadraten. Elf waren grün, eines sehr deutlich blau. Die Himba hatten große Schwierigkeiten, das blaue Quadrat ausfindig zu machen. Nun kam die Gegenprobe. Davidoff zeigte Menschen mit Englisch als Muttersprache ebenfalls einen Kreis mit zwölf Quadraten, diesmal alle in Grün. Nur ein einziges hatte einen winzigen Gelbstich, der auch mir nicht aufgefallen ist. Den Test können Sie übrigens selbst im Internet machen, die Seite ist über die Quellenangabe auffindbar.3 Die englischsprachigen Teilnehmer hatten erhebliche Probleme, das fragliche Quadrat ausfindig zu machen. Nicht so die Himba. Ihnen fehlt zwar das Wort für Blau, dafür haben sie jedoch wesentlich mehr Wörter für Grün als wir. Dadurch sind sie in der Lage, selbst kleinste Farbunterschiede zu beschreiben, und offenbar erleichterte ihnen diese Fähigkeit auch beim Experiment die sofortige Identifizierung des leicht abweichenden Quadrats.4
Auch aus dem europäischen Sprachraum gibt es Hinweise, dass das Farbsehen eng mit der Kultur verknüpft ist. So können etwa Menschen mit Russisch als Muttersprache viel schneller verschiedene Blautöne wahrnehmen, weil im Russischen eine schärfere Trennung zwischen Hellblau und Dunkelblau gemacht wird als in anderen Sprachen. Ein Forscherteam um den New Yorker Psychologen Jonathan Winawer fand heraus, dass Mitarbeiter mit dieser Muttersprache Blautöne besser unterscheiden konnten als ihre englischsprachigen Kollegen.
Leider kenne ich nur Untersuchungen zur Farbe Blau. Doch gerade für mich als Förster ist es natürlich interessant herauszufinden, wie es sich mit der Farbe Grün verhält. Wenn ich aus dem Fenster meines Büros in den Garten des Forsthauses schaue, dann sehe ich unzählige Varianten von Grün. Das bläulich-graue Grün der Flechten an der alten Birke, das gelbliche Grün des winterlichen Grases, das kräftige Blaugrün der Nadeln an den Zweigen der großen Douglasien, das warme gelbgraue Grün der Algenbeläge auf der Rinde junger Buchenstämme – all das subsumiere ich unter Grün.
Gewiss fallen mir Unterschiede zwischen den verschiedenen Pflanzen und Materialien auf, gibt es Farbtöne mit Namen wie Tannengrün, Lindgrün oder Maigrün. Doch im Alltag werden diese Begriffe kaum gebraucht, sondern eher vage Umschreibungen wie Hell- oder Dunkelgrün genutzt.
Andererseits spricht sehr viel dafür, dass unsere Vorfahren schon sehr lange bewusst sämtliche Farbnuancen von Grün und Rot wahrnehmen konnten. Denn wenn, wie bereits geschildert, Rot für unsere Ernährung wegen des Erkennens reifer Früchte wichtig war, dann sicher auch alle Varianten von Grün bis hin zu Gelb. Wie sonst etwa sollten unsere Ahnen reifes, gelbes Korn bemerken, wie das Verdorren mühsam angelegter Gemüsefelder, deren einst saftiges Grün im Verwelken verblasst, oder auch Früchte, deren Reifegrad ebenfalls der Farbwechsel von Grün (unreif) zu Gelb oder Rot anzeigt? Sogar der noch weiter in die Vergangenheit gerichtete Blick zeigt die Notwendigkeit einer Unterscheidung. Wurde etwa ein Tier bei der Jagd verwundet, dann konnte der Jäger die Spur nur verfolgen, wenn er die roten Blutstropfen im grünen Gras deutlich erkannte.
Die Fähigkeit der Bluterkennung war übrigens auch einer der Gründe, weshalb eine Einstellungsvoraussetzung bei meiner Bewerbung für den Forstdienst – der damals noch automatisch mit der Tätigkeit als Jäger einherging – das vollständige Farbsehen war.
Eine Rot-Grün-Sehschwäche ist genetisch bedingt, wie wir heute wissen, ebenso wie das Sehvermögen für die Farbe Grün. Doch wenn, je nach Kultur, selbst Blau nicht sofort erkannt wird, trotz blausensibler Zapfen im Auge, dann erscheint mir das Erkennen von Grün ebenfalls nicht selbstverständlich.
Wie sehr eine kulturell geprägte Sinneswahrnehmung den Menschen verändert, zeigt sich am deutlichsten in der Schrift. Während Sie in diesen Buchstaben Worte mit einer Bedeutung erkennen, sieht das bei japanischen Schriftzeichen möglicherweise ganz anders aus – da wundert man sich, wie diese Zeichen überhaupt Bilder im Kopf erzeugen können. Ähnliches kennen Sie vom Geschmackssinn. Je nach Kultur gelten Lebensmittel als ekelhaft oder lecker, und um hier Erfahrungen zu machen, müssen Sie gar nicht so weit reisen. So gilt etwa in Schweden vergorener Fisch, Surströmming, als Delikatesse. Mich hingegen erinnert der Geruch an frischen Hundekot, und die meisten Touristen überkommt schon beim Öffnen der ausgebeulten Dosen ein Brechreiz.
Und selbst wenn das bewusste Sehen von Grün nicht kulturell, sondern genetisch bedingt ist, muss das nicht gleichermaßen für die Wirkung auf unsere Psyche gelten. Dass Grün, vor allem beim Anblick von Bäumen, einen Einfluss auf unser Gemüt hat, ist gut erforscht, wie ich später noch näher ausführen werde. Doch ist das Ganze vielleicht nur kulturhistorisch bedingt? Um diese Frage beantworten zu können, wären wohl noch vergleichende Studien nötig, etwa mit Menschen wie den Inuit, die eher selten Grün sehen, ebenso wie die Tuareg, deren Zuhause in der Sahara eher von Brauntönen dominiert ist. Doch solche Studien sind mir aktuell nicht bekannt.
Auch wenn das Thema Farben überaus spannend ist, so ist doch die Schärfe des Gesehenen noch weitaus wichtiger. Und auch dabei spielt nicht nur die Genetik, sondern auch die uns umgebende Natur eine gravierende Rolle. Darüber hinaus fehlt uns wie gesagt manchmal lediglich ein bisschen Training, um unsere Sinne wieder fit zu machen.
Möchten Sie das Tragen einer Brille oder wenigstens die Verschlechterung Ihres Sehvermögens vermeiden? Dann kann Ihnen geholfen werden – zumindest wenn es um Kurzsichtigkeit geht. Ich dachte früher, dass die Neigung dazu angeboren sei und dass die Menschheit irgendwann nur noch aus Brillenträgern bestehen wird. Schließlich hängt heutzutage niemandes Leben mehr davon ab, ob Löwen am Horizont gesichtet werden und wir rechtzeitig davonlaufen können. Ein Aussieben im Sinne der Evolution ist in dieser Hinsicht mangels Gefahr ausgeschaltet; zudem können wir die meisten Einschränkungen durch entsprechende Hilfen ausgleichen.
Entwickeln wir uns also alle zu Brillenträgern? Sicher nicht, denn mittlerweile weiß die Wissenschaft, dass sich unser Auge lediglich an den geringeren Sehabstand anpasst – das haben wir Büchern und Computern zu verdanken. Das Schöne daran ist, dass dieser Vorgang umkehrbar oder doch zumindest aufzuhalten ist. Dazu müssen Sie nur eines machen: hinaus in die Natur gehen. Sobald Ihr Blick in die Ferne schweift, wird das Auge auf Weitsicht trainiert. Umgekehrt ist der häufige Aufenthalt am Schreibtisch, geprägt von schwachem Licht und kurzer Lesedistanz, ganz maßgeblich für die stetige Zunahme der Kurzsichtigkeit. Das legen universitäre Studien nahe, die ostasiatische Kinder in den Fokus genommen haben. Durch die rasante Entwicklung hin zu einer modernen Gesellschaft ist der Wandel in Taiwan besonders gut zu dokumentieren. Dort sind mittlerweile 80 bis 90 Prozent der Schulabgänger auf eine Brille angewiesen, zehn bis 20 Prozent kämpfen mit Sehbehinderungen. Was die Forscher zunächst an genetische Veränderungen denken ließ, ist letztendlich auf den erhöhten Bildungsdruck und den damit einhergehenden Verlust von Frischluftaktivitäten zurückzuführen. Oder anders ausgedrückt: Die Jugendlichen werden durch den Leistungsanspruch zu Stubenhockern und damit zu Brillenträgern.5
Auch mich erwischte es im Alter von 16 Jahren, und damals lagen meine Brillenwerte bei –2,5 Dioptrien. Damit war für mich die Welt ab drei Meter Entfernung völlig unscharf. Doch das sollte nicht so bleiben. Im Gegensatz zu den meisten Leidensgenossen verbesserten sich meine Werte ständig und pendelten sich nach einigen Jahren bei –1 Dioptrien ein – knapp über dem Wert, ab dem keine Brille mehr notwendig ist. Schon damals erklärte ich mir die für mich logische Veränderung mit meiner beruflichen Tätigkeit. Mein Tagesablauf sah viel Zeit im Wald vor, in der ich Stämme und Kronen der zu durchforstenden Bestände beurteilen musste, alles auf weite Distanz. Und auch in der Freizeit hielt ich mich viel im Freien auf, reparierte Weidezäune oder sägte Brennholz.
Kurzsichtigkeit ist also keine evolutionäre Anpassung, sondern lediglich eine Gewöhnung und Umformung des Auges auf kurze Distanzen, wie sie zum Lesen notwendig sind. Und das kann der Aufenthalt in der Natur und der freie Blick in die Höhe oder Ferne zumindest in jungen Jahren lindern oder gar verhindern.
Eine andere Art von Training hat nichts mit der Sehstärke zu tun. Kennen Sie das Phänomen, dass Hunde Wildtiere viel eher bemerken als Sie? Das liegt, anders als vermutet, oft nicht am Geruch, den Rehe und Wildschweine verströmen, denn dazu müsste der Wind diesen genau auf die Hunde zuwehen. Nein, es ist meist vielmehr die Bewegung, die unsere Vierbeiner aus den Augenwinkeln registrieren. Unsere Münsterländer-Hündin Maxi konnte das sogar ganz prima aus dem Fenster unseres fahrenden Autos heraus.
Im Laufe meiner Berufsjahre habe ich mir das ebenfalls antrainiert, wenn auch nicht bewusst. Grundsätzlich sind Wildtiere bestens getarnt; nicht umsonst ist das Fell von Rehen und Hirschen braun wie der Waldboden. Doch wenn sie sich bewegen, dann registriere ich das aus dem Augenwinkel und auf große Entfernung. Und damit bin ich nicht allein. Denn unser aller Augen haben eine verblüffende Eigenschaft. Eigentlich ist die Sehkraft am Rand des Sehfelds sehr schlecht, die Auflösung so gering, dass wir dort nichts mehr scharf sehen. Selbst die einfache Unterscheidung von Kreisen, Quadraten und Versuchsobjekten ist nicht mehr möglich, wie Laura Fademrecht und ihr Team vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen herausfanden. Das alleine wäre noch nichts Sensationelles, doch wenn es darum geht, Menschen wahrzunehmen, erkennt diese Region deutlich mehr. Die Forscher brachten Stabfiguren ins Sichtfeld der Probanden, die verschiedene Bewegungen wie beispielsweise Winken vollführten. Die Teilnehmer erkannten nicht nur diese vereinfachten Gestalten, sondern konnten anhand ihrer Bewegungen auch sofort einschätzen, ob sie aggressiv oder freundlich agierten. Evolutionär gesehen ist das ein wichtiger Vorteil, weil sich nähernde Menschen auf die Art sofort eingeordnet werden können. Die Augenwinkel sind also zur Orientierung draußen in der Natur von großer Bedeutung.6
Und diese wichtige Fähigkeit können Sie selbst dort testen, wo vermeintlich die größte Naturferne herrscht: in den Städten. Schließlich sind dort sehr viele Menschen unterwegs, genug Futter also für Ihre Augenwinkel.
Dass unsere Augen noch überaus leistungsfähig sind, ist an sich nichts Überraschendes, selbst wenn ein genauerer wissenschaftlicher Blick Erstaunliches zutage fördert. Doch wie sieht es mit unseren Ohren aus? Unser Hörvermögen gilt gemeinhin im Vergleich zu dem anderer Vertreter des Tierreichs als schwach ausgeprägt, um nicht zu sagen degeneriert. Doch ist das wirklich so?
Gehörtraining in der Natur
Können Sie den Gesang des Wintergoldhähnchens hören? Es zählt mit einem Gewicht von kaum sechs Gramm zu den kleinsten Vögeln Europas und singt so hoch, dass es sich prima als Test für Ihr Hörvermögen eignet. Das leise »sisisi« klingt fast wie ein hohes Fiepen im Ohr, wie es bei vielen Menschen manchmal für wenige Sekunden durch innere Prozesse auftritt. Mit zunehmendem Alter gehen die höheren Frequenzen verloren; die Welt der Vögel verstummt für uns also allmählich.
Ist unser Hörsinn also generell verkümmert? Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man die Vergleiche mit tierischen Leistungen betrachtet. So versteigen sich manche Internetseiten zu der Aussage, Hunde könnten höhere Frequenzen bis zu 100 Millionen Mal besser hören als wir.7 Das ist natürlich stark übertrieben und lässt unsere Ohren als völlig untaugliche Organe erscheinen.
Zu den Fakten: Wir Menschen können Schallwellen mit einer Frequenz von 20 bis 20 000 Hertz hören, Hunde dagegen von 15 bis 50 000 Hertz. Unser Gehör ist damit nicht so extrem viel schlechter, wir können nur ganz einfach oberhalb 20 000 Hertz nichts mehr hören, in einem Bereich also, in dem für Hunde die Welt noch voller Geräusche ist. Wenn schon ein Faktor eingeführt wird, dann erscheint er lediglich in Bezug auf die Lautstärke sinnvoll. Hier sind uns die Hunde allein schon wegen ihrer größeren Ohrmuscheln überlegen. Den Unterschied können Sie leicht mit hinter den Ohren angelegten und nach vorne gewölbten Händen nachvollziehen – das macht sehr viel aus und kommt Ihnen auch bei einem Waldspaziergang zugute. Denn dann hören Sie selbst auf große Entfernung leisere Vögel oder ein Reh, welches vorsichtig durchs Geäst schlüpft.
Im Zusammenhang mit den Ohrmuscheln hat sich auch eine andere Behauptung als Mythos entpuppt: Hunde und etliche andere Säugetiere hörten besser als wir, weil sie ihre Ohren in Richtung der Geräuschquelle ausrichten könnten – im Gegensatz zu uns. Auf die Ohrmuscheln bezogen stimmt das auf jeden Fall; schließlich können nur geschätzte 10 bis 20 Prozent der Menschen überhaupt derartige Bewegungen ausführen.8 Diese Bewegungen sind allerdings nur rudimentär und führen nicht dazu, dass die Ohren nach vorne klappen. Neueste Forschungen zeigen jedoch, dass wir uns in der Vergangenheit wohl zu sehr auf Äußerlichkeiten konzentriert haben. Denn Sie und ich können sehr wohl die Ohren je nach Bedarf ausrichten, dieser Prozess findet allerdings im Inneren statt. Dazu brauchen Sie Ihre Augen, wie Kurtis G. Gruters, Neurologe an der Duke University in North Carolina, entdeckte. Er untersuchte 16 Versuchspersonen, die in einem völlig abgedunkelten Raum saßen. So konnten sie sich auf farbige LEDs konzentrieren, denen sie mit ihren Augen folgen sollten. Erstaunlicherweise bewegten sich aber nicht zuerst die Augen, sondern die Trommelfelle, die sich auf den Lichtpunkt ausrichteten. Die Zeitspanne maß nur zehn Millisekunden, bis die Augen folgten.9 Man könnte also auch sagen, dass Augen und Ohren relativ synchron auf ein Objekt ausgerichtet werden. Entscheidend ist in diesem Fall auch nicht die Zeitdifferenz, sondern die Tatsache, dass überhaupt eine Ausrichtung unseres Hörorgans erfolgt, eine Ausrichtung, die bis dahin völlig unbemerkt geblieben war. Noch überraschender ist, dass die Ohren sich dabei nicht an einer Schallquelle, sondern an dem Objekt orientieren, das die Augen in den Fokus nehmen möchten.
Die Studien von Gruters zeigen sehr deutlich, dass wir in Bezug auf unsere körperlichen Fähigkeiten noch einiges dazulernen können und vor allem, dass selbst unsere vermeintlich schwachen und unbeweglichen Ohren in ihren Möglichkeiten jederzeit für eine Überraschung gut sind.
Analog zu den Augen können Sie auch Ihre Ohren trainieren, zwei Sinne, die, wie gerade beschrieben, untrennbar miteinander verbunden sind. Dazu reicht es, einfach aufmerksam in die Natur zu lauschen und akustisch Ausschau zu halten. Ich mag zum Beispiel den Ruf des Schwarzspechts. Vielleicht liegt es daran, dass ich weiß, dass er alte, dicke Buchen zum Höhlenbau benötigt und mangels geeigneter Bäume selten geworden ist, vielleicht ist es aber auch wegen seiner beeindruckenden Größe und der hübschen knallroten Federhaube. Wie auch immer, ich freue mich bis heute jedes Mal, wenn ich sein fröhliches »krükrükrü« höre. Genau wie das »Krokkrok« der Kolkraben, die noch bis Ende des 20. Jahrhunderts in der Eifel als ausgestorben galten, oder die unverwechselbaren Rufe der Kraniche, die wieder zu Tausenden im Frühjahr und Herbst über unser Forsthaus ziehen.
Da diese Vogelrufe zu meinen absoluten Lieblingsgeräuschen zählen, höre ich sie auch dann noch, wenn sie für viele andere Menschen in den Umgebungsgeräuschen untergehen. Kranichrufe etwa dringen trotz Dreifachverglasung, isolierter Wände und abendlich laufendem Fernseher in mein Bewusstsein. Schnell springe ich dann von der Couch auf und laufe zur Haustür, um draußen die volle Lautstärke zu genießen.
Natur deutlicher akustisch wahrzunehmen sollte für niemand ein Problem sein. Denken Sie an andere Alltagsgeräusche, auf die Sie sich im Laufe der Zeit »eingehört« haben, so etwa das Klingeln des Handys oder die Benachrichtigungstöne beim Eintreffen von WhatsApp-Nachrichten. Ich finde es immer wieder amüsant, die instinktiven Zuckungen bei Mitreisenden in Bahnhöfen oder Zügen zu beobachten, wenn irgendwo solch ein Ton erklingt, sei er noch so leise. Da die meisten Menschen (mich eingeschlossen) diese nicht individualisiert haben, klingen alle Handys einer Marke gleich.
Wenn Sie Ihr Unterbewusstsein stattdessen auf Naturgeräusche trimmen, können Sie bei vielen unserer tierischen Mitgeschöpfe akustisch locker mithalten.
Der Darm – die verlängerte Nase
Die menschliche Nase scheint draußen in der Natur kaum eingesetzt zu werden. Den Eindruck habe ich zumindest bei so mancher Waldführung gewonnen. Wenn ich die Teilnehmer frage, wie es unter den Buchen oder Eichen riecht, dann müssen sie erst einmal tief durch die Nase Luft holen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich die meisten von ihnen lediglich mit den Augen orientiert, Waldgerüche können sie erst beschreiben, nachdem sie ganz bewusst einen »Nasenzug« genommen haben.
Ebenso wie die Ohren wird unser Riechorgan im Vergleich mit Tieren, besonders mit Hunden, regelrecht degradiert. Einem Hund etwa werden auch in diesem Bereich unglaubliche Fähigkeiten zugeschrieben. So soll sein Riechpotenzial pauschal eine Million Mal besser sein als unseres.10 Zudem sollen zehn Prozent des Hundegehirns zuständig für das Riechen sein, während es bei uns nur ein Prozent ist.11 Eine kleine Anmerkung am Rande: Unser Gehirn ist zehnmal größer als ein Hundegehirn, die Umrechnung in Prozente also irreführend, weil wir absolut gesehen die gleiche Gehirnmasse zum Riechen zur Verfügung haben.
Angesichts solcher Aussagen, die gerne und oft zitiert werden, wundert es mich nicht, warum viele Menschen ihrer Nase eine untergeordnete Rolle beimessen. Doch die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Natürlich können Hunde vieles deutlich besser erschnuppern als wir. Die entscheidende Frage ist jedoch: Um welche Gerüche handelt es sich dabei? Das untersuchte Matthias Laska, Professor für Zoologie an der Universität von Linköping/Schweden. Dazu testete er bei 15 unterschiedlichen Gerüchen die Schwellenwerte, die ein Hund noch erschnüffeln kann. Diese Schwellenwerte testete er auch mit menschlichen Probanden, und siehe da: Bei immerhin fünf Gerüchen schnitten sie besser ab als die Vierbeiner. Verwunderlich ist das im Nachhinein nicht, denn diese fünf Gerüche stammen aus dem Reich der Pflanzen, zum Beispiel von Früchten.12 Daran haben Hunde naturgemäß wenig Interesse; sie wollen erschnüffeln, was für ihr Leben eine Bedeutung hat. Und dazu gehören sicher keine Äpfel, Bananen oder Mangos, sondern Rehe, Hirsche oder Wildschweine.
Nicht dass wir uns falsch verstehen: In der Summe hat ein Hund sicher eine sehr viel bessere Nase, weil in seiner Welt das Riechen eine wesentlich größere Bedeutung hat als bei uns Menschen. Wir sind ja auch schon allein aufgrund des aufrechten Gangs benachteiligt; mit der Nase am Boden eine Spur zu verfolgen ist für uns nicht wirklich praktikabel. Aber das müssen wir auch gar nicht. Unsere Nase soll uns ja nicht unbedingt helfen, Beute zu verfolgen, sondern leckere Früchte im Geäst oder auch einen Partner zu finden. Strömt der Duft des anderen Geschlechts an unseren 30 Millionen Riechzellen vorbei, dann macht es manchmal »klick«. Dieses Klick löst bei Frauen zum Beispiel der Duft von Männern mit einem besonders hohen Testosteronspiegel aus. Es kann auch eine starke genetische Abweichung von der eigenen DNA sein, die potenzielle Partner anzieht, allerdings erstaunlicherweise ebenso ein gutes Parfüm! So kann man den eigenen Körpergeruch nicht nur für das Bewusstsein des anderen, sondern sogar für dessen Unterbewusstsein übertünchen und attraktiver machen.13
Die Partnerwahl per Nase ist im Reich der Säugetiere ebenfalls weitverbreitet, und selbst hier kommt Parfüm zum Einsatz. Bei Ziegen etwa ist dies gut bekannt. So änderte unser Bock Vito zur Paarungszeit seinen Duft, indem er sich mit seiner Hausmarke einsprühte: dem eigenen Urin. Der konzentrierte sich nach tagelanger Dusche gegen die Vorderbeine und ins Maul so sehr, dass man den Kerl schon auf 100 Meter Entfernung riechen konnte. Die Ziegendamen fanden es attraktiv, wir dagegen eher weniger.
Riechen können wir übrigens nicht nur mit der Nase. Riechrezeptoren gibt es auch in den Bronchien, die sich bei bestimmten Düften weiten. Und selbst der Dünndarm beteiligt sich am Erschnuppern unserer Nahrung. So entdeckten Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München, dass sich in der Darmschleimhaut Rezeptoren für Thymol und Eugenol befinden – den Geruchsstoffen von Thymian und Gewürznelken. Diese Rezeptoren gibt es eigentlich nur in der Nase. Als Reaktion auf diese Stoffe schüttet der Darm Botenstoffe aus und ändert seine Bewegungen. Die Entdeckung ist deswegen so wichtig, weil wir von Natur aus nur einer begrenzten Anzahl von Duftstoffen ausgesetzt sind. Die aktuelle Überflutung mit künstlichen Substanzen in Parfüms, Duftkerzen und Haushaltschemikalien kann also auch unser Wohlbefinden beeinträchtigen und Bauchschmerzen auslösen.
Wenn manche Menschen im Wald wenig bis gar nichts riechen, dann liegt es vielleicht nicht immer an der fehlenden Aufmerksamkeit, sondern manchmal auch an einem teilweise oder gar kompletten Verlust des Riechvermögens. Und der ist gar nicht so selten, wie Dr. Sven Becker, Gastwissenschaftler am HNO-Klinikum der Universität München, dem Bayerischen Rundfunk erzählte. Seiner Schätzung nach haben 20 Prozent der Bevölkerung bereits ein herabgesetztes Riechvermögen, drei bis fünf Prozent haben es sogar vollständig verloren.14
Und selbst bei voller Funktionsfähigkeit wird die Nase nie die gleiche Bedeutung für die Erfassung unserer Umwelt erlangen wie die Augen oder die Ohren; schließlich sind letztere Sinnesorgane viel wichtiger für die Kommunikation. Dennoch ist die Nase weiterhin ein nicht zu unterschätzendes Wahrnehmungsorgan, das in der Natur viel zu wenig eingesetzt wird. Aber das können Sie ja ändern!
Natur schmeckt nicht immer lecker
Neulich saß ich in einer Talkshow und hatte den Gästen etwas zum Verkosten mitgebracht: Fichten- und Douglasienzweige. Die Fichte als häufigste Baumart Deutschlands ist noch einigermaßen bekannt, die Douglasie hingegen schon weniger. Sie ist eine nordamerikanische Nadelbaumart von der Westküste und wächst dort zu beeindruckenden, uralten Riesen heran. Bei uns wurde sie in den letzten Jahrzehnten vermehrt angebaut, doch darauf lag in der Sendung nicht das Augenmerk. Ich hatte Zweige der Douglasie ausgewählt, weil sie angenehm würzig nach Orangeat schmecken – so meinte ich zumindest. Vertrauensvoll bissen der Schauspieler Axel Prahl und die Kabarettistin Ilka Bessin in die Zweige, um gleich darauf angewidert den Mund zu verziehen: Es schmeckte ihnen gar nicht! Und damit unterscheiden sie sich nicht vom Durchschnitt der Bevölkerung. Die Geschmacksnoten des Waldes sind in erster Linie saure Varianten und bittere mit allen Nuancen dazwischen. Was wir als lecker empfinden, also reife Beeren und Nüsse, ist im Regelfall Mangelware und höchstens wenige Wochen im Jahr verfügbar. Frische Triebe und Blätter im Frühjahr sind sauer, später dann sauer-bitter und zäh. Das Kambium, eine glasklare Schicht unter der Borke, die sich mit dem Taschenmesser abschälen lässt, ist sehr nahrhaft. Es enthält Zucker und andere Kohlenhydrate, schmeckt ein wenig nach Möhren, ist ansonsten aber eher bitter. Und das trifft auf die Nahrung im Wald fast durchgängig zu.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in grauer Vorzeit ein Großteil der Mahlzeiten unserer Vorfahren völlig anders geschmeckt hat als heute. Denn unsere Speisen und Getränke haben eine Art Evolution durchlaufen, ähnlich der belebten Umwelt. In den Geschäften überlebt nur das, wonach die Kunden greifen. Also versuchen die Produzenten, ihre Produkte so anzupassen, dass sie unsere Zunge optimal reizen. Ihre Methoden werden immer ausgefeilter und treffen immer genauer. Das ist auch einer der Gründe, warum es uns so schwerfällt, bei bestimmten Lebensmitteln nicht zuzugreifen. Zucker, Salz, Fett, das Ganze angereichert durch weitere Geschmacksverstärker, und schon wird mehr gefuttert, als der Körper braucht. Darüber vergessen wir mehr und mehr, wie natürliche und unbehandelte Nahrung schmeckt. Damit meine ich nicht Gemüse oder Obst, denn auch dieses wurde züchterisch bereits in eine ähnliche Richtung verändert: immer süßer und immer weniger Bitterstoffe. Im Vergleich zum geschmacklichen Reichtum der Natur essen wir mehr oder weniger einen Einheitsbrei. Daraus heben sich nur bestimmte Abweichler hervor, die besonders bitter oder sauer schmecken dürfen, wie etwa Kaffee oder Mixed Pickles.
Glücklicherweise können Sie Ihre Zunge aber nie endgültig verwöhnen oder gar Ihre Geschmackszentren auf der Zunge, die Papillen, abstumpfen lassen. In einer einzigen Papille sitzen 100 Geschmacksknospen, die wiederum jeweils 100 Sinneszellen enthalten. Diese Zellen sind nicht besonders dauerhaft – sie werden alle zehn Tage erneuert.15 Wird also bei der Nahrungsaufnahme einmal etwas beschädigt – zum Beispiel durch ein zu heißes Getränk –, so regeneriert sich die Zunge relativ schnell wieder.
Bei rund 100 Papillen besitzen wir also 10 000 Geschmacksknospen. Wenn Ihnen das jetzt viel erscheint, dann schauen Sie sich mal eine Pferdezunge an: Dort sitzen nämlich rund 35 000 Geschmacksknospen.16 Warum Pferde so viele brauchen? Auf einer Wiese gibt es Hunderte Arten von Gräsern und Kräutern, etliche davon giftig. Hinzu kommt, dass Pferde nicht so gut sehen können, was sich unmittelbar vor ihren Lippen befindet – da ist ihr riesiger, lang gezogener Kopf im Weg. Und wer beim Fressen nichts sieht, muss sich auf seine Zunge verlassen. Dazu muss das fragliche Gras aber erst einmal ins Maul gelangen und auch schnell wieder heraus, wenn es nicht das richtige ist. Das beherrschen Pferde perfekt, wie wir bei unseren beiden Stuten immer wieder fasziniert beobachten können. Schmeckt ein Kräutlein nicht, so wird es beim Kauvorgang elegant an den Rand der Mundhöhle und anschließend über die Lippen wieder ins Freie befördert.
Apropos Zunge: Sie ist nicht der einzige Körperteil, mit dem Sie schmecken können. Da kommen wir als Erstes noch einmal auf die Nase zurück. Bis heute sind rund 8000 flüchtige Substanzen in Lebensmitteln bekannt, die riechbar sind. Dieses Riechen geschieht erstaunlicherweise überwiegend beim Ausatmen, und Ihre Geschmackseindrücke basieren zu drei Vierteln auf Wahrnehmungen der Nase. Das kennen Sie vielleicht von einem Schnupfen: Prompt schmeckt das Essen fade, geht jeder Genuss verloren.