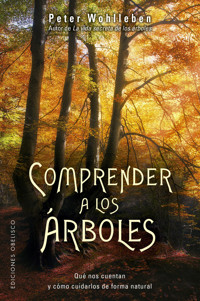5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig bei Heyne
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Wald ist noch nicht übern Berg
Gegenstand romantischer Kunst und Dichtung, Rückzugs- und Erholungsort, aber vor allem Symbol unberührter Natur: Das ist für uns der Wald. Doch was wir für unberührt halten, ist es schon lange nicht mehr. Ein Förster berichtet aus der Praxis: von den Schäden, die Holzindustrie und Jäger anrichten, warum Bioenergie aus Holz falsch verstandener Klimaschutz ist und wie wir das fragile Ökosystem Wald vor dem Kollaps bewahren können. Danach wird man den Wald mit anderen Augen sehen.
Peter Wohllebens jahrzehntelange Erfahrung als Förster hat ihn gelehrt, dass Wälder am besten ohne menschliche Eingriffe gedeihen. Tatsächlich gibt es jedoch kaum mehr einen Wald, den der Mensch nicht nach seinen Bedürfnissen geformt hat. Die Freizeitindustrie und die Jägerlobby, eine am Profit orientierte Holz- und Forstwirtschaft und die boomende Bioenergiebranche schaden ihm nicht weniger als der saure Regen in den 80ern. Wohlleben zeigt in seinem Buch auch, wie es anders gehen könnte: Er bewirtschaftet in der kleinen Eifel-Gemeinde Hümmel einen ökologischen Vorzeigewald, in dem er konsequent auf heimische Buchen setzt, auf Pflanzenschutzmittel verzichtet und Besucher für die Belange der Bäume sensibilisiert. Anschaulich vermittelt er alles Wissenswerte und Überraschende über das Leben und Zusammenleben der Bäume. – Eine spannende Lektüre mit vielen Aha-Erlebnissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
PETER WOHLLEBEN
DER
WALD
EIN NACHRUF
Wie der Wald funktioniert,
warum wir ihn brauchen
und wie wir ihn retten können –
ein Förster erklärt
Copyright © 2013 by Ludwig Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
www.ludwig-verlag.de
Lektorat: Dr. Sigrun Künkele, Hamburg
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München
Umschlagfotos: David Pattyn/Foto Natura/Minden Pictures/Corbis und Trish Punch/Rudolf Vlček, beide Getty Images
Satz: Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN: 978-3-641-09127-9
Inhalt
Vorwort
Wie ich Förster wurde
Vom Studium in den Wald
Unser Wald
Wild wachsende Bäume
Wandern auf Bäumeart
Warum Buchen?
Der natürliche Lebenszyklus einer Buche
Ich sehe was, was du nicht siehst
Kultivierte Bäume
Geschädigte Böden
Schwierige Anfangsjahre
Massenpflanzenhaltung
Unnatürliche Auslese
Nährstoffmangel
Künstliche Taiga
Jagd
Ein Blick zurück
Haustierhaltung im Wald
Lieblingsspeise
Tierische Konkurrenz
Wir zahlen alle
Verkehrte Verhältnisse
Sizilianische Verhältnisse nördlich der Alpen
Weg mit der Jagd?
Unter Schutz gestellt
Was ist eigentlich schützenswert
Fragwürdige Bemühungen
Die Größe von Schutzgebieten
Streitfall Nationalpark
Schutz durch Nutzung?
Rettet die Urwaldböden!
Strippenzieher im Wald
Bewirtschaftungskontrolle
Die Konsequenz des Sparens
Unter allen Wipfeln ist Ruh’
Survival im Wald
Juniorförster
Die Zukunft des Waldes
Waldsterben
Klimawandel
Windparks
Energie aus Holz
Warmzeit
Fremdlinge und ihr Gefolge
Ökologische Waldwirtschaft
Hoffnung Generationswechsel?
Hoffnung am Horizont?
Quellenverzeichnis
Vorwort
Ich stehe vor einer riesigen Buche. Ihre glatte Rinde ist auf einer Seite hellgrau, auf der anderen dunkel und feucht vom Regen der letzten Nacht. Das Laub riecht nach Pilzen und Moder. Ich schaue noch einmal in die weit ausgreifenden kahlen Kronenäste. Rund 170 Jahre hat sie auf dem Buckel. Da schreckt mich der Achtungsruf der Waldarbeiter aus meinen Gedanken und unwillkürlich trete ich noch einige Schritte zurück. Die Motorsäge heult auf, weiße Späne spritzen umher. Das Schwert der Maschine frisst sich unerbittlich ins Holz und wenig später geht ein Zittern durch den Baum. Fast unmerklich setzt sich die Krone in Bewegung, um rasch an Fahrt aufzunehmen. Der Stamm ächzt und quietscht, die Äste rauschen und dann schlägt die Buche so hart zu Boden, dass ich es in den Fußsohlen spüre.
Meine Gefühle fahren Achterbahn. Denn da sind zum einen die gewaltigen Kräfte, die so eine Fällung zum Ausbruch bringt. Der dicke Stamm, das viele Nutzholz, all das wird auf meine Anweisung hin bearbeitet. Zum anderen schwingt ein Bedauern mit, welches mit jedem abgesägten Baum immer größer wird: Ich beseitige die letzten alten Laubwälder des Gemeindewalds, die letzten mächtigen Buchen und Eichen. Zurück bleibt nur Jungwuchs, wenige Jahre alt. Dieser »Wald« reicht mir nicht einmal bis zum Kinn. Ist es das, was ich mir für unsere Umwelt wünsche?
Diese berufliche Episode ist mittlerweile 20 Jahre her und die alten Wälder meiner Gemeinde stehen nun unter Schutz. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, was dort draußen vor sich geht, wie ein Wald funktioniert und was menschliches Handeln bewirkt. Wieder und wieder habe ich meine Arbeit hinterfragt, nicht nur als Förster, sondern auch als Mensch, der seinen Platz im 21. Jahrhundert einnimmt. Und obwohl dieser Lernprozess nie zu Ende gehen wird und ich immer noch Fehler mache, habe ich mich mit den Bäumen versöhnt. Jetzt endlich, nach 25 Jahren beruflicher Tätigkeit, passen Arbeit und Naturschutz zusammen. Und in letzter Zeit lässt mich der neue, unverkrampfte Blick auf unser größtes Ökosystem laufend überraschende Dinge entdecken, die so an keiner Hochschule gelehrt werden.
Wald kommt der Ursprünglichkeit unzerstörter Natur noch am nächsten. Der Lärm und die Hektik des Alltags scheinen in ihm zu verhallen. Wenn der Wind durch die Wipfel rauscht, die Vögel singen und das Grün der Blätter harmonisch in das Blau des Himmels übergeht, können wir tief durchatmen und entspannen. Das Wissen, dass Wälder nebenbei auch unverzichtbar für reines Trinkwasser, gesunde Luft und die Artenvielfalt sind, verstärkt die positiven Gefühle. Doch ist das wirklich intakte Natur, was wir da sehen? Seit ich mich kritisch mit der eigenen Zunft beschäftige, kommen mir viele Forste nur noch wie grüne Kulissen vor, hinter denen es ums knallharte Geschäft geht. Die Tierwelt wird zum Teil an den Rand gedrängt und als lästiges Hindernis gesehen, Bäume nur noch als Holzlieferanten mit begrenzter Verweildauer begriffen.
Noch gibt es sie, die grünen Inseln mit intakten Lebensgemeinschaften. Selbst wenn es keine Urwälder mehr sind, sondern eher wilde Kulturwälder, so kann man hier das Sozialleben der Bäume beobachten, neue Tierarten im kaum erforschten Boden entdecken oder einfach nur spüren, wie sich echter Wald anfühlt. Doch selbst diese Fläche wird täglich kleiner, um Platz für neue Nadelbaumplantagen zu schaffen. Leider wird das in der Öffentlichkeit kaum bemerkt und auffällige Veränderungen werden dem Waldsterben oder dem Klimawandel in die Schuhe geschoben.
Es ist vielfach unser aller Wald, mit dem so gewirtschaftet wird, denn ein Großteil der Betriebe befindet sich im Besitz von Staat, Städten und Gemeinden. Und deswegen wünsche ich mir mehr kritische »Aktionäre«, die helfen, dieses empfindliche Ökosystem zu schützen.
Haben Sie Lust, mich zu begleiten? Dann lade ich Sie ein auf einen Spaziergang durch den Wald, auf eine Entdeckungstour zu den letzten Geheimnissen vor unserer Haustür. Zuvor aber möchte ich Ihnen noch ein wenig über meinen Weg in den Wald erzählen …
Wie ich Förster wurde
Schon als kleiner Junge wollte ich Naturschützer werden. Die Familienurlaube im Allgäu oder auf den Nordseeinseln riefen in mir eine tiefe Sehnsucht nach weiten, ursprünglichen Landschaften hervor. Ging es wieder nach Hause, brach ich jedes Mal in Tränen aus. Diese Sehnsucht ist mir bis heute geblieben.
Naturschutz ist kein Studienzweig oder Lehrberuf und so schrieb ich mich nach dem Abitur für ein Biologiestudium ein, auch wenn mir nicht so richtig klar war, was ich damit später anfangen sollte. Eines Tages brachte mir meine Mutter einen Artikel aus der Tageszeitung, in dem die Bezirksregierung Koblenz Stellen für eine interne Ausbildung zum Förster ausschrieb. Neben 200 anderen Bewerberinnen und Bewerbern schwitzte ich im Auswahltest über politischen Fragen, rechnete kleine Testaufgaben und wurde schließlich vor ein dreiköpfiges Gremium geladen. Hier stellte man die üblichen Fragen, zum Beispiel warum man Förster werden wolle. Und dann wurde es brenzlig: »Waren Sie schon bei der Bundeswehr oder werden Sie noch eingezogen?« Ich wurde rot. Nein, antwortete ich, ich sei aufgrund meiner Körpergröße von 1,98 Metern freigestellt worden. Untauglich also. Dumm nur, dass die Forstverwaltungen erzkonservative Behörden waren, die das Militärische geradezu liebten. Kein Wunder, rekrutierten sich die grünberockten Waldwächter doch früher aus den soldatischen Jägerregimentern – und auch jetzt noch wurde jeder, der nicht gedient hatte, argwöhnisch beäugt.
Ich wähnte mich also durchgefallen und sah mich schon als Biologiestudent im Hörsaal sitzen. Umso mehr überraschte mich Wochen später die Zusage, zum 1. September 1983 als Dienstanfänger eingestellt zu werden. Hurra!
Am Einstellungstermin wurden wir nach Koblenz zu einem Empfang des Regierungspräsidenten eingeladen, der anders als erwartet verlief. So ließ der ergraute Politiker keinen Sekt mit Häppchen reichen, sondern ermahnte uns polternd, keine modernen Radiosender zu hören. Eingeschüchtert warteten wir auf den nächsten Programmpunkt, doch das war’s: Willkommen in der Realität!
Das Dienstanfängerjahr entpuppte sich als ein Praktikum, das dem eigentlichen Studium vorgeschaltet war. Es war eine lustige, unbeschwerte Zeit mit den anderen jungen Kollegen, wenngleich uns immer wieder klargemacht wurde, dass wir die Anfänger waren und auf der niedrigsten Stufe standen. Wir waren schließlich noch keine Beamten. Ich verbrachte viel Zeit bei den Waldarbeitern des Lehrreviers und verrichtete schwere körperliche Arbeit. Ob Holzernte, Zaunbau oder Pflanzung, bei Wind und Wetter lernte ich das Spektrum der Aufgaben kennen. Die Arbeiter freuten sich, denn ihr Akkordlohn stieg durch meine Mitarbeit, die sie einfach als ihre eigene Arbeit verbuchten.
An meinem ersten Arbeitstag wurde ich gleich mit der grünen Realität konfrontiert. Ich hatte damals als 19-Jähriger kein Auto, sondern legte die 15 Kilometer bis zum Forsthaus meines Lehrherren mit dem Fahrrad zurück. Meine Kleidung bestand aus einer blauen, wattierten Jacke und einer hellblauen Jeans. Ich weiß das deshalb noch so genau, weil es mir schon in den ersten Stunden meines neuen Daseins peinlich war. Blau! Das ging gar nicht. Selbst Dienstanfänger hatten Grün zu tragen, und so kaufte ich mir am nächsten Wochenende in einem Jagdkaufhaus in Bonn eine Kniebundhose aus Cord sowie ein Jagdhemd – natürlich in Olivgrün. Meine Mutter strickte mir passende Kniestrümpfe und so konnte ich im Dienst endlich erhobenen Hauptes auftreten.
Das Jahr wurde durch mehrere Lehrgänge im Dörfchen Trippstadt in der Pfalz unterbrochen. Hier lernte ich die anderen Jahrgangsteilnehmer kennen. Der Umgang mit der Motorsäge stand ebenso auf dem Kursplan wie die Pflege von Anpflanzungen oder der Einsatz von Insektiziden.
Im Herbst des darauffolgenden Jahres wurden wir alle zu Beamten auf Widerruf ernannt und an die Fachhochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar versetzt, eine Einrichtung, die von mehreren Bundesländern gemeinsam betrieben wurde. Dieses verwaltungsinterne Studium mit zwei praktischen und zwei Hochschuljahren jeweils im Wechsel funktionierte ähnlich wie ein duales Studium: Wir bekamen ein Gehalt und verpflichteten uns dafür, hinterher bei unserer Forstverwaltung zu arbeiten. Die Fachhochschule war klein und übersichtlich, fast schon familiär, allerdings mit strengen Regeln. So galt für jede Vorlesung Anwesenheitspflicht; Diskussionen über den dargebotenen Stoff gab es nicht und waren auch nicht erwünscht. Erst später wurde mir klar, dass wir so alle auf Linie gebracht wurden.
Ein Highlight war die Ausgabe der Uniformen. Jetzt sahen wir endlich wie richtige Förster aus! Grüne Jacken mit dunkelgrünen Aufschlägen, grüne Schulterstücke, die uns als Anwärter auswiesen, sowie ein Försterhut, natürlich auch in Grün, mit dem Landeswappen von Rheinland-Pfalz – so ausgestattet fühlten wir uns wichtig. Bei manchen Exkursionen war das Tragen der Dienstkleidung Pflicht und wir folgten dieser Anweisung gern.
Nach einem Jahr Büffeln folgte die Zwischenprüfung, der ich mit gemischten Gefühlen entgegensah, da ich etwas faul gewesen war und kaum gelernt hatte. Mein Kumpel Wolfgang, ebenfalls nicht besonders fleißig, bekam auch langsam Bedenken, je näher der Termin rückte. Kurz entschlossen opferten wir ein Wochenende und blieben an der Fachhochschule, um noch einmal die Sammlungen durchzugehen. Hier standen Holzstücke der wichtigsten Baumarten fein säuberlich auf Tischen sortiert und an den Wänden hingen Geräte für Waldarbeiter. Daneben fanden sich Tierpräparate, die uns aus Glasaugen anstarrten, und, ganz besonders wichtig, die Insektensammlung. Hunderte von Käfern waren mit Nadeln auf Schaumstoffkissen gespießt und einzeln in Schächtelchen gesetzt. Daneben lag ein Stück Holz oder Rinde mit dem Fraßbild der Schädlinge. Ein Student, der sich und uns mit der Stofffülle, die er für das absolut zu beherrschende Minimum hielt, verrückt machte, schien so oft hier zu sein, dass wir uns fragten, ob er im Ausstellungsraum auch übernachtete. Als er uns hereinkommen sah, dozierte er gleich ungefragt über Borkenkäfer. Ein Name kam mir besonders bizarr und auch völlig unwichtig vor. »Das hier ist das typische Fraßbild des Fichtenrindenbastkäfers.« Ich konnte ein Kichern kaum unterdrücken und blickte zu Wolfgang, dem es ähnlich ging. Wir verdrehten die Augen und verließen die staubige Sammlung, um noch ein Eis essen zu gehen.
Tags darauf fand die mündliche Prüfung im Fach Forstschutz statt, zu dem auch die Insektenkunde gehörte. Und was wurde mir vom Professor vorgelegt? Der Fichtenrindenbastkäfer. Volle Punktzahl! Dieser eine Name hat sich seither in mein Gedächtnis eingebrannt. Wichtiger aber war, ich bestand die Zwischenprüfung und durfte endlich wieder in den Wald!
Im dritten Jahr mussten wir, jeder an einer anderen Dienststelle, beweisen, was wir gelernt hatten. Ich wurde einem Eifelforstamt zugewiesen, in dem die Uhren noch etwas langsam gingen. Es war von einem riesigen Waldgebiet in Staatsbesitz geprägt und hatte entgegen dem gesetzlichen Auftrag, sich schwerpunktmäßig um die Bäume zu kümmern, offensichtlich die Jagd als wichtigstes Betätigungsfeld. Hier wurden Hirsche und Muffelschafe in großer Zahl gehegt, was mir damals aber nicht seltsam vorkam, sondern aufregend. Für mich als kleines Licht gab es nur beschränkte Abschussmöglichkeiten. Struppige Rehe, die kurz vor dem Verhungern waren, gestand man dem forstlichen Nachwuchs zu. Die dicken Hirsche mit den ausladenden Geweihen waren für andere reserviert: Diese begehrten Tiere durften Beamte des Ministeriums, Jagdgäste aus der Wirtschaft oder der Forstamtsleiter erlegen. Normale Förster kamen in der Regel nur einmal bei solchen Trophäenträgern zum Zug, und zwar am Ende ihrer Dienstzeit. Dann erhielten sie die Freigabe für einen »Pensionshirsch«. Damals empfand ich diese Art des Wildmanagements als etwas völlig Logisches und den Jagdbetrieb selber als wichtigen Bestandteil meines künftigen Berufs.
Ich selbst hatte kein Jagdglück. Nur einmal, während einer Treibjagd, wäre es fast passiert. Denn bei einer solchen Gelegenheit darf jeder Schütze, also auch Studenten, alles Wild aufs Korn nehmen, das die behördlichen Abschusspläne freigegeben haben.
Schon von Weitem hörte ich die Hunde bellen, die in meine Richtung unterwegs waren. Da sie irgendetwas vor sich her zu treiben schienen, machte ich mich schussfertig. Es knackte im Unterholz und dann sah ich einen jungen Hirsch hervorbrechen. Mit kleinem Geweih zwar, aber für mich als Jungspund eigentlich eine Nummer zu groß. Etwa 100 Meter von mir entfernt stand der zuständige Revierleiter. Er war bekannt dafür, Hirsche zu füttern und zu schonen, bis sie eines Tages als mächtige Geweihträger geschossen wurden. Ihm musste das Herz bluten, dass sein geliebtes Rotwild so dezimiert werden sollte. Und ausgerechnet mir als einem der Rangniedrigsten lief so ein Tier vor die Büchse. Also ließ er den Hund, der bis dahin brav neben ihm gelegen hatte, blitzartig von der Leine. Und der Vierbeiner wusste genau, was er zu tun hatte. Aus den Augenwinkeln sah ich ihn spurten, geradezu fliegen, hinüber zu mir. Das Gewehr im Anschlag auf den Hirsch wähnte ich mich schon als erfolgreichen Schützen, da bemerkte er den Hund und machte auf den Hinterbeinen kehrt. Aus der Traum, weg war er.
Als Jäger durfte ich mich an diesem bitterkalten Wintertag trotzdem noch betätigen. Zusammen mit anderen Auszubildenden wurden wir zur Wildkammer beordert, in der die Strecke, die geschossenen Tiere, lagen. Normalerweise macht jeder Jäger sein Wild selbst verkaufsfertig, wozu es aufgebrochen werden muss. Dabei wird der Bauchraum durch einen Längsschnitt vom After bis zur Kehle geöffnet und die Innereien werden komplett entfernt. Danach kann das Fleisch auskühlen und verdirbt nicht so schnell. Bei dieser Treibjagd, zu der das Ministerium ins Forstamt geladen hatte, war es jedoch anders. Denn den Gästen war kalt und sie wollten schnell ins Wirtshaus, wo Kasseler, Kartoffelpüree, Sauerkraut und das eine oder andere Bier auf sie warteten.
Die forstliche Jugend musste derweil bei minus fünf Grad Celsius die blutige Arbeit in der Wildkammer erledigen, bevor auch sie in die warme Wirtsstube durfte. Ich erinnere mich noch, dass ich einen dicken Keiler bearbeiten musste. Er stank wie die Pest und sein Bauch war dick und fett vom Winterfutter. Ich arbeitete mich mit klammen Händen durch die Speckschichten, hatte kaum noch Gefühl in den Fingern und wühlte Därme, Lunge und Leber heraus. Der Geruch klebte noch Tage später an meiner Haut.
Ähnlich ging es während des ganzen praktischen Jahres zu. Immer wurde fein säuberlich zwischen den verschiedenen Rangstufen unterschieden: Ganz oben war der höhere Dienst angesiedelt, hier in Gestalt des bärtigen Forstamtsleiters. Seine Uniform zierten Schulterstücke, deren grüne Kordel silbern eingefasst war. Diese Verzierung fehlte bei den Revierleitern, aber sie hatten noch Eicheln aus Metall auf dem Geflecht. Bei mir, dem Beamtenanwärter, waren die grünen Zierstücke ungeschmückt. Damit war ich zwar als rangniedriger gekennzeichnet, aber unter mir ging es noch weiter. Die Angestellten des Forstamts, als reine Innendienstler im Büro tätig, standen damals eindeutig auf einer tieferen Stufe als ich und wurden daher bei Dienstbesprechungen nur ab und an eingeladen. Bei öffentlichen Empfängen mussten sie sogar Häppchen und Getränke reichen. Die Putzfrau schließlich, ebenfalls im öffentlichen Dienst beschäftigt, wurde selbst bei solchen Anlässen ausgeschlossen. Ich denke, dass die meisten Beschäftigten gar nicht wussten, wie sie hieß.
Nachdem ich gelernt hatte, wie die forstliche Welt funktionierte, kehrte ich für ein weiteres Jahr an die Fachhochschule zurück. Dieses zog sich ähnlich in die Länge wie das erste, wobei der nahende Ernst des Berufslebens uns etwas fleißiger werden ließ. 14 Monate später fand unsere Staatsprüfung an einem grauen Oktobertag statt. Dazu war der gesamte Jahrgang per Bus in den Westerwald gefahren worden, um in Einzelbefragungen vor Ort Rede und Antwort zu stehen. Meine Antworten waren anscheinend in Ordnung, denn wenig später hielt ich mein Diplom in den Händen. Ich war Förster! Und weil mein Notenschnitt gut war, wurde ich gleich als Beamter übernommen. Damals war ich stolz auf das Erreichte, wähnte mich angekommen und sah mit Freude meiner beruflichen Zukunft entgegen. Dass ich meine Meinung wenige Jahre später ändern und mein mühsam erlerntes Wissen über Bord werfen sollte, ahnte ich damals noch nicht.
Vom Studium in den Wald
Da stand ich nun als frischgebackener Förster: stolz auf meine bestandene Staatsprüfung, voller Tatendrang und mit großer Vorfreude auf die Tätigkeit im Wald. Ich sah mich schon zwischen den Bäumen umherstreifen, die frische Luft genießen, kurz, das Leben eines Revierleiters führen, denn so hatte ich es bei meinen Ausbildern während der praktischen Jahre erlebt. Die Forstdirektion holte mich jedoch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Jungen Forstbeamten werden die Stellen angeboten, die sonst kaum jemanden aus der Verwaltung interessieren. Und für Waldmenschen ist das der Innendienst. Meine Verlobte arbeitete damals in der Verwaltung eines Industriebetriebs in Bonn und ich versuchte, so nah wie möglich an die Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen versetzt zu werden, damit wir wenigstens zusammenziehen konnten. Das Resultat war eine Büroleiterstelle in einem kleinen Forstamtsgebäude eines Eifelstädtchens.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!