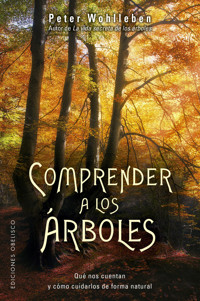9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
"Wohllebens Bücher erweitern unsere Wahrnehmung von der Welt." Denis Scheck in Der Tagesspiegel
Die Natur steckt voller Überraschungen: Laubbäume beeinflussen die Erdrotation, Kraniche sabotieren die spanische Schinkenproduktion und Nadelwälder können Regen machen. Was steckt dahinter? Der passionierte Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben lässt uns eintauchen in eine kaum ergründete Welt und beschreibt das faszinierende Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Tieren: Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Gibt es eine Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Arten? Und was passiert, wenn dieses fein austarierte System aus dem Lot gerät? Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und seiner eigenen jahrzehntelangen Beobachtungen lehrt uns Deutschlands bekanntester Förster einmal mehr das Staunen. Und wir sehen die Welt um uns mit völlig neuen Augen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der Autor
Peter Wohlleben, Jahrgang 1964, wollte schon als kleines Kind Naturschützer werden. Er studierte Forstwirtschaft und war über zwanzig Jahre lang Beamter der Landesforstverwaltung. Um seine ökologischen Vorstellungen umzusetzen, kündigte er und leitet heute eine Waldakademie in der Eifel. Er ist Gast in zahlreichen TV-Sendungen, hält Vorträge und Seminare und ist Autor von Büchern zu Themen rund um den Wald und den Naturschutz. Mit seinen Bestsellern Das geheime Leben der Bäume und Das Seelenleben der Tiere hat er Menschen auf der ganzen Welt begeistert.
Zum Buch
Die Natur steckt voller Überraschungen: Laubbäume beeinflussen die Erdrotation, Kraniche sabotieren die spanische Schinkenproduktion, und Nadelwälder können Regen machen. Was steckt dahinter? Der passionierte Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben lässt uns eintauchen in eine kaum ergründete Welt und beschreibt das faszinierende Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Tieren: Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Gibt es eine Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Arten? Und was passiert, wenn dieses fein austarierte System aus dem Lot gerät? Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und seiner eigenen jahrzehntelangen Beobachtungen lehrt uns Deutschlands bekanntester Förster einmal mehr das Staunen. Und wir sehen die Welt um uns mit völlig neuen Augen …
PETERWOHLLEBEN
DAS GEHEIME
NETZWERK
DER NATUR
Wie Bäume Wolken machen und Regenwürmer Wildschweine steuern
Inhalt
Vorwort
Warum Wölfe den Bäumen helfen
Wie Lachse in die Bäume wandern
Tiere in der Kaffeetasse
Warum Bäumen Rehe nicht schmecken
Ameisen – die heimlichen Herrscher
Der böse Borkenkäfer
Leichenschmaus
Spot an!
Sabotierte Schinkenproduktion
Wie Regenwürmer Wildschweine steuern
Märchen, Mythen und die Artenvielfalt
Wald und Klima
Heißer geht’s nicht
Natur und Mensch
Woher kommen weiße Menschen?
Die alte Uhr
Über die wissenschaftliche Sprache
Dank
Anmerkungen
Vorwort
Die Natur ist wie ein großes Uhrwerk. Alles ist übersichtlich geordnet und greift ineinander, jedes Wesen hat seinen Platz und seine Funktion. Betrachten wir beispielsweise den Wolf: Er gehört zur Ordnung der Raubtiere, darin zur Überfamilie der Hundeartigen, darin wieder zur Familie der Hunde, hier zur Tribus der echten Hunde, zur Gattung der Wolfs- und Schakalartigen und letztlich zur Art Wolf. Uff. Seine Rolle als Beutegreifer dient dazu, die Bestände der Pflanzenfresser zu regulieren, damit sich etwa Hirsche nicht zu stark vermehren. So sind alle Tiere und Pflanzen fein im Gleichgewicht, jedes Wesen hat seinen Sinn und seine Aufgabe im Ökosystem. Für uns Menschen ist dieses System vermeintlich gut überschaubar und bietet dadurch Sicherheit. Als ehemaliger Steppenbewohner ist unsere Art mit dem wichtigsten der Sinnesorgane, den Augen, auch auf einen guten Überblick angewiesen. Aber haben wir diesen guten Überblick wirklich?
In diesem Zusammenhang fällt mir eine Begebenheit aus meiner Kindheit ein. Ich war ungefähr fünf Jahre alt und in den Ferien zu Besuch bei meinen Großeltern in Würzburg. Dort schenkte mir mein Opa eine alte Uhr. Ich zerlegte sie sofort in ihre Einzelteile, weil mich die Funktionen brennend interessierten. Obwohl ich fest davon überzeugt war, sie wieder funktionstüchtig zusammensetzen zu können, gelang mir das nicht – ich war ja auch noch ein Knirps. Nach dem Zusammenbau blieben ein paar Zahnrädchen übrig – und ein Opa, der nicht gerade die beste Laune hatte.
Die Funktion solcher »Zahnräder« übernehmen in der Natur beispielsweise die Wölfe. Rotten wir sie aus, dann sind damit nicht nur die Feinde von Schaf- und Rinderhaltern verschwunden, sondern das feine Uhrwerk Natur beginnt, anders zu ticken. So anders, dass Flüsse sich neue Läufe suchen und viele Vogelarten lokal aussterben.
Aber auch wenn man etwas hinzufügt, gerät alles aus dem Tritt, beispielsweise wenn eine fremde Fischart ausgesetzt wird. Das führt nämlich dazu, dass die örtliche Hirschpopulation massiv dezimiert wird. Durch Fische? Ja, das Ökosystem Erde ist doch ein wenig zu komplex, um es in Schubladen packen und simple Wenn-dann-Regeln aufstellen zu können. Selbst Naturschutzmaßnahmen wirken häufig an unerwarteten Stellen, so etwa, wenn die sich erholende Kranichpopulation die spanische Schinkenproduktion beeinträchtigt.
Es ist also höchste Zeit, sich mit den Zusammenhängen zwischen den Arten zu beschäftigen, den großen und den kleinen. Dabei fällt der Blick dann auch auf so lustige Gesellen wie rotköpfige Fliegen, die nur nachts und im Winter unterwegs sind und nach alten Knochen Ausschau halten, oder Käfer, die vermodernde Baumhöhlen lieben und dort Federreste von Tauben und Eulen (aber nur gemischt!) verspeisen. Je intensiver man die Beziehungen zwischen den Arten beleuchtet, desto mehr wunderbare Dinge offenbaren sich.
Ist die Natur nicht sogar noch viel komplexer als ein Uhrwerk? In ihr greift ja nicht nur ein Zahnrad ins andere, sondern alles ist auch noch untereinander vernetzt. Dieses Netzwerk ist so zart verästelt, dass wir es wahrscheinlich niemals in seinem vollen Umfang begreifen werden. Und das ist auch gut so, denn dadurch bleibt uns das Staunen über Pflanzen und Tiere erhalten. Wichtig ist nur zu erkennen, dass bereits kleine Eingriffe große Folgen haben und wir daher besser unsere Finger überall dort herauslassen, wo ein Handeln nicht unbedingt erforderlich ist.
Damit Sie sich ein klareres Bild von diesem zarten Netzwerk machen können, möchte ich es Ihnen gerne in einigen Beispielen nahebringen – lassen Sie uns zusammen staunen.
Warum Wölfe den Bäumen helfen
Wie kompliziert Zusammenhänge in der Natur sein können, lässt sich wunderbar am Beispiel der Wölfe zeigen. Die Beutegreifer sind nämlich erstaunlicherweise in der Lage, den Lauf von Flüssen zu verändern und somit Ufer neu zu gestalten.
Die Sache mit den Flussläufen fand im Yellowstone-Nationalpark statt. Dort hatte man im 19. Jahrhundert systematisch damit begonnen, die Wölfe auszurotten. Das geschah vor allem auf Druck von Farmern aus dem Umland hin, die um ihr Weidevieh fürchteten. Um 1926 war das letzte Rudel ausgelöscht, und bis in die 1930er-Jahre wurden nur noch ab und an einzelne Tiere beobachtet, bis auch diese schließlich erlegt waren. Die anderen im Park lebenden Arten blieben verschont oder wurden sogar aktiv unterstützt, wie etwa die Hirsche. Waren die Winter zu hart, wurden sie sogar von den Rangern gefüttert.
Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten: Kaum behelligt von Beutegreifern, wuchsen die Bestände stetig an, und etliche Regionen des Parks wurden regelrecht kahl gefressen. Besonders die Flussufer waren betroffen. Die saftigen Gräser an ihren Rändern verschwanden, ebenso sämtliche Schösslinge von Bäumen. Das verödete Land bot kaum noch Nahrung für Vögel, sodass deren Artenspektrum ebenfalls stark zurückging. Auch die Biber zählten zu den Verlierern. Sie sind nicht nur auf Wasser angewiesen, sondern auch auf Bäume, die nah am Ufer stehen. Weiden und Pappeln zählen zu ihren Leibspeisen. Sie fällen die Bäume, um an die nährstoffreichen Triebe heranzukommen, die sie dann genüsslich verspeisen. Weil nun aber alle jungen Laubbäume entlang der Gewässer in den hungrigen Mägen der Hirsche landeten, hatten die Biber nichts mehr zu beißen und verschwanden.
Die Ufer verödeten, und da kaum noch Vegetation die Böden schützte, konnten immer wieder auftretende Hochwasser mehr und mehr Erdreich mitreißen – die Erosion schritt rasch voran. In der Folge begannen die Flussbetten stärker zu mäandrieren, sich also durch die Landschaft zu schlängeln. Je schutzloser der Untergrund, desto stärker ist dieser Effekt vor allem in flachen Gebieten.
Dieser traurige Zustand hielt sich über Jahrzehnte, genauer gesagt, bis 1995. In diesem Jahr wurden Wölfe in Kanada gefangen und im Yellowstone-Park ausgesetzt, um das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen.
Was in den folgenden Jahren geschah und bis heute andauert, wird von Wissenschaftlern als »trophische Kaskade« bezeichnet. Der Begriff bedeutet so viel wie eine Veränderung des gesamten Ökosystems über die Nahrungskette, von oben beginnend. Oben stand nun der Wolf, und was er auslöste, kann man vielleicht eher als trophische Lawine bezeichnen. Er tat, was wir alle tun, wenn wir Hunger haben: Wir besorgen uns etwas zu essen. In diesem Fall waren es die Hirsche, die sich in großer Zahl und leicht jagdbar präsentierten. Der Ausgang der Geschichte scheint klar: Die Wölfe fressen die Hirsche, deren Zahl drastisch schrumpft, und so bekommen die kleinen Bäume wieder eine Chance. Heißt die Lösung also Wolf statt Hirsch? Solche drastischen Tauschaktionen gibt es in der Natur glücklicherweise nicht, denn je weniger Hirsche, desto länger dauert die Suche nach ihnen, und ab einer bestimmten Restzahl lohnt es sich für die Wölfe nicht mehr; also wandern sie ab oder verhungern.
Im Yellowstone-Nationalpark konnte man jedoch zusätzlich etwas ganz anderes beobachten: Die Wölfe sorgten dafür, dass sich das Verhalten der Hirsche änderte: Sie bekamen es mit der Angst zu tun. Die Tiere mieden die offenen Bereiche der Flussufer und zogen sich in Areale zurück, die einen besseren Sichtschutz boten. Zwar kamen sie hin und wieder an die Gewässer, doch hielten sie sich dort nicht mehr lange auf – ständig irrte ihr Blick durch die Landschaft in der Sorge, einen der grauen Jäger zu sichten. Dadurch hatten sie kaum noch Zeit, sich nach den Schösslingen von Weiden und Pappeln zu bücken, die nun wieder in großer Zahl entlang der Ufer wuchsen. Die beiden Baumarten gehören zu den sogenannten Pioniergehölzen und können rascher wachsen als die meisten anderen Bäume – Jahrestriebe von einem Meter sind bei ihnen keine Seltenheit.
Innerhalb weniger Jahre befestigten sich die Ufer wieder, sodass die Flüsse ruhiger in ihren Betten flossen und kaum noch Erde abtransportierten. Das Mäandrieren wurde beendet; die Kurven, die die Flüsse bis dato in die Landschaften geschnitten hatten, blieben allerdings erhalten.
Vor allem aber gab es wieder Nahrung für die Biber. Diese begannen, ihre Dämme zu bauen, wodurch das Wasser noch langsamer floss. Es bildeten sich vermehrt Tümpel, die kleine Paradiese für Amphibien bildeten. In dieser aufblühenden Vielfalt nahm auch die Anzahl der Vogelarten wieder kräftig zu (auf der Homepage des Yellowstone-Nationalparks finden Sie dazu ein beeindruckendes Video).1
Es gibt durchaus Kritik an dieser Sichtweise. Denn zeitgleich mit der Rückkehr der Wölfe endete eine mehrjährige Dürre, und mit der Rückkehr stärkerer Regenfälle ging es auch den Bäumen wieder besser – Weiden und Pappeln lieben feuchten Boden. Doch diese Erklärung des Phänomens lässt die Biber außer Acht. Wo sie leben, können auch Schwankungen der Niederschläge kaum etwas bewirken, zumindest nicht in Ufernähe. Die Dämme halten das Flusswasser zurück, bewirken ein Durchfeuchten der Böschungen und helfen somit den Bäumen, an Wasser zu kommen, auch wenn es einmal monatelang nicht regnet. Genau dieser Prozess wurde mit der Rückkehr der Wölfe wieder in Gang gesetzt: weniger Hirsche in Ufernähe = mehr Weiden und Pappeln = mehr Biber. Alles klar?
Ich muss Sie leider enttäuschen, denn die Sache kann sogar noch komplizierter werden. Manche Forscher sehen in der bloßen Anzahl der Hirsche das Problem und nicht in deren Verhalten. Es seien seit der Rückkehr der Wölfe insgesamt weniger Hirsche im Park (weil seither so viele gefressen wurden) und daher logischerweise auch ein paar weniger an den Ufern zu sehen.
Sind Sie jetzt vollends verwirrt? Kein Wunder. Ich muss gestehen, dass ich mir selbst zeitweilig wieder wie der im Vorwort erwähnte Fünfjährige vorkam. Im Falle von Yellowstone beginnt das Uhrwerk allerdings langsam wieder zu ticken, weil die Eingriffe zurückgefahren werden. Und wenn Wissenschaftler diesen Prozess noch nicht bis ins letzte Detail verstanden haben, ist das für sich genommen doch auch schon ein erfreuliches Eingeständnis. Dennoch: Je stärker die Einsicht, dass schon kleinste Störungen zu nicht kalkulierbaren Veränderungen führen können, desto besser sind die Argumente für den Schutz großer Gebiete.
Die Rückkehr der Wölfe half übrigens nicht nur den Bäumen und den Bewohnern der Flussufer, auch andere Beutegreifer haben davon profitiert. Es waren die Grizzlys, denen es in den Jahrzehnten der Überbevölkerung durch Hirsche nicht so gut ging. Bären sind im Herbst auf Beeren angewiesen. Indem sie unermüdlich die kleinen mit Zucker und anderen Kohlehydraten angefüllten Kraftkügelchen futtern, legen sie ordentlich an Gewicht zu. Die kleinen Sträucher mit ihren scheinbar unerschöpflichen Beständen lieferten irgendwann aber nicht mehr genug, oder, besser gesagt, sie wurden geplündert – denn Hirsche lieben ebenfalls kalorienreiche Früchte. Als nun wieder Wölfe Jagd auf die großen Pflanzenfresser machten, blieb zur Erntezeit im Herbst mehr für die Bären übrig, denen es seitdem gesundheitlich wesentlich besser geht.2
Ich habe die Wolfsgeschichte mit der Feststellung begonnen, dass die Ausrottung der Bestände durch den Druck der Rinderzüchter ausgelöst wurde. Die Wölfe verschwanden, die Rinderzüchter nicht. Sie siedeln bis heute rings um das Yellowstone-Gebiet und halten ihr Vieh auf den Weiden bis hart an die Parkgrenze. Die Einstellung hat sich bei vielen von ihnen in den vergangenen Jahrzehnten nicht geändert, und so ist es kein Wunder, dass auf die Wölfe geschossen wird, sobald sie den Park verlassen. Der Wolfsbestand ist in den letzten Jahren erneut stark zurückgegangen, obwohl das Gebiet für eine weitere Ausbreitung sehr gut geeignet wäre. Von einem Höchststand mit 174 Exemplaren im Jahre 2003 ist die Zahl auf rund 100 Tiere gesunken.
Der Grund dafür liegt nicht allein in der Abneigung der Farmer, sondern auch in der verbesserten Technik. Viele Yellowstone-Wölfe tragen inzwischen Senderhalsbänder, mit deren Hilfe Forscher die Rudel orten und erfahren können, auf welchen Wegen die Tiere durch den Park ziehen – oder über seine Grenzen hinaus. Wie mir die Wolfsforscherin Elli Radinger berichtete, machen sich die illegalen Schützen dieselben Signale zunutze, um die Tiere abzupassen, sobald sie das schützende Areal verlassen haben. Effektiver kann man Wölfe nicht bejagen, und scheinbar haben das auch deutsche Wilderer begriffen. So wurde 2016 in Mecklenburg-Vorpommern in der Lübtheener Heide ein junger Wolf getötet, der ebenfalls ein Sendehalsband getragen hatte.3 Es ist schade, dass diese wissenschaftliche Technik so ausgenutzt wird; hilft sie doch, die Wanderbewegungen von Wölfen besser zu verstehen.
Doch trotz der schlechten Nachrichten ist der Wolf gleichzeitig ein Botschafter für den Optimismus im Umweltschutz. Es grenzt an ein Wunder, dass in einer so dicht besiedelten Region wie Mitteleuropa wilde Tiere dieser Größe zurückkehren können – auch und vor allem, weil die Bevölkerung dies nicht nur akzeptiert, sondern regelrecht wünscht. Das ist nicht nur ein Segen für alle Naturfreunde, sondern vor allem für die Natur selbst. Wir sind in weiten Teilen nämlich immer noch in einer ähnlichen Situation wie im Yellowstone-Gebiet. Riesige Bestände von Hirschen, Rehen und Wildschweinen ziehen hierzulande ihre Bahn, bisher meist unbehelligt von Wolf und Co. Und wie einst im amerikanischen Nationalpark werden sie immer noch massiv gefüttert. Strenge Winter können kaum noch eine Auslese betreiben, auch schwache Tiere überleben und pflanzen sich munter fort. Die Fütterung geschieht allerdings nicht durch Ranger, sondern durch Jäger. Sie karren tonnenweise Mais, Rüben und Heu in die Wälder, um stets ein gefülltes Warenlager an jagdbarer Beute zu haben.
Ebenso beteiligt ist die Forstwirtschaft. Durch die starke Nutzung der Wälder, durch den massiven Holzeinschlag kommt so viel Licht auf die Böden, dass überall Kräuter und Gräser sprießen. Das wirkt wie eine zusätzliche Fütterung und heizt die Vermehrung der Tiere noch weiter an. Mittlerweile sind die Wildbestände auf dem bis zu fünfzigfachen Niveau dessen, was einst in den Urwäldern zu finden war. Die riesigen Heerscharen fressen die meisten Baumsämlinge, sodass eine natürliche Waldentwicklung vielerorts nicht mehr stattfindet.
Schlecht für den Wald, gut für den Wolf. Der Rückkehrer trifft auf eine prall gefüllte Speisekammer, deren Bewohner völlig verlernt haben, angemessen auf eine solche Gefahr zu reagieren. Seit über 100 Jahren war ja nur noch der Mensch als Feind übrig geblieben. Menschen können schlecht laufen und schlecht hören, jedenfalls im Vergleich zu den meisten Waldtieren. Das Sehen jedoch ist ihre Domäne, zumindest bei Tageslicht. Daher haben unzählige Generationen von großen Säugetieren gelernt, dass es besser ist, sich tagsüber in Gebüschen zu verstecken und nur nachts herauszukommen. Eine Taktik, die so gut funktioniert, dass die meisten Menschen kaum glauben können, dass Deutschland auf die Fläche bezogen eines der wildreichsten Länder der Erde ist.
Und nun kommt der Wolf, der völlig anders jagt. Als Erstes erwischt es besonders »verweichlichte« Arten wie das Muffelschaf. Wissenschaftler streiten darüber, ob es überhaupt ein Wildtier ist oder nicht eher nur ein verwildertes Haustier. Es wurde schon vor Jahrhunderten auf Mittelmeerinseln ausgesetzt und kam dann auch in unsere Breiten. Der Grund: Seine großen schneckenförmig gedrehten Hörner gaben eine prächtige Jagdtrophäe ab, die sich neben Hirsch- und Rehgeweihen gut an der heimischen Kaminwand machte. Das Aussetzen der Tiere findet übrigens bis heute statt, wenn auch illegal (meist ist dann ein Gehegezaun »undicht« geworden).
Wie auch immer, Muffelschafe sind kein heimisches Wild, und dass sie von Haustieren abstammen könnten, bestätigt eine neue Entwicklung: Überall dort, wo Wölfe auftauchen, verschwinden sie, und zwar in deren Mägen. Das Flüchten haben sie anscheinend verlernt. Hinzu kommt ihre Anpassung an das Gebirge. Denn die Bergbewohner, hervorragende Kletterer, sind es gewohnt, ihren Verfolgern in steile Felswände zu entfliehen, wo die Wölfe chancenlos sind. In den Wäldern der Ebenen können sie diese Vorteile nicht ausspielen, und in Bezug auf die Schnelligkeit sind sie den Wölfen hoffnungslos unterlegen. So wird der natürliche Zustand wiederhergestellt, und der hat bei uns keine Schafe vorgesehen.
Als Nächstes sind Rehe und Hirsche dran. Nicht die Haustiere?, werden Sie sich wahrscheinlich verwundert fragen. Wenn das Muffelschaf schon so leicht zu erbeuten ist, was ist dann mit anderen Rassen, Ziegen oder Rinderkälbern? Sie stehen schließlich meist nur so schlecht eingezäunt herum, dass sie zwar nicht weglaufen, Wölfe jedoch bequem unter den Zäunen hindurchschlüpfen oder darüberspringen können. Anstatt in den Schlagzeilen der großen Boulevardblätter, die gern über vermeintliche Wolfsangriffe berichten, nach fragwürdigen Informationen zu suchen (dazu später mehr), sollten wir lieber Wissenschaftlern über die Schulter schauen. Sie erforschen die Exkremente der ostdeutschen Lausitz-Wölfe, denn dort befindet sich eines der dichtesten und ältesten Vorkommen der grauen Jäger.
Mitarbeiter des Senckenberg Museums für Naturkunde in Görlitz sammelten dazu Tausende Kotproben ein und kamen zu folgendem Ergebnis: Nicht Schafe oder Ziegen, sondern Rehe stellen mit über 50 Prozent der Gesamtmasse den Löwenanteil der Nahrung. Hirsche und Wildschweine kommen zusammen auf rund 40 Prozent, und nein, jetzt kommen immer noch keine Haustiere, sondern Hasen und ähnliche kleinere Säuger mit rund vier Prozent. Der Damhirsch, der sich mit zwei Prozent in der Losung nachweisen lässt, ist wie das Mufflon ein aus jagdlichen Gründen ausgesetzter Exot, den die Wölfe gerne in die ewigen Jagdgründe schicken. Erst jetzt reihen sich ein paar vereinzelte Haustiere in das Beutespektrum und bereichern die Statistik mit 0,75 Prozent.4
Im Blätterwald der Boulevardpresse hingegen sieht die Sache ganz anders aus. Hier dominieren Meldungen über Haustierrisse, und jeder einzelne ist eine Schlagzeile wert. Noch vor Veröffentlichung der genetischen Untersuchungen, ob es sich bei dem Übeltäter tatsächlich um einen Wolf und nicht vielleicht doch um einen wildernden Hund gehandelt hat, wird die Nachricht unters Volk gebracht. Stellt sich dann heraus, dass es doch ein anderer Beutegreifer war, erfolgt eine Richtigstellung meist nur noch als Randnotiz. Die Öffentlichkeit bekommt so den Eindruck, als ob jede Ziege und jedes Schaf von nun an in Todesgefahr schwebe.
Dabei müsste das gar nicht sein. Denn der Wolf lässt sich relativ einfach von den geliebten Nutztieren fernhalten. In den meisten Fällen reicht dafür ein einfacher Elektrozaun aus, den viele Halter ohnehin zur Einzäunung verwenden. Dieser Zaun ist wie ein grobmaschiges Netz konstruiert, in dessen Schnüre dünne Metallfäden eingedreht sind. Sie leiten den Strom eines angeschlossenen Weidezaungeräts.
Bei uns zu Hause haben wir die Weide unserer Ziegen ebenfalls auf diese Art eingezäunt, und schon so manches Mal habe ich vergessen, beim Betreten den Strom abzustellen. Autsch! Der Schlag wirkt, als würde man mit einem Brett auf dem Rücken getroffen. In den Tagen nach einem solchen Missgeschick schaue ich lieber einmal zu viel, ob denn auch wirklich kein Saft auf der Leitung ist.
Wölfen ergeht es da noch viel schlimmer, denn sie stoßen ja mit Nase oder Ohren gegen dieses Hindernis. Bevor sie sich noch einmal solchen Schmerzen aussetzen, greifen sie künftig lieber zu Reh- oder Wildschweinbraten. Wichtig ist nur, dass der Zaun ausreichend hoch ist und einwandfrei funktioniert. Manche Experten halten 90 Zentimeter Höhe für ausreichend, wir gehen lieber auf Nummer sicher und haben die Variante mit 120 Zentimeter im Einsatz.
Elli Radinger, »meine« Wolfsforscherin, erzählte mir, dass Rudel ihr Beutespektrum ändern können, wenn ältere Tiere herausgeschossen werden. Statt wie bisher Wildschweine, Rehe oder Hirsche zu jagen, werden nun eher Schafe und andere Haustiere ins Visier genommen. Wolfshasser, die Übergriffe auf das Vieh verhindern möchten, sollten also lieber das Gewehr im Schrank stehen lassen.
Neben all diesen Fakten können Wölfe aber auch noch etwas anderes bewirken: Sie würzen jedes Walderlebnis auf ganz besondere Weise. Ich weiß noch, wie glücklich und aufgeregt ich war, als ich eines Tages eine Wolfsspur fand. Nein, nicht hier in Hümmel, wo ich mit meiner Familie lebe, sondern in Mittelschweden auf einem einsamen Waldweg. Allein diese Spur machte den Gang durch den Wald zu einem Abenteuer, ließ den Wald selbst ein bisschen wilder erscheinen. Und genau diese Empfindung teile ich wohl mit vielen anderen Menschen: Der Wolf gibt dem Wald seine wilde Seele zurück. Er ist ein Zeichen dafür, dass es selbst in dichter besiedelten Erdteilen möglich ist, größere ausgestorbene Tierarten wieder zurückkehren zu lassen. Und im Gegensatz zum Yellowstone-Nationalpark kehren die Wölfe bei uns tatsächlich von selbst zurück. Sie wanderten aus Polen ein und breiten sich langsam über ein Bundesland nach dem anderen aus.
Müssen wir nun bei jedem Waldspaziergang Angst haben? In den Zeitungen häufen sich die Berichte von verhaltensauffälligen Wölfen. Nicht, dass sie irgendeinem Menschen etwas getan hätten, doch allein die Nähe zu Dörfern oder gar Kindergärten lässt so manchem das Blut in den Adern gefrieren. Gewiss, es sind wilde Tiere, die sich nicht zum Streicheln und Kuscheln eignen. Doch wenn man sie nicht absichtlich an uns gewöhnt, hält sich das Risiko in Grenzen.
Leider lassen sich jedoch offenbar immer einige Mitbürger dazu verleiten, Wölfe anzufüttern. So geschehen möglicherweise auch bei den Wölfen Kurti und Pumpak, die immer wieder Siedlungen in der Nähe von Munster beziehungsweise in der Lausitz aufsuchten. Die Konsequenz: Beide Tiere wurden zum Abschuss freigegeben, ohne dass irgendetwas Gefährliches vorgefallen wäre. Ein Fehlverhalten kann hier also nicht den Tieren unterstellt werden, sondern ist eher bei den fütternden Menschen zu sehen.
Überhaupt sollte man das Ganze einmal aus einer anderen Warte betrachten. Wie gefährlich kann es tatsächlich werden, wenn nicht ein paar Hundert, sondern irgendwann ein paar Tausend Wölfe durch unsere Wälder ziehen?
Streng genommen haben wir diese Situation schon seit Langem, und zwar in verschärfter Gangart. Denn nicht nur in der freien Landschaft, sondern auch in unseren Städten wimmelt es nur so von Wölfen. Es sind unsere Haushunde, die sich von ihren Urahnen ganz wesentlich in einem Punkt unterscheiden: Sie haben keine Angst mehr vor uns. Wenn ich die Wahl hätte, einem herumstreunenden Schäferhund oder einem Wolf zu begegnen, ich würde mich für das Wildtier entscheiden. Denn Letzteres ist im Zweifelsfall nur neugierig und verschwindet wieder, wenn es weiß, wem es da begegnet ist. Wir gehören nun mal nicht zum Beutespektrum von Wölfen.
Und so wundert es nicht, dass nur Hunde unangenehm auffallen. Nach Aussagen von Olaf Tschimpke, Präsident der Naturschutzorganisation NABU, werden jährlich Zehntausende Beißattacken registriert, von denen einige so schwer sind, dass sie bei ihrem Opfer zum Tode führen.5 Stellen Sie sich vor, nur ein Bruchteil davon würde von Wölfen verursacht – mit Sicherheit würde von irgendeiner Seite gefordert, alle Tiere abzuschießen.
Im Moment sind es aber eher die Wildschweine, die für Schlagzeilen sorgen. So etwa mitten in Berlin, wo Bachen unbekümmert den Rasen umpflügen, während die Besitzer in einigen Metern Entfernung ängstlich versuchen, die Tiere durch lautes Rufen und wildes Klatschen zu vertreiben. Verwüstete Tulpenbeete, leer gefressene Weinberge oder Maisfelder – die Schweine sorgen vielerorts für Ertragseinbußen und Ärger. Die Population der Borstentiere zeigt seit vielen Jahren nur in eine Richtung: steil nach oben. Wildschweine haben bei uns keine natürlichen Feinde oder, besser gesagt: hatten. Denn mit den Wölfen ist nun erstmals wieder ein ernst zu nehmender Gegenspieler aufgetaucht.
Als ich vor Jahren einmal in einem ehemaligen Braunkohletagebau Brandenburgs unterwegs war, stieß ich dort auf Wolfslosung. Sie bestand aus weißen Knochenresten und dicken schwarzen Haaren – eindeutig von einem Wildschwein. Erst da wurde mir klar, wie hart das Leben von Wölfen ist. Jedes Mal, wenn sie ihren Hunger stillen möchten, müssen sie sich in große Gefahr begeben.
Ich kann mich in diesem Zusammenhang an Treibjagden erinnern, an denen ich als Treiber teilgenommen hatte. In einem Dickicht stöberten die Hunde Wildschweine auf und verfolgten diese sofort. Von fünf Hunden kamen abends nur drei zurück, die anderen beiden sind wahrscheinlich beim Kampf mit den Schweinen ums Leben gekommen. Viele Hundeführer, die ihre Meute einsetzen, bestehen darauf, dass der örtliche Tierarzt informiert und erreichbar ist. Abends nach getaner Arbeit flickt so mancher Hundeführer die Wunden seiner Tiere schnell selbst mit Nadel und Faden, Wunden, die von den scharfen Eckzähnen der Wildschweine stammen.
Für Wölfe allerdings können selbst weniger schwerwiegende Verletzungen lebensgefährlich sein, denn nur mit Einschränkungen jagen zu können reicht in ihrem Fall aus, um zu verhungern. Es ist wirklich bewundernswert, wie die grauen Jäger all diese Gefahren im Laufe ihres über zehnjährigen Lebens Tag für Tag meistern.
Bevor wir das Thema Wölfe abschließen, möchte ich noch einmal in den Yellowstone-Nationalpark zurückkehren, denn dort war noch eine weitere Veränderung zu beobachten. Schon wieder Yellowstone? Es könnte auch jedes x-beliebige andere Fleckchen auf unserer Erde sein, das von Pflanzenwuchs bedeckt ist und einen reichen Tierbestand enthält, also auch Mitteleuropa. Die einzige Bedingung ist, dass dort auf ausreichend großer Fläche – und das bedeutet in diesem Fall mehrere Tausend Quadratkilometer – keinerlei Manipulation durch den Menschen mehr erfolgt. Das gibt es in unseren Breiten aber leider nicht.
Und die Nationalparks? Wird da nicht ein Gebiet nach dem anderen als ein solcher ausgewiesen? Stimmt, doch diese Reservate sind im Maßstab der Natur gemessen winzig klein. Nicht ein einziges Wolfsrudel hätte in den meisten dieser Schutzgebiete eine ausreichende Lebensbasis, sodass natürliche Abläufe kaum zu studieren sind. Hinzu kommt, dass auch hier leider immer noch massive Eingriffe stattfinden. So werden etwa in einigen der deutschen Nationalparks die größten Kahlschläge durchgeführt, deutlich größer als im normalen Wirtschaftswald. »Entwicklungszonen« nennen dies die Verantwortlichen, und selbst wenn dies in bester Absicht passiert, so wird der Natur dadurch immer wieder ins Handwerk gepfuscht.
Überraschungen aber kann man nur erleben, wenn man sich einfach zurücklehnt und den Dingen ihren Lauf lässt. Oder aber nur hier und da ausgerotteten Arten behutsam bei der Wiederansiedlung behilflich ist beziehungsweise fremde, ausgesetzte Arten bei der Abreise unterstützt. Solange das hier nicht der Fall ist, müssen wir uns für derartige Erfolgsgeschichten in anderen Erdteilen umsehen, wie etwa im ersten amerikanischen Nationalpark.
Diesmal sind es Fische, die im Fokus stehen, genauer gesagt, Angehörige der Spezies Amerikanische Seeforelle. Sie sind in den USA und Kanada zu Hause (zum Beispiel in den Großen Seen), wo ihre Bestände schon stark geschrumpft und gefährdet sind. Mittlerweile gibt es aufwendige Zuchtprogramme, um die Wildpopulation zu unterstützen. Allerdings ist die Lage nicht überall bedrohlich für diese Wasserbewohner, nein, andernorts werden sie selbst zur Gefahr. Ob es Angler waren, die das Spektrum vor Ort erweitern wollten, oder Menschen, die Naturschutz falsch verstehen, ist nicht bekannt, doch vor knapp 30 Jahren tauchten die Fische plötzlich im Yellowstone-See auf.
Das wäre grundsätzlich kein Problem, wenn dieses Ökosystem nicht schon von einem anderen Verwandten besetzt gewesen wäre: der Cutthroat-Forelle. Ihr Name rührt von dem blutrot gefärbten Unterkiefer her, doch im übertragenen Sinne geht es ihr tatsächlich an den Kragen. Die Neuankömmlinge machten ihr den Lebensraum streitig und verdrängten den kleineren Hausherrn – und das macht nicht nur diesem zu schaffen. Erstaunlicherweise leiden seit einigen Jahren auch die Hirsche des Parks unter diesem Verdrängungswettbewerb.
Doch was haben Hirsche, also reine Pflanzenfresser, mit Fischen zu tun? Wieder einmal ist es ein Zwischenschritt, der die Lösung des Rätsels bildet, in diesem Falle handelt es sich dabei um die Braunbären. Sie lieben Cutthroat-Forellen, die jedoch inzwischen rar geworden sind. Die Fische laichen in kleinen Bächen und sind dann für ihre Jäger leicht zu erbeuten. Ganz anders verhalten sich die Invasoren: Sie pfeifen auf die kristallklaren Zuflüsse und legen ihre Eier einfach auf dem Seeboden ab – hier kommt kein Grizzly an die erschöpften Elterntiere heran. Die Folge: Meister Petz muss sich mit knurrendem Magen nach einer anderen Beute umsehen. Die ist etwas schwerer zu jagen und wartet an Land. Es sind die Kälber der Hirsche, die nun ins Visier geraten und zunehmend häufiger ihr Leben unter einer krallenbewehrten Tatze aushauchen. So häufig, dass der Hirschbestand merklich zurückgeht.6
Ist das nun ein Grund zum Jubeln? War es nicht so, dass wir aus genau diesem Grund die Rückkehr der Wölfe begrüßen? Sie machen schließlich nichts anderes und senken auf ihre Art den ausgeuferten Bestand ab. Aber ganz so einfach ist die Sache auch in diesem Fall nicht. Während Wölfe auch ältere Tiere jagen, greifen sich Bären verstärkt den Nachwuchs heraus, was die Altersstruktur in den Rudeln stark verändert. Anders gesagt: Die Bestände vergreisen, was das Absinken zusätzlich beschleunigt. Gut für die Bäume, schlecht für die Hirsche.
Der Fall zeigt noch einmal ganz deutlich: Ökosysteme sind überaus vielschichtig, und Veränderungen betreffen niemals nur einzelne Arten. Ist es vielleicht so, dass der Wolf gar nicht den größten Einfluss hat, sondern das Duo Seeforelle/Bär? Die große Uhr hat doch mehr Zahnräder, als bis heute bekannt sind.
Aber apropos Fische: Sie greifen in einer Art und Weise ins Räderwerk der Wälder ein, dass sie ein eigenes Kapitel verdient haben.
Wie Lachse in die Bäume wandern
Wie kompliziert Ökosysteme sein können, zeigt das Verhältnis von Bäumen und Fischen. Speziell in Gebieten, in denen die Böden sehr nährstoffarm sind, ist das Baumwachstum regelrecht abhängig von den flinken Wasserbewohnern.
Fische sind ein wichtiger Faktor in Gewässern, wenn es darum geht, Nährstoffe zu verteilen. Lachse etwa wandern in ihrer Jugend ins Meer und bleiben dort erst einmal zwei bis vier Jahre. Hier jagen und leben sie, vor allem aber legen sie ordentlich an Größe und Gewicht zu.
An der nordamerikanischen Pazifikküste sind mehrere Lachsarten verbreitet, von denen der Königslachs der größte ist. Er bringt es nach seinen Jugendjahren im Meer auf bis zu 1,5 Meter Länge und bis zu 30 Kilogramm Gewicht. Und es ist nicht nur Muskelfleisch, was er sich in den Weiten der Meere antrainiert und angefressen hat, sondern auch jede Menge Fett. Das brauchen die Tiere für die anstrengende Heimreise in die Flüsse, in denen sie einst geboren wurden. Mühsam kämpfen sie sich gegen die Strömung in Richtung Quelle, teils über viele Hundert Kilometer und etliche Wasserfälle hinweg. In ihren Körpern bringen sie in konzentrierter Form Stickstoff- und Phosphorverbindungen mit, doch dies interessiert die Fische nicht. Sie quälen sich bergauf, weil sie dort in einem ersten – und letzten – Liebesrausch Nachwuchs zeugen und anschließend ihr Leben aushauchen. Während der Reise verändert sich die Farbe der einst metallischsilbernen Haut teilweise ins Rötliche, und die Lachse verlieren Gewicht, denn sie fressen nichts mehr. Daher nimmt ihr Fettgehalt kontinuierlich ab. Mit letzter Kraft wird in den Quellgewässern der Liebesakt vollzogen, bevor die Tiere erschöpft sterben.
Für den Wald und seine Bewohner bedeutet die Fischwanderung Erntezeit. Und die Erntehelfer reihen sich dann hungrig entlang der Ufer auf: Es sind Bären, an der Pazifikküste des amerikanischen Nordens Grizzly- und Schwarzbären. Sie fischen an den Stromschnellen nach den stromaufwärts schwimmenden Lachsen und fressen sich mit ihrer Hilfe einen dicken Winterspeck an. Je nach Standort und Wanderzeit der Fische sind diese jedoch schon ein wenig abgemagert, wenn sie gefangen werden. Anfangs fressen die Bären noch viel von ihrem Fang, später jedoch werden sie wählerischer. Fettarme Lachse, die schon erschöpft sind und daher weniger Kalorien enthalten, werden zwar gefangen, aber kaum noch gefressen. Und das ist die Chance für viele andere Tierarten, nun ebenfalls etwas in den Magen zu bekommen. Nerze, Füchse, Greifvögel und eine Unzahl an Insekten machen sich über die oft nur angefressenen Fischkadaver her und verschleppen sie weiter ins Hinterland.
Nach der Mahlzeit bleiben einige Teile der Lachse (wie Gräten oder Köpfe) übrig und düngen den Boden direkt; viel Stickstoff wird auch über den Kot der Tiere abgegeben, den diese nach dem üppigen Festmahl wieder ausscheiden. Und es ist eine Menge Stickstoff, der da in den Wäldern entlang der Flüsse verteilt wird. Die Wissenschaftler Scott M. Gende und Thomas P. Quinn berichten in der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft, dass gemäß feinmolekularer Analysen bis zu 70 Prozent des Stickstoffs in der ufernahen Vegetation aus dem Meer, also von den Lachsen stammen. Das beschleunigt ihren Angaben zufolge das Baumwachstum so sehr, dass Sitka-Fichten in diesen Bereichen bis zu dreimal schneller wachsen als ohne den Fischdünger.7 In manchen Bäumen gehen mehr als 80 Prozent des enthaltenen Stickstoffs auf Fische zurück. Woher man das so genau weiß? Schlüssel ist das Stickstoff-Isotop 15N, welches in diesen Breiten fast ausschließlich in Meeren zu finden ist – oder in Fischen. Hinweise in Pflanzen auf solche Moleküle lassen daher immer direkte Rückschlüsse auf die Herkunft des Stickstoffs zu, in diesem Fall auf den Lachs.
Es ist jedoch nicht so, dass all die begehrten Nährstoffe an Land bleiben. Irgendwann ist alles gefressen und verdaut, die Ausscheidungen sind auf dem Boden gelandet, in den sie schließlich einsickern. Hier warten schon die Bäume mit ihren Wurzeln und saugen sie gierig auf. Unterstützung erhalten sie dabei von den Pilzen, die sich wie feine Watte um die zarten Ausläufer legen und so helfen, ein Vielfaches der Nährstoffe nach oben zu fördern. Das Laub der Bäume fällt irgendwann zu Boden, die Stämme verrotten nach dem Tod der Urwaldriesen. Nachdem eine Armada aus Kleinstlebewesen alles fein säuberlich zerlegt hat, gehen die Nährstoffe an die nächsten Bäume, die das frei werdende Lebenselixier ihrerseits aus dem Boden ziehen. Doch nicht alles bleibt in diesem feinmaschigen Netz hängen, ein Teil wird vom Wasser unweigerlich in die Flüsse und von dort ins Meer gespült. Und dort warten schon unzählige Kleinstlebewesen auf die nährstoffhaltige Fracht.