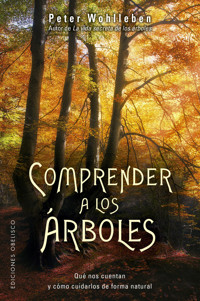19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Erinnerungen einer Buche
Über 200 Jahre ist sie alt, jetzt blickt sie dem Ende ihres Lebens entgegen: eine alte Buche, zu deren Füßen ihre Sämlinge umsorgt und geschützt heranwachsen. Doch alles wird sich ändern, wenn die Buche stirbt. Wie kann sie die kleinen Bäume auf eine Zukunft vorbereiten, in der sie auf sich gestellt sind und in der nur überlebt, wer die Gesetze der Natur versteht? So beginnt sie zu erzählen, von ihrem fesselnden Leben voller Lebenslust und Neugier, Gefahr und Verlust …
In diesem einzigartigen Roman – dem ersten seiner Art – inszeniert Peter Wohlleben die spannende und berührende Geschichte einer Buche, die unseren Blick auf die Natur für immer verändern wird.
Dieses Buch ist auch in einer Sonderedition mit veredeltem Umschlag erhältlich
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Was würden uns Bäume erzählen, wenn sie sprechen könnten? Fast zehn Jahre nach Erscheinen von Das geheime Leben der Bäume hat die Forschung so viel neues Wissen erschlossen, dass es an der Zeit ist, die Bäume selbst zu Wort kommen zu lassen. Dazu leiht ihnen Deutschlands berühmtester Förster seine Stimme: Erstmals lässt er eine 250 Jahre alte Buche berichten, was ihr im Laufe der Zeit – vom Samen bis zum Giganten des Waldes – widerfährt, welche Gefahren ihr im Laufe ihres Daseins begegnen, wie sich »Familie« für sie anfühlt und wie das Leben und Überleben im Wald genau funktionieren. Und wir erfahren Unglaubliches, durch neueste wissenschaftliche Forschungen Bestätigtes: Bäume verständigen sich u. a. durch Klicklaute miteinander, sie können also hören! Und nicht nur das: Sie verfügen auch über ein Sehvermögen und können sich sogar erinnern und Erfahrungen an ihren Nachwuchs weitergeben!
Basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft, gelingt es Peter Wohlleben, in dieser eindrücklichen »Autobiografie« einer Buche das faszinierende Leben und die überaus facettenreiche Biologie der Bäume einem naturliebenden Publikum auf unterhaltsame und originelle Weise näherzubringen – so nah wie nur irgend möglich.
PETER WOHLLEBEN
Buchenleben
Ein Baum erzählt seine Geschichte
Mit diesem Buch wird das Buchen-UrwaldProjekt von Wohllebens WALDAKADEMIE in der Eifel unterstützt. Von Natur aus wäre Deutschland zu über 90 Prozent von Wald bedeckt, der größte Teil davon Buchen- oder Buche/Eichen-Mischwälder. Alte Buchenwälder sind die Regenwälder Europas, und ähnlich wie in den Tropen ist es auch um sie sehr schlecht bestellt. Buchenwälder ab Alter 180 haben nur noch einen Anteil von 0,16 Prozent an der Landfläche. Die Buchenwälder des UrwaldProjekts werden konsequent geschützt und für kommende Generationen erhalten. In dem Wald-Schutzgebiet in der Eifel wird auf natürliche Weise CO2 in alten Wäldern gespeichert und somit das Klima entlastet. Gleichzeitig übernimmt das Projekt auch eine wichtige Rolle im Erhalt der Biodiversität.
Durch das Einscannen dieses QR-Codes gelangen Sie auf die Website von Wohllebens WALDAKADEMIE und können den Buchen-Urwald, den Sie mit dem Kauf dieses Buches schützen helfen, live erleben.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Sonderedition mit neuem Umschlag 2024
Copyright © 2024 by Ludwig Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angelika Lieke
Illustrationen: Mascha Greune
Layout: Eisele Graphik-Design, München
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, unter Verwendung der Motive von © Shutterstock
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28748-1V004
www.Ludwig-Verlag.de
INHALT
Vorwort
TEIL I Die Buche erzählt
1. Es ist an der Zeit
2. Das Licht der Welt
3. Die mächtige Mutter
4. Die alte Lehrerin
5. Nachrichten aus dem Wald
6. Der lange Schlaf
7. Eine bittere Lektion
8. Die Lichtung
9. Gefährliche Wunden
10. Die Stachligen kommen
11. Die sonderbaren Zweibeiner
12. Endlich erwachsen
13. Das Wunder der Liebe
14. Wie man die Wühler auf Abstand hält
15. Das süße Blut
16. Die Zweibeiner bleiben
17. Löcher in der Haut
18. Eine fatale Chance
19. Der Friedhof
20. Ein Unglück kündigt sich an
21. Wie man Regen herbeiruft
22. Die große Dürre
23. Tante Buckel
24. Ein hartes Urteil
25. Der große Schmerz
26. Ein merkwürdiges Geschenk
27. Eine neue Sprache
28. In der Welt der Erhabenen
29. Unerwartete Hilfe
30. Die Welt wird größer
31. Gute Nachbarinnen
32. Die Große Vermittlerin
33. Das Ende der Geschichte
TEILIIWissenschaftlicher Hintergrund
Das Setting
Die Baumanatomie
Das Ende des Automaten-Zeitalters
Zu Kapitel 1: »Es ist an der Zeit …«
Zu Kapitel 2: »Das Licht der Welt«
Zu Kapitel 3: »Die mächtige Mutter«
Zu Kapitel 4: »Die alte Lehrerin«
Zu Kapitel 5: »Nachrichten aus dem Wald«
Zu Kapitel 6: »Der lange Schlaf«
Zu Kapitel 7: »Eine bittere Lektion«
Zu Kapitel 8: »Die Lichtung«
Zu Kapitel 9: »Gefährliche Wunden«
Zu Kapitel 10: »Die Stachligen kommen«
Zu Kapitel 11: »Die sonderbaren Zweibeiner«
Zu Kapitel 12: »Endlich erwachsen«
Zu Kapitel 13: »Das Wunder der Liebe«
Zu Kapitel 14: »Wie man die Wühler auf Abstand hält«
Zu Kapitel 15: »Das süße Blut«
Zu Kapitel 16: »Die Zweibeiner bleiben«
Zu Kapitel 17: »Löcher in der Haut«
Zu Kapitel 18: »Eine fatale Chance«
Zu Kapitel 19: »Der Friedhof«
Zu Kapitel 20: »Ein Unglück kündigt sich an«
Zu Kapitel 21: »Wie man Regen herbeiruft«
Zu Kapitel 22: »Die große Dürre«
Zu Kapitel 23: »Tante Buckel«
Zu Kapitel 24: »Ein hartes Urteil«
Zu Kapitel 25: »Der große Schmerz«
Zu Kapitel 26: »Ein merkwürdiges Geschenk«
Zu Kapitel 27: »Eine neue Sprache«
Zu Kapitel 28: »In der Welt der Erhabenen«
Zu Kapitel 29: »Unerwartete Hilfe«
Zu Kapitel 30: »Die Welt wird größer«
Zu Kapitel 31: »Gute Nachbarinnen«
Zu Kapitel 32: »Die Große Vermittlerin«
Zu Kapitel 33: »Das Ende der Geschichte«
Dank
Anmerkungen
Bildnachweis
VORWORT
Manchmal werde ich gefragt, ob ich mir nicht wünschen würde, eines Tages mit Bäumen sprechen zu können. »Nein«, antworte ich dann, »mir würde es reichen, wenn ich zuhören könnte!«
Wäre es nicht faszinierend zu erfahren, wie sich die Welt aus Sicht dieser Giganten darstellt? Diese Welt unterscheidet sich nämlich stark von unserer, angefangen beim Standort, der sich das ganze Leben lang nicht verändert, über den Körperbau (das Hirn steckt quasi im Boden) bis hin zur Geschwindigkeit – Bäume sind rund 1000-mal langsamer als wir. Dennoch gibt es auch zahlreiche Ähnlichkeiten: Manche Baumarten wie die Buche sind überaus soziale Wesen, sie kümmern sich um ihren Nachwuchs und wachsen gerne in Familienverbänden. Auch die Alten werden versorgt, und gemeinsam wird vieles geschafft, was einen einzelnen Baum überfordern würde. So verändert eine Waldgemeinschaft etwa aktiv das Lokalklima gegen den globalen Trend, indem die Luft gekühlt und Wolken produziert werden (was wir Menschen trotz aller Bemühungen noch nicht hinbekommen haben – im Gegenteil: Wir heizen stattdessen die Atmosphäre auf). Es wird fleißig kommuniziert, nicht nur untereinander, sondern sogar mit Tieren.
Vieles ist inzwischen über die Wälder bekannt, und dass sie eine maßgebliche Rolle zur Milderung der Klima- und Umweltkrise spielen, ist den meisten Menschen wohl klar. Dennoch geht es überall auf der Welt alten Wäldern weiter an den Kragen, und viel zu wenig wird dagegen unternommen. Daher ist der Schutz alter Bäume genau so dringlich wie etwa der Schutz der Wale. Beide Giganten erzeugen Mitgefühl, doch Wale sind uns evolutionär deutlich näher und dadurch besser zu verstehen. Deshalb wurden sie schon viel früher konsequent geschützt, indem seit den 1980er-Jahren bis auf wenige Ausnahmen die Jagd auf die sympathischen Meeressäuger eingestellt wurde. Gleiches wünsche ich mir auch für alte Wälder, speziell für alte Bäume, und deswegen möchte ich ihnen an dieser Stelle eine Stimme geben. Wer wäre für diesen Versuch besser geeignet als eine alte Buche, die uns aus ihrem Leben erzählt? Und was wäre, wenn diese Lebensgeschichte auch noch der Wahrheit entsprechen würde?
Schon lange habe ich den Wunsch gehegt, eine solche Geschichte zu Papier zu bringen. Es war ein ziemlicher Spagat, denn ich wollte keine Märchen erzählen, sondern lediglich die Perspektive wechseln und von all den wunderbaren Fakten, die es zu diesen Wesen gibt, so berichten, wie es ein Baum aus heutiger Sicht vielleicht tun würde. Aber natürlich spricht eine Buche keine menschliche Sprache und viele Begriffe kämen einem Baum sicher niemals in den Sinn. Deshalb fasse ich mein Anliegen noch etwas präziser: Ich möchte ein Ghostwriter für die alte Buche sein, der das bäumische Wesen in menschliche Sprache übersetzt und dabei doch, soweit es möglich ist, auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Wissenslücken habe ich fiktional so geschlossen, dass sie zum bisher Bekannten passen. Die Fülle der wissenschaftlichen Entdeckungen ist jedoch so unglaublich, dass Sie sich vielleicht schon nach den ersten Seiten verwundert die Augen reiben und mich vom eben skizzierten Pfad abgekommen wähnen. Deshalb habe ich im Anschluss an die Erzählung zu jedem Kapitel die wissenschaftlichen Grundlagen einschließlich der Quellen zusammengefasst. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, bei Interesse tiefer in die jeweilige Thematik einzusteigen. Auch die Lücken und der Stand der wissenschaftlichen Diskussion werden ausführlich beleuchtet.
Die Buche, deren Leben hier ausgebreitet wird, gibt es übrigens tatsächlich: Sie steht in einem Waldreservat hinter unserem Forsthaus, wo ich sie seit 1991 fast täglich besuche. Dort wächst sie schon seit über 200 Jahren, und ihr Leben war keinesfalls langweilig, obwohl sie stets auf demselben Fleck blieb: Sie schloss Freundschaften, durchlebte Gefahren, erfuhr durch ein ausgeklügeltes Nachrichtensystem von Ereignissen aus entlegenen Waldgebieten und wird inzwischen zunehmend mit den Veränderungen ihres Lebensraums durch uns Menschen konfrontiert.
Lassen Sie sich verzaubern von einem der faszinierendsten Wesen unseres Planeten, und begleiten Sie es über Jahrhunderte hinweg auf seinem Weg bis in die heutige Zeit.
TEIL I
DIE BUCHE ERZÄHLT
KAPITEL 1
ES IST AN DER ZEIT …
Es ist an der Zeit, meine Kleinen, euch auf den Abschied vorzubereiten. Ich habe jetzt mehr als zweihundert Sommer erlebt, und meine Knochen schmerzen. Pilze sind über eine Wunde in mich eingedrungen und beginnen, mich von innen aufzufressen. Diese weiße Fäule ist nicht mehr aufzuhalten. Schaut auf meine rissige Haut – daran sitzen schon die Halbmonde, die das letzte Stadium dieser Krankheit verkünden. Es ist nur noch eine Frage weniger Mondumläufe, bis meine Äste abbrechen und ich blattlos endgültig verhungere. Die Spechte schlagen respektlos große Löcher in meine Knochen, um die Würmer zu finden, die leise raspelnd mein Inneres zu Staub verwandeln.
Aber ich gräme mich nicht. Ich hatte ein schönes Leben und freue mich, dass ihr nun, da ich weichen werde, schneller wachsen könnt. Sobald ich keinen Schatten mehr werfe, wird das große Wettrennen um das Licht starten. Seid vorbereitet! Ihr wisst, dass viele andere Jugendliche ebenfalls diese Chance nutzen wollen. Haltet als Geschwister weiter so gut zusammen wie bisher, denn es gibt durchaus Nachwuchs anderer grüner Riesinnen, der sehr nahe bei euch steht und mir ein wenig Sorge bereitet.
Gerade die Kleine mit den schmalen dunkelgrünen Blättern zwischen euch hat sich von Jahr zu Jahr unauffällig ein wenig breiter gemacht. Ihre Zweige nehmen mehr Licht, als ihr zusteht, und sobald es am Waldboden noch heller wird, kann sie durchstarten. Wenn ihr aufpasst, euer Netzwerk nutzt, eure Tanten einbindet, auf dass sie euch mit einer Extraportion Zucker helfen, dann kann es gelingen!
Doch noch bleibt mir ein wenig Zeit, und die will ich so nutzen, wie es meine Mutter damals tat, als sie Abschied nehmen musste. Ich habe euch all die Weisheit mitgegeben, die ich von meinen Ahninnen erhalten habe. Diese Weisheit und all meine Erfahrung stecken von Geburt an in euch, auch wenn ihr davon vielleicht noch nichts bemerkt habt.
Damit ihr euch aber rechtzeitig erinnern könnt, falls es einmal notwendig werden sollte, will ich euch jetzt noch einmal die ganze Geschichte erzählen.
KAPITEL 2
DAS LICHT DER WELT
An die ersten Tage meines Lebens kann ich mich noch recht gut erinnern. Am Anfang war alles schwarz. Ein weiches, wohliges Schwarz, angenehm feucht, durch das ich mich mit der Spitze meiner frisch geschlüpften Wurzel hindurchtastete. Es hätte gemütlich sein können, wenn es nicht so laut gewesen wäre! Heute weiß ich, dass die Geräusche von Wasser, vor allem aber von den vielen winzigen Wuslern im Boden herrühren, die dort jeden Krümel bevölkern und rastlos mit hoher Geschwindigkeit alles fressen, dann wieder ausscheiden, umbauen, mit Schleim überziehen oder auch Wurzeln von kleinen Baumkindern attackieren. Es raspelte, schmatzte, klickte, schleifte oder grummelte aus allen Richtungen.
Laut war es also, und in dem ganzen Gedränge und Gewusel schob ich meine kleine Wurzel neugierig in die Tiefe. Dabei fing ich zu meiner Überraschung selbst an, Klicklaute mit meinen Spitzen auszustoßen. Gleichzeitig reckte und streckte ich mich, fühlte mich vor allem oben eingeengt, doch mit aller Kraft drückte ich den Trieb mit den ersten Blättchen hoch. Plötzlich gab die letzte Schicht nach, und es wurde gleißend hell. Das erschreckte mich, und am liebsten hätte ich mich sofort wieder in den Boden verkrochen. Doch sosehr ich mich auch mühte, es gelang mir nicht, den Trieb wieder umzudrehen. Das findet ihr sicher komisch, denn es ist ja selbstverständlich, dass wir unsere oberirdischen Organe nicht in die Erde wachsen lassen können, doch damals wollte ich im ersten Moment nur dem starken Licht des Frühlings entfliehen. Es dauerte ein, zwei Sonnenläufe, bis sich meine Augen in den Blättchen an den grellen Schein gewöhnt hatten.
Noch bevor ich mich von dem Schreck erholt hatte und mich ein wenig umsehen konnte, schmeckte ich – Zucker! Er durchströmte meine Adern von den Blättchen bis hinab in die zartesten Wurzelspitzen, und erst jetzt merkte ich, wie hungrig ich die ganze Zeit gewesen war. Während die Sonne hinter den großen, noch laublosen Bäumen nach oben stieg, wurde der süße Strom in meinen Adern zunehmend stärker, bis sie ihren Bogen am Himmel schließlich vollendet hatte und hinter dem benachbarten Hügel wieder verschwand. Mit der Dämmerung endete der nahrhafte Fluss, und ich erkannte, dass Licht auf den Blättern den Hunger stillt. Wenig später überkam mich große Müdigkeit, und ein tiefer Schlaf folgte, aus dem mich erst der Tagesanbruch wieder erwachen ließ.
Nachdem sich meine Augen an die Helligkeit des Tages gewöhnt hatten, bemerkte ich, dass ich nicht allein war. Hunderte, wenn nicht Tausende winziger Bäumchen überzogen den Waldboden, auch direkt neben mir. Manche reckten schon ihre kleinen Blätter ins Licht, andere entfalteten sich gerade oder krochen gar erst aus der Hülle. Durch den Waldboden flutete mich ein Geschmack an. Es war der Geschmack von – Familie? Ja, Familie! Das war mein erstes und zugleich wichtigstes Wort, das ich mit den Wurzelspitzen einsog.
Gleich stimmte ich in den Aromachor ein und verströmte ebenfalls ein unterirdisches »Familie!«. Nun wurde mir auch klar, woher die anderen unterirdischen Klicks kamen – von den Wurzelspitzen meiner Geschwister! So kamen wir uns nicht gegenseitig ins Gehege und konnten uns in der Tiefe tummeln, ohne uns den Platz streitig zu machen. Das Hochgefühl hielt ein paar Tage an, in denen die Schar immer größer wurde. Manche brauchten doch recht lange, um sich mit ihren Blättchen aus dem Boden zu arbeiten.
Es war eine schöne Zeit, so sorglos und gleichzeitig aufregend. Was gab es alles zu entdecken! Die meisten nichtgrünen Wesen, die oberirdisch lebten, waren viel zu schnell, als dass man sie richtig wahrnehmen konnte. Schemenhaft huschten sie hin und her und hinterließen manchmal tiefe Eindrücke im weichen Boden. Ab und zu verharrten sie jedoch kurz, sodass wir uns ihre Gestalt einprägen konnten. Winzige, glänzende Krabbler, deren Bewegungen kaum hörbar waren, wechselten sich mit haarigen, deutlich größeren Wesen ab, deren rasches Stampfen auf dem Boden dumpfe Wellen durch das Erdreich jagte.
Dabei lernten wir die ersten großen Gefahren kennen. Ein Knistern im trockenen, alten Laub, und schon fiel ein langer Schatten auf mich und meine Geschwister. Ein großes braunes Geschöpf auf vier Beinen stand einen kurzen Moment über uns, und ehe ich mich versehen hatte, schienen viele meiner Geschwister zusammen mit dem Wesen verschwunden. Doch sie waren nicht weg, nein, ihr Klagen war noch lange zu riechen, denn sie waren nur ihrer Blätter beraubt worden.
Für sie gab es keine Rettung. Ohne Blätter, ohne oberirdischen Körper konnten keine Neugeborene überleben. Noch Tage später waberte ein immer schwächer werdender Duft über den Boden und verkündete die Botschaft der verstümmelten Opfer, die vergebens um Hilfe flehten. Ich war nun zwar nicht allein, aber die Schar war bereits erheblich geschrumpft.
Der erste Schreck hatte sich gerade gelegt, da klopfte es plötzlich bei mir an. Na ja, klopfen ist vielleicht das falsche Wort, denn was ich spürte, war nur eine winzige, fragende Berührung. Nein, nicht an meinen Blättern, sondern an den Wurzeln. Sie schmeckte irgendwie wie ein wunderbares Versprechen, das sich, falls ich es wagte, mehr zuzulassen, in einen kleinen Strom aus Leckereien verwandeln würde. Ich gab meinen Widerstand auf, und ehe ich mich versah, drang ein haariges Wesen in meine kleine Wurzel ein. Nein, das tat kein bisschen weh, ganz im Gegenteil. Es kribbelte ein wenig, kitzelte sogar in mir, und dann breitete es sich weiter aus.
Das Haarwesen umspann mit unzähligen hauchdünnen Fäden meine Wurzeln, ohne sie jedoch zu strangulieren. Dann tränkte es mich mit Wasser, das es aus winzigen Poren im Boden sog. Ich fühlte mich geborgen und hätte am liebsten auch meine zarten Blättchen nach hier unten zurückgezogen, denn nach oben, ans helle Licht, traute sich das Gespinst offenbar nicht. Ob es die großen, schnellen Räuber auch fürchtete?
Nach der Erfahrung mit dem, was etlichen meiner Geschwister passiert war, wäre es ohnehin keine schlechte Idee gewesen, sich unter der Erde zu verstecken. Aber egal, was ich anstellte, das Wachstum meines Stämmchens ließ sich nicht nach unten umlenken. Vor lauter Anstrengung hielt ich die Luft an, zumindest schloss ich die vielen kleinen Münder auf der Unterseite meiner Blätter. Umso heftiger musste ich mit den Wurzeln atmen, und der einzige »Erfolg« dieser Aktion war, dass der süße Strom aus meinen Erstlingsblättchen schwächer wurde und schließlich versiegte.
Hunger ist sehr unangenehm, noch unangenehmer aber ist Panik. Schnell öffnete ich die Münder wieder, und der süße Strom setzte erneut ein, allerdings nicht mehr so stark wie vorher.
Damals war mir noch nicht klar, dass die ersten Tage die schönsten in der Kindheit sind, weil Öl und Zucker aus den Vorräten des einstigen Embryos noch viel Nahrung liefern. Dieser Vorrat versiegte nun, und ein quälender Hunger breitete sich in meinen Wurzeln und der Haut aus. Der ganze Körper schmerzte, und ich versuchte verzweifelt, den Strom wieder zum Fließen zu bringen. Sollte ich meine Blätter anders ausrichten oder die Münder noch einmal schließen, vielleicht nicht alle auf einmal?
Es dauerte einen ganzen Mondumlauf, bis mir eine etwas ältere Schülerin in der Nähe zu verstehen gab, dass es nicht an mir läge. Es seien die Mütter, die den Nachwuchs durch ihr dichtes Blätterdach vom Sonnenlicht abschirmten. Mütter? Was hieß das, und welche der Bäume im Umkreis sollten das sein? Und warum versuchten sie, mich verhungern zu lassen?
Vor lauter Fragen schwirrten mir die Wurzelspitzen. Ich musste versuchen, so schnell wie möglich näher an das kostbare Licht zu kommen, das von weit oben her durch die sich im Wind wiegenden Zweige der Großen drang. Wenn ich es bis dorthin schaffen könnte, an diesen Müttern vorbei, dann hätte ich Zucker, so viel ich wollte.
Doch der Hunger ließ mir keine Kraft, mich zu strecken, und die meiste Zeit des Tages dämmerte ich vor mich hin, bis mich der Nachtschlaf für ein paar Stunden erlöste. Meinen Geschwistern schien es nicht viel besser zu gehen – das Hochgefühl, das uns direkt nach der Geburt durchströmt hatte, war verflogen, und der Geschmack von Familie war von einigen Regenschauern in tiefere Bodenschichten gespült worden.
KAPITEL 3
DIE MÄCHTIGE MUTTER
Ich schrak aus dem Schlaf und blickte in eine stockfinstere Nacht. Rings um mich ruhten alle anderen noch, doch an meinen Wurzeln fühlte ich eine ungewohnte Bewegung. War der unbekannte Räuber zurück und fraß nun auch unterirdisch Junge? Panisch öffnete ich meine Münder und entließ einen Hilfeduft. Noch bevor ich nach einer Antwort schnuppern konnte, wurde aus der Bewegung eine Berührung und kurz darauf eine Verbindung. Das Wesen hatte mich nun fest im Griff, und ich erstarrte. Vor lauter Aufregung merkte ich zuerst gar nicht, dass sich ein Sättigungsgefühl in mir ausbreitete, denn über die Wurzelverbindung setzte ein Zuckerstrom ein.
Ganz langsam verschwand die Angst, und ich wurde richtig wach. Nun erst drang eine Botschaft zu mir durch, die wohl schon die ganze Zeit über wiederholt wurde: »Beruhige dich, mein Kleines.« Mittlerweile war die Sonne aufgegangen, und ich blickte in die Richtung, aus der mich die fremden Wurzeln erreicht hatten. Wenige Meter neben mir stand eine mächtige Riesin. Ihre Blätter spielten im Wind so hoch oben im Sonnenlicht, dass ich sie nur als Flirren wahrnahm. Die graue Haut war glatt, hier und da mit hellen Sprenkeln versehen und kurz über dem Boden samtig grün. Als ob sie meine Gedanken lesen konnte, signalisierte sie mir, dass sie meine Mutter sei.
Eine Mutter? Das waren doch die, die die Kleinsten verhungern ließen! Offenbar konnte die Alte meine Gedanken lesen, denn die nächste Botschaft lautete: »Hab keine Angst! Ich habe dich geboren, ich werde dich beschützen und ernähren.« Ich beruhigte mich tatsächlich, obwohl mir damals immer noch nicht ganz klar war, was »geboren« und »Mutter« zu bedeuten hatte – schließlich war ich ganz allein auf die Welt gekommen. Doch der stete Zuckerstrom, verbunden mit einem wohligen Geschmack, war die beste Erklärung. Dieser erste Sommer wiegte mich in der Illusion, das ganze Leben könne so geborgen verlaufen.
Doch lasst mich noch weiter vom ersten Frühling erzählen. Schon zu Beginn der Saison bewahrte mich das alte Laub meiner Mutter vor einem jähen Tod. Wenige Tage nach meiner Geburt wurde es nämlich empfindlich kalt. Die Morgensonne tauchte die Lichtung nebenan in ein Meer aus funkelnden Kristallen – sämtliche Tautropfen waren hart gefroren. Im Laufe des Tages taute das Eis, und ich konnte sehen, dass viele Grünlinge die Blätter hängen ließen. Sie waren offensichtlich erfroren oder zumindest stark verletzt. Das gefrorene Wasser hatte anscheinend ihre Blätter zerbissen und in eine matschige olivbraune Masse verwandelt. Hier im Wald, mitten im alten Laub, war es viel wärmer. In Bodennähe waberte milde Luft um sämtliche Neugeborene herum, zudem schützte das Blätterdach hoch oben vor kaltem Zug.
Während der nächsten Mondläufe wurde es immer heißer und trockener. Tag um Tag strahlte ein blauer Himmel über dem Wald, von dem wir allerdings nur winzige Ausschnitte durch die dichten Zweige unserer Mütter erspähten. Trotzdem war es durch die fehlende Wolkendecke heller, und das bedeutete wenigstens ein kleines bisschen mehr Zucker in unseren Blättchen.
Doch je länger das Wetter anhielt, desto trockener wurde das Erdreich. Was nützten die schönsten Süßigkeiten, wenn es dazu immer weniger zu trinken gab? Wir Jungspunde wurden langsam unruhig, und wir lernten, mit unseren Wurzeln jedes noch so kleine Tröpfchen im Boden rinnen zu hören. Es war ein leises, zartes Geräusch, das die Finderin mit einem erfrischenden kleinen Getränk belohnte. Doch diese Funde wurden immer rarer, denn unsere Spitzen ertasteten selbst in den kleinsten Poren kaum noch etwas.
Auch die Pilze, diese Haarwesen, die sich noch besser auf das Entdecken selbst des kleinsten bisschen an Feuchtigkeit verstanden, waren mit ihren Fähigkeiten am Ende. Es setzte ein Ziehen im ganzen Körper ein, und das Laub an unseren Trieben rollte sich schmerzhaft nach oben. Manche der Kleinsten hatten in der Angst zu vertrocknen sogar schon ein paar ihrer wenigen Blättchen abgeworfen, doch selbst dazu reichte meine Energie nicht, und ich dämmerte tags wie nachts vor mich hin.
Eines Nachts wachte ich aus einem traumlosen Schlaf auf und bemerkte plötzlich, dass das Erdreich rings um mich herum feucht geworden war. Gierig trank ich, bis mein kleiner Körper prall mit Wasser gefüllt war. Zufrieden ging mein Blick nach oben, und ich sah, dass über mir die Sterne funkelten. Die Welt war wieder schön! Doch Moment – keine Wolken, kein Regen, und trotzdem feuchte Erde? Ach egal, ich genoss den Moment und fiel dann wieder in einen erholsamen Schlaf.
Die Dürre hielt an, und zwischendurch litten wir Baumkinder wieder heftigen Durst, doch regelmäßig wiederholte sich das Wunder der ersten Nacht. Die Panik verschwand und machte dem ungeduldigen Warten auf den nächsten Wassernachschub Platz. Normalerweise schlief ich durch, doch nach einem weiteren Mondumlauf wachte ich erneut im Dunkeln auf.
Das Erdreich rings um meine Wurzeln wurde wieder feucht, die Sterne funkelten, und ich saugte genüsslich alles auf, was meine Wurzeln erreichen konnten. Dabei entdeckte ich zufällig die Quelle des Wassers: Es quoll zwischen den Wurzeln meiner Mutter in die Poren des Bodens. Offenbar pumpte sie es in der Dunkelheit aus tieferen Schichten nach oben. Das war ein Irrtum, wie ich heute weiß, da ich die wahre Quelle dieser Unterstützung kennengelernt habe, nämlich andere grüne Riesinnen, doch dazu später mehr. Von dem Moment an war jedes Trinken mit einem Gefühl tiefer Liebe und Dankbarkeit zu meiner Mutter verbunden, ein Gefühl, das sich selbst noch bei Regen einstellte, der im Herbst pünktlich einsetzte.
Wir Kinder fühlten uns also bestens versorgt und geborgen, wurden im Herbst langsam müde und verbrachten einen gemütlichen Winterschlaf, um im kommenden Frühjahr erneut sorglos den Wald zu erkunden.
Nur langsam erwachte ich aus dem langen, traumlosen Schlaf. Ich war im Wald, dort stand Mutter, um mich herum andere Kinder. Endlich durften wir uns strecken, durften unseren Trieb nach oben recken und der Sonne entgegenwachsen – so dachten wir zumindest. Doch der Zuckerstrom der Mütter war so schwach, dass die erste Euphorie des Erwachens rasch in bohrenden Hunger überging. Auch das wenige Licht, das auf unsere Blättchen fiel, konnte kaum etwas zur Bekämpfung des wachsenden Verlangens nach Zucker beitragen.
Was sollte das? Eben noch hatte ich mich voller Energie und geborgen gefühlt, und nun war ich wieder allein und der Gefahr des Verhungerns ausgesetzt. Obwohl – allein war ich nicht, denn ich fand mich inmitten einer Gesellschaft jammernder Jungbäumchen wieder, die im zweiten Frühling ihres Lebens alle die gleiche Erfahrung machen mussten wie ich.
Immerhin gab es, wenn der Hunger besonders bohrend wurde, eine winzige Zuckergabe unserer Mütter, verbunden mit der Mahnung, wenigstens hundert Sommer lang geduldig zu sein. Hundert Sommer! Schon ein einziger verging quälend langsam, während man ständig auf den nächsten kleinen Sonnenstrahl wartete, der im Tagesverlauf nur für Augenblicke das dichte Dach der wachenden Mütter durchdrang und über unsere Blättchen huschte. Dieses lange Warten sollte der Vorbereitung auf ein langes Leben dienen, sollte dichte, gesunde Knochen bringen und starke Abwehrkräfte gegen Krankheiten.
Wenigstens schienen die schrecklichen Räuber, deren Hunger etliche meiner Geschwister kurz nach ihrer Geburt im vorherigen Jahr das Leben gekostet hatte, nicht mehr an uns interessiert zu sein. Sie ließen sich manchmal sogar mitten unter uns nieder, sodass wir einen genaueren Blick auf sie erhaschen konnten.
Damals wusste ich noch nicht, dass es Rehe waren. Wie soll ich sie euch beschreiben? Ihre vier Beine sitzen an einem breiteren, braunen Körper, der einen langen Hals mit großem Kopf trägt. Mit einer Öffnung an diesem Kopf können sie Blätter und Knospen abschneiden und auffressen. Sie selbst tragen keinerlei Grün, können also mit Fug und Recht als Schmarotzer bezeichnet werden. Statt mit Zweigen und Blättern ist ihr Körper mit Haaren bewachsen, die allerdings sehr viel kürzer sind als die der Haarwesen. Ab und zu knicken ihre Beine ein, dann liegen sie einen kurzen Moment auf dem Boden, bevor sie sich wieder erheben und wie der Wind verschwunden sind. Manchmal stoßen sie dabei ein tiefes Bellen aus.
Die Alten nennen die Rehe »den braunen Tod« und fürchten sie, weil sie so viele Kinder töten. Eines Tages erklärte mir meine Mutter, dass die einzige Waffe gegen diese Plage die Dunkelheit am Waldboden sei, die sie durch ihre unzähligen Blätter auch tagsüber zu schaffen wusste. Weshalb Dunkelheit solche Räuber davon abhalten sollte, uns zu töten, konnte sie mir auch nicht erklären, doch später fand ich die Antwort auf der benachbarten Lichtung.
Aber lasst mich euch erst noch von Tante Buckel erzählen.
KAPITEL 4
DIE ALTE LEHRERIN
In unserer Nähe wuchsen nicht nur meine Geschwister, andere Baumkinder, Halbwüchsige und die Mutterbäume, sondern auch ein bedauernswürdiges Wesen. Es war auf den ersten Blick nicht als Baum zu erkennen, denn ihm fehlten der oberirdische Körper, Äste, Zweige und sogar Blätter.
Wenn ich sage, dass es keinen Körper hatte, dann stimmt das nicht ganz. In einem großen Kreis waren wie graue Steine aufgereiht buckelige, knorrige Reste zu sehen, die davon zeugten, dass dies einst ein mächtiger, stolzer Baum gewesen sein musste. Nun war er auf diese kümmerlichen Brocken zusammengeschrumpft, vielleicht, weil ihn einst ein Sturm gefällt und kurz über dem Boden gekappt hatte.
Den Stumpf hatten über die Jahrhunderte Haarwesen und kleine Wusler aufgefressen und zu braunen Krümeln verarbeitet. Nur am Rand, wo ein wenig lebende Haut und darunter etwas Knochen übrig geblieben waren, stemmte sich das arme Geschöpf weiter gegen den nahenden Tod.
Im Boden sah es nicht viel besser aus: Von dem riesigen Wurzelwerk waren nur spärliche Ausläufer geblieben, die sich auch nicht mehr neugierig vorwärtstasteten, wie das sogar bei meiner alten Mutter der Fall war. Nein, sie verharrten oder wuchsen bestenfalls so langsam, dass wir es kaum bemerkten. Wie konnte so etwas überhaupt leben? Ohne Blätter gibt es schließlich keinen Zucker, stirbt jede grüne Riesin spätestens nach dem langen, kräftezehrenden Schlaf. Doch offenbar kämpfte dieses Etwas schon sehr, sehr lange ums Überleben, denn selbst vom einstigen abgebrochenen Körper war nichts mehr zu sehen – er war längst zu Waldboden geworden.
Aber wie ernährte sich dieses buckelige Wesen? Wer gab ihm süße Flüssigkeit? Die Antwort war ziemlich einfach und zugleich empörend, denn wir konnten es im Boden fühlen: Tante Buckel (wie wir sie respektlos nannten) wurde wie ein kleines Kind von den Müttern der Nachbarschaft über die Wurzeln gestillt! Ein schwacher, aber süßer Strom floss auch von meiner Mutter in ihre Richtung, und ich verstand nicht, weshalb sie wertvollen Zucker an ein offenbar nutzloses Mitglied unserer Gemeinschaft verschwendete, wo ich doch jeden Tag mit dem Hunger zu kämpfen hatte.
Andere Ältere, die ein ähnliches Schicksal erlitten hatten, trieben nach solchen Unfällen hastig ganze Büschel von Zweigen mit Blättern aus den Stümpfen, um möglichst schnell wieder genug zu essen zu haben und anschließend einen neuen Haupttrieb zu bilden. Nicht so Tante Buckel: Ihre fast schon störrisch anmutenden knorrigen Stumpfreste auf dem Boden zeigten nicht den geringsten Hauch eines Zweigleins, geschweige denn ein einziges Blatt, um wenigstens etwas guten Willen zu demonstrieren. Wir Kinder verachteten sie und waren sogar ein wenig eifersüchtig. Den Zucker, mit dem unsere Mütter sie unterstützten, hätten wir liebend gerne selbst genommen – davon kann man in dem Alter nie genug bekommen.
Eines Tages forderten uns die Mütter zu unserer Überraschung auf, mit unseren Wurzeln Kontakt zu diesem – sollten wir sie überhaupt noch »grüne Riesin« nennen? – alten Wesen aufzunehmen. Gehorsam streckten wir die zarten Spitzen in Richtung der Buckel, bis wir widerwillig ihre feuchten Ausläufer berührten. Wir waren so mit unserer Abscheu beschäftigt, dass wir die mahnenden Worte unserer Mütter fast nicht beachtet hätten, gut aufzupassen, was uns die Alte zu erzählen hätte, denn sie sei fortan für einen Teil des Unterrichts zuständig.
Langsam verstummten die Botschaften ringsherum, und auch wir Kinder hörten schließlich mit unseren Unterhaltungen auf und warteten angespannt, was nun vonseiten Tante Buckels kommen würde. Erst einmal kam gar nichts. Wir lauschten dem gluckernden Wasser in den Bodenporen unter uns, knisternden und krabbelnden Abfallbeseitigern, die alles Tote zersetzten, und dem schmatzenden Geräusch der Regenwürmer, die den Boden lüfteten, während sie durch ihre schleimigen Röhren krochen. Doch der alte Stumpf verharrte still und ohne jede Regung.
Nachdem wir mehrere Tage gewartet hatten und schon überlegten, bei unseren Müttern Protest einzulegen, kam die erste Botschaft. Schwach, aber doch eindringlich bat sie uns, gut auf ihre Worte zu achten. Besonders energisch klang das nicht, und so nahmen wir Tante Buckel schon am ersten Tag nicht besonders ernst. Sie faselte etwas vom Zusammenhalt der großen Familie, vom Respekt gegenüber den Älteren (na klar!), vom Geben und Nehmen und ähnlich Schwülstigem. Davon abgesehen war für sie das Nehmen offenbar der zentrale Bestandteil ihres kümmerlichen Lebens, und sie nahm uns jungen Schülerinnen vor allem eines: Zeit, die wir gerne mit anderen Dingen verbracht hätten.
Wir Buchen wären »die Wahren«, so die bucklige Lehrerin, die Herrscherinnen des Waldes, die über Wohl und Wehe der gesamten Gemeinschaft wachten. Die anderen grünen Riesinnen, von minderem Verstand, gelte es im Zaum zu halten, weil ansonsten das Chaos auszubrechen drohe. Mit »wir« waren allerdings nicht wir Schülerinnen gemeint, wie sie uns deutlich zu verstehen gab. Es sei die Familie, vor allem die Älteren, die fertig ausgebildet und in vollem Bewusstsein ihrer Rechte und Pflichten ihren Aufgaben in der Gemeinschaft nachkämen. Für die besonders verdienten Mitglieder, wohl geprüft über viele Sommer Dienst an den Wahren, winke eine Wahl in den Ältestenrat. Hier fielen die Grundsatzentscheidungen, würden neue Gefährdungen beurteilt und auch in Liebesdingen entschieden.
An dieser Stelle wurden wir kurz hellhörig – Liebe, das geheimnisvolle und deshalb umso aufregendere Thema, von dem unsere Mütter nie sprachen und auch andere Ältere nur leise tuschelten, sobald sie bemerkten, dass wir lauschten.
Buckel verkündete sehr stolz, dass einige Mitglieder des Rats bei ihr zur Schule gegangen seien, darunter auch eine Wahre, die sehr weit entfernt stand und nur mithilfe der Haarwesen am Unterricht hatte teilnehmen können. Ein bisschen habe ich euch ja schon von den haarigen Wurzelpilzen im Zusammenhang mit meiner Geburt erzählt, doch sie können noch viel mehr. Ich werde euch davon berichten, aber erst bitte noch ein klein wenig Geduld, meine Lieben.
Unser Leben als Kleinste der Familie war nicht so langweilig, wie es sich anhören mag. Denn uns stand ja nach dem Unterricht noch die zweite Hälfte des Tages zur Verfügung, und auf diese fieberten wir hin, je höher die Sonne stieg. Um uns herum gab es nämlich viel zu entdecken, zu erlauschen und zu erschnüffeln, was viel interessanter war als das ständige Wiederholen von Ermahnungen: Botschaften aus der weiten Welt des großen Waldes.
KAPITEL 5
NACHRICHTEN AUS DEM WALD
Wenn die Sonne im Zenit stand, wurden wir aus dem Unterricht von Tante Buckel entlassen. Unsere Wurzeln blieben zwar verbunden, aber die Alte verstummte bis zum nächsten Tag. Endlich konnten wir den wilden Wald erkunden. Und es gab so viel zu entdecken, wenn man nur wusste, wie man es anstellen musste. Durch die Luft und den Boden erreichten uns nämlich ständig Nachrichten, Hilferufe oder Liebesbotschaften; kurz, der Wald war regelrecht geschwätzig.
Es dauerte allerdings mehrere Sommer, bis ich verstand, wie ich die Botschaften entschlüsseln konnte, und unter uns Schülerinnen entspann sich ein Wettbewerb, wer am tiefsten in den Wald hineinzuhorchen vermochte. Je weiter entfernt der Ort des Geschehens, desto schwächer waren nämlich die Signale. So konnten wir mit etwas Übung spüren, wenn irgendwo ein Baum durch einen Sturm gefällt wurde und auf dem Waldboden aufschlug. Dann ging ein wellenartiges leichtes Beben durch das Erdreich, dem ein dumpfer Schlag folgte.
Solche Geräusche und Vibrationen hörten wir allerdings sehr selten. Viel häufiger waberten Duftbotschaften zwischen unseren Blättern hindurch. Manche von ihnen waren so aufdringlich, dass wir gar nicht darüber hinwegriechen konnten. Anfänglich wussten wir mit einigen dieser Gerüche nur wenig anzufangen, weil sie von anderen grünen Riesinnen zu stammen schienen.
Erst mit der Zeit wurde uns klar, dass dies Hilfeersuchen waren, in einer anderen Sprache verfasst und gar nicht für Familienmitglieder gedacht. Sie richteten sich vielmehr an ganz besondere Wesen, die Vögel. Ähnlich wie der braune Tod können auch sie sich bewegen, und zwar durch die Luft. Zum Glück fressen die meisten keine Wahren, sondern helfen uns ganz im Gegenteil dabei, andere Angreifer loszuwerden.
So baten einige meiner Tanten diese Flieger ganz eindringlich um Unterstützung, weil sie von Blattfressern befallen würden. Ihre Blätter seien von Würmern, kleinen wurzelartigen Wuslern, besetzt und würden nun nach und nach von diesen vollständig vertilgt. Sosehr wir auch unsere Blättchen reckten, wir konnten die ramponierten Älteren nicht sehen. Da ein kräftiger Wind aus Richtung Sonnenuntergang wehte, konnten die gequälten Wahren allerdings auch völlig außerhalb der Sichtweite hinter der nächsten Hügelkette stehen, wo das Licht jeden Abend unter dem Horizont verschwindet.
Ob die Flieger in diesem Fall zu Hilfe geeilt waren, konnten wir natürlich nicht beobachten, aber auch in unserer Nähe kam es immer wieder zu solchen Wurmangriffen. Sobald der Duft für die Flieger ausgestoßen wurde, kamen sie angesaust und pickten die Würmer von den Blättern. Sie schluckten sie hinunter und flogen wieder davon.
So lernte ich gemeinsam mit meinen Geschwistern und Freundinnen nach und nach auch die Fliegersprache, oder besser: die Fliegersprachen. Denn es gab noch viel mehr Wesen, die man herbeiduften konnte. Da waren neben den Vögeln zum Beispiel winzige Wespen, die einen Stachel besaßen. Holte man sie zur Unterstützung, so stürzten sie sich auf die Würmer und bohrten ein Löchlein hinein. Nach nicht einmal einem Mondumlauf starben die Würmer, und aus ihren Körpern entstiegen neue Wespen.
Neben solch aufregenden Neuigkeiten gab es aber auch sehr viel langweiliges Geschwätz. So mahnten einige Ältere, die außerhalb unserer Sichtweite wuchsen, man möge doch bitte sparsamer mit dem Wasser umgehen. Ob das Verwandtschaft von Tante Buckel war? Wirklich lästig, solche Hinweise auch noch nachmittags zu erhalten, wo wir doch auf wirklich spannende Informationen hofften! Diese grünen Riesinnen wurzelten offenbar an Stellen, an denen die Bodenschicht besonders dünn war, bevor harter Fels jegliches Vordringen in den Untergrund verhinderte. Hier waren folglich weniger Wasservorräte gespeichert, trocknete das Erdreich im Sommer besonders schnell aus. Kein Wunder, dass diese Bäume als Erste dürsteten und alle anderen warnten, sich rechtzeitig auf eine Dürre vorzubereiten.
Doch wir Schülerinnen ignorierten solche Ratschläge, denn unsere Wurzeln fanden im tiefen, weichen Boden noch genügend Wasser, und im Falle eines Falles, so dachten wir, würden unsere Mütter schon für Nachschub aus der Tiefe sorgen.
Wie wir solche Botschaften ohne Duft über größere Entfernungen erhielten? Das erledigte eine Bande von Gaunern. Na ja, Gauner klingt vielleicht etwas zu hart, möglicherweise trifft es »durchtriebene Händler« besser. Es waren Pilze, die Nachrichten gegen eine deftige Bezahlung im ganzen Wald verbreiteten. Wer immer eine Mitteilung außerhalb des eigenen Wurzelnetzwerks aussenden wollte, bediente sich dieser Gilde der Haarwesen. Man konnte bei ihnen sogar Schulden machen, also eine Botschaft beauftragen und erst später dafür zahlen. Das war sehr praktisch, denn oft hatten die Mutterbäume im Herbst einige Vorräte zur Seite gelegt, aus denen dann die flauschigen Vermittler bezahlt werden konnten.