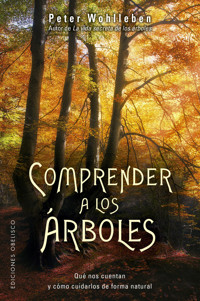16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wie kann es sein, dass das vermeintlich höchstentwickelte Wesen auf diesem Planeten seinen Lebensraum selbst zerstört?
Haben wir unser Schicksal wirklich selbst in der Hand oder agieren wir nicht – wie jede andere Tierart auch – überwiegend instinktgesteuert? Augenscheinlich ja: Unfähig zu vorausschauendem, langfristigem Denken, rein an unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung interessiert, plündert die Menschheit die Ressourcen des Planeten hemmungslos aus und steuert sehenden Auges in den eigenen Untergang.
In seinem faszinierenden neuen Buch gewährt Peter Wohlleben erstmals Einblicke in die wahre Natur des Menschen. Anhand vieler verblüffender Vergleiche zur Tier- und Pflanzenwelt zeigt er, dass wir nicht etwa die Krone der Schöpfung sind, sondern die Evolution nach wie vor auch bei uns wirkt. Nur wenn wir die menschliche Natur verstehen und ihr fortwährendes Wirken akzeptieren, können wir neue Wege einschlagen, die eine lebenswerte Zukunft ermöglichen!
- Entdeckungsreise in den geheimnisvollen Kosmos der menschlichen Natur
- Wie kann es sein, dass das vermeintlich höchstentwickelte Wesen auf dem Planeten seinen Lebensraum selbst zerstört?
- Bisher hat Peter Wohlleben auf seine unnachahmliche Weise das geheime Leben der Natur erklärt. Jetzt geht er dem Geheimnis unseres häufig so unerklärlichen Verhaltens auf den Grund.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ZUMINHALT:
Wie kann es sein, dass das vermeintlich höchstentwickelte Wesen auf diesem Planeten seinen Lebensraum selbst zerstört?
Haben wir unser Schicksal wirklich selbst in der Hand oder agieren wir nicht – wie jede andere Tierart auch – überwiegend instinktgesteuert? Augenscheinlich ja: Unfähig zu vorausschauendem, langfristigem Denken, rein an unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung interessiert, plündert die Menschheit die Ressourcen des Planeten hemmungslos aus und steuert sehenden Auges in den eigenen Untergang.
In seinem faszinierenden neuen Buch gewährt Peter Wohlleben erstmals Einblicke in die wahre Natur des Menschen. Anhand vieler verblüffender Vergleiche zur Tier- und Pflanzenwelt zeigt er, dass wir nicht etwa die Krone der Schöpfung sind, sondern die Evolution nach wie vor auch bei uns wirkt. Nur wenn wir die menschliche Natur verstehen und ihr fortwährendes Wirken akzeptieren, können wir neue Wege einschlagen, die eine lebenswerte Zukunft ermöglichen!
ZUMAUTOR:
Peter Wohlleben, Jahrgang 1964, wollte schon als kleines Kind Naturschützer werden und betrieb bereits früh Verhaltensstudien bei Tieren. Er studierte Forstwirtschaft und war über zwanzig Jahre lang Beamter der Landesforstverwaltung. Heute arbeitet und lehrt er in der von ihm gegründeten Waldakademie in der Eifel und setzt sich weltweit für die Rückkehr der Urwälder ein. Peter Wohlleben initiierte einen neuen Studiengang (Sozioökologisches Waldmanagement) und gründete eine gemeinnützige GmbH für den Waldschutz.
Er ist Gast in zahlreichen TV-Sendungen, hält Vorträge und Seminare und ist Autor von Büchern zu Themen rund um den Wald und den Naturschutz. Über seine Bestseller Das geheime Leben der Bäume, Das Seelenleben der Tiere, Das geheime Netzwerk der Natur und Das geheime Band zwischen Mensch und Natur näherte er sich dem zentralen Thema des neuen Buchs: Ist der Mensch eine Tierart wie jede andere oder gelingt es ihm tatsächlich, sich aus seinen evolutionären Fesseln mithilfe des Verstandes zu befreien und seine Zukunft anders zu gestalten, als dies jede andere Tierart tun würde? Dazu schöpft der Autor aus seinen lebenslangen Erfahrungen, aus eigenen Beobachtungen, aus den Gesprächen mit vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie aus neuesten Studien. Für seine emotionale und unkonventionelle Wissensvermittlung wurde Peter Wohlleben 2019 die Bayerische Naturschutzmedaille verliehen. 350 000 Menschen sahen im Kino den 2020 erschienenen Film zum gleichnamigen Buch Das geheime Leben der Bäume.
PETER WOHLLEBEN
UNSER WILDES ERBE
Wie Instinkte uns steuern und was das für unsere Zukunft bedeutet – faszinierende Einsichten für ein Leben im Einklang mit der Natur
Mit diesem Buch wird das Buchen-UrwaldProjekt von Wohllebens WALDAKADEMIE in der Eifel unterstützt.Von Natur aus wäre Deutschland zu über 90 Prozent von Wald bedeckt, der größte Teil davon Buchen- oder Buche/Eichen-Mischwälder. Alte Buchenwälder sind die Regenwälder Europas, und ähnlich wie in den Tropen ist es auch um sie sehr schlecht bestellt. Buchenwälder ab Alter 180 haben nur noch einen Anteil von 0,16 Prozent an der Landfläche. Die Buchenwälder des UrwaldProjekts werden konsequent geschützt und für kommende Generationen erhalten. In dem Wald-Schutzgebiet in der Eifel wird auf natürliche Weise CO2 in alten Wäldern gespeichert und somit das Klima entlastet. Gleichzeitig übernimmt das Projekt auch eine wichtige Rolle im Erhalt der Biodiversität.
Durch das Einscannen dieses QR-Codes gelangen Sie auf die Website von Wohllebens WALDAKADEMIE und können den Buchen-Urwald, den Sie mit dem Kauf dieses Buches schützen helfen, live erleben.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 10/2023
Copyright © 2023 by Ludwig Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angelika Lieke
Umschlaggestaltung: Martina Eisele Design, München,
unter Verwendung der Fotos von Ramon Haindl (Vorderseite)
und Nhan/Adobe Stock (Rückseite)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-30793-6V001
www.Ludwig-Verlag.de
Inhalt
Vorwort: Von Bäumen und Menschen
Kapitel 1 Wir sind immer noch Tiere
1.1 Vom Aussterben bedroht
1.2 Revierverhalten
1.3 Winzlinge mit Power
1.4 Falsch abgebogen
1.5 Was zum Teufel ist eigentlich Natur?
1.6 Die Illusion vom natürlichen Gleichgewicht
1.7 Das Wissen der Alten
Kapitel 2 Die Krone der Schöpfung?
2.1 Evolution und Intelligenz
2.2 Wie frei ist der freie Wille?
2.3 Der Elefant im Raum – das Bevölkerungswachstum
2.4 Die Apokalypse als Regulierungsmechanismus?
Kapitel 3 Den Spieß umdrehen
3.1 Das Erwachen aus allzu süßen Träumen
3.2 Die Tragik der Allmende
3.3 Bürgerräte – Demokratie der Zukunft
3.4 Die Technik wird’s schon richten
3.5 Vor der eigenen Haustüre kehren
3.6 Verzichten für mehr Lebensglück
3.7 Von den Bäumen lernen
Anmerkungen
Vorwort: Von Bäumen und Menschen
Eine große Gruppe sozialer Lebewesen beansprucht rücksichtslos Lebensraum für sich und verändert ihn so, dass eine beachtliche Anzahl an faszinierenden Tierarten verschwindet. Nashörner, Elefanten und viele andere mehr müssen weichen und sterben großräumig aus.
Was ich hier beschreibe, bezieht sich nicht auf uns Menschen, sondern auf Bäume. Sie gelten als sanfte Riesen, können im Verband aber ganze Landschaften zu ihren Gunsten verändern. Pflanzen, die sich gegenüber Tieren durchsetzen und diese sogar ausrotten? Das geht tatsächlich, und zwar ganz subtil über eine allmähliche Veränderung der Lichtverhältnisse am Boden und damit eine starke Reduzierung der für Pflanzenfresser wichtigen Gräser und Kräuter. Es ist also nichts Neues für die Erde, dass Lebewesen die Ellenbogen ausfahren und einfach alles umkrempeln.
Selbst die Allerkleinsten sind dabei: So bewirkten Bakterien vor rund drei Milliarden Jahren eine Katastrophe, weil sie Sauerstoff produzierten – für den Großteil der damaligen Arten ein tödliches Gift, das zu ihrem Aussterben führte. Gleichzeitig läuteten sie die Herrschaft der Pflanzen über diesen Planeten ein, und mittlerweile wirken Klein (Bakterien) und Groß (Bäume) wunderbar zusammen – zum Beispiel an der Bildung von Regenwolken.
Mich hat dieses Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Arten schon als Kind fasziniert, und mir drängte sich bereits damals die Frage auf, wie wir Menschen in dieses System hineinpassen. Verhalten wir uns wie Bäume und Tiere, oder gehören wir womöglich inzwischen gar nicht mehr zur Natur?
Einer der Unterschiede zwischen Bäumen und Menschen ist der, dass Bäume mithilfe von Pilzen, Bakterien, Insekten und Tausenden anderen Arten stabile Ökosysteme aufbauen, die sich gegen Veränderungen wehren und zumindest für einen Zeitraum von vielen Tausend Jahren einigermaßen gleichbleibende Verhältnisse schaffen können. Wälder halten Wasserkreisläufe in Gang, kühlen im Sommer die Luft und erzeugen Böden, die stetig fruchtbarer werden. So verbessern sich ihre Lebensgrundlagen fortlaufend, bis eines Tages einsetzende Eis- oder Warmzeiten die Karten neu mischen.
Wir dagegen beuten den Planeten so aus, dass unsere Lebensgrundlagen schon unter optimalen Klimabedingungen stetig schlechter werden und unsere ökologische Nische schrumpft. Veränderungen sind etwas völlig Normales, doch das aktuelle Tempo überfordert die meisten Arten – auch unsere.
Homo sapiens stand bereits mehrfach kurz vor dem Aussterben, bis sich die Entwicklung eines Tages ins Gegenteil verkehrte und wir die erfolgreichste Säugetierart wurden – zu erfolgreich. Wie konnte es so weit kommen? Haben wir das Ende einer langen Entwicklung erreicht?
Das Leben auf der Erde existiert seit etwa 3,5 Milliarden oder vielleicht sogar schon seit vier Milliarden Jahren.[1] Es entwickelte sich gemächlich aus Einzellern und brachte schließlich Pflanzen und Tiere hervor. Mit Höhen und Tiefen, Aussterben und neuen Arten ging es im Endeffekt immer weiter nach oben in Richtung Artenvielfalt und Stabilität der Ökosysteme, bis unsere Ahnen vor rund 300 000 Jahren[2] die Bühne dieser Welt betraten und fortan in dem Reigen des Lebens mitmischten – anfangs noch ganz gesittet.
Irgendwann in der nicht allzu fernen Vergangenheit begann die Sache jedoch aus dem Ruder zu laufen, erst langsam mit wenigen Veränderungen, dann immer schneller mit dem bekannten Resultat der letzten Jahrzehnte: Die Bevölkerung wächst, der Planet wird geplündert, die Ökosysteme werden zerstört.
Wie kann eine einzelne Säugetierart derart selbstzerstörerisch auftreten? Greifen bei uns die natürlichen Regulierungsmechanismen nicht mehr? Das wäre dann der Fall, wenn unser Verstand uns dazu befähigen würde, diese Naturgesetze außer Kraft zu setzen.
Doch sollten wir mit einem solchen Verstand nicht erst recht in der Lage sein, das Ruder herumzureißen? Scheinbar nicht, denn trotz aller Bemühungen, trotz aller Regelungen nimmt der Ausstoß an Treibhausgasen weiter zu, werden mehr und mehr Wälder gerodet und die Weltmeere weiter leer gefischt. Schon seit Jahren beschleicht mich immer stärker der Verdacht, dass wir an die Bewältigung der Probleme vollkommen falsch herangehen. Zwar sind die Strategien, wie sie mit Solarenergie oder Recyclingmethoden verfolgt werden, im Detail durchaus gut, in der Summe jedoch bremst das alles den Ressourcenverbrauch nicht, geht die ungehemmte Plünderung der Natur unaufhörlich weiter.
Ich denke, dass wir mit dem völlig falschen Ansatz unterwegs sind, weil wir unsere tierische Natur komplett ausblenden und so tun, als ob die Lösung allein Sache des Verstands wäre. Würde das tatsächlich stimmen, dann müssten wir allerdings allmählich große, durchschlagende Erfolge im Kampf gegen den Klimawandel und die Umweltzerstörung sehen. Ein Großteil der Menschheit hat doch längst verstanden, dass es so nicht weitergehen kann! Gewiss, es gibt immer einige Gruppen einflussreicher, wohlhabender Menschen, die egoistisch auf dem »Weiter so!« beharren, aber zumindest in Demokratien sollten sich die Lösungen der erkannten Probleme rasch umsetzen lassen.
Die wissenschaftlichen Diagnosen zeigen jedoch klar, dass die Maßnahmen zu zaghaft sind und zu spät greifen. Deshalb stellen sich die entscheidenden Fragen: Haben wir unser Schicksal wirklich selbst in der Hand, oder agieren wir nicht – wie jede andere Tierart – überwiegend instinktgesteuert? Unterliegt unsere Population nicht weiterhin natürlichen Regelungsmechanismen, wie alle anderen Arten auch?
Das würde ich gerne mit Ihnen zusammen ergründen. Dazu schauen wir uns Parallelen Mensch/Tier im Umgang mit Ressourcen und Regelmechanismen für die Population an. Denn wenn in unserer belebten Umwelt nach festen Spielregeln gelebt, gefühlt und gedacht wird, dann gelten diese Regeln möglicherweise ungeschmälert ebenso für unsere Art.
Selbst die aktuelle Umweltzerstörung durch den Menschen ist demnach zunächst ein natürlicher Prozess. Jede Tier- und Pflanzenart nutzt ihre Ressourcen aus, so gut es geht – und bei uns geht es momentan eben besonders gut. Dabei sind wir durchaus nicht die erste Art, die diese Chancen zu gründlich nutzt und dabei unzählige andere in den Abgrund stürzt. Solche Störungen bedeuten jedoch nicht das Ende jeglicher Ökosysteme, sondern mischen lediglich die Karten des Lebens neu. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Natur diese Wunden heilt und unzählige neue Kreaturen ihre Chance nutzen.
Fragen nach unserer tierischen Natur sind entscheidend im Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung. Momentan versuchen wir nämlich alle drängenden Probleme so zu lösen, als ob wir aufgrund unserer geistigen Fähigkeiten über andere Arten erhaben wären. Wenn wir jedoch erkennen, dass wir letztendlich alle zusammen immer noch im selben Boot sitzen, sollten wir dringend über andere Lösungsstrategien nachdenken. Und es gibt solche Lösungsstrategien! Sie sprechen allerdings weniger unseren Verstand an als vielmehr unsere Instinkte und könnten uns den entscheidenden Schritt weiterbringen, den es jetzt braucht, um die Umwelt und damit uns selbst zu retten.
Kapitel 1 Wir sind immer noch Tiere
Seit es Naturwissenschaften gibt, betrachtet sich der Mensch in westlichen Kulturkreisen als etwas Besonderes, so besonders, dass er vermeintlich über den anderen Arten steht. Das spiegelt sich auch in biologischen Fachausdrücken wie »höhere und niedere Tiere« wider, also einem Ranking, welches gleichzeitig wertet. Nach dieser Lesart hebt sich der Mensch sogar streng wissenschaftlich aus dem Meer der Millionen Arten hervor.
Unsere Vorfahren in der Steinzeit (von denen wir uns genetisch nicht unterscheiden) hätten über unsere merkwürdigen Ansichten sicher gelacht, wenn sie nicht ganz andere Sorgen gehabt hätten. Sie wussten, dass sie nur eine von vielen Arten waren, wussten, dass sie nicht über ihren Mitgeschöpfen standen, sondern mitten unter ihnen lebten. Ein Teil dieser Mitgeschöpfe zeigte ihnen täglich, wo die Grenzen von Homo sapiens verlaufen, und zwar so deutlich, dass die Existenz unserer Art lange Zeit auf Messers Schneide stand.
1.1 Vom Aussterben bedroht
Das größte Wunder in unserer Entwicklungsgeschichte ist wohl, dass es uns überhaupt noch gibt, denn von Natur aus sind wir nicht besonders gut für unsere eigene Verteidigung ausgestattet. Deshalb ist unsere Art auch schon mehrfach an den Rand des Aussterbens geraten. Bevor wir uns diese Ereignisse, die unsere Überlebensstrategien prägten, näher anschauen, lassen Sie uns einen Blick auf die Waffenarsenale der Konkurrenz werfen.
Viele Pflanzen und Tiere verfügen über deutlich bessere Strategien, um Angriffe anderer Arten abzuwehren. Einige Pflanzen sondern etwa Giftstoffe über ihre Wurzeln oder Blätter ab, um lästige Konkurrenz loszuwerden. Solch ein Giftmischer ist zum Beispiel die Walnuss. Untereinander scheinen die Bäume verträglich zu sein, wie der letzte verbliebene Walnuss-Urwald im Süden Kirgisistans bezeugt.[3] Anderen Pflanzen gegenüber ist der Baum jedoch rücksichtslos. Um sich die Konkurrenz vom Leibe zu halten, produziert er einen Wirkstoff namens Juglon. Dieser wird über die verrottenden Blätter in den Boden abgegeben und hemmt dort Sämlinge fremder Arten.[4]
Brombeeren gehen wesentlich brachialer vor: Sie haben gegenüber mächtigen Bäumen kaum eine Chance, weil diese an ihnen vorbei nach oben wachsen und anschließend mit mächtigen belaubten Kronen regelrecht das Licht für die Bodenpflanzen ausknipsen. Auf Kahlflächen, etwa nach Borkenkäferbefall oder Sturm, ist die Brombeere jedoch häufig als Erste wieder in den Startlöchern. Sie bildet meterlange Ranken und überwuchert damit junge Bäume. Dann wartet der stachelige Strauch auf den Winter. Während Buchen, Eichen oder Linden die Blätter abwerfen, behält die Brombeere ihr grünes Laub. Wenn es nun schneit, bleibt die weiße Pracht auf den Blättern liegen und kann zentnerschwer werden. Dadurch sinkt das gesamte Gebüsch zu Boden, einschließlich des Baumnachwuchses, der verbogen oder gar abgebrochen keine Chance mehr hat, eine stattliche Größen zu erreichen, und oft ganz abstirbt. Die Brombeere hingegen erneuert ohnehin jedes Jahr einen Großteil ihrer Ranken und kann das Spiel jederzeit von vorn beginnen.
Tiere können ebenfalls auf eine große Palette an Waffen zurückgreifen. Zähne und Klauen erreichen teilweise furchterregende Ausmaße, wie beispielsweise beim Megaraptor, einem Raubsaurier, der bis zu 35 Zentimeter lange Klauen besaß (und dann trotzdem vor rund 70 Millionen Jahren ausstarb).[5]
Giftpfeile, wie sie zum Beispiel Quallen einsetzen, sind da schon raffinierter. Mit bis zu 150 bar, also bis zum 60-fachen Druck eines Autoreifens, platzen ihre Nesselzellen bei Berührung[6] und jagen harpunenähnliche giftige Geschosse, die mittels einer Leine mit der Qualle verbunden sind, in den Eindringling. Vielleicht haben Sie ja auch schon Bekanntschaft mit diesen Plagegeistern gemacht, die auf solche Weise dafür sorgen, dass so manches Gewässer trotz Traumstrand menschenleer bleibt. Im Extremfall können Quallen Menschen sogar töten. Das Gift einer einzigen Würfelqualle zum Beispiel würde theoretisch für 250 tödliche Badeunfälle reichen.[7]
Vieles gäbe es noch zu berichten über Käfer, die kochend heiße Flüssigkeiten verschießen, oder Schlangen, die ihr tödliches Gift direkt in die Augen des Angreifers spritzen. Dabei übertreibt die Natur häufig und versucht sich mit einer Ausstattung, die bis ins Bizarre übersteigert scheint – der Megaraptor ist da keine Ausnahme. So trug beispielsweise der Riesenhirsch, der in Europa erst vor rund 7 000 Jahren ausstarb, ein Geweih mit einer Spannweite von bis zu vier Metern mit sich herum.[8] In den sich ausbreitenden nacheiszeitlichen dichten Wäldern war das sicher eine große Behinderung, sehr zur Freude der Wölfe.
Ein weiterer Kandidat, der ebenfalls vor nicht allzu langer Zeit ausgestorben ist, war der Säbelzahntiger (Smilodon). Er durchstreifte den nord- und südamerikanischen Kontinent und war, von einigen Ausnahmen abgesehen, nicht viel größer als heutige Großkatzen. Das größte bisher gefundene Exemplar wog allerdings geschätzte 400 Kilogramm und hatte Zähne, die bis zu 20 Zentimeter aus dem Schädel ragten.[9] Ob diese Zähne womöglich doch nicht so praktisch waren, ob der jagende Mensch oder das sich ändernde Klima dem Beutegreifer zusetzten, ist unbekannt. Fakt ist, dass sich diese Monsterzähne zumindest bei Katzen nicht dauerhaft bewährt haben.
Und der Mensch? Von Natur aus sind wir vergleichsweise mickrig ausgestattet: Unsere Eckzähne sind lächerlich klein, unsere Fingernägel nicht gerade schreckenerregend. Gift haben wir auch nicht in unserem Körper, und schnelles Laufen ist ebenfalls nicht unsere Spezialdisziplin. Aber da ist ja noch das außergewöhnlich große Gehirn. Mithilfe unseres proteinbasierten Rechenzentrums können wir vieles ausgleichen, doch dazu benötigten wir weitere körperliche Fähigkeiten.
Um das näher zu beleuchten, unternehmen wir einen Ausflug zu den Walen. Sie haben ebenfalls große Gehirne, gelten als extrem intelligent, singen Lieder, haben eigene Sprachen und Dialekte, entwickeln ausgefeilte gemeinsame Jagdstrategien und sogar regelrechte Kulturen. Dennoch haben sie nicht die Herrschaft über den Globus angetreten, so wie wir es taten. Der Grund: Ihnen fehlen die Hände. Die brauchen Wale allerdings auch nicht, denn sie sind schnell und wehrhaft und vor allem: Sie sind im Wasser unterwegs, wo sich kaum Materialien zur Herstellung von Werkzeugen finden lassen und wo mitgeschlepptes Gepäck nur behindern würde. Stattdessen sind die Arme und Hände zu Flossen umgebildet worden, die eine perfekte Steuerung ermöglichen.
Manche Vogelarten sind ähnlich intelligent, wie etwa Papageien oder Rabenvögel. Doch auch bei ihnen sind die Hände das Pendant zu Flossen für die Luft geworden – zu Flügeln, mit denen man ebenfalls nicht greifen kann. Ein wenig besser als bei den Walen geht es allerdings schon, denn immerhin sind die Füße noch beweglich und ermöglichen das Greifen von Ästchen, die zum Stochern und damit als einfache Werkzeuge genutzt werden. Geradschnabelkrähen schaffen es im Experiment sogar, ohne Anleitung Werkzeuge aus bis zu vier Einzelteilen zu basteln. So stecken sie beispielsweise zwei kürzere Elemente zu einem längeren zusammen.[10] Derartige Fähigkeiten werden sonst im Tierreich nur bei Menschenaffen (und Menschen) beobachtet.
Dennoch sind die Greiforgane des Menschen besonders feinfühlig und vor allem: Wir können beide Greiforgane gleichzeitig einsetzen und damit viel ausgeklügeltere Werkzeuge und Waffen herstellen. Erst diese Kombination aus Geist und Motorik ermöglichte Homo sapiens das Überleben. Messer, Lanzen und später auch Pfeil und Bogen verhalfen unseren Ahnen zu etwas mehr Sicherheit.
Die Fähigkeit zur Aufrüstung reichte lange Zeit allerdings bestenfalls, um eine Art Gleichstand mit ihren Mitgeschöpfen herzustellen, boten aber keinerlei große Expansionsmöglichkeiten auf Kosten anderer Arten. Das größte Problem der Menschheit ist entwicklungsgeschichtlich betrachtet nämlich nicht die Überbevölkerung, sondern das ständig drohende Aussterben. Und diese Bedrohung bestand über Jahrhunderttausende hinweg.
Wie dramatisch die Situation war, lässt sich am Beispiel Europas verdeutlichen. Heute leben allein in der Europäischen Union über 446 Millionen Menschen. In der Altsteinzeit herrschte hier gähnende Leere. Wer damals unterwegs war, musste wochenlang wandern, um auf eine andere Sippe zu treffen: Im Zeitraum vor 42 000 bis 33 000 Jahren siedelten in Europa im Mittel nur 1 500 Menschen. Diese waren räumlich konzentriert; so fand sich die größte Dichte unserer Urahnen im südwestlichen Frankreich mit einer Population von 440 Individuen. Nächstgrößerer Ballungsraum war Nordspanien mit 260 Einwohnern, daneben gab es nur drei weitere Hotspots mit mehr als 150 Personen – die Mindestgröße, um eine überlebensfähige Population zu erhalten. Die kleineren Sippen mit zehn bis 80 Personen konnten nur deshalb bestehen, weil sie offenbar reiselustig waren und so Kontakt zu den größeren Gruppen hielten.[11] Möglicherweise stammt unser Wunsch nach Reisen, Urlaub und generell viel Bewegung über weite Distanzen aus diesen Zeiten.
Ein paar mehr Menschen hätte die Landschaft sicher vertragen, doch die Art der damaligen Ernährung verhinderte eine intensive Besiedlung. Das Sammeln von Beeren, Nüssen und Wurzeln stellte dabei noch das geringste Problem dar. Eine Übernutzung solcher Ressourcen ist selbst bei einer um ein Vielfaches größeren Bevölkerung kaum denkbar. Gerade bei Beeren und Nüssen sind es ja die Pflanzen selbst, die die Nutzung geradezu anbieten und die man damit keineswegs ausrottet, sondern sogar begünstigt. Brombeeren etwa können sich nach Genuss und Passage durch den Magen-Darm-Trakt wirkungsvoll verbreiten, indem ihre Samen ausgeschieden werden und an neuen Standorten keimen.
Ganz anders sieht es allerdings mit Fleisch aus. Es war sicher eine wesentliche Komponente in der Ernährung unserer Vorfahren und sorgte dafür, dass diese sich nicht allzu stark ausbreiten konnten. Naturgemäß muss man ein Tier töten, bevor man es verzehren kann. Das geht genau einmal relativ problemlos, nämlich dann, wenn man auf eine Population trifft, die den jagenden Menschen noch nicht kennengelernt hat. Solche paradiesischen Zustände herrschen auch heute gebietsweise noch, etwa auf den Galapagos-Inseln. Dort haben die Tiere keine Scheu vor den Touristinnen und Touristen und lassen diese bis auf wenige Meter an sich heran.
Ist aber die erste Lanze geworfen, hat der erste Pfeil sein Ziel gefunden, dann ändert sich die Situation schlagartig. Zweibeiner werden fortan als gefährliche Raubtiere gesehen, und die Fluchtdistanz nimmt schlagartig zu – nämlich mindestens so weit, dass sich die Tiere außerhalb der Reichweite von Speeren und Pfeilen befinden.
Das ist ansatzweise selbst heute noch in dicht besiedelten Landstrichen wie Deutschland zu beobachten. Auch dort werden Rehe und Hirsche ein kleines bisschen zahmer, wenn die Schonzeit im Spätwinter einsetzt. Sobald die Jagdwaffen schweigen, zeigen sie sich zunehmend unvorsichtig. Das ändert sich schlagartig mit dem ersten Schuss der beginnenden Jagdsaison im Mai, wenn die Tiere sofort wieder extrem schreckhaft werden. Ruht die Jagd hingegen ganz, wie etwa in Städten, wagen sich die Wildtiere sogar in die Vorgärten hinein und fressen dort in Seelenruhe die Blumenbeete leer.
Insgesamt war die Natur in grauer Vorzeit eine viel unzuverlässigere Nahrungsquelle als heute – der Ackerbau im Verbund mit dem globalen Handel hat den Nachschub kalkulierbarer und planbarer gemacht.
Eine kleine Population, schwankende Nahrungsquellen sowie Naturkatastrophen haben unsere Art sicher mehrfach an den Rand des Aussterbens gebracht. Der Ausbruch des Vulkans Toba auf der indonesischen Insel Sumatra vor ca. 74 000 Jahren hatte solch ein Potenzial. Riesige Mengen an Asche wurden in die Atmosphäre geschleudert, verdunkelten den Planeten für sechs Jahre und sorgten für eine massive Abkühlung. Unsere Vorfahren, von denen schon vor rund 120 000 Jahren etliche Sippen aus Afrika ausgewandert waren,[12] wurden durch dieses Ereignis auf kleinere Gruppen in Afrika in Äquatornähe reduziert – so wenige, dass sich ihre Spuren kaum noch nachweisen lassen. Alle heutigen Menschen gehen auf diese Restpopulation von geschätzten 30 000 Individuen zurück.[13]
Der letzte größere Schock trat möglicherweise vor 7 000 Jahren auf. Damals, so Forschende, kam es zu einem drastischen Schwund von Männern im gesamten Verbreitungsgebiet von Homo sapiens. Der Schwund war so stark, dass auf 17 Frauen nur noch ein Mann kam. Das lässt sich aus dem starken Rückgang der genetischen Vielfalt des Y-Chromosoms schließen. Eine mögliche Ursache könnten Stammesfehden gewesen sein. Damals dominierten wahrscheinlich Männergruppen, derer Mitglieder alle miteinander verwandt waren. Die Frauen wurden aus anderen Gebieten geholt (freiwillig oder nicht), sodass die Verwandtschaftslinie immer männlich geprägt war. Diese Männergruppen kämpften mit dem Aufkommen des Ackerbaus und damit festen Territorien gegen andere Gruppen – bis zu deren Auslöschung. So ließe sich die genetische Verarmung bei Männern im Vergleich zu Frauen erklären, die nicht fest an Clans gebunden waren und bei denen die genetische Vielfalt im gleichen Zeitraum eher noch zunahm.[14]
Diese ständige Gefahr des Verlöschens unserer Art ist es auch, weshalb all unsere Sinne auf Absicherung unserer Existenz in Form von materiellen Dingen, aber auch Informationen ausgerichtet sind. Heute würden wir es vielfach gierig nennen, wenn der Kleiderschrank überquillt und trotzdem noch die nächste Hose bestellt wird, doch vor entwicklungsgeschichtlich gesehen kurzer Zeit war diese Gier, besser: dieses Verlangen, einer der wichtigsten Impulse, um zu überleben.
Die Gefahr des Aussterbens besteht bis heute, doch die Gründe haben sich anscheinend ins Gegenteil verkehrt. Wir sind zu erfolgreich geworden, können zu viele Lebensräume besiedeln, können zu viele Ressourcen verwerten und all das in eine immer weiter ansteigende Bevölkerungszahl ummünzen. Weil wir dabei nicht nur die Erträge der Ökosysteme verbrauchen, sondern die Systeme selbst, schrumpfen unsere Grundlagen scheinbar unaufhaltsam. Haben wir die Naturgesetze außer Kraft gesetzt?
1.2 Revierverhalten
Falls der Mensch weiterhin ein Bestandteil der Natur ist, dann müssten für ihn dieselben Regeln gelten wie für jede andere Art auch. Stimmt diese Annahme, dann muss auch der steile Anstieg unser Population a) erklärbar sein und b) nicht ungebremst erfolgen können. Darauf deutet tatsächlich einiges hin, und dazu schauen wir uns diese Regeln der Reihe nach an.
Es gibt keine Art auf diesem Planeten, die sich unreguliert vermehren kann. Die einfachste Regulation ist physisch und bezieht sich auf den Platz: Wenn alles voll ist, passt niemand mehr hinein. Für Tiere ist so ein Gedränge unvorstellbar, weil vorher längst andere Faktoren greifen würden, vor allem einer: Die Nahrung ginge aus. Tiere sind ohne Pflanzen nicht denkbar, weil sie keine eigene Nahrung produzieren können. Wäre jedes Fleckchen mit Tieren besetzt, so bliebe kein Platz mehr für ihre Nahrungsgrundlage.
Klingt alles logisch und scheinbar überflüssig, doch wenn wir das Reich der Pflanzen betreten, sieht die Sache schon ganz anders aus, weil für sie die eigene Standfläche zur Existenz völlig ausreichend ist – vorausgesetzt es gibt genug Licht für die Blätter. So demonstrieren üppige Wiesen, dass jedes Plätzchen mit Gras oder Kräutern besetzt ist, sodass man kein Fleckchen nackten Boden erspähen kann.
Diese Dichte macht das Ökosystem jedoch nicht schwach, sondern ganz im Gegenteil fit. Je mehr Biomasse vorhanden ist, desto robuster ist das System. Humus kann sich unter der Grasnarbe bilden, der Wasser speichert und recycelte Nährstoffe freisetzt. Große Pflanzen wie Bäume können sich im Verbund als alte und dichte Wälder durch Verdunstung großer Mengen an Wasser herunterkühlen und so heiße Sommertage erträglicher machen. Zugleich sorgen sie durch den Ausstoß von Kohlenwasserstoffen sowie von Bakterien, die auf den Blättern sitzen, für Kondensationskeime in der Luft. An ihnen bilden sich Wassertröpfchen, was zur Folge hat, dass es über solchen Wäldern signifikant mehr regnet.
Pflanzliche Populationen können also gar nicht dicht genug sein, während Tiere viel Abstand brauchen, um immer genügend Nahrung zur Verfügung zu haben. Es gibt allerdings eine Ausnahme, bei der Tiere diese Spielregeln ausgetrickst haben. Es handelt sich um die Wesen, die die größten Bauwerke der Erde geschaffen haben. Nein, das sind nicht die Menschen, sondern festgewachsene Nesseltiere, die Korallen. Sie haben sich mit Algen verbündet, die in ihnen Fotosynthese betreiben und den tierischen Partnern einen Teil der süßen Ausbeute überlassen. Hinzu kommt die Meeresströmung, die allerlei Verwertbares heranträgt, das die Nesseltiere mit ihren Fangärmchen herausfiltern können. So gelingt es ihnen, großflächig dicht an dicht aufzutreten und so imposante Gebilde wie das Great Barrier Reef zu bilden. Das Korallenriff vor der Ostküste Australiens gilt als größtes Bauwerk, welches je Lebewesen auf der Erde geschaffen haben, und ist ungefähr so groß wie Deutschland.
Für die meisten anderen Tierarten wären solche Siedlungsdichten allerdings unvorstellbar, denn meist wird ihre Nahrung nicht von einer Strömung herbeigetragen, sondern muss aktiv gesucht und im Falle von Fleischfressern, wie etwa Wölfen, sogar erbeutet werden. Sie fressen in unseren Gefilden Hirsche und Wildschweine, hauptsächlich jedoch Rehe.[15]
Diese Pflanzenfresser haben von der Forstwirtschaft mit ihren aufgelichteten Wäldern und Kahlschlägen massiv profitiert. Je mehr Licht, desto mehr Kräuter und Sträucher, die Rehe so lieben. Ihre Population ist deshalb vielerorts von ein bis zwei Tieren im einstigen Urwald auf rund 40 Tiere pro Quadratkilometer Wald angeschwollen. Diese 40 Tiere »produzieren« pro Jahr mindestens 20 Kitze. Ein durchschnittliches Wolfsrevier ist 250 Quadratkilometer groß, davon etwa ein Drittel Wald, also 80 Quadratkilometer. Das macht dann mindestens 1 600 neue Rehe pro Jahr, somit mehr als genug für das Wolfsrudel, welches im Schnitt nur 400 Rehe erbeutet.[16]
Warum ist ein Revier dann viermal größer als nötig? Es liegt an der Scheu der Beutetiere, egal ob Wildschwein, Hirsch oder Reh: Wenn Isegrim auf Jagd ist, werden die Tiere vorsichtiger. Es spricht sich regelrecht im ganzen Wald herum, wie mir einst ein Kollege berichtete. Dass Luchse, Großkatzen, die ebenfalls Hirsche und Rehe lieben, im Revier sind, erkenne er daran, dass sich seine Hauskatze nicht mehr vor die Tür traue. Offenbar funktioniert der Buschfunk bis in unsere Gärten. Einen solchen Buschfunker haben Sie im Wald vielleicht schon einmal bei der Arbeit gehört: Es ist der Eichelhäher, ein extrem intelligenter Rabenvogel. Er warnt mit lautstarkem Krächzen vor Gefahr und ist bei menschlichen Jägerinnen und Jägern nicht besonders beliebt, weil er auch sie ankündigt. Die Reviergröße von Beutegreifern ist also auch abhängig von der verfügbaren Information der darin lebenden Tiere.
Bei Rehen spielt analog die verfügbare pflanzliche Nahrung eine Rolle, die den Vorteil besitzt, nicht weglaufen zu können. Dennoch sind auch Reh-Reviere (die nur im Sommer verteidigt werden) viel größer, als sie sein müssten. Fünf Hektar scheint bei Böcken das absolute Minimum zu sein, selbst bei allerbester Nahrungsverfügbarkeit.[17] Zum Vergleich: Auf einem Hektar könnte man bei saftiger energiereicher Vegetation ohne Probleme eine Kuh halten, die mit über 600 Kilogramm Körpergewicht[18] entsprechend mehr fressen muss als ein Reh mit maximal 25 Kilo.
Rehböcke benötigen deshalb mehr Platz, weil es sonst zu stressig wird. Geht es bei hohen sommerlichen Temperaturen in Richtung Paarungszeit, so wird das Revier erbittert verteidigt. Dazu muss ein Bock nicht ständig kämpfen, da er sein Gebiet geruchlich für Konkurrenten als No-go-Area markiert. Gibt es zu viele Rehe, dann vagabundiert ein Teil der Böcke (vor allem sehr junge) durch die Wälder und Felder auf der Suche nach einem freien Plätzchen. Das schafft Stress für alle Beteiligten. Die weiblichen Tiere sind zwar nicht ganz so unduldsam, brauchen aber speziell in der Zeit nach der Geburt der Kitze ein kleines eigenes Gebiet, wo sie in Ruhe fressen können. Auch bei ihnen erzeugt eine Überpopulation Stress.
Diese nervliche Belastung hat Folgen. Zunächst verlieren die Tiere Gewicht – wer ständig gestört wird, kann nicht so viele Kalorien zu sich nehmen. Die häufigeren Kontakte untereinander erhöhen zudem den Befall mit Parasiten. Schwächere Ricken bauen oft schon Embryos im Körper ab, sodass sie statt der üblichen Zwillinge nur noch ein Kitz setzen oder gar keinen Nachwuchs austragen.
Stress reguliert also ganz direkt die Population und ist damit neben der Nahrungsverfügbarkeit einer der Hauptfaktoren für die Vermehrungsrate. Dies trifft auf viele, vielleicht sogar alle Tierarten zu, selbst so evolutionär weit entfernte wie Frösche. Wird die Umwelt stressiger, so steigen selbst bei Grasfröschen die Stresshormone im Blut, und die Population schrumpft.[19]
Das wirft die Frage auf, wie es mit Homo sapiens aussieht. Gefühlt sind die meisten von uns regelmäßig gestresst, und falls wir uns trotz aller zivilisatorischen Errungenschaften weiterhin tierisch verhalten, sollte das ähnliche Auswirkungen auf unser Reproduktionsverhalten haben.
Menschen leben wie viele Tierarten in Revieren. Die Vorteile dieser festen Territorien liegen in der Ernährungssicherheit und in der Ruhe bei der Aufzucht des Nachwuchses – das ist bei uns nicht anders als bei Rehen und Wölfen. Und auch wir markieren unsere Reviere, wenn auch nicht mit Duftmarken, sondern mit Grenzschildern (Staatsgrenzen), Gartenzäunen oder Haustüren. Die Revierdichte hängt bei allen Tieren von der Ergiebigkeit der natürlichen Ressourcen ab, und hier gibt es einen Unterschied: Wir können deshalb so dicht siedeln, weil wir die Ressourcen in Geldform komprimieren und deshalb mit in die Städte nehmen können. Wohnort und Ressourcen sind dadurch trennbar. Ein Hochhaus mit Dutzenden von Wohnungen ist durch die tierische Brille betrachtet nichts anderes als ein dicht gepacktes, gestapeltes Reviersystem. Rehe und Wölfe würden dadurch gestresst, denn selbst wenn die Ressourcen ausreichen, ist auch die Nähe zu Artgenossen außerhalb der eigenen Familie extrem anstrengend, weil ständig die Grenzen verteidigt werden müssen. Im menschlichen Jargon heißt so etwas Nachbarschaftsstreit.
Menschen, die ihr Revier besonders gut verteidigen können, haben Macht, etwa durch ein hohes politisches Amt, durch eine Alleinherrschaft, besonders häufig aber durch viel Geld. Je stärker die Position, desto größer ist das Revier – ganz wie im Tierreich. So umfasst einer der größten Wälder Österreichs in Privateigentum 345 Quadratkilometer[20]; für eine Einzelperson oder Familie sicher etwas überdimensioniert. Ein noch gewaltigeres »Revier« ist in Australien zu besichtigen. Die größte Farm des Landes, Anna Creek Station, ist mit knapp 16 000 Quadratkilometern[21] halb so groß wie Belgien.
Revierverhalten führt allerdings automatisch zu Aggressionen, die in der modernen Zivilisation nicht nur für menschliche Tragödien, sondern auch für erhebliche Umweltzerstörungen sorgen, vor allem wenn es um Staatsgrenzen geht. Doch auch die individuellen Reviere, in den meisten Fällen ein Häuschen mit Garten oder eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus, führen zu Spannungen, die sich möglicherweise auf die Populationshöhe auswirken.
Dazu werfen wir einen Blick auf eine Besonderheit unserer Art, nämlich die, unsere Distanzzone maximal einzuschränken. Wo alle einander fremden Säugetiere bei Revierkämpfen schon längst aufeinander losgegangen wären, bleiben wir völlig gelassen. Notwendig macht das unsere ausgefeilte Arbeitsteilung, ohne die gar nicht so viele Menschen auf diesem Planeten leben könnten, doch dazu später mehr.
Unsere persönliche Distanzzone, quasi unsere Bannmeile, die niemand ohne Erlaubnis betreten darf, ist im westlichen Kulturraum auf winzige ein bis vier Meter geschrumpft – näher dürfen nur Bekannte oder Familienmitglieder heranrücken.[22] Das unerlaubte Unterschreiten dieser Distanzzonen erzeugt Stress, und im Alltag passiert das ständig. Ob im öffentlichen Nahverkehr auf dem Weg zur Arbeit, ob auf Partys oder Konzerten, auf Weihnachtsmärkten oder in Fußgängerzonen, überall kommen uns Menschen näher, als wir uns instinktiv wünschen würden. Hinzu kommen Revier- und Rangkämpfe, bei uns im Gewand von Lohnverhandlungen und Karriereleiter.
Bei sozial lebenden Tieren, wie etwa dem Wildkaninchen, sind ähnliche Strukturen zu beobachten. Da gibt es Familien, Freundschaften und eine Hierarchie. Dies alles hat Einfluss auf das Wohlbefinden, das Stressniveau und nachweisbar auf die Reproduktion. Bei den Mümmelmännern regulieren gruppendynamische Prozesse die Größe der Population.[23]
Haben unsere sozialen Interaktionen ähnliche Auswirkungen wie im Tierreich, lassen sich Veränderungen bei der Geburtenrate feststellen? Möglicherweise schon, denn nun schauen wir uns das aktuelle Reproduktionsverhalten unserer Art an, und da gibt es durchaus Auffälligkeiten. So kommt eine Metaanalyse aus dem Jahr 2022 zu dem Befund, dass die Zeugungsfähigkeit von Männern global rapide sinkt.[24] Insgesamt wurden die Daten von 57 000 Männern in 53 Ländern aus allen Kontinenten ausgewertet. Noch ist im Großen und Ganzen alles im grünen Bereich – noch. Das liegt an der enormen Menge von Spermien, von denen sich normalerweise 100 Millionen in einem Milliliter Samenflüssigkeit tummeln. Doch seit den 1970er-Jahren geht die Menge ständig zurück auf aktuell nur noch 49 Millionen. Es ist kaum vorstellbar, dass die Halbierung ohne Folgen bleibt – schließlich gibt es kaum etwas in der Natur, was völlig überflüssig produziert wird. Und das Tempo der Abnahme der Spermienzahl scheint sich noch zu beschleunigen.
Über die Ursachen wird in der Wissenschaft geforscht, doch aktuell gibt es noch keine schlüssige Erklärung für einen einzigen Faktor. Stress zählt auf jeden Fall dazu, wie Studien belegen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Columbia University stellten bei Tests an 193 Männern im mittleren Alter fest, dass Stress die Anzahl und die Qualität der Spermien reduziert.[25] Männern sieht man das nicht an, Kohlmeisen dagegen schon: Die Qualität ihrer Spermien spiegelt sich in der Farbe ihrer Brust wider. Leuchtet sie kräftig gelb, ist alles in bester Ordnung. Eine schwache Färbung dagegen signalisiert schlechtes Sperma, weshalb Weibchen auf die knallgelben Männchen fliegen. Forschende der Universität Bern belegten, dass die Ursachen im Stress bei der Nahrungssuche und der Revierverteidigung liegen,[26] einem klassischen Problem hoher Siedlungsdichten.
Da drängt sich schon der Gedanke auf, dass wir auch bei der Reproduktion zumindest noch teilweise wie ganz normale Tiere funktionieren.
Wäre es nicht viel einfacher, einen Blick auf die menschliche Populationsdynamik, sprich: Bevölkerungsentwicklung zu werfen? Das haben wir bei den Rehen schließlich ebenfalls getan. Also machen wir es an dieser Stelle ebenso, doch es gestaltet sich nicht ganz so einfach wie bei den Tieren.
Die Geburtenrate in Deutschland geht tatsächlich seit vielen Jahren zurück, doch die moderne Zivilisation nimmt mit Methoden, die die Natur nicht vorgesehen hatte, kräftig Einfluss – eines der Stichworte heißt Antibabypille. Die unscheinbare Tablette revolutionierte das Sexualleben und machte Schwangerschaften planbar. Zusammen mit der Markteinführung fiel die Kurve der Geburten ab Mitte der 1960er-Jahre so drastisch ab, dass man dieses Phänomen seither als »Pillenknick« bezeichnet. Bekam nach Angaben des Statistischen Bundesamtes jede westdeutsche Frau 1964, dem geburtenstärksten Jahrgang überhaupt, noch durchschnittlich 2,5 Kinder, so waren es am Tiefpunkt der Entwicklung ab Mitte der 1970er-Jahre unter 1,4. Seither dümpelt dieser Wert mit kleineren Aufs und Abs immer unterhalb der Sterberate.[27]
Die Bevölkerung schrumpft also ohne Zuzug schon seit rund 50 Jahren. Ist die Antibabypille demnach die Ursache des Schrumpfungsprozesses? Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse legt das nahe. Doch ganz so einfach ist es nicht. Bleiben wir zur genaueren Betrachtung in Deutschland. Der Knick ist unbestreitbar, aber rührte er wirklich von der Pille her?
Um Klarheit zu gewinnen, müssen wir die Entwicklung noch ein wenig länger zurückverfolgen. Um 1870 waren fünf Geburten pro Frau völlig normal,[28] ein Wert, der an Nigeria denken lässt, wo solche Zahlen heute noch Durchschnitt sind.[29] Die Lebensverhältnisse waren ähnlich: Hunger und Armut waren ständig zu Gast, und die beginnende Industrialisierung erreichte weite Teile der ländlichen Bevölkerung nicht. Kinder galten als willkommene Arbeitskräfte, die das Familieneinkommen aufbessern halfen. Auch zur Versorgung der Eltern im hohen Alter war der Nachwuchs nötig, denn eine Rentenversicherung gab es erst Ende des 19. Jahrhunderts.
Und diese Rentenversicherung hatte Folgen, die sich möglicherweise stärker ausgewirkt haben als diejenigen der Pille. Denn ihre Einführung dürfte einer der ersten Fälle gewesen sein, wo soziale Maßnahmen einen unerwarteten Geburtenrückgang zur Folge hatten. Die Wirkung basierte wahrscheinlich auf zwei Effekten: Zum einen wurden Kinder als lebende Rentenversicherung überflüssig, zum anderen sank das Einkommen der Arbeitenden. Ein Teil des Lohns wurde zwangsweise als Beitrag einbehalten und konnte nicht mehr für den Lebensunterhalt der Kinder ausgegeben werden. Mit dem weiteren Ausbau des Sozialstaats verstärkte sich dieses Wirkgefüge,[30] etwa durch die Schulpflicht, die den Kostenfaktor Kind (ich bitte um Entschuldigung für diese Formulierung) weiter nach oben trieb, da sie nun einen erheblichen Zeitanteil außer Haus verbrachten.
Analog zu dieser Entwicklung fiel die Geburtenrate immer weiter ab, unterbrochen nur von einem Aufschwung in den 1950er- und 1960er-Jahren (dem ich auch meine Geburt verdanke – meine Eltern wollten gerne viele Kinder). Dem langfristig fallenden Trend tat dies jedoch keinen Abbruch, und so gingen die Geburten auch Ende der Sechzigerjahre wieder zurück,[31] dem Zeitraum, in dem die Antibabypille eingeführt wurde. Doch schaut man sich die Daten genauer an, dann fällt die kleine Tablette als maßgeblicher Grund aus. Denn der Knick trat auch in Ländern auf, in denen die Pille so gut wie gar nicht verwendet wurde, wie etwa in Japan. Dort knickte die Geburtenkurve massiv ein, ohne dass die Pille überhaupt auf dem Markt war. Auch in den USA sank die Zahl schon in den 1950er-Jahren deutlich früher als in Deutschland, wo die Markteinführung eher zufällig mit den fallenden Zahlen korrelierte. Nur eine Minderheit der Frauen nutzte die Antibabypille, weil sie damals noch ein gesellschaftliches Tabu war.[32] Der Geburtenrückgang ist demnach eher auf konventionelle Verhütungsmethoden zurückzuführen.
Zunehmend dürften aber auch unfreiwillige Verhütungsmittel eine Rolle spielen, und zwar in Form von Umweltgiften, die wie Hormone wirken. Mindestens 15 Millionen Spermien pro Milliliter, 32 Prozent davon voll beweglich, sind nach der Definition der WHO zur Zeugungsfähigkeit erforderlich.[33] Dieser Wert wird bei mehr und mehr Männern unterschritten, und neben dem Stress stehen Chemikalien in Verdacht, das männliche Y-Chromosom zu schädigen. Im Vergleich zum weiblichen X-Chromosom ist es sowieso schon mit weniger Genen ausgestattet und damit anfälliger gegen äußere Einflüsse.
Die Menschheit entlässt derzeit gewaltige Mengen an künstlichen Stoffen in die Umwelt, die über das Abwasser wieder ins Trinkwasser gelangen, so etwa Weichmacher und viele andere hormonähnlich wirkende Substanzen. Weltweit wird bei etlichen Wirbeltieren hierdurch eine Verweiblichung der Männchen beobachtet, die uns als Wirbeltierart leider ebenso betrifft. Ein solcher Kandidat ist Bisphenol A, eine Substanz, die vielen Plastikprodukten wie etwa Getränkeflaschen beigemischt ist. Es kann sich unter bestimmten Umständen lösen und wird dann über die Nahrung oder über die Haut aufgenommen. Im Körper wirkt es wie das Hormon Östrogen – nicht gerade günstig für Männer, die sich Nachwuchs wünschen.[34]
Der Geburtenrückgang ist also neben Stress, einer typisch tierischen Regulationsgröße bei hohen Dichten, zunehmend auf zivilisatorische Begleiterscheinungen wie den gesellschaftlichen Wandel, aber auch auf Umweltgifte zurückzuführen – hier haben wir die Tiere ja leider ebenfalls mit zu uns ins Boot geholt.
1.3 Winzlinge mit Power
Wir schauen gerne auf große Arten und lieben besonders diejenigen, die größer als wir sind: Wale, Elefanten und Giraffen, aber auch Bäume, Palmen oder Bambus (der je nach Art regelrechte Wälder bildet) – big is beautiful. Dabei sind es eher die allerkleinsten, die wir im Blick behalten sollten, die unser Leben viel entscheidender beeinflussen und uns entweder wohlgesinnt sind oder aber über uns herfallen.
Egal ob Pflanze oder Tier, wird es von einer Art zu viel, so greifen sie unerbittlich ein. Sie sind eine zweite wichtige Größe bei der Regulierung einer Population. Dabei trifft es nicht jedes Individuum gleichermaßen: Ob man krank wird oder nicht, hängt von der persönlichen Konstitution ab. Je gestresster, desto leichter wird man Opfer von Erregern oder Parasiten. Diese sind letztendlich auch eine Art Beutegreifer, denn sie betrachten den Wirtsorganismus als riesiges Nahrungsreservoir, gleichzeitig aber auch als Lebensraum. Sie können ihre Opfer umso leichter erlegen, Pardon, befallen, wenn diese sich nicht richtig wehren können.