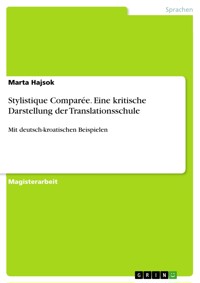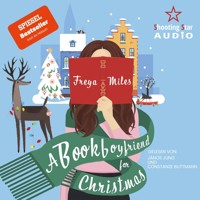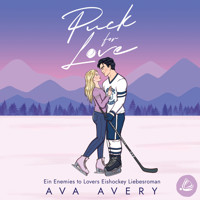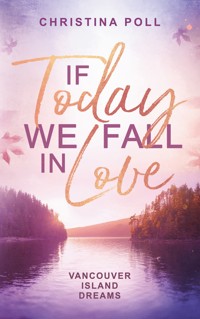14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Literaturwissenschaft - Literatur der Romantik, Note: 1, , Veranstaltung: Philosophische Fakultät, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit vergleicht die Motive und Ideologien zweier Strömungen, Aufklärung und Romantik, und befasst sich mit der Schwarzen Romantik, Hoffmanns Darstellung des Wahnsinns und den stilistischen Merkmalen von Hoffmanns Roman „Die Elixiere des Teufels“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus, Bachelor und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Die Zusammenfassung
1. Die Einleitung
2. Der Wendepunkt von der Vernunft zum Wahnsinn
2.1. Geschichtlicher Wendepunkt von der Aufklärung zur Romantik
2.1.1. Schwarze Romantik
2.2. Der Wendepunkt bei Medardus
2.2.1. Rede bei Anwesenheit des Malers
2.2.2. Der Genuss des Teufelselixiers
3. Hoffmanns Darstellung des Wahnsinns
4. Stilistische Merkmale des Romans „Die Elixiere des Teufels“
4.1. Gattungsbezeichnung
4.2. Form
4.3. Handlungsablauf
4.4. Bildersprache
4.5. Ironie und Komik
5. Anzeichen des Wahnsinns bei Medardus
5.1. Innerer Zwiespalt
5.2. Mordgedanken
5.3. Verfolgungsangst
5.4. Wahnvorstellungen
5.5. Träume
5.5.1. Medardus’ Traum von der Hölle als Abbild von Hieronymus Boschs Werken
5.6. Obsession
6. Gestalten und Bilder, die bei Medardus den Wahnsinn entfachen
6.1. Maler
6.2. Aurelie
6.3. Bild der heiligen Rosalia
6.4. Doppelgänger
6.4.1. Sigmund Freuds Deutung des Doppelgängers
7. Gemeinsamkeiten zwischen Medardus und den anderen Wahnsinnigen
8. Das Messer als Mordwaffe der vom Wahnsinn Befallenen
9. Die Erbsünde als Erklärung für Medardus’ Wahnsinn
10. Die Schlussfolgerung
11. Die Quellenangaben
Die Zusammenfassung
In dieser Abschlussarbeit wird man den Themenkreis, die Motive und die Ideologien zweier Strömungen, Aufklärung und Romantik, vergleichen und sich mit der schwarzen Romantik, der Unterströmung der Romantik, die sich mit dem Dämonischen und Kranken beschäftigt, Hoffmanns Darstellung des Wahnsinns, den stilistischen Merkmalen von Hoffmanns Roman „Die Elixiere des Teufels“ und der Darstellung des Wahnsinns bei Medardus befassen. Nachdem der Vergleich der beiden Strömungen und der damit zusammenhängende Übergang von der Vernunft zum Dämonischen, Kranken und Wahnsinnigen geklärt ist, folgt die Erklärung des Begriffs „schwarze Romantik“, Hoffmanns Darstellung des Wahnsinns und die Darstellung des Wahnsinns bei Medardus. In der Darstellung des Wahnsinns bei Medardus wird von dem Zeitpunkt des Ausbruchs des Wahnsinns bei Medardus, Medardus’ Anzeichen des Wahnsinns, die von Träumen bis zu Wahnvorstellungen und innerem Zwiespalt reichen, den Auslösern seiner Wahnsinnsanfälle, den Gemeinsamkeiten zwischen den Wahnsinnigen, der gemeinsamen Tatwaffe der Wahnsinnigen und der Erbsünde, die als Fluch Medardus’ Geschlecht zerstört, die Rede sein.
1. Die Einleitung
In dieser Abschlussarbeit, zu der man durch Heinrich Heines Äußerung, dass durch Hoffmanns Roman „Die Elixiere des Teufels“ ein Student in Göttingen „toll“ geworden ist, angeregt worden ist, will man sich der Darstellung des Wahnsinns widmen, um sich selbst ein Urteil zu bilden, ob das Werk den Wahnsinn wirklich so naturgetreu wiedergibt, dass es als Ursache für den Ausbruch des Wahnsinns beim Studenten angesehen werden kann oder ob das Werk nur das Produkt reiner Phantasie mit über die Wirklichkeit hinausgehenden Anzeichen des Wahnsinns ist.
Im ersten Kapitel unter dem Namen „Der Wendepunkt von der Vernunft zum Wahnsinn“ wird man die vernunftsorientierte Aufklärung und der Mythologie, dem Phantastischen, Dämonischen und Wahnsinnigen zugewendete Romantik vergleichen, den Themenkreis und den trivialen Charakter der Werke der schwarzen Romantik vorstellen und Medardus’ Verwandlung vom vernünftigen Menschen zur verwirrten und innerlich gespaltenen Persönlichkeit begründen.