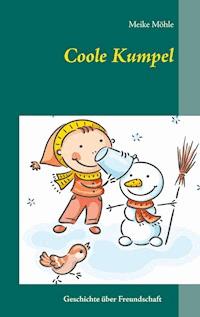Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Leben ist bunt, und auch der Alltag hat es nicht verdient, immer nur grau genannt zu werden. Wenn man ganz genau hinschaut, fallen sie einem auf, die kleinen Merkwürdigkeiten und lustigen Vorfälle, die jedem von uns immer wieder begegnen. Genau beobachtet und gewürzt mit einer ordentlichen Portion Selbstironie beschreibt die Autorin alltägliche Dinge - und das ist ganz und gar nicht langweilig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Als ich einmal jung war …
Heldendämmerung
Zuckerwatte und Liebesapfel
Tanzkurs 1985
Onkel, Tante und der Rest
Das Softeis-Debakel
Zuhause-Töne
Nie wieder siebzehn
Die Glorifizierung des Bandsalats
Jaffa!
Liedgut
Die Oma im Wolf
Mein Haushalt und ich
Wer macht sowas?
Mein Toaster – Technik, die begeistert!
Der Eierkauf
Von der fixen Idee, ein Tiefkühlgerät zu besitzen
Suchet, so werdet ihr finden …
Prokrastination: Eimer ohne Lappen
Gesundheit!
Doktor Google und ich
Wie ich zu Herrn Schnabel wurde
Hafertee
Das Marmeladenorakel
Das Schlüsselproblem
Und sonst so?
Der Name der Sache
Leggings
Bürotechnik
Im Zugabteil
Die totale digitale Vernetzung
Beinahe Pasewalk
Der Hocker
Das Monster im Klo
Hierarchie in Tüten
Hals über Kopf
Fachpersonal
Die Miesmacher
Die Lesung – ein Bericht
Als ich einmal jung war …
Heldendämmerung
Ich gehöre nicht zu den Menschen, die das Verschwinden der Kindheit als besonders belastend empfinden. Es war wirklich nicht alles toll, als ich klein war. Gut, es kommt mit steigendem Alter hier und da zu Zipperlein, die Haut wird lappig, die Wirbel knacken und Frisörbesuche werden teurer. Doch diese Unbillen sind eigentlich zu verkraften, stellt man sie in Relation zur gewonnenen Freiheit und inneren Sicherheit, die sich mit den Jahren einstellt. Was waren das doch für Zeiten, in denen man die Mutter fragen musste, wann man zuhause sein sollte, oder ob man statt einem Quarkbrot vielleicht lieber ein Nutellabrötchen haben dürfte. Und diese Diskussionen, ob man nun Hausschuhe tragen muss oder nicht – wo doch jeder weiß, dass Hüttenschuhe eine Geißel der Menschheit sind! Nein, ich glorifiziere die Kindheit und Jugend wirklich nicht, sondern bin ausgesprochen gerne erwachsen.
Was mich jedoch hin und wieder ein bisschen traurig macht, ist das Verschwinden meiner Helden. Wen habe ich nicht früher alles bewundert. Viele von ihnen hingen als Poster in meinem Zimmer und lachten mich siegesgewiss an. Menschen mit einem solchen Lachen hatten es geschafft, ihnen machte nichts Angst. An ihnen konnte ich mich orientieren, sie waren meine Beschützer.
Leider wurden diese Helden im Laufe der Jahre entzaubert, schrumpften und verließen mich. Es begann mit einer lachenden Stoffpuppe namens Eumel. Sie war mein Kamerad in dunklen Nächten, verschwand jedoch irgendwann einfach von der Bildfläche. Inzwischen weiß ich, dass meine Mutter Eumel klammheimlich in den Müll geworfen hatte, denn er fusselte und führte bei mir mehrmals zu nächtlichen Erstickungsanfällen. Um Eumel trauerte ich lange und tue das eigentlich heute noch, auch wenn er realistisch betrachtet wohl ein Billigprodukt war.
Weiter ging es mit Tony Marshall, dessen Bild ich an meiner Tür befestigen ließ, als ich in etwa fünf Jahre alt war. „Heute hau‘n wir auf die Pauke!“, ja, das war ein Lebensmotto, das mir gefiel. Dazu noch eine Lockenfrisur, die der meinen gar nicht unähnlich war, und jede Menge Rhythmus im Blut. Es gab für mich keinen Zweifel, diesen Mann wollte ich heiraten. Doch dann sah ich mir irgendwann mit meinen Eltern eine Fernsehshow an – war es der Blaue Bock, oder vielleicht Dalli Dalli? – und erfuhr, dass Tony Marschall bereits verheiratet war und sogar Kinder hatte. Er hatte nicht auf mich gewartet – was für ein Verrat. Ich verbannte ihn aus meinem Herzen und von meiner Kinderzimmertür, an die ich stattdessen einen bunten Strauß Prilblumen klebte.
Mein nächster Held war Winnetou. Der edle Rote, den wir nur in schwarz-weiß empfangen konnten, gefiel mir wegen seiner langen Haare und der ruhigen, überlegten Art. Dieser Mann haute nicht auf die Pauke, er rauchte die Friedenspfeife und wurde in Teil drei erschossen. Und das, obwohl ich zum Ende des Films nicht hinsah und mir die Ohren zuhielt. Ich begriff, dass aus mir und Winnetou nichts werden konnte. Jahre später gab ich in Gedanken auch seinem Darsteller den Laufpass, denn ich sah in einem Museum den original Winnetou-Anzug. Der zeigte deutlich, dass Pierre Brice nicht die Größe hatte, die mir bei Männern gefällt. Auch dieser Held schrumpfte bis zur Unkenntlichkeit.
Auf Winnetou und Tony Marshall folgten eine ganze Reihe von Stars und Sternchen, die ich anhimmelte und als meine persönlichen Helden vergötterte: Richard Chamberlain, Pater Ralph und Shogun in Personalunion, gefiel mir wegen seines seelenvollen Blicks und des energischen Auftritts. Irgendwann errechnete ich, dass er fast so alt wie mein Vater und sogar ganze vier Jahre älter als der in Ungnade gefallene Tony Marshall war – also uralt. Lee Majors, der Colt für alle Fälle, konnte genau wie sein Kollege MacGyver fast alles, vor allem aber die Welt und mich vor Unholden retten. Sein Stern sank, als ich feststellte, dass er das schaurige Titellied zur Serie selber gesungen hatte. Und McGyver brauchte ich nicht mehr, als ich endlich ein eigenes Schweizer Taschenmesser bekam.
Natürlich war ich ein vernünftiges Kind und suchte mir auch Helden außerhalb der Traumwelt der Stars. Da war zuerst einmal meine Oma: Die konnte am besten Kirschkerne spucken und Seilspringen, hatte eine Zunge scharf wie ein Rasiermesser und scheute vor keinem Streit zurück. Wir verstanden uns gut. Oma war nichts Menschliches fremd, von ihr wurde ich sorgfältig aufgeklärt – über die Schlechtigkeit der Welt im Allgemeinen und besonders die der Jungs. Sie erteilte mir auch Unterricht im Straßenkampf, denn als die Kleinste in der Nachbarschaft hatte ich es nicht immer ganz leicht. Nachdem Oma mir das mit dem Tritt in die Weichteile erklärt hatte, wurde mein Leben einfacher. Doch irgendwann sah ich auch meine Oma schrumpfen. Zwar war sie immer noch scharfzüngig und streitsüchtig, aber ihr Körper ließ sie im Stich. Sie wurde kleiner und kleiner, bis sie schließlich verschwand. Ich gehe davon aus, dass sie in den Himmel gekommen und dort auf Opa getroffen ist, denn seit ihrem Tod hat die Gewitterhäufigkeit über Norddeutschland fühlbar zugenommen.
Bis ich meinen Vater als Helden akzeptierte, dauerte es sehr lange. Natürlich war er groß und stark, konnte alles reparieren und wusste meistens, was zu tun war. Dass er einen wunderbaren Beruf hatte und ich manchmal heimlich vorne in der Lok mit ihm mitfahren durfte, war toll und der Gedanke daran ist eines meiner Highlights in Sachen Kindheitserinnerung. Trotzdem reichte es einige Jahre bei mir nicht für eine Heldenverehrung: Denn mein Vater war peinlich. Er tat, was ihm richtig erschien, zog sich manchmal unkonventionell bis seltsam an und war einfach anders als andere Väter. Er entsprach nicht der Norm, und was gibt es Schlimmeres für ein pubertierendes Mädchen, als Eltern zu haben, die irgendwie anders sind? Am Ende noch komisch sogar? Die sich unpassende Motorradhelme kurzerhand in Form sägen, Maulwurfvertreibungsmaschinen bauen oder vor lauter Schusseligkeit immer mal wieder versehentlich den Telefonhörer auf die Gabel knallen, anstatt ihn an die wartende Tochter weiterzureichen? Ich war schon über zwanzig, als ich meinen Vater als das akzeptierte, was auch meine Freunde in ihm sahen: eine verdammt coole Socke. An den Gedanken musste ich mich erst einmal gewöhnen. Und als ich so richtig versöhnt mit meinem heldenhaften Vater war, wurde auch er plötzlich kleiner. Er verließ seine Bühne überraschend früh und mit einem Paukenschlag, so wie es zu ihm passte. Mich ließ er fast heldenlos zurück und ich akzeptierte, dass die Zeit der Idole für mich vorbei und ich endgültig erwachsen war. Ich hatte keinen Beschützer mehr, und ich brauchte auch keinen.
Inzwischen bin ich über 40, stehe mit beiden Beinen fest im Leben und bin auf gesunde Weise desillusioniert. Aus Überschwang und Verehrung wurde Realismus, und das ist sicherlich nicht das Schlechteste. Da Tony nicht auf mich gewartet und Oma mich vor den Männern gewarnt hat, bin ich Single geblieben und muss mich nicht mit einem Helden in meinem Schlafzimmer herumplagen.
In meinem Leben gibt es jetzt nur noch eine Heldin, und das ist meine Schwester. Sie kümmerte sich viele Jahre lang liebevoll um unsere Mutter, widmete ihr viel Zeit und Mühen. Denn Mutter war krank, ihre Kräfte schwanden langsam und unaufhörlich. Ich versuchte, ihr von meiner Kraft zu geben, was ich konnte. Es war nicht viel, was ich für sie tun konnte, und deshalb beeindruckte mich der heldenhafte Einsatz meiner Schwester umso mehr. Es ist mir überhaupt nicht peinlich, sie für das zu bewundern, was sie alles geleistet hat. Ich hoffe, dass sie mir noch lange bleibt, und bin bereit, sie bis ans Ende unseres Weges zu verehren. Es sind in meinem Leben genug Idole verschwunden.
Zuckerwatte und Liebesapfel
Kürzlich war ich mit einer Freundin auf einem Festchen. Wir tranken moderat, aßen ein paar Kleinigkeiten und nahmen was zum Naschen mit nach Hause: Antje kaufte Schokoladenpopcorn, ich eine Tüte gebrannte Mandeln. Außerdem gönnte ich mir einen Obstspieß: Weintrauben mit Bitterschokolade drumherum – das esse ich schon immer gerne! Und schon immer ist das eigentlich nicht essbar, denn die Schokolade platzt beim Abbeißen ab und fällt irgendwo hin. Ich fand ein Stück, das mir abhandengekommen war, auf der Heimfahrt wieder: schön verteilt auf Rock und Bluse.
Während wir den letzten Äppler tranken, saßen wir auf einer Bank direkt gegenüber dem Süßwarenstand. Und es kamen Erinnerungen hoch, hauptsächlich an den Oldenburger Kramermarkt: An die roten Liebesäpfel, die meine Mutter uns immer so gerne kaufte, die so hübsch aussahen und mir aber überhaupt nicht schmecken. Schon das knirschende Geräusch, wenn man da reinbeißt – schrecklich! Und wenn einem die roten Stückchen dann auch noch zwischen die Backenzähne geraten, quietscht es! Nein, das war nie mein Fall, meine Äpfel standen immer ein paar Tage angelutscht auf einem Tellerchen herum und wanderten dann in den Müll.
Besser waren Lebkuchenherzen. Die ließ ich zwar immer ewig hängen, was sie unter Garantie nicht besser machte, aber wenn sie dann einmal ausgepackt waren, nagte ich gerne daran herum. Ich hätte auch geteilt, aber meine Familie war der Sache zumeist eher abgeneigt, was wohl auch daran lag, dass ich zuerst tagelang die Dekoration abfummelte und so dafür sorgte, dass wirklich jeder Millimeter des Lebkuchens sorgfältig angegrabbelt worden war.
Am besten aber fand ich auf Jahrmärkten die langen, hohen Zuckerwattehaufen, die damals noch ganz frisch hergestellt wurden und einem kleinen Kind riesig erscheinen mussten. Heute werden sie in Tüten verkauft, sind manchmal bunt und viel fester als früher. Zum Essen ist das praktischer und auch sauberer, aber ganz das Original ist das natürlich nicht.
Ich weiß noch genau, wie ich meine erste Zuckerwatte bekam: Ich wollte eine, weil meine große Schwester eine wollte – essen mochte ich die eigentlich nicht so gerne. Fasziniert sah ich zu, wie die Zuckerwattefrau einen Stängel in die Maschine hielt und sich allmählich ein weißes Gespinst zu der begehrten großen Zuckerwatte formte – wie das geht, habe ich bis heute nicht verstanden. „Machen Sie die mal nicht so groß für die Kleine“, bat mein Vater und ich wollte gerade aufbegehren, als die Dame sagte: „Ach, jetzt ist sie schon groß, wollen Sie die trotzdem?“ Und so trug ich stolz meine gigantisch große, fluffige Zuckerwatte über den Kramermarkt. Eine Seite sabberte ich etwas an, irgendwo in der Mitte, was die Sache instabil machte. Und dann, als wir schon zum Auto gingen, titschte ich mit meiner Süßigkeit an den Wollmantel eines vor mir laufenden Herrn. Meine eifrig herbeigeeilte Mutter konnte nicht verhindern, dass die Hälfte meiner Watte abriss und wie eine Klette an dem Mann hängenblieb. Und da der Mann deutlich schneller lief, als meine Mutter das konnte, nahm er meine Watte mit. Damals fand ich das blöd, heute muss ich bei dem Gedanken, dass der arme Mann sich wahrscheinlich mit dem Wattehaufen im Kreuz in sein Auto gesetzt hat, ein bisschen kichern: was für eine Schweinerei! Der Rest der Watte wurde übrigens nie gegessen, sondern landete neben dem Liebesapfel auf einem kleinen Teller.
Tanzkurs 1985
Es gibt Dinge, an die erinnert man sich mit Grausen: die Blinddarmentzündung zu Beginn der Sommerferien, die Rundfahrt auf der Ostsee, bei der ich so spucken musste, oder Birnen mit Bohnen und Speck. Zu den Erlebnissen, die bei mir heute noch ein ungläubiges Kopfschütteln hervorrufen, gehört der Tanzkurs, den ich irgendwann so mit 14 oder 15 absolvieren musste. Denn das, was eigentlich Spaß machen sollte, war der absolute Horror: gut gemeint, aber schlecht gemacht.
Ich komme aus einem kleinen, verschlafenen Ort in Norddeutschland. Dort gab es in den 80er Jahren nicht viel, doch wir hatten die größte Schule der Umgebung, einen wirklich guten Sportverein und Norddeutschlands größte Freiluftarena. Und es gab den „Hof von Oldenburg“, ein Hotel mit Restauration, das seinen Saal regelmäßig Oldenburger Tanzschulen zur Verfügung stellte. Aus irgendeinem Grund war es nämlich Tradition, dass die ungelenke Dorfjugend im Jahr nach der Konfirmation einen Tanzkurs besuchte. Das machten fast alle, und was ein Ausscheren aus diesem Irrsinn noch schwieriger machte, war die Tatsache, dass meine Eltern das Gehoppel befürworteten und meine große Schwester schon mit viel Enthusiasmus ebenfalls einen solchen Kurs absolviert hatte.
Ich wurde also nicht groß gefragt und fand mich an einem Herbsttag im ungeheizten Tanzsaal des Dorfhotels wieder. Die dort angetretenen Jugendlichen gehörten zu den noch recht geburtenstarken Jahrgängen 1969/70, der Kurs war also sehr groß. Ein besonderes Phänomen bei uns war, dass wir viel mehr Mädchen als Jungs hatten. Das zog sich durch die gesamte Schulzeit, und im Tanzkurs drückte sich das ganz besonders drastisch in einem Verhältnis von zwei Mädchen auf einen Jungen aus. Wir Mädchen waren also von vorneherein unter Druck: Schließlich drohte am Ende des Kurses der Abtanzball, und für den brauchte man einen Partner. Am besten auch noch einen, der nicht anderthalb Köpfe kleiner war als man selber.
Ja, die Größe – auch das war so eine Sache. Es war mir nie einsichtig, warum man den Hoppelkurs unbedingt zu diesem Zeitpunkt machen musste: Mitten in der Pubertät, wo bei vielen das Selbstbewusstsein am Boden liegt, die jungen Mädchen ausgewachsen und schon recht fraulich, die Jungs aber noch kleine, kindliche Wichte sind. Die meisten Paare sahen mehr als seltsam aus, und viele der armen Jungen, die das Führen übernehmen sollten, konnten ihren Partnerinnen kaum über die Schulter gucken. Folglich glichen Wiener Walzer und Foxtrott oft eher einem Ringkampf als einem Tanz, weil die Mädchen die Lage überblicken konnten und die Führung übernahmen, die Jungs sich das aber nicht bieten lassen wollten.