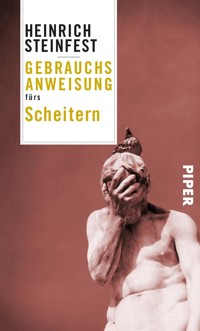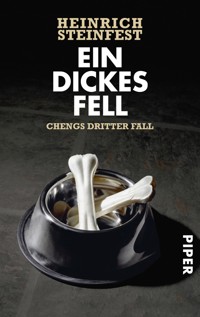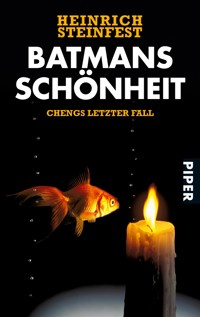9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Meisterpolizistin Lilli Steinbeck hat eine Vergangenheit namens Ivo. Eine traurige Vergangenheit, der sie ihre Klingonennase verdankt. Jahre später bekommt diese Vergangenheit plötzlich Gegenwart eingehaucht, als Ivo durch einen rätselhaften Auftrag aus seinem beschaulichen, aber lillilosen Leben als Baumheiler in der württembergischen Provinz gerissen wird. Er soll für ein Pharma-Unternehmen einen Baum aus der sibirischen Tundra holen. Als Helfer stellt man ihm den rotbemützten Knaben Spirou zur Seite, der nicht nur zufällig so heißt wie eine sehr bekannte belgische Comicfigur … Ihr Auftrag führt Ivo und Spirou in eine unterirdische Verbrecherrepublik – und vielleicht brauchte es genau diesen Umweg auf der Suche nach dem Wunderbaum, damit Ivo Lilli noch einmal begegnen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2011
ISBN 978-3-492-95373-3
© Piper Verlag GmbH, München 2011
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere München
Umschlagmotiv: gallerystock / jonathan minster
Die Orte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Rom: Der Ort, an dem sich Lilli und Ivo erstmals begegnen. Ein Ort, dessen Luft mit bewußtseinsverändernden Giftstoffen angereichert scheint, die von exorzistischen Praktiken des Vatikans herrühren könnten.
Giesentweis: Ort mit Schnee.
Warschau: Großer Ort mit Schnee.
Ochotsk: Kleiner Ort ebenfalls mit Schnee. Verwunschene Ansiedlung an der Nordwestküste des Ochotskischen Meers, die ihre besseren Zeiten hinter sich hat. Vom einstigen Kosakenlager über eine gewisse sowjetische Bedeutung zur neurussischen Depression. Aber nicht ohne Charme, wie so viele Alpträume.
Dschugdschur: Der Dschugdschur, Gebirgsgegend, halb so groß wie Deutschland, jedoch frei vom Tourismus. Beinahe frei. Offiziell dreitausend Bewohner, die man erst einmal aufstöbern muß.
Toad’s Bread:
Die Personen in der Vergangenheit
Lilli Steinbeck: Frau mit einem unsichtbaren Pfeil in der Brust. Zudem trägt sie in ihrem Gesicht eine verunfallte Nase, als Zeichen eines tiefen Schmerzes. Eines Schmerzes, den Lilli niemals vergessen möchte.
Ivo Berg: Mann mit einem unsichtbaren Pfeil in der Brust. Einst blind. Dann sehend. Mittlerweile Baumpfleger, der mit Bäumen redet. Erhält einen Auftrag, der ihn nach Russisch-Fernost führt. – Aufträge kommen in die Welt, damit die Welt kompliziert wird.
Dr. Kowalsky: Notar in Giesentweis. Sammler christlicher Kunst. Desillusioniert, was das menschliche Wesen betrifft. Er wird es sein, der Ivo Berg den Auftrag übermittelt.
Marlies Kuchar: Die Vererberin. Vermacht Lilli ein Haus. Damit beginnt das Unglück. Denn in jedem Erbe steckt das Unglück wie ein schlagendes Herz.
Moritz: Ein Junge aus Giesentweis. Wird von Ivo Berg unerbetenerweise gerettet. Dementsprechend sehen die Folgen dieser Rettung aus.
Eila von Wiesensteig: Freifrau und Freidenkerin. Eine Figur aus dem Roman Ein sturer Hund
Die Personen in der Gegenwart
Spirou: Dreizehnjähriger Junge aus Ochotsk, elternlos, lebenserfahren, dient Ivo Berg als Führer. Trägt zu jeder Zeit ein rotes, fleckiges Pagenkostüm und spricht perfekt Deutsch. Beides, wie auch sein Name, ist dem leidenschaftlichen Studium von Band 13 der Comicserie Spirou und Fantasio zu verdanken.
Professor Oborin: Naturwissenschaftler, Mystiker, aber nicht Magier, vor allem Telephonspezialist.
Galina Oborin: Des Professors Tochter, ihres Zeichens Suppenköchin, zudem taubstumm, sagt man. Aber was sagt man nicht alles?
Lopuchin: Gehört zur Fraktion der »Superschurken«, fungiert als der »Zar« von Ochotsk, gibt sich bösartig und charmant und pflegt die Unart, seine Lieblingsfeinde mit einem Stigma aus fünf kleinen Wunden zu versehen.
Spiridon Kallimachos:
Die Personen in der Zukunft
Kommissar Yamamoto: Seines Zeichens moderner Samurai. Vertritt die alte Bushidô-Anschauung, der Weg des Kriegers liege im Sterben. Doch in Toad’s Bread zu sterben ist gar nicht so einfach.
Madame Fontenelle: Französin in Toad’s Bread. Siebzigjährig, elegant, kämpferisch, gelenkig, eine steinfeste Frau. Darauf bedacht, das Geheimnis der Stadt auch als ein solches zu bewahren.
Dr. Ritter: Ungar in Toad’s Bread. Zahnarzt. Daneben Mitarbeiter von Madame Fontenelle. Mit einer Narbe an der Wange, die genauso aussieht wie die von Ivo Berg.
Giuseppe Tyrell: Erinnert an James Mason, ist aber der Puppenmacher in dieser Geschichte. Ein herrschaftlicher Mann im Smoking. Fertigt Ongghots an, schamanistische Fellpuppen. Daneben unternimmt er es, seine Kundschaft phototechnisch zu dokumentieren.
Breschnew/Romanow:Der
Die Pilze, die Tiere und die Pflanzen
Amanita muscaria: Besser bekannt als Fliegenpilz, nicht so bekannt unter dem Begriff Krötenbrot (Toad’s Bread). Gibt also der Verbrecherrepublik seinen Namen. Und bewirkt auch sonst viel Gutes.
Das Schneeschaf: Wildes Schaf im Nordosten Sibiriens, Opfer unsinniger Jagdleidenschaft.
Die Dahurische Lärche:
I
Vergangenheit
– Sind Sie verletzt, Madam?
– Ich bin tot, Sir.
– Tot. Das ist ernst. Kann ich helfen?
– Werden Sie mich heiraten?
– Madam, ich täte es mit Freuden,
aber ich fürchte, ich habe mir den Knöchel verstaucht.
(Billy Zane und Tilda Swinton in Sally Potters Film Orlando)
Oft nehmen wir auch nicht einmal wahr, daß wir im Inneren gar so blind sind.
(Thomas von Kempen, Die Nachfolge Christi)
1
Jeder Mensch stirbt zweimal. Bekanntermaßen am Ende seiner Jahre, aber auch irgendwann zwischendrin. Das hat aber überhaupt nichts mit jenem James-Bond-Titel zu tun, der uns weiszumachen versucht, man würde zweimal leben. Denn zwischen Leben und Sterben gibt es ja wohl einen Unterschied. Wenn man stirbt, ist man nachher auch tot. Ein zweites Mal zu sterben bedeutet nicht automatisch, auch ein zweites Mal zu leben. Nein, leben tut man nur einmal.
Manche bemerken diesen ersten Tod augenblicklich, andere nach und nach. Meistens tritt er ein, wenn man von einer so absoluten wie schmerzhaften Erkenntnis ereilt wird, ganz wie ein Pfeil, der mitten in die Brust geht und einen tötet. Man läuft den Rest seines Erdendaseins mit diesem Pfeil in der Brust durch die Gegend. Das ist nicht nur ein Bild. Dieser Pfeil steht einem tatsächlich im Wege, beim Arbeiten, beim Faulenzen, beim Liebemachen. Erst recht, wenn auch die andere Person, mit der man da zusammenliegt, einen solchen Pfeil in der Brust trägt. Man kann sich drehen und wenden, wie man will, die verrücktesten Stellungen ausprobieren, zum Therapeuten gehen, Sport treiben, Gewicht verlieren, in den Bauch statt in die Brust atmen, Faktum bleibt, da ist ein Pfeil und dort ist ein Pfeil und die Umständlichkeit beträchtlich.
Natürlich, man gewöhnt sich an den Pfeil, an die Komplikationen, die er verursacht. Nicht wenige Menschen machen aus der Not eine Tugend und sprechen von Überwindung, von Heilung, von Lebensmut. Sie betteln richtiggehend darum, von weiteren Pfeilen getroffen zu werden, um sich unentwegt überwinden und heilen zu können. Aber so, wie es heißt, jeder Mensch müsse irgendwann einmal sterben, stirbt jeder Mensch eben bloß zweimal und nicht etwa, so oft es ihm paßt.
Im ersten Teil eines zweiteiligen Auf-der-Erde-Wandelns läuft man dem Pfeil entgegen, man ist, in anderer Bedeutung der Formulierung, ein »bewegliches Ziel«, das sich unwillentlich in die Flugbahn eines Pfeils stürzt. Manche können sich hinterher kaum noch daran erinnern, wie das war, so ganz ohne das Ding in der Brust. Einige idealisieren diese Zeit. Andere wiederum meinen – um den Pfeil besser auszuhalten –, daß diese Zeit gar nicht so schön war und daß die, die so gerne daran zurückdenken, alles nur verklären.
Ivo Berg gehörte zu den aufgeklärten Verklärern. Er verklärte, was es verdient, verklärt zu werden. Er war unmodern, aber nicht ungebildet. Er wäre nie auf die Idee gekommen, die Schönheit der Heiligen Jungfrau so darzustellen wie Max Ernst, der uns eine ungehaltene Maria präsentiert, die dem Christuskind den Hintern versohlt, bis dieser rot glüht. – Das ist ein geniales Bild, keine Frage. Ivo erkannte das unübersehbar Geniale, mochte es aber trotzdem nicht. Statt dessen Raffael. Ivo war ein Raffaelmensch.
Darf einer sagen, er hätte in seinem Leben echtes Glück erfahren?
Ivo Berg durfte es. Er konnte das allen Ernstes von sich geben. Nicht einfach nur behaupten, weil man denkt, das Haus der Eltern geerbt, die Tochter des Chefs geheiratet, ein paar stramme Kinder in die Welt gesetzt zu haben, bei der Besetzung eines Postens anderen vorgezogen worden zu sein, dies und anderes würde echtes, wahres Glück bedeuten.
Diesen Irrtum beging er nicht. Er war dem Glück begegnet, wußte, wie es schmeckt, wie es riecht, wie es sich anfühlt und daß es vor allem nicht umsonst ist. Man muß es bezahlen. Auf eine gewisse Weise bezahlt man es mit dem eigenen Leben, mit dem, was vom Leben übrigbleibt, wenn das Glück wieder gegangen ist. Und daß das Glück geht, daß es verschwindet, ist wahrscheinlich sein wesentlichster Zug. Ohne diesen Plan des Verschwindens könnte es gar nicht existieren. Das Glück geht, der Pfeil kommt.
Doch solange das Glück da ist, ist man so blind und blöd davon, daß man nicht begreift, es sei einem nur darum widerfahren, weil man zu denen gehört, die es nicht festhalten können. Die, die dazu in der Lage wären, es festzuhalten, toughe, smarte, praxisorientierte Charaktere, wie man so sagt, lebenstüchtige Menschen, um die herum macht das wahre Glück einen großen Bogen, und es ist bloß ein gefälschtes Glück, das sich hergibt, solchen Leuten zu begegnen.
Paradoxerweise sind es also die von Natur aus eher unglücklichen und schwermütigen und in ihren Ängsten gefangenen Gemüter, die sich eignen, echtes Glück zu erfahren.
Ist das Glück darum bösartig zu nennen? Hinterlistig? Ivo hätte geantwortet: Na, das kann man wohl sagen!
Doch wäre er nochmals vor der Wahl gestanden, diesmal wissend … keine Frage, er hätte sich erneut in die Katastrophe begeben und dankbar sein Schicksal angenommen.
Das Glück ist verrückt nach solchen Leuten wie Ivo. Solche Leute sind Leckerbissen für das Glück. Das Glück frißt sie mit Haut und Haar und spuckt nachher ein paar Knochen aus.
Und genau so, mußte man sich vorstellen, sah dieser Mann aus: ein paar ausgespuckte Knochen. Nicht, daß er unattraktiv gewesen wäre, aber es waren eben allein Knochen, aus denen sein attraktives Äußeres sich zusammensetzte. An ihm klebte das durch das Glück geborene Unglück und verlieh ihm eine Aura. Die Frauen sagten gerne: Er hat so traurige Augen. Diese traurigen Augen waren geradezu eine Eintrittskarte in die Herzen vieler Frauen. Sie wollten von diesem Mann verstanden werden. Nicht, daß das seine Spezialität war, diese Verstehensschiene. Aber die Frauen glaubten es, weil sie den Schatten in seinen Augen so mochten.
Als er Lilli Steinbeck das erste Mal begegnete, war er gerade blind. Oder wenigstens fast blind. Damals in Rom, Ende der Achtziger. Ein Jahr zuvor hatte sich Ivo auf einer Pakistanreise eine unspezifische Krankheit zugezogen und war daraufhin mehrere Monate Patient gewesen. Am Ende dieser Leidenszeit, als die Fieberschübe, die massiven Ausschläge, der Druck auf die Lunge, ja sich die Lebensgefahr gelegt hatten, war gleich einem erstaunlichen Nachwort – als wollte das Nachwort die eigentliche Geschichte übertreffen – etwas eingetreten, das die Mediziner als idiopathischen Blepharospasmus bezeichnen, eine Form des Lidkrampfs, deren Ursache allgemein als uneindeutig gilt. Zwar bot sich in Ivos Fall aufgrund der Virusgeschichte ein Infektionsherd als Auslöser an, aber der behandelnde Arzt meinte, er würde eher einen psychischen Hintergrund vermuten, eine posttraumatische Erscheinung. Eine Reaktion auf das Kranksein an sich, die Todesnähe, die Ivo seiner pakistanischen »Eroberung« verdankt habe.
Es war nicht so, daß er die ganze Zeit die Augen geschlossen hatte. Gemäß dem gängigen Krankheitsbild besserte sich der Zustand während der Nachtzeit. Allerdings wurde Ivo gegen Abend hin ungemein müde, müde vom Tage, von der vormittäglichen Blinzelei und dem nachmittäglichen völligen Augenverschluß, und anstatt also die Besserung zu genießen, schlief er immer sehr rasch ein, um sich dann während des Schlafs Angstträumen vom dauerhaften Erblinden hinzugeben. Nur beim Frühstück, da ging es gut. Doch spätestens gegen die frühe Mittagszeit hin wiederholte sich das Drama. Er war ab dann gezwungen, sein verkrampftes Antlitz hinter der größtmöglichen Sonnenbrille zu verbergen. Außerdem benötigte er Hilfe, da er vermeiden wollte, gleich einem perkussiven Wünschelrutengeher mit einem Stock herumzulaufen und die Häuserwände und Gehwege abzuklopfen. Er war ja nicht wirklich blind, sondern nur unfähig, seine Lider zu öffnen. Zudem hatte ihm der Arzt versichert, die Sache würde sich wieder geben, denn eine erbliche Vorbelastung, wie sie oft bestehe, sei in seinem Fall auszuschließen. – Freilich fragte sich Ivo, wie der Arzt da so sicher sein konnte, wo doch er selbst, Ivo, nicht mal über seine Urgroßmutter Bescheid wußte. Andererseits wollte er dem Fachmann gerne glauben. Zudem existierte eine Therapieform, nämlich die Behandlung mit Botulinumtoxin – richtig, das Zeug gegen die Falten! –, die als äußerst vielversprechend galt. Nur wollte man damit noch warten, bis die anderen Folgen des pakistanischen Virus vollständig ausgeheilt waren. Es war ein Krieg an vielen Fronten.
Um nun also ohne Stock oder Hund oder dank einer mühsam eingeübten Schrittfolge durch die Stadt zu gelangen, wechselten sich ein paar gute Freundinnen ab, die Ivo an den Arm nahmen und ihm halfen, sich dort hinzubegeben, wo er sich hinbegeben wollte. Im Grunde besaß er bereits damals – obgleich noch jung, nämlich zweiundzwanzigjährig, obgleich noch kein einziges Mal gestorben – diesen Charme trauriger Augen. Die meisten Frauen verfügen diesbezüglich über einen Röntgenblick, mit dem sie nicht nur durch schwärzeste Sonnenbrillen sehen können, sondern eben auch durch geschlossene Lider. Kein trauriges Männerauge entgeht einer schauenden Frau.
In dieser Zeit in Rom gehörte Ivo zu einer Clique deutschsprachiger Studenten, die, mit Stipendien ausgestattet, ihre Gastsemester absolvierten und jene Leichtigkeit genossen, die ihnen an Orten wie Wien oder Klagenfurt oder München oder Zürich bislang verwehrt geblieben war. Zumindest wirkten sie alle sehr ausgelassen, beschwingt und tänzerisch, auf eine Weise betrunken, daß man schwer sagen konnte, wovon eigentlich. Vielleicht vom Alkohol, vielleicht auch von der Luft in den Straßen, die mit dubiosen, bewußtseinsverändernden Giftstoffen angereichert schien. In der Tat, wenn man sich ein bißchen übergeschnappt fühlen wollte, ging man einfach nach draußen und atmete tief ein. Es waren nicht nur die Abgase, sondern … vielleicht das Zeug, das vom Vatikan herübergeweht kam. Und wirklich meinten einige, dies würde von den exorzistischen Praktiken, von den vielen Kräutern, die man dort verbrannte, herrühren. Egal, die römische Luft hatte es jedenfalls in sich.
Ivo selbst war kein Student, sondern lebte hier nur, weil seine Eltern es taten. Steiermärker, die nach Wien und dann nach Rom gegangen waren, um ein Import-Export-Geschäft zu betreiben. Ivo würde niemals richtig sagen können, was da eigentlich importiert und exportiert wurde. Für ihn standen seine Eltern ein Leben lang hinter einem Schleier … nein, Schleier ist ein viel zu poetisches Wort. Die beiden waren keine Schleierleute. Daß ihre Gestalt und ihr Wesen sowie ihr Import und Export so unklar blieben, war dem Stahlbeton zu verdanken, hinter dem sie sich stets aufzuhalten pflegten.
Ivos Vorhaben hingegen bestand darin, als weltreisender Forscher in die Geschichte einzugehen, ohne sich zuvor die Mühen einer akademischen Ausbildung angetan zu haben. Es ging ihm ja nicht darum, eine ethnologische Studie zu verfassen. Er war überzeugt davon, fast alles im Leben sei eine Sache des Instinkts, der Eingebung, nicht zuletzt des Mutes, der Entschlossenheit, Dinge zu tun, die andere für absurd oder kindisch hielten. Sein Plan gipfelte jedenfalls darin, irgendwann einmal auf etwas Unbekanntes zu stoßen, am liebsten ein Tier, das noch nie jemand gesehen hatte, oder ein mysteriöses Artefakt. – Nun, immerhin hatte er es bereits zu einer recht unspezifischen Krankheit gebracht, was aber leider nicht ausreichte, sich einen Namen zu machen. Es sind zumeist die Ärzte, nach denen Krankheiten benannt werden, nicht die Patienten. Was eigentlich ein Skandal ist.
An diesem Tag gegen Ende des Sommers, als in der Luft der Anteil an vatikanischen Substanzen seinen Höhepunkt erreichte, hing Ivo am Arm einer Freundin und ließ sich von ihr in eins der bevorzugten Cafés führen. Welches natürlich an einer stark befahrenen Straße gelegen war, des bewußtseinserweiternden Gestanks wegen. Es war Nachmittag, und Ivo hätte eine Zange benötigt, um seine Augen aufzukriegen.
Ob ihm das nun recht war oder nicht, sein Gehör war in dieser Zeit natürlich besser und besser geworden. Es fungierte als der Blindenstock in seinem Kopf, der die Stimmen und Geräusche abklopfte und die ganz bestimmte Konsistenz und Zusammensetzung des jeweiligen »Objekts« erkannte. Nicht, daß Ivo begann, am Auspuffgeräusch die Automarken auseinanderzuhalten, aber er registrierte früher als andere, wenn etwa zwei Leute demnächst zusammenstießen. Er hörte ihre Schritte und sah vor seinem geistigen Auge die aufeinandertreffenden, in der Kollision sich vereinigenden Linien. Manchmal sagte er »Vorsicht!« oder eben »Attenzione!«, aber wenn er dies tat, verhinderte er in der Regel den Zusammenstoß. Die Leute blieben also stehen, starrten ihn an und fragten sich, was mit ihm los sei. Er spürte diese fragenden Blicke. – So ist das, wenn man ein Unglück voraussieht. Darum läßt man es meistens bleiben. So, wie man es ja auch bleiben läßt, einen Tyrannen zu morden, bevor der noch zum Tyrannen wird. Täte man es doch, niemand würde einen verstehen. Leute, die zur rechten Zeit ein Unglück verhindern, stehen im Verdacht, verrückt zu sein. Die Irrenhäuser sind voll mit Leuten, die ein Unglück verhindert haben und jetzt dafür bestraft werden.
Er konnte bereits aus der Entfernung feststellen, welche von seinen Bekannten hier am Tisch saßen, beziehungsweise bemerkte er die eine Stimme, die neu war, bevor noch jemand auf die Idee kam, ihm die Person vorzustellen, die zu dieser Stimme gehörte.
Im Dunkel seiner heruntergelassenen Augenlider erkannte Ivo das milde, flammenartige Licht dieser einen Stimme. Mild, aber Licht genug, um die Dunkelheit aufzuhellen, während alle anderen Stimmen, da mochten sie noch so kräftig oder laut sein, die Wirkung einer schwarzen Feder inmitten eines Krähenvogels besaßen.
»Ivo, das ist Lilli, eine Freundin aus Wien, sie ist gerade angekommen«, sagte die Frau, die von allen Joe genannt wurde, nicht, weil sie wirklich so hieß, sondern weil es zu den Prinzipien dieser Clique gehörte, daß jeder seinen Namen auf drei Buchstaben verkürzte oder, wenn das nicht ging, sich einen neuen, eben dreiletterigen Namen aussuchte.
Ivo hatte den Vorteil, schon immer so geheißen zu haben.
»Lil also«, sagte er.
»Richtig«, sagte die Frau, die Lilli hieß und die offensichtlich besagte Regel bereits kannte.
Dann gab sie ihm die Hand. Das ist wörtlich zu nehmen. Sie gab sie ihm wirklich. So daß er den Eindruck hatte, eine ganze Weile nur allein diese eine Hand zu halten und sich auf eine Weise damit vertraut machen zu können, die geeignet war, von der Hand auf den Rest schließen zu lassen, von den dünnen, langen, sehr geraden Fingern auf einen ebensolchen Körper, ebensolche Gesichtszüge, ein ebensolches Wesen. Finger, die sich weniger nach Fleisch und Knochen und Sehnen, nach dieser Angespanntheit alles Körperlichen anfühlten, sondern eher nach Kunststoff, aber dem feinsten und ausgeklügeltsten, der sich denken läßt. In diesem ersten Moment fühlte sich Ivo an eine lebendig gewordene Schaufensterpuppe erinnert, an eine Figur aus Plastik, die ein vergnügter Gott erweckt hatte, ohne jedoch die Vorteile des Plastiks zu opfern, seine chemische und sonstige Beständigkeit, seine Elastizität, seine Härte, seine Modernität, seinen hohen Entwicklungsstand. Zudem lag ein beträchtliches Empfinden in diesem unempfindlichen Stoff. Schon möglich, daß dieser Frau weder große Kälte noch große Wärme etwas anhaben konnten, aber sie war durchaus empfänglich dafür, wie da jemand ihre Hand festhielt.
Im konkreten Fall viel zu lange natürlich, was nur darum funktionierte, weil Ivo praktisch als blind gelten durfte. Und es ist nun mal weitgehend akzeptiert, wenn Blinde die Hände ihrer Gegenüber intensiver befühlen, um sich nämlich ein Bild zu machen, wo ein Bild fehlt.
Andererseits war Ivo Berg kein netter alter Mann mit drei gelben Punkten am Oberarm, der sich alles herausnehmen durfte, was er für nötig hielt. Es wäre unhöflich gewesen, diese Hand nicht mehr herausrücken zu wollen. Darum zeigte er sich einsichtig, löste seinen Griff und gab der Frau ihre fünf Finger zurück.
Man kann sagen: Ivo Berg war sofort verliebt.
Allerdings nicht ganz frei von Zweifeln. Wobei sich der Zweifel in keiner Weise auf das eigene Verliebtsein bezog, sondern das Aussehen der Frau betraf, von der er ja nur die Stimme sowie ihre auf eine warme Weise kalte Plastikhand kannte. Aus der kleinen Flamme, die in der Dunkelheit seines Betrachtens flackerte, war die schlanke Gestalt einer Person erwachsen, deren Vorstellung ihm einen Stich ins Herz versetzte.
So ein Stich ist nicht ohne. Man blutet nachher ziemlich stark, kann sich aber gleichzeitig nichts Schöneres im Leben denken als dieses Bluten, dieses geöffnete Herz. Mit einem Pfeil hat das nichts zu tun. Das Loch im Herzen tötet einen nicht, eher bringt es einen auf die Welt.
Wäre Ivo dazu in der Lage gewesen, hätte er jetzt die Augen aufgeschlagen wie soeben geboren.
Dann aber kam ihm der Gedanke, ob es nicht viel besser wäre, tatsächlich blind zu sein, und zwar für alle Zeiten. Um nämlich diese Frau niemals in natura sehen zu müssen. Denn Ivo hätte sich gerne erspart, feststellen zu müssen, wie wenig seine von einer Flamme getragene Einbildungskraft mit der Realität übereinstimmte. – Man kennt das von Leuten, die von hinten betrachtet, in ihrem Sportwagen sitzend, in ihrem Taucheranzug, inmitten eines Fernsehstudios, über ein Klavier gebeugt, an solchen Orten und in solchen Positionen also in einer Weise erscheinen, die sie, sodann von vorn gesehen, ohne Sportwagen, ohne Taucheranzug, ohne die Strahlkraft medialer Räume und prachtvoller Musikinstrumente, nicht mehr erfüllen. Jetzt ganz zu schweigen von denen, die im Smoking so toll ausschauen und in der Unterhose so deprimierend.
Darum war es Ivo sehr recht, in den nächsten Wochen dieser Frau, die Lilli Steinbeck hieß, aber von allen hier nur noch Lil genannt wurde, ausschließlich an den Nachmittagen und Abenden zu begegnen, in Person des blinden Mannes, der er dann zu sein pflegte. Vormittags waren seine Freunde ja mit ihren universitären Angelegenheiten beschäftigt oder gaben dies wenigstens vor, während er selbst, der auf Eis gelegte Weltenbummler, die frühen Stunden dazu nutzte, zunächst einmal ausgiebig zu frühstücken.
Nicht, daß seine Eltern es gut fanden, einen Taugenichts zum Sohn zu haben, der nicht einmal bereit war, sich mittels eines Studiums oder einer künstlerischen Karriere eine Tarnung zu verleihen. Andererseits waren sie derart in ihre geschäftlichen Aktivitäten eingesponnen, daß sie keine Zeit fanden, ihn aus der Wohnung zu werfen und die monatlichen Zuwendungen zu streichen. Vielleicht scheuten sie auch die Konfrontation mit ihrem mißratenen Kind.
Jeden Tag nach dem Frühstück studierte Ivo die Karten der entlegenen Gegenden, die er demnächst bereisen wollte. Mittags erblindete er, und nachmittags saß er im Café. Wo es für ihn keine größere Freude gab, als Lils Stimme zu hören und im Geiste ihre helle, marianische, ihre gotische Erscheinung zu betrachten: das Langhalsige, das Gestreckte, die plastikhafte Zartheit, das Weißliche ihrer Haut, ihren insgesamt skulpturalen Ausdruck.
Es lag für Ivo Berg überhaupt kein Widerspruch darin, daß diese Frau, deren Aussehen er mit dem sogenannten »weichen Stil« der Kunst um 1400 in Verbindung brachte, allein deshalb nach Rom gekommen war, um an diesem Ort ihre kriminologischen Studien fortzusetzen, die sie an der Katholischen Universität von Mailand begonnen hatte. Lil schrieb eine Arbeit über »System, Nährboden und stammesgeschichtliche Einordnung von Entführungsdelikten« und untersuchte dabei die gesellschaftlichen Strukturen, die das gewerbsmäßige Kidnappen von Menschen begünstigten. Daß sie sich zu diesem Zweck in Italien immatrikuliert hatte, braucht nun wirklich niemand zu erstaunen. Wobei ihr die italienischen Verhältnisse nur als Modell dienten, um eine gesamteuropäische Entwicklung zu analysieren und eine Parallele zu mehr oder weniger legalen ökonomischen Prozessen herzustellen. Sie war eine Anhängerin der Anschauung, daß in allem – ob beim Verkauf von Hühnerfleisch oder beim Verkauf von Menschenleben – der gleiche Wurm steckte und man folglich eine korrekte systematische Einordnung dieses Wurms und seiner Varianten vornehmen mußte. Sie erklärte in der Tat gerne, eine »biologische Kriminologie« zu betreiben, den Begriff des Stammesgeschichtlichen also nicht nur ethnologisch, sondern auch in einem evolutionären Sinn zu verstehen. Wie Lil überhaupt das Verbrechen als Teil des Natürlichen empfand. Nicht minder freilich die Arbeit der Polizei und der Justiz. Sie nannte es den »Kampf der Gene«. Der »ideale Polizist« erschien als Antwort auf einen Krankheitserreger und bildete den militärischen Arm der Moralität. Während wiederum die korrupten Teile der Exekutive, die korrupten Teile der Justiz von der Kraft jener Erbfaktoren zeugten, die das Verbrechen hervorbrachten und bei denen es sich natürlich um die ursprünglicheren handelte. Man konnte gewissermaßen sagen, der Mensch stamme nicht vom Affen, sondern vom Verbrechen ab.
Was auch immer Lil da ausbrütete, Ivo fand es so betörend wie logisch, daß diese »Madonna«, die da im Dunkel seines Kopfes weißlich glühte, sich mit derartigen Themen beschäftigte. Daß also ausgerechnet sie die Abgründe des Lebens erforschte, anstatt wie die meisten anderen aus der Studentengruppe Kunstgeschichte oder ähnliches zu studieren. Nun, Lil selbst war ja ein Kunstwerk und hätte also sich selbst studieren müssen, was aber Kunstwerke nicht tun. Eine Madonna schaut sich nicht in den Spiegel, sie ist der Spiegel. Daß Lil sich mit dem Elend dieser Welt auseinandersetzte, und zwar nicht in einer rührseligen Weltrettermanier, sondern wissenschaftlich und kalt und analytisch, machte sie perfekt.
Doch dann passierte, was Ivo so gefürchtet hatte: Er wurde gesund.
Im ersten Moment bemerkte er es gar nicht, weil er ja starke Sonnenbrillen trug und sich praktisch eine Überschneidung des Bildes in seinem Kopf mit dem Bild der Realität ergab. Nur daß natürlich die Lil, die jetzt hinter den eingefärbten Gläsern zu erkennen war, weniger hell erschien als jene in seiner Einbildung.
Als Ivo begriff, was geschehen war, reagierte er auf das ungewollte Öffnen seiner Lider, indem er sie sofort wieder schloß. Doch eine Lösung war das nicht, und darum erschien er bereits am nächsten Tag ohne Brille, erschien sehenden Auges, wobei ihm vorkam, als würde nicht er Lil zum ersten Mal zu Gesicht bekommen, sondern als verhalte es sich genau umgekehrt. Als hätte erst seine Heilung bewirkt, für alle sichtbar zu werden und nicht nur aus einer übergroßen Sonnenbrille zu bestehen.
In jedem Fall war es so, daß Lils Aussehen durchaus mit dem übereinstimmte, was ihre Stimme und die Information ihrer Hand suggeriert hatten. Nur, daß sie nun angezogen vor Ivo stand, modisch gekleidet, während sie in seiner Einbildung ohne Kleidung gewesen war, zwar nicht nackt im herkömmlichen Sinne, sondern eben unangezogen, was ein Unterschied ist, wenngleich ein schwer erklärbarer.
Gar keine Frage, Lil war die bestgekleidete Frau, die Ivo je gesehen hatte, und würde es auch für immer bleiben. Dabei hatte sie zu dieser Zeit noch gar nicht das Geld, sich Designerkostüme zu leisten. Aber woher auch immer diese Kleider und Blusen und hohen, leichten Schuhe, diese Handtaschen und Tücher und dieser einfache, aber elegante Schmuck herstammten, wer auch immer all das vorher getragen haben mochte, an Lil wirkten die Stoffe und Gegenstände wie aus ihr herausgewachsen, als ein kreatürlicher Teil ihrer Schönheit. – Bei einer Madonna aus Sandstein ist ja nicht nur die Haut aus Sandstein, sondern ebenso das Kleid, der Umhang sowie das Christuskind in ihren Armen.
Die Enttäuschung, die sich nun für Ivo ergab, betraf seine eigene Person. Er spürte deutlich, wie sehr seine völlige Gesundung auch eine beträchtliche Einbuße mit sich brachte. Denn auch wenn behauptet wird, Frauen würden vor allem anderen durch ihr Aussehen, ihre optischen Merkmale bestechen wollen, dürfte noch viel mehr der Umstand gelten, daß sie am liebsten von Männern bewundert werden, die sie gar nicht sehen können. Jedenfalls meinte Ivo bei sämtlichen weiblichen Mitgliedern seiner Clique eine gewisse Ernüchterung festzustellen. So wie umgekehrt bei den Männern eine Erleichterung. Endlich war wieder Waffengleichheit hergestellt. Ivo war auf seine Basis zurückgeworfen worden, auf den simplen Umstand, ein hübscher Kerl zu sein, der mit Hilfe von ein paar Retuschen gewiß auf einem Unterwäschebild von Calvin Klein hätte posieren können. Aber da war er eben nicht der einzige. Sosehr ein Waschbrettbauch zum gängigen Schönheitsbild dazugehören mag, er besitzt keine Aura, keinen Geist, keine Seele. Ja, so ein Bauch fühlt sich nicht einmal gut an, sondern in der Tat wie ein Waschbrett, also ein Gerät, das weniger mit den fröhlichen Gesängen der Wäscherinnen am kristallklaren Bächlein assoziiert wird als mit der deprimierenden Plackerei einer waschmaschinenlosen Epoche.
Solange Ivo blind gewesen war, hatte Lil ihn wie einen richtigen Mann behandelt, in einer Weise mit ihm gesprochen, als würde er über faktische Lebenserfahrung und Lebensklugheit verfügen. Als wäre seine pakistanische Erkrankung ein Ausdruck seines Weltbürgertums, seiner Reife, ja entspräche einer absichtsvoll herbeigeführten Todesnähe. – Das ist vielleicht überhaupt der Punkt: Daß nämlich Männer für Frauen anziehend wirken, indem sie mit dem Tod in Verbindung stehen.
Blind sein und dem Tod nahe. Das ist es!
Leider war beides nun dahin, und so stand Ivo recht unverbrämt im matten Schein seiner calvinkleinistischen Zweiundzwanzigjährigkeit.
Hatte er in den Monaten zuvor unter großer Müdigkeit gelitten, fiel es ihm nun schwer, ins Bett und in den Schlaf zu finden. Und so ergab es sich einmal, daß Lil und Ivo als die letzten aus ihrer Runde in einem Nachtcafé zurückblieben. Nicht einmal mit Absicht, auch nicht von Ivos Seite, der ja bald aufgehört hatte, sich etwas auszurechnen. Zudem war Lil schon damals eine Anhängerin frühen Schlafengehens. Doch an diesem Abend klebten beide an ihren Stühlen fest.
Als sie da nun saßen, am Ende eines Getränks, schweigend, lustlos, wurde Ivo von dem plötzlichen Bedürfnis gepackt, das Unausgesprochene auf den Tisch zu befördern. Jedenfalls fragte er Lil geradeheraus: »Muß ich mir die Augen ausstechen lassen, um bei dir eine Chance zu haben?«
Sie wußte sofort, was er meinte. Ihre Antwort war eindeutig: »Richtig, Ivo, blind fand ich dich interessanter. Und sei ehrlich, seitdem du wieder sehen kannst, redest du dauernd Unsinn.«
»Unsinn?« fragte Ivo, wie man seinen Zahnarzt fragt, ob der dunkle Belag auf den Zähnen tatsächlich vom Kaffee und vom Rotwein und den vielen Zigaretten kommt.
Was soll’s! Es stimmte ganz einfach. Seit Ivo seinen Lidkrampf los war, fehlte ihm die Inspiration der Bilder aus seinem Kopf. Fehlten ihm die Sätze, die gleich Untertiteln diese Bilder begleitet hatten. Es fehlten die Einflüsterungen. Es war ein Jammer! Und er wußte um den Jammer. Darum nahm er die Frage, was Lil denn unter »Unsinn« verstehe, wieder zurück und sagte: »Du hast recht.«
Dann hob er die Hand und gab dem Kellner ein Zeichen, zahlen zu wollen.
Wenn ein Mann einer Frau recht gibt, und zwar ohne Theater, ohne Relativierung, ohne Anbiederung oder Ironie, ohne den Verdacht, Hexenkünste hätten dieses Rechtgeben begünstigt, dann beeindruckt das. Lil, die ja gerade noch Ivos Bedeutungslosigkeit festgestellt hatte, begann, ihn neu zu betrachten. Oder besser gesagt, die so einfache wie beifügungslose Erklärung Ivos, Lil habe recht, versetzte ihn in den alten Zustand einer Attraktivität, die über einen geriffelten Bauch hinausging. Und zwar sicher nicht, weil Lil immer dominieren wollte. Das tat sie ohnedies. Bedeutsam schien für sie nur zu sein, wie die anderen Menschen darauf reagierten.
Es war Ivo gelungen, Lil zu verblüffen.
Sie sagte: »Ich bring dich nach Hause.«
Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein: Der Mann bringt die Frau nach Hause. Doch aus der soeben erfolgten Quasiwiedererblindung ergab sich die Konsequenz, daß jetzt Lil es war, die Ivo begleitete, um ihn sicher in seiner Wohnung abzuliefern. Dementsprechend war es an Ivo, zu fragen, ob sie noch Lust habe, auf ein Glas Wein hochzukommen.
»Wie ist der Wein bei dir?« wollte Lil wissen.
»Ganz toll«, sagte Ivo, der aber in dieser Phase seines Lebens eher zu den Trinkern als zu den Kennern gehörte.
Es war darum nur vernünftig, daß Lil, sobald man auf dem Sofa saß, erklärte: »Ach, lassen wir das mit dem Wein. Es bringt ja nichts, sich abzufüllen, nur damit man nachher die Ausrede hat, besoffen gewesen zu sein.«
Mein Gott, welch passender Kommentar!? Nichts gegen den Alkohol an sich, aber er sollte nie etwas anderem dienen als dem reinen und puren Besäufnis. Das sah auch Ivo ein. Er stellte die halb entkorkte Flasche – aus der nun der Korkenzieher gleich einem mit dem Kopf hilflos im Sand steckenden Männlein ragte – zurück auf den Tisch und ließ sich von Lil auf ihre Seite des Sofas ziehen.
Natürlich war er überrascht und verwirrt. Dazu kam, daß sie beide ja keine Jugendlichen mehr waren, es andererseits etwas jugendhaft Verbotenes an sich hatte, in der elterlichen Wohnung Sex zu haben. Somit ergaben sich in dieser Situation eine Menge Fragen. Andererseits war das hier wohl kaum eine Fragestunde zu nennen. Doch wenigstens in einem Punkt wollte Ivo Klarheit herstellen und sagte darum: »Ich hol mir einen Gummi.«
»Lieber nicht«, antwortete Lil.
»Willst du denn nicht …?« Er betrachtete verlegen ihren nackten Oberkörper, die viele weiße Haut, die über den Glanz frisch getrockneten Geschirrs verfügte. Und mindestens so frisch roch.
»Natürlich will ich«, sagte Lil. »Aber ich verhüte nicht. Hätte Gott gewollt, daß die Menschen verhüten, hätte er uns wohl in diesem Sinne ausgestattet.«
»Meine Güte, bist du etwa religiös?« fragte Ivo.
Sie fragte zurück: »Meine Güte, bist du etwa Atheist?«
Ja, was eigentlich? War Ivo Berg Atheist? Er hatte sich das noch nicht so richtig überlegt. Angesichts der Amtskirche war er eher Atheist, angesichts der von ihm noch zu entdeckenden mysteriösen Artefakte eher religiös. Das Übersinnliche erschien ihm als ein notwendiger Aspekt seiner zukünftigen Expeditionen. Gerade darum, weil er sich dem Akademischen verweigerte, lag ihm daran, in Grenzbereiche vorzustoßen. Im Grund war er der Typ, der auf Wunder hoffte. In diesem Sinn also religiös.
Freilich hatte das wenig bis nichts mit dem vernünftigen Vorschlag zu tun, hier und jetzt ein Präservativ zur Anwendung zu bringen. Darum folgerte Ivo: »Ich kann mir nicht vorstellen, daß du ein Kind von mir willst. Und schon gar keine Krankheit.«
Doch Lil wies darauf hin, daß nur wenige Leute in den letzten Monaten so viele Bluttests gemacht hätten wie Ivo. Und da hatte sie nun wirklich recht. Ivo war ausgeheilt, er war nicht ansteckend, und er hatte es schwarz auf weiß. Blieb freilich die Ungewißheit, ob er sich als Vater eignen würde.
Lils weitere Argumentation ging in die Richtung, daß, wenn man einmal die Zwanzig überschritten habe, sich diese Frage gar nicht stelle. Sie sagte: »Wir wollen miteinander schlafen, nicht wahr? Wenn sich daraus Konsequenzen ergeben, dann werden wir sie tragen. So einfach ist das. Es gilt für alles im Leben. Und ich denke, ein Kind ist sicher nicht die schrecklichste Konsequenz, die sich aus einem Vergnügen ergibt. Und wenn es kein Vergnügen ist, bleibt immer noch die Schönheit der Konsequenz.«
»Das klingt, als wolltest du dich schwängern lassen«, sagte Ivo. In seiner Stimme war ein Zittern. Wie wenn die Scheibe eines Fensters zittert und sich die Leute fragen, ob das jetzt die Müllabfuhr oder ein Erdbeben ist.
»Nein«, erklärte Lil, »ich akzeptiere nur den Umstand deiner potentiellen Zeugungsfähigkeit und meiner potentiellen Gebärfähigkeit. Wir sind in dem Alter, wo man Kinder kriegt – verheiratet, nicht verheiratet, schnell, langsam, geplant, ungeplant. In keinem Fall etwas, aus dem man ein Drama machen sollte.«
»Schon, aber es gibt doch sicher bessere oder schlechtere Momente dafür.«
»Das bilden sich die Menschen nur ein. Es ist eine Illusion zu meinen, man könnte den passenden Termin für eine bestimmte Sache auswählen. In Wirklichkeit ist es so wie mit den Katzen und den Hunden. Sie sind es, die sich uns aussuchen, nicht umgekehrt.«
»Na, das gilt vielleicht im Falle des Tierschutzheims, aber nicht, wenn man zum Züchter geht.«
»Wieso? Denkst du, du bezahlst ihn dafür, eine Wahl zu haben? Die Wahlmöglichkeit ist im Tierschutzheim viel größer. Theoretisch.«
Nun, eigentlich wollte Ivo mit dieser Frau schlafen und nicht über Haustiere diskutieren. Sex mit ihr haben, aber nach Möglichkeit konsequenzlosen Sex. Andererseits muß natürlich gesagt werden, Beischlaf mit einer Madonna ohne irgendwelche Konsequenzen, das wäre dann auch wieder komisch, oder?
Ivo hätte jetzt aufstehen und gehen müssen. Und genau das sagte er sich auch: Steh auf und geh! Dann aber fiel ihm ein, sich in der eigenen Wohnung, genauer gesagt der Wohnung seiner Eltern, zu befinden. Es wäre also an ihm gewesen, Lil hinauszuwerfen, hinauszubitten, hinauszubegleiten …
Statt dessen schloß er die Augen und tauchte seinen Mund in ihr Gesicht.
Wenn sich Ivo Berg später an diese Nacht erinnerte, konnte er nicht sagen, etwas Extremes sei passiert, also eine Form von übersinnlichem oder wenigstens übersinnlich gutem Sex. Dies hätte zu einer Madonna auch gar nicht gepaßt, der Sex schon, aber nicht, ihn zu übertreiben. Mehr aus ihm zu machen, als in ihm steckt. Und es steckt ja nicht wirklich viel in ihm, als »Akt« gesprochen. Jedenfalls weder die Möglichkeit einer Verschmelzung noch die, eine Wahrheit zu erkennen, die man nicht auch ohne Orgasmus und zeitweilige Entrückung zu erkennen in der Lage wäre.
Nachdem sich die beiden geliebt hatten, bettete Ivo seinen Kopf auf Lils Schulter, fragte aber gleichzeitig, ob ihr das unangenehm sei.
»Was?«
»Na ja. Vielleicht brauchst du jetzt deine Ruhe.«
»Ich sag dir schon, wenn ich Ruhe brauche.«
»Noch was, Lil!«
»Ja?«
»Sind wir jetzt ein Paar, oder war’s das?«
Lil antwortete: »Wir sind ein Paar.«
Der Mensch hat es gern mit den Zeichen. Und in der Tat ist die Welt voll von Zeichen, und fast alle bedeuten etwas. Das Problem ist, wie so oft, die Auslegung. Denn jedes Zeichen trägt in sich eine Falle. Das ist wie mit dem Glück, dessen Sinn im Verschwinden besteht. Der Sinn der Zeichen ist ihr verführerisches Element. Sie wollen also nicht richtig, sondern falsch gelesen werden, so wie ja auch eine mit Blättern und Ästen getarnte Fallgrube nicht schon auf zehn Meter als Fallgrube erkannt werden möchte, sondern eben als das, was sie nicht ist: ein normaler Waldweg.
Als Lil nach dieser ersten verhütungslosen Nacht sowie auch weiteren entsprechenden Begegnungen nicht schwanger wurde, nahm Ivo das als ein Zeichen dafür, dies würde auch so bleiben. Weil entweder Lil im geheimen doch verhütete oder weil einer von ihnen beiden gar nicht in der Lage war, Kinder zu bekommen. Oder aber – und dies erschien dem halb gläubigen, halb ungläubigen Ivo am naheliegendsten –, weil die Sterne dafür nicht richtig standen. Ivo spekulierte, daß das Schicksal für ihn, den zukünftigen Erkunder der letzten weißen Flecken auf dieser Erde, etwas anderes bereithielt als ein Leben zwischen Windeln und Milchflaschen. Wenn er an schlaflose Nächte dachte, dann nicht wegen des Geplärrs eines Babys, sondern aufgrund des Geheuls eines Wüstensturms.
Somit das freundliche Zeichen falsch deutend, hatte Ivo mit Lil fortgesetzt ungeschützten Sex. Eine gewisse Verkrampftheit zu Beginn war dem Gefühl gewichen, sich in absoluter Sicherheit zu befinden. Daneben muß gesagt werden, daß Lil und Ivo fortan tatsächlich als ein Paar auftraten und sich in Treue verbunden waren. Ohne jedoch als Kletten durchs Leben zu marschieren. Was zu Lils apart überlegener Art auch kaum gepaßt hätte. Immerhin bestand sie ja aus unverschmelzbaren Materialien.
»Wir brauchen eine Wohnung«, sagte Lil im zweiten Monat ihrer Beziehung.
»Wieso?« fragte Ivo, der sich bereits daran gewöhnt hatte, in seinem eigenen »Kinderzimmer« dem Liebesspiel nachzugehen.
»Weil es keinen Spaß macht, mit deinen Eltern das Bad zu teilen.«
Dabei waren Ivos Eltern von Lil begeistert. Sie hofften inniglich, diese Frau möge aus ihrem Sohn genau das machen, was ihnen, den Eltern, nicht gelungen war. Darum auch waren sie sofort bereit, Geld zur Verfügung zu stellen, um eine Wohnung anzumieten. Eine kleine Wohnung. Denn darauf bestand Lil, da sie meinte, große Wohnungen würden die Menschen, die in ihnen leben, häßlich machen. Ganz wie im Fall von zu großer Kleidung. Dicke Jacken, ballonartige Röcke, herunterhängende Unterhosen, englische Damenhüte, Goldketten und Brillantencolliers, das alles führe bei den Trägern und Trägerinnen zu einer bedauerlichen Monstrosität. Wie eben auch riesenhafte Wohnungen. Der Gewinn an Freiraum und somit an Freiheit müsse mit einem Verlust an eigener Identität und Größe bezahlt werden. Größe in jeder Hinsicht. Unter einem großen Kristalluster stehe immer nur ein kleiner Mensch.
Zudem ergab sich aus der Anschaffung einer vernünftig dimensionierten und damit relativ günstigen Wohnung in Universitätsnähe das Faktum eines finanziellen Überschusses, den man verwenden konnte, um hin und wieder ein gutes Restaurant zu besuchen und sich das eine oder andere geschmackvolle Kleidungsstück zuzulegen. Jetzt, wo sie zusammengehörten, wollte Lilli, daß auch Ivo darauf achtete, womit er seine Haut umgab – und zur Einsicht kam, daß Holzfällerhemden Holzfällern vorbehalten sein sollten.
»Bei deiner Freundin«, sagte einer zu Ivo, »kenn ich mich nicht aus. Ist die jetzt links oder katholisch, oder hat sie einen Modetick?«
Ivo, der ja schon einige Zeit von Lils Wesen infiltriert war, antwortete: »An deiner Frage stimmt das oder nicht.«
Sie lebten nun also mit exakt so vielen Möbeln, wie sie brauchen konnten, auf vierzig Quadratmetern, was angesichts der Nester und Höhlen vieler Tiere immer noch als umfangreich gelten konnte. Zudem hatte sich Ivo die intellektuelle Qualität seiner »blinden« Phase zurückerobert. Es gelang ihm – zumindest hin und wieder –, auch offenen Auges das erleuchtete Dunkel in sich wahrzunehmen. Und somit Bilder und Untertitel.
Eine gute Zeit, ein gutes Leben.
Im fünften Monat ihrer Partnerschaft trat Lil zu Ivo auf den kleinen Balkon, schob mit einem langen Finger die angebotene Zigarette in die Tiefe der Packung zurück und sagte: »Ich bin schwanger.«
Er wußte nicht, was er sagen sollte. Beziehungsweise war ihm völlig klar, daß Lil kaum mit sich würde reden lassen. Sie hatte ihn ja bloß informiert. Aber irgend etwas mußte er schon von sich geben. Am besten, daß er sich freue.
Lil kam ihm zuvor: »Du wirst dich daran gewöhnen, Liebling. Vor allem wirst du feststellen, wie schön eine Frau wird, wenn sie schwanger ist.«
Und da hatte sie nun absolut recht. Die Madonna würde sich in eine Frau verwandeln, und das ist nun wirklich nicht als Schmälerung zu verstehen. Zur heiligen Person sollte sich die menschliche gesellen und Lils anorganische Stofflichkeit zur Lebendigkeit erweckt werden.
Lil entschied: »Wir gehen weg aus Rom.«
»Wieso?«
»Das ist keine Luft für ein Baby.«
»Na, in Wien ist die Luft auch nicht besser.«
»Wer redet von Wien? Wir ziehen aufs Land.«
»Und deine Arbeit, deine Wissenschaft?«
»Nur damit ich besser das Verbrechen studieren kann, muß mein Kind keine schlechte Luft einatmen. Abgesehen davon, kann man überall Bücher lesen und überall schreiben. Und überall gibt es Kriminalität.«
»Aber nicht die organisierte«, wandte Ivo ein.
»Kein Ort, wo sie nicht auch organisiert wäre.«
»Lil, ich bitte dich«, sagte Ivo, »du bist ein Stadtmensch. Du brauchst das Leben um dich herum, die Boutiquen, die Museen, Leute, die das Muster einer Gucci-Handtasche nicht für einen Polsterüberzug halten und Marcel Proust nicht für einen französischen Fußballer, der in England spielt.«
»Sag, wie viele Leute in Rom wissen, wer Marcel Proust ist? – Und hör auf, Ivo, mir etwas ausreden zu wollen, das ich bereits beschlossen habe.«
»Du kannst nicht immer so über mich drüber…?«
Ja, was drüber? Drüberfahren? Drüberwischen? Drüberschauen? Das tat sie ja nicht. Auch sagte sie mit keinem Wort, Ivo müsse mit ihr kommen, daß sie ihn zu etwas verpflichte, außer zu dem, zu dem er sich selbst verpflichte oder von Natur aus verpflichtet sei. Bei Lil schienen die Dinge über eine Ordnung zu verfügen, die nicht diskutierbar war. In der Art, wie man die Zukunft nicht zu ändern vermag, weil das nämlich zu unauflöslichen Paradoxien führt.
»Und wohin genau, bitte?« fragte Ivo, gleichermaßen bockig wie einsichtig. Mit einem Bein im Bockigen, mit dem anderen im Einsichtigen stehend.
»Giesentweis«, antwortete Lil mit derselben Bestimmtheit, mit der man sagt: Die Krater auf dem Mond kann man nicht ausradieren.
»Nie gehört.« In einem ängstlichen Ton erkundigte sich Ivo, ob das in der Steiermark liege.
»Giesentweis ist nicht in Österreich«, klärte Lil ihn auf, »sondern im Süddeutschen. Ich hab dort ein kleines Häuschen geerbt. Von einer entfernten Verwandten, der ich niemals begegnet bin.«
»Verkauf das Haus, dann mußt du nicht nach Giesentweis.«
»Wieso? Kennst du den Ort?«
Nun, so meinte Ivo das nicht. Er hielt Süddeutschland für kaum weniger erschreckend als die Steiermark. Hingegen wäre man mit dem Geld aus einem Hausverkauf in der Lage gewesen, eine freie Ortswahl vorzunehmen, wobei Ivo fortgesetzt den italienischen Raum im Sinn hatte, wenn er schon auf die von halluzinogenen Abgasen und vatikanischen Emissionen durchsetzte römische Luft verzichten sollte. Aber Lil machte rasch klar, ein derartiges Erbe – gerade darum, weil sie niemals der Vererberin begegnet war – als Verpflichtung anzusehen. Abgesehen davon, daß man es schwerlich als Zufall nehmen könne, soeben schwanger geworden zu sein und fast im gleichen Moment die Benachrichtigung über eine Erbschaft erhalten zu haben.
»Meinst du im Ernst, Gott will dir damit etwas sagen?« fragte Ivo, diesmal mit einem Fuß im Spott stehend, mit dem anderen in der Sorge. Der Sorge, diese Schwangerschaft würde Lil zwar noch schöner als schön machen, leider aber auch ein wenig verrückt.
Lil blieb ernst und streng. Sie schien nicht bereit zu sein, ausgerechnet mit Ivo über Gott zu debattieren. Weniger, weil er Atheist war. War er ja nicht. Mit einem Atheisten hätte sie durchaus dieses Thema behandelt. Aber keinesfalls mit einem Menschen, der so völlig uneindeutig zwischen Glauben und Nichtglauben herumlavierte. Wie das leider die meisten tun.
Egal, Lil hatte beschlossen, ihr Erbe anzutreten und zusammen mit dem Kind in ihrem Leib die Reise in eine Gegend anzutreten, die ihr so unbekannt war wie jene Cousine ihres Großvaters, die nach dem Krieg nach Deutschland geheiratet hatte und über die in der Familie nie ein Wort verloren worden war, nicht einmal ein schlechtes. Im Grunde wäre es darum an der Zeit gewesen, daß sich Lil …
Übrigens, sie hieß jetzt nicht mehr Lil, sondern wieder Lilli, denn die Zeit in Rom würde ja bald vorbei sein und damit auch die etwas kindische Usance, ausschließlich Namen mit drei Buchstaben zu tragen.
Lilli hätte sich also eigentlich bei ihrem Großvater mütterlicherseits erkundigen müssen, was es mit dieser Frau auf sich hatte. Aber sie hielt diesen alten Mann für einen notorischen Lügner. Und wegen einer Lüge brauchte sie nicht nach Österreich zu telephonieren, auch wenn das eine Menge Leute tagtäglich tun. Blieben ihre Mutter und ihr Vater. Doch nach Lillis Einschätzung standen diese völlig im Banne des lügnerischen, machtvollen, die Kunst der Intervention ausübenden Großvaters. Ebenso unnötig also, mit ihnen zu sprechen.
Lilli entschied, sich ein eigenes Bild machen. Und zwar vor Ort. Immerhin hatte die Erblasserin die letzten zwanzig Jahre in Giesentweis zugebracht, zehn davon als Witwe, da sollte sie wohl einige Spuren hinterlassen haben.
Der Notar, der Lilli kontaktiert hatte, hatte gemeint, das Haus befinde sich in einem recht praktikablen Zustand, würde allerdings einiger Ausbesserungen bedürfen.
»Wie bist du eigentlich als Handwerker?« fragte Lilli ihren Ivo.
»Ich weiß nicht.« Nicht nur, daß er noch nie Vater gewesen war, er war auch noch nie Handwerker gewesen.
Lilli antwortete in jener milden Art, die sie so sparsam wie wirkungsvoll einzusetzen verstand: »Du glaubst gar nicht, was man alles hinkriegt, wenn man nur will.«
Nun, das stimmt ganz sicher, obgleich gerade Männer vorzugsweise die Zwei-linke-Hände-Theorie vertreten, gleichzeitig aber gesagt werden muß, daß auch mit der linken Hand schon viel Großes geleistet wurde. Außerdem: Zwei engagierte linke Hände sind besser als zwei lahme rechte, deren Fähigkeiten allein theoretischer Natur bleiben.
»Und wann willst du umziehen?« fragte Ivo.
»Na, was denkst du? Sofort natürlich.«
»Und …?«
»Ja?« Lilli verfügte über mehrere Ja-mit-Fragezeichen-Vertonungen. Manche klangen scharf, andere fröhlich, selten hörte sich eine kokett an, hin und wieder mitleidig. Diese hier drückte Ungeduld aus, vielleicht, weil Ivos Kleinmut Lilli langsam auf die Nerven ging.
Aber damit lag sie falsch. Ivo hatte nicht vor, einen erneuten Einwand gegen das Landleben vorzubringen, sondern …
Er sagte: »Denkst du, es wäre besser zu heiraten?«
»Liebling, einen Heiratsantrag sollte man schöner formulieren.«
»Ich dachte nur wegen des Kindes.«
»Wieso? Willst du denn das Kind heiraten?«
»Mein Gott, Lil«, stöhnte Ivo, der sich an das dritte l und das zweite i erst noch gewöhnen mußte, »du kannst es einem manchmal wirklich schwermachen.«
»Wäre es leicht, dann wäre es nichts wert«, sagte sie, beugte sich aber gleichzeitig zu Ivo herunter, bettete ihre Wange auf seiner Schulter und meinte: »Laß uns mal das Kind kriegen, und dann schaun wir weiter.«
Ivo hob ihr Gesicht leicht an und küßte sie. Er fühlte etwas in sich: man könnte sagen, eine Art Planetensystem, Körper, die sich in festgeschriebenen Bahnen um einen masseschweren Mittelpunkt bewegten. Doch um genau zu sein, das, was er da zu spüren meinte, war nicht wirklich ein Sonnensystem, sondern nur ein Modell davon, einer dieser hübschen Bausätze mit Zahnrädern und Drahtstangen und bemalten Kugeln, wo alles maßstabgetreu aufgesteckt wird, frei von Kollisionen, frei von übergroßer Hitze und übergroßer Kälte und der vielen Dunkelheit dazwischen.
Ja, solange das Glück vorhanden ist, ist es ein Modell, ein Bausatz. Erst im Verschwinden wird es zu etwas Echtem.
2
Giesentweis also. Einer dieser Orte, die man lieber bei Sonnenschein besuchen sollte, weil sie derart in ein enges Tal hineingebaut wurden, daß man im Herbst und Winter, bei Nebel oder Regen oder abgestürzten Wolken von diesen Dörfern und kleinen Städten geradezu verschluckt wird, wie auch die Ortschaften selbst verschluckt scheinen. Dabei ist es dort wirklich schön, am Fuße der Schwäbischen Alb, die ganz sicher mehr Menschen in den Wahnsinn getrieben hat als die dramatische Bergwelt der Alpen, in die die Leute sich bereits verrückt hineinbegeben und dann die Alpen verantwortlich machen.
Irgendwie zählt Giesentweis zu der eine Stunde entfernt gelegenen Landeshauptstadt Stuttgart, aber das kann man sich nicht vorstellen, wenn man an einem sonnenhellen Tag auf diesen Ort hinuntersieht, auf die beiden massiven weißen Türme der Stiftskirche, die engstehenden hellen Fachwerkbauten, den übers Tal hingestreckten Siedlungskörper, der an einen gefällten Stamm erinnert, welcher genau dort hingestürzt ist, wo er hinstürzen sollte (während ja viele Ortschaften im Zuge ihrer Verbauung an Waldarbeiterunglücke gemahnen). Nein, angesichts dieser kleinen Stadt konnte man an den Ausspruch denken, mit dem manche Hundebesitzer auf die Frage, wem denn dieser süße Hund hier gehöre, gerne antworten: Der gehört sich selbst. – Ja, Giesentweis gehörte sich selbst, und daß es Teil eines Regierungsbezirkes war … nun, der Mensch ist Teil der Evolution, und Island ist Teil von Europa, aber was heißt das schon?
Als Lilli und Ivo von Rom aufbrachen, taten sie das bei bestem Wetter. Mitte März. Der Frühling grüßte. Er grüßte Rom, nicht aber Giesentweis. Das ganze Tal, der ganze Albabschnitt lagen unter einer dichten Schneedecke begraben. Die Dinge und Gebäude erinnerten an diese Frauen in übergroßen Pelzmänteln, die man gar nicht mehr erkennen kann, wo selbst die Magersüchtigen wie Wesen aus vielerlei Fettschichten anmuten.
Es schneite unaufhörlich, so stark, daß man nur schwer mit dem Wagen vorwärts kam. Lillis und Ivos erster Blick auf diese magische Gegend bestand somit darin, die Gegend nicht zu sehen. Beziehungsweise allein in einem locker hingesetzten Tarnkleid, das in Summe höchst massiv zu nennen war.
»Ich hab noch nie soviel Schnee erlebt«, sagte Ivo.
»Schön, nicht wahr?« meinte Lilli und lenkte den Wagen mit jener Übersicht, zu der in der Tat nur Frauen in der Lage sind. Das ist eine hormonelle Frage. Männer in Autos erliegen biochemischen Desastern, für die sie nichts können. Sie können allerdings sehr wohl etwas dafür, sich trotz allem hinter ein Steuerrad zu setzen. Wenn es stimmt, daß Männer besser beim Parken sind, dann nur darum, weil die Autos so froh sind, daß der Mißbrauch ihres Körpers zu Ende geht. Beim Fahren wehrt sich das Auto, beim Parken nicht.
Jedenfalls erreichten Lilli und Ivo die Zweitausend-Seelen-Gemeinde, ohne auch nur einmal in eine haarige Situation geraten zu sein, während an diesem Tag so einige Leute die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.
Der Notar, der die beiden in seinem Büro empfing, machte einen letzten Versuch, Lilli zu einem Verkauf des Objekts zu überreden. Es gebe mehrere Interessenten, die durchaus bereit seien, einen Preis anzubieten, der den eigentlichen Wert überschreite. Weit überschreite.
»Wieso eigentlich?« fragte Lilli. »Ist dort ein Schatz vergraben?«
Der Notar lächelte verzweifelt. Er schien sich nicht sicher zu sein, ob diese Frage ernst gemeint war oder als Scherz zu verstehen, und verharrte darum eine ganze Weile in seinem Lächeln. Es gehörte absolut nicht zu seinen Pflichten, Lilli zu überreden. Allerdings gab es Leute in der Stadt, und nicht wenige, die es gerne gesehen hätten, wäre ihm dies gelungen. Doch bereits während der Telephonate nach Rom war ihm bewußt geworden, es zwar mit einer jungen, aber überaus selbstbewußten Person zu tun zu haben, die man nicht beeindrucken konnte, wenn sie nicht beeindruckt werden wollte. Gleich, ob er den lieben Onkel oder den strengen Bürokraten spielte. Lilli verstand das eine wie das andere gut auszuhalten.
Im Angesicht dieser schönen, jungen, aus dem Albschnee märchenhaft aufgetauchten Österreicherin, die den Namen Steinbeck trug, erkannte der Notar die Unmöglichkeit dieses Ansinnens. Es brauchte ihn auch gar nicht zu wundern, wenn er an die Frau dachte, die vor zwanzig Jahren zusammen mit ihrem Mann an diesen Ort gezogen war und die ihr Haus an ebendiese junge, rothaarige Verwandte vermacht hatte.
Rothaarig? Kann man das so sagen? Sicher nicht Feuerrot, auch nicht Henna, überhaupt nichts Gefärbtes. Kein starkes Rot, kein rostiges. Ein helles Rot. Ein Wangenrot. Nur eine Spur stärker als das Rot, das tatsächlich die Wangen Lillis hin und wieder bedeckte und bei dem es sich dann freilich um aufgetragenes Rouge handelte.
Ende der Leseprobe