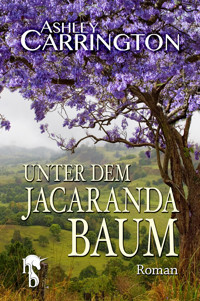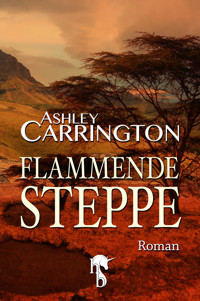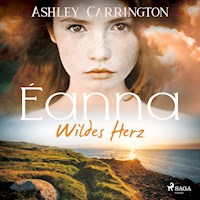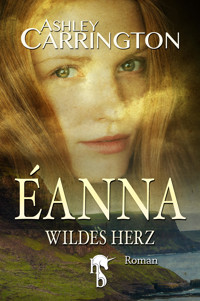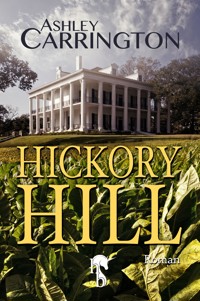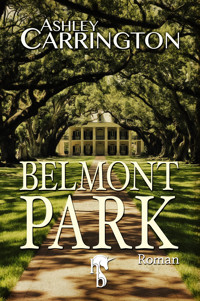6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die Herren der Küste« – unter diesem Beinamen kennt man die einflussreichen Glenvilles. Ende des 19. Jahrhunderts haben sie sich in San Francisco ein mächtiges Schiffsimperium aufgebaut. Für ihren Erfolg schreckt die Familie vor nichts zurück. Die junge Krankenschwester Kate O’Hara, die sich in London in einen der Glenville-Erben verliebt, nachdem sie ihm das Leben gerettet hat, bekommt die Macht der Familie am eigenen Leib zu spüren. Doch die Glenvilles unterschätzen Kate, ihren Ehrgeiz – und vor allem ihren Wunsch nach Vergeltung. Schritt für Schritt baut sie sich ihr eigenes Firmenimperium auf, um der Familie schließlich als ebenbürtige Gegnerin wieder entgegenzutreten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ashley Carrington
Die Herren der Küste
Roman
»Irgendwer muss verlieren, und nur Grünschnäbel machen sich darüber Gedanken. Nein, er brauchte weder an diese zu denken noch an die Beiprodukte erfolgreicher Spekulation. Du gewinnst – ein anderer muss verlieren, und nur ein Grünschnabel macht sich darüber Gedanken.«
Haben und Nichthaben
Ernest Hemingway
»Man kann einiges über das Wesen einer Epoche lernen, indem man ihre gute Gesellschaft studiert, denn diese Leute tun das, was die große Masse wahrscheinlich gern täte, wenn sie die Mittel dazu hätte.«
Louis Auchincloss im Vorwort zuDie Geschichte der amerikanischen Gesellschaft
von Dixon Wester
Erstes Buch
Februar 1894 – Mai 1896
1
Das Erste, was James Glenville bewusst wahrnahm, als er erwachte, war das kühle, feuchte Tuch, das sanft und seltsam vertraut über seine heiße Stirn fuhr. Doch diese fremde energische Stimme, die nun zu ihm drang – träumte er sie? Und das müde Seufzen, das Rücken eines Stuhles und das Geräusch einer ins Schloss schnappenden Tür, das einem kurzen Wortwechsel folgte, träumte er all das, oder gehörte es zur Wirklichkeit, in die er aus wirren Träumen wieder aufstieg wie ein Taucher aus der Tiefe der See? Durchdringender Fischgeruch war das Zweite, was James Glenville bewusst wahrnahm und sofort als real erkannte, denn seine Träume waren eine Welt ohne Farben und Gerüche.
Er öffnete die Augen und blickte in ein Gesicht, das rot, rund und fleischig wie eine reife Augusttomate war. Zwei klare Augen sahen ihn an, in einer beunruhigenden Mischung aus Mitgefühl und Verärgerung. Und plötzlich hatte er Angst.
»Krankenhaus?«, stieß er mit belegter Stimme hervor. »Bin ich im Krankenhaus?« Ein heftiger Hustenanfall schüttelte seinen geschwächten Körper.
Emily Wilson sah die Angst in Mr. Glenvilles fiebrigen Augen, und sie meinte, die Angst richtig zu deuten. Nichts gegen Miss O’Hara und ihren Glauben an die segensreiche Einrichtung des Krankenhauses; aber sie selbst würden keine zehn Pferde in ein Haus bringen, das mit Kranken so vollgestopft war wie eine Tonne mit eingelegten Heringen. Sie dachte an ihren Laden an der Ecke von St. Mary-at-Hill und St. Dunstan’s Lane. Im Krankenhaus wurden die Leute ihrer Meinung nach erst richtig krank. »Keine Sorge, Mr. Glenville«, beruhigte sie ihn. »Sie sind in Ihrer Wohnung in der St. Dunstan’s Lane. Oder sehe ich vielleicht wie eine Krankenschwester aus?«
Die Angst wich von ihm, sein Blick wurde klarer. Nun erkannte er sie: die dicke, redselige Fischhändlerin, die in der Parterrewohnung lebte, sich ausschließlich in schwere schwarze Wollstoffe kleidete und mit ihrem jüngsten Sohn das Fischgeschäft an der Straßenecke betrieb. »Nein, ganz und gar nicht, Mrs. Wilson.«
»Das will ich auch meinen!«, sagte Emily Wilson mit Nachdruck, erhob sich aus dem Lehnstuhl und ging zum Ofen.
Mr. Glenville wandte den Kopf zum Fenster. Das Licht, das von der Straße hereinfiel, war grau und trüb. Gelegentlich zog ein Nebelschleier vorbei. Er hörte das Rumpeln eines Fuhrwerkes und dann den hellen Glockenklang der Fischerkirche oben am Ende von St. Mary-at-Hill. Es war also noch früh am Morgen. Dem schwachen Licht nach hätte es aber ebenso gut auch früher Abend sein können. Die Fischhändlerin kam mit einem Emaillebecher zurück. »Hier, trinken Sie, damit Sie wieder zu Kräften kommen. Das hat Miss O’Hara für Sie gekocht.«
»Was ist das?« Mr. Glenville war so schwach, dass er beide Hände brauchte, um den Becher zu halten.
»Hühnerbouillon. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten Sie eine anständige Fischsuppe bekommen. Aber ich wollte nicht mit Miss O’Hara streiten. Dabei gibt es nichts Besseres als eine kräftige Fischsuppe – ein wahres Lebenselixier! Nun ja, Miss O’Hara wollte nichts davon wissen.« Mrs. Wilson zuckte die Achseln und sah aus, als ärgere sie sich noch immer über die Zurückweisung. »Nichts gegen Hühnersuppe! Aber was steckt schon im Federvieh? Hühnersuppe ist was für Frauen, die mit Migräne oder mit Schwermut in Seidenkissen liegen.«
Mr. Glenville schauderte allein beim Gedanken an Fischsuppe, zog es jedoch vor, keine Antwort zu geben. Er schlürfte die heiße Bouillon. Sie tat ihm gut.
»Aber es wäre nicht recht gewesen, wenn ich die Hühnersuppe bemängelt hätte, wo Miss O’Hara sich doch all die Tage so aufopferungsvoll um Sie gekümmert hat«, fuhr Mrs. Wilson grimmig fort und vertraute ihre Körperfülle wieder dem Stuhl an, der unter ihrem Gewicht ächzte. »Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte sich Mr. Harwick für diese Wohnung schon wieder einen neuen Mieter suchen können.«
Mr. Glenville verschluckte sich beinahe und sah sie erschrocken an.
»Ja, so schlimm hat es um Sie gestanden, Mr. Glenville!«, bekräftigte Mrs. Wilson. »Tag und Nacht ist Miss O’Hara nicht von Ihrem Bett gewichen. Sie ist selbst ganz vom Fleisch gefallen, die Ärmste. Ja, und wenn ich vorhin nicht ein Machtwort gesprochen und ihr befohlen hätte, ins Bett zu gehen und sich ein paar Stunden Schlaf zu gönnen, dann würde sie noch immer hier sitzen.« Sie schüttelte betrübt den Kopf. »Wenn ich nicht die ganze Woche bei meiner jüngeren Schwester den Haushalt hätte führen müssen, weil sie mit ihrem ersten Kind niedergekommen ist, hätte ich Miss O’Hara schon eher abgelöst.«
Mr. Glenville trank den letzten Schluck Hühnerbouillon und sank wieder müde in die Kissen. »Danke, Mrs. Wilson«, murmelte er, als sie ihm den leeren Becher abnahm.
»Mir brauchen Sie nicht zu danken. Danken Sie nachher besser Miss O’Hara. Ich muss in ein paar Stunden wieder in meinen Laden. Mein Sohn ist dieses Jahr achtundzwanzig geworden und damit ein wenig älter als Sie, doch ich muss noch immer ein scharfes Auge auf ihn haben, obwohl er schon alles besser zu wissen meint. Ja, ja, man hat so seine Arbeit und seine Sorgen, bis man die Kinder groß hat. Und dann stellen sich wieder neue Sorgen ein.«
James Glenville kannte George Wilson vom Sehen. Er war ein großer, stämmiger Mann mit dem Nacken eines Stiers, den Händen eines Boxers und den Augen eines Hechtes. »Ihr Sohn macht auf mich nicht den Eindruck, als müssten Sie sich um ihn sorgen, Mrs. Wilson«, sagte er, und seine vom Husten gereizte Kehle schmerzte.
»Ach was!« Sie machte die Handbewegung, mit der sie Schuppen und Eingeweide ausgenommener Fische von ihrer nassen Ladentheke zu wischen pflegte. »Schauen Sie doch sich selbst an. Allein dieser Husten, der Ihnen noch so tief in der Brust sitzt wie ein dreifacher Widerhaken, kann einem Angst machen! Wenn Ihre Familie Sie so sähe, würde sie sich alle Sorgen dieser Welt machen!«
Er schüttelte kaum merklich den Kopf, während ihm die Augen zufielen. »Mit Sicherheit nicht«, murmelte er. Und bevor er wieder einschlief, dachte er, dass es seinen Angehörigen sicher lieber wäre, wenn Mr. Harwick sich nach einem neuen Mieter hätte umsehen müssen.
2
Kate O’Hara kniete vor dem Ofen, öffnete die Feuerluke mit dem Schürhaken, nahm mit einem Stück Zeitungspapier nacheinander drei Briketts aus dem Kohlenkasten und schob sie ins Feuer. Das Papier warf sie hinterher. Sie erhob sich und blieb einen Augenblick nachdenklich vor dem Ofen stehen, der eine herrliche Wärme abgab und die feuchte Februarkälte fernhielt, die von der Themse herauf durch die abendlichen Straßen von London zog und in die Häuser der Armen kroch. Mr. Glenville war zu beneiden. Sein Keller war randvoll mit Kohle gefüllt. Als er im Oktober vergangenen Jahres die Wohnung unter ihr bezogen hatte, hatte er Henry Forlow, dem mürrischen Kohlenhändler von der Fenchurch Street, den vagen Auftrag erteilt, ihm so viel Kohle im Keller einzulagern, wie er wohl brauchte, um den Winter zu überstehen, ohne zu frieren. Noch Wochen später hatte man sich im Viertel rund um St. Mary-at-Hill halb neidisch und halb spöttisch erzählt, dass Henry Forlow dem jungen Amerikaner den Keller bis unter die Decke gefüllt hatte. Und dass man den Händler an jenem Tag zum ersten Mal seit langer Zeit wieder hatte lächeln sehen.
Kate O’Hara dachte an ihre Wohnung unter dem Dach, die im Winter wohl die kälteste im ganzen Haus war. In den neun Tagen, die sie Mr. Glenville nun schon pflegte, war sie täglich dreimal mit seinem Kohleneimer in den Keller hinuntergestiegen. Einmal hatte sie angesichts dieses Brikettberges das Verlangen gespürt, einige Eimer davon in ihren Keller zu schaffen, wo die Kohle kaum mehr kniehoch stand. Doch im nächsten Moment hatte sie sich dieses Gedankens geschämt, und diese Scham hatte sie den ganzen Tag verfolgt.
Das Knarren des Bettes in ihrem Rücken holte sie aus ihren Gedanken. Und noch bevor sie ihn ansah, spürte sie, dass der Patient aufgewacht war. Im Laufe der Jahre hatte sie dafür einen sechsten Sinn entwickelt. Sie drehte sich um, sah seine tiefblauen Augen auf sich gerichtet. Dieses Blau war ihr sofort aufgefallen, als sie sich das erste Mal im Hausflur begegneten. Es war ein Blau, wie sie es sonst noch bei niemandem gesehen hatte. Selbst das Blau der See bei Dover schien ihr nicht so intensiv.
»Wie geht es Ihnen, Mr. Glenville?« Mit einem Lächeln trat sie ans Bett.
»Als hätte ich eine Woche lang kein Auge zugetan«, sagte er heiser und lächelte gequält. »Ich glaube, ich fühle mich so, wie es mir geht – miserabel.«
»Das Fieber hat Sie so entkräftet und natürlich der Husten, aber der löst sich. Es war nicht gut um Sie bestellt. Jetzt ist das Fieber endlich gefallen, und Sie befinden sich auf dem Weg der Besserung«, versicherte sie ihm und lächelte aufmunternd.
»Ich habe schrecklichen Durst.«
»Ich bringe Ihnen etwas Brühe.«
»Nein, bitte etwas Kaltes, Miss O’Hara.«
Ihr Gesicht nahm den Ausdruck berufsmäßiger Besorgnis an. Die Krankheit hatte Mr. Glenville gezeichnet. Er hatte viel Gewicht verloren, sein Gesicht war noch schmaler geworden, und die Jochbögen traten noch stärker hervor. Und der Kontrast seiner fahlen Haut zu seinem pechschwarzen, dichten Haar war geradezu erschreckend. Er hatte den Kräften des Todes zähen Widerstand geleistet und diesen Kampf gewonnen, doch gesund war er noch nicht. Ein Rückschlag bei solch physischer Entkräftung würde wohl tödlich verlaufen. »Brühe bekommt Ihnen viel besser. Sie haben viel Salz ausgeschwitzt, und mit Hühnerbrühe …«
»Später, bitte!«, fiel er ihr ins Wort und kämpfte gegen einen Hustenreiz an. »Erst einen Schluck kaltes Wasser!«
»Nun gut. Aber hinterher bringe ich Ihnen ein Teller Hühnersuppe mit Fleischstückchen.« Er nickte, und sie ging in die Küche.
Sein Blick blieb auf die Tür gerichtet, während er sie hantieren hörte. Als sie mit einem Glas Wasser zurückkehrte, kam ihm zum ersten Mal klar zu Bewusstsein, dass diese junge, schlanke Frau, mit der er in den vergangenen vier Monaten auf der Straße und im Treppenhaus nur freundlich-unverbindliche Grüße ausgetauscht hatte, ihn all die Tage gepflegt hatte. Sie hatte kastanienbraune Locken, braune Augen, eine gerade Nase, einen hübschen Mund und ein energisches Kinn. Und wenn sie lächelte, zeigte sie perlweiße Zähne. Sie war sicher nicht älter als zweiundzwanzig. Und in diesem blauen Baumwollkleid mit den feinen, weißen Längsstreifen und dem kleinen weißen Rüschenkragen sah sie so gar nicht nach Krankenschwester aus.
Kate O’Hara reichte ihm das Glas. »Trinken Sie langsam, Mr. Glenville. Es bekommt Ihnen besser.«
Er leerte das Glas so langsam, wie es seine Selbstbeherrschung zuließ. Er meinte, nie etwas annähernd Köstliches und Belebendes getrunken zu haben. Der Husten, der ihn gleich danach überfiel, verursachte ihm heftige Kopfschmerzen. Dann überkam ihn ein dringendes menschliches Bedürfnis, und es war ihm sehr unangenehm. Er räusperte sich. »Miss O’Hara …« Er sah sie nicht an, sondern blickte starr auf seine feingliedrigen Hände. »Würden Sie sich bitte umdrehen?«
»Weshalb?«, fragte sie ruhig und blickte ihn an.
Seine Befangenheit wuchs. »Ich muss … äh … ich … ich … ich muss mal aufstehen.«
»Sie können nicht aufstehen, Sie sind noch viel zu schwach. Sie haben ja kaum Kraft genug, das Wasserglas zu halten.«
»Ich muss aber!« Schweiß stand auf seiner Stirn.
Ein kaum merkliches Lächeln zuckte in Kate O’Haras Mundwinkeln. »Soll ich Ihnen die Urinflasche zum Wasserlassen geben, oder brauchen Sie die Bettpfanne?«, fragte sie sachlich.
Verlegenheit schoss wie eine Stichflamme in sein Gesicht. »Ich brauche weder das eine noch das andere, Miss O’Hara!«, brauste er in seiner Beschämung auf. »Wenn Sie sich also jetzt umdrehen oder noch besser das Zimmer verlassen würden …«
»Ich bin Krankenschwester, Mr. Glenville!«, schnitt sie ihm das Wort ab. »Ich arbeite seit zwei Jahren auf der chirurgischen Station, wo keiner der Patienten ohne fremde Hilfe auskommt. Sie brauchen sich vor mir also nicht zu schämen.«
»Ich schäme mich nicht!«, log er. Sein Körper drängte immer stärker danach, sich zu erleichtern.
»Und ob Sie das tun! Aber Sie haben keinen Grund dazu. Das ist das Natürlichste …«
»Mein Gott, halten Sie mir keine Vorträge!«, stieß er gereizt hervor, denn er hatte Angst, jeden Augenblick ins Bett zu machen. »Drehen Sie sich endlich um, verdammt noch mal!«
Kate O’Hara stemmte beide Fäuste in die Seite und funkelte ihn beinahe zornig an. »Nicht in diesem Ton, Mr. Glenville! Zieren Sie sich jetzt bloß nicht wie ein Halbwüchsiger, der gerade seinen Körper entdeckt hat! Wer, glauben Sie denn, hat Sie ausgezogen und ins Bett gebracht, als Sie bewusstlos und mit hohem Fieber vor Ihrer Wohnungstür lagen? Und verraten Sie mir mal, wer Sie, Ihrer Meinung nach, in den letzten Tagen gewaschen, Ihnen Umschläge gemacht, die verschwitzten Laken gewechselt und Ihnen frische Nachthemden angezogen hat!«
Mr. Glenvilles Gesicht brannte nun bis zu den Ohren. »So habe ich es nicht … ich meine, ich … ich …«, stammelte er verlegen.
Kate O’Hara bückte sich, zog die makellos saubere Bettpfanne unter dem Nachttisch hervor und drückte sie ihm in die Hände. »Männer!«, rief sie, als wäre damit alles gesagt, drehte sich um und ging zur Tür. Von dort sah sie sich noch einmal kurz nach ihm um. »Rufen Sie mich, wenn Sie fertig sind. Ich warte in der Küche.« Und ohne eine Antwort abzuwarten, zog sie die Tür hinter sich zu.
James Glenville entschuldigte sich wortreich und kleinlaut bei ihr, nachdem sie ihm wenige Minuten später auf seinen Ruf hin die Bettpfanne abgenommen, sie gesäubert hatte und mit der Hustenmedizin sowie der Tageszeitung zurückgekehrt war. Er sah ihr dabei nicht ins Gesicht, denn er schämte sich sowohl seines Benehmens als auch der ganzen Situation. »Es tut mir leid, dass ich so dumm reagiert habe, Miss O’Hara, und es tut mir auch leid, dass ich Ihnen all die Tage zur Last gefallen bin«, schloss er seine Entschuldigung. »Mrs. Wilson hat mir schon gesagt, was Sie alles für mich getan haben.«
»Schon gut, Mr. Glenville«, sagte sie versöhnlich. »Ich bin Krankenschwester, und deshalb sind Sie mir auch nicht zur Last gefallen. Und was Mrs. Wilson betrifft, so ist sie eine gute Seele, aber wenn es nicht gerade um Fisch geht, sollte man ihren Worten, bei allem Respekt, keine übermäßige Bedeutung zumessen.«
Er lächelte, dann wurde sein Gesicht wieder ernst, und er fragte: »Was ist überhaupt mit mir passiert? Sie sagten, Sie hätten mich bewusstlos vor meiner Wohnungstür gefunden?«
»Ja, vor neun Tagen, als ich von der Spätschicht nach Hause kam. Sie lagen im Morgenmantel bewusstlos vor der Tür, und ein Eimer mit Briketts lag halb ausgekippt neben Ihnen. Sie glühten vor Fieber, und Dr. Boswell bestätigte, dass Sie eine schwere Lungenentzündung hatten. Wie haben Sie es bloß dazu kommen lassen?«, fragte sie vorwurfsvoll.
Er hustete. »Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich aus dem Bett aufgestanden bin, um Kohlen zu holen, weil das Feuer im Ofen auszugehen drohte. Ein paar Tage davor hatte ich mich wohl erkältet, als mich dieser heftige Eisregen bei einem Spaziergang durch den Hyde Park überraschte. Ich dachte, mit ein paar Tagen im Bett sei das rasch auskuriert.«
»Sie wären beinahe rasch Kunde von Mr. Cunnigham geworden!«, erwiderte sie trocken. Edgar Cunnigham war der Leichenbestatter, dessen Geschäft sich vorteilhafterweise gegenüber der Kirche von St. Mary-at-Hill befand.
»Was Sie verhindert haben, Miss O’Hara. Ich danke Ihnen dafür, aber Mr. Cunnigham wird Ihnen das vielleicht nicht verzeihen«, versuchte er zu scherzen.
Ihr Blick ruhte nachdenklich auf ihm. »Warum hatten Sie solche Angst, dass man Sie ins Krankenhaus bringen könnte?«
Er sah ihr nicht in die Augen. »Ich … ich habe einfach Angst vor dem Krankenhaus.«
Sie fühlte, dass das nicht der einzige Grund sein konnte; doch es stand ihr wohl nicht zu, in ihn zu dringen. »Ich hätte Sie dennoch ins Krankenhaus gebracht, wenn Dr. Boswell nicht der Ansicht gewesen wäre, dass man in dem fortgeschrittenen Stadium Ihrer Lungenentzündung im Krankenhaus für Sie auch nicht mehr würde tun können, als was hier in meiner bescheidenen Macht stand.«
»So bescheiden sollten Sie nicht sein, immerhin verdanke ich Ihnen mein Leben.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das verdanken Sie Ihrer Konstitution und Ihrem Lebenswillen.«
»Nun gut. Es wäre überaus undankbar, mit meiner Lebensretterin zu streiten, nicht wahr?« Er warf ihr einen verschmitzten Blick zu, den ein Hustenanfall im nächsten Augenblick vertrieb.
Miss O’Hara füllte einen Esslöffel mit Hustensaft und flößte ihm die Medizin ein.
»Habe ich …« Er zögerte.
Sie stellte den Docht der Nachttischlampe höher. Die hereinbrechende Nacht hatte das Zimmer in diffuses Licht getaucht.
»… Habe ich im Schlaf gesprochen?«
»Sicher. Sie hatten Alpträume und haben häufig im Schlaf gesprochen. Das machen wir wohl alle.«
Ein fast angstvoller Ausdruck trat auf sein mageres Gesicht, das dringend einer Rasur bedurfte. »Und? Was … was habe ich gesagt?«, fragte er wie gehetzt.
»Eine Menge, aber was es war, daran kann ich mich nicht erinnern«, antwortete sie der Wahrheit gemäß und sah die Erleichterung in seinen Augen. »Es war wirres Zeug, wie man es im Fieber nun mal von sich gibt.« Sie zwinkerte ihm zu und fuhr scherzhaft fort: »Falls Sie ein großes Geheimnis haben – ich kann Sie beruhigen: Sie haben davon im Fieber nichts ausgeplaudert. Mir ist nichts Geheimnisvolles und nichts Ruchloses zu Ohren gekommen.«
Er lachte, eher befreit als belustigt. »An mir ist auch nichts Ruchloses oder Geheimnisvolles.«
Sie war sich dessen nicht so sicher. Allein die Tatsache, dass er aus Amerika kam, in Billingsgate eine möblierte Wohnung bewohnte und es sich offensichtlich leisten konnte, keiner Arbeit nachzugehen, war Geheimnis genug. Doch es war nicht ihre Art, sich über solche Fragen den Kopf zu zerbrechen.
»Und Sie sind seit neun Tagen nicht von meinem Bett gewichen, wie Mrs. Wilson mir sagte?«
»Sie waren schwerkrank, und jemand musste sich doch um Sie kümmern«, erklärte sie schlicht.
»Ja, aber was war mit Ihrer Arbeit?«, wandte er ein. »Sie sind über eine Woche nicht zur Arbeit gegangen, ich meine im Krankenhaus?«
Nun wich Kate O’Hara seinem Blick zum ersten Mal aus. Es war ihr unangenehm, diese Frage zu beantworten. Sie verabscheute Lügen, aber hier zog sie die Lüge der Wahrheit vor. Denn wenn sie gesagt hätte, dass sie eine Woche unbezahlten Urlaub genommen hatte, würde er sich wohl noch tiefer in ihrer Schuld fühlen, und das wollte sie nicht. Sie hatte nur getan, was getan werden musste. Deshalb antwortete sie: »Das einzig Gute an Ihrer Lungenentzündung war, dass sie in meinen Zwangsurlaub gefallen ist.«
Er runzelte die Stirn. »Zwangsurlaub?«
»Ja, meine Kolleginnen und ich haben Urlaub nehmen müssen, weil unsere Station wegen Renovierungsarbeiten für zehn Tage geschlossen werden musste.«
Seine tiefblauen Augen zeigten Belustigung. »Welch glücklicher Zufall, nicht wahr?«
Sie fühlte sich unwohl in ihrer Haut, durchschaut. »Das Leben ist eine Kette von Zufällen, hat mein Vater immer gesagt, von glücklichen und weniger glücklichen.«
Er lächelte, und für einen Augenblick waren die Spuren der Krankheit von seinem Gesicht verschwunden. »Sie tun es auf ganz reizende Art, aber das ändert nichts daran, dass Sie lügen, Miss O’Hara.«
Leichte Röte stieg ihr in die Wangen. »Es liegt bei Ihnen, mir zu glauben oder nicht.«
Sein Lächeln wurde noch breiter. »Ich glaube, was ich sehe, Miss O’Hara. Manchen Menschen ist einfach eine besondere Aufrichtigkeit zu eigen, so dass sie nicht lügen können … und wenn sie es doch einmal versuchen, sieht man es ihnen an der Nasenspitze an.«
»Es steht Ihnen frei, was Sie glauben wollen und was nicht. Jedem Menschen seinen Glauben, auch das habe ich von meinem Vater gelernt«, sagte sie steif.
»Schade, dass ich dergleichen Nobles von meinem Vater nicht gelernt habe.«
Sie fand die Gelegenheit günstig, das Thema hiermit abzuschließen. »Ich mache Ihnen jetzt die Suppe warm«, sagte sie und begab sich in die Küche.
Später las sie ihm aus der Zeitung vor. »Hier, das wird Sie interessieren. In Chicago ist letzten Monat auf der Columbia-Ausstellung ein Feuer ausgebrochen und hat praktisch alle Gebäude vernichtet.« Sie blickte von der Zeitung auf.
»Kennen Sie Chicago?«
Er nickte. »Recht gut, aber ich komme aus San Francisco. Das ist in Kalifornien, an der Westküste.«
Sie seufzte. »Reisen muss etwas Wunderschönes sein.« Dann las sie weiter vor, bis er eingeschlafen war.
Als James Glenville irgendwann in der Nacht aufwachte, fand er Kate O’Hara noch immer auf dem harten Lehnstuhl an seinem Bett vor – vom Schlaf übermannt. Der Kopf war ihr auf die rechte Schulter gesunken. Er drehte sich auf die Seite und sah sie im schwachen Schein der Lampe lange an. Sie ist stark und selbstbewusst und lebenstüchtig, dachte er – zugleich voll Bewunderung und bitterem Schmerz. Und damit hat sie alles, was ich nicht habe und auch niemals haben werde. Und du bist schön, fügte er dann noch in Gedanken hinzu. Ja, du bist wirklich schön, Kate O’Hara!
3
Elizabeth Briggs war mit Kate O’Hara in der St. Dunstan’s Lane aufgewachsen und ihre beste Freundin von Kindesbeinen an. Sie hatten zusammen im Hinterhof gespielt, einander ihre Geheimnisse anvertraut und Freud und Leid der Mädchenjahre geteilt. Als Kates Vater vor drei Jahren bei einem Unfall getötet worden war – in den Fischhallen des Billingsgate Market –, waren Elizabeth und ihre Familie in den Monaten des größten Kummers ihre wichtigste Stütze gewesen. Als Elizabeth im vergangenen Jahr William Briggs geheiratet hatte, der zweiter Geselle bei Hector Roddenbery war, einem Buchdrucker in der Gracechurch Street, hatte Kate ihr mit Rat und Tat freundschaftlich beigestanden. Auch wenn sie seitdem nicht mehr so viel Zeit zusammen verbrachten, so verging doch kaum ein Tag, an dem sie sich nicht wenigstens für eine halbe Stunde sahen, denn sie arbeiteten beide im selben Krankenhaus – Elizabeth hatte in der Küche eine Anstellung gefunden.
An jenem Nachmittag wartete Elizabeth schon auf Kate, als diese die breite Treppe aus dem zweiten Stockwerk herunterkam. Elizabeth war eine mollige Person mit einem fröhlichen Gesicht und mit langem, blondem Haar, das sie bei der Arbeit zu einem Zopf geflochten trug. »Du siehst müde aus.«
»Ja, es war mal wieder ein langer und ganz und gar nicht erfreulicher Tag«, gab Kate zu.
»Zu viel Arbeit auf der Station?«
»Ach, die Arbeit ist es nicht. Harte Arbeit habe ich nie gescheut. Ich bin nur so verzweifelt, wenn ich sehe, wie hilflos die Ärzte und besonders wir Schwestern bei den vielen schrecklichen Krankheiten sind.«
»Ich weiß, dass ich deine Arbeit nicht einen Tag durchstehen würde!«, versicherte Liz. »In der Küche bin ich genau richtig. Aber jetzt erzähl, wie es deinem James geht!«
»Er ist nicht mein James. Er ist Mr. Glenville!«, rügte Kate sanft.
»Aber ihr nennt euch schon beim Vornamen!«
»Weil er darauf bestanden hat«, erklärte Kate scheinbar leicht ungehalten; insgeheim fühlte sie jedoch ein wenig Stolz, dass er sie darum gebeten hatte.
»Wie geht es ihm denn?«
»Oh, sehr viel besser. Letzte Woche hat Dr. Boswell ihm erlaubt, das Bett zu verlassen.«
»Und gehst du nach der Arbeit noch immer auf eine oder auch zwei Tassen Tee zu ihm?«, fragte Liz verschmitzt. »Und liest du ihm auch noch aus der Zeitung vor?«
Kate lächelte verlegen. »Ja, es ist so eine …« Eine liebe Gewohnheit, hatte sie sagen wollen, sagte dann aber nur: »… eine Gewohnheit geworden. Er mag es eben, wenn man ihm vorliest.«
»Du magst es auch. Und du magst ihn, richtig?«
»Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe ihn lange gepflegt. Das schafft natürlich eine gewisse Vertrautheit und Bindung …«
»Ach, komm mir doch nicht mit solchen Floskeln, Kate«, fuhr Liz der Freundin fröhlich ins Wort. »Du magst den Amerikaner. Punktum. Ich sehe es dir an, dass er dir was bedeutet … und zwar offensichtlich viel mehr als Sean Coolidge, der dir letzten Sommer den Hof gemacht hat.«
»Wer ist Sean Coolidge?« Kate gab sich verständnislos. »Sprichst du vielleicht von dem Mann, der bei jedem zweiten Wort rot wird, der fürchterlich schwitzende Hände hat und mit dem Onkel Liam mich verkuppeln wollte?«
»Genau den meine ich!«
»Ich kann mich nicht an ihn erinnern.
Lachend betraten sie die weite, zugige Eingangshalle, und in Erwartung der eisigen Kälte, die sie vor der Tür erwartete, schlossen sie ihre Mäntel. Kate wickelte sich den breiten schwarzen Schal um den Hals, den sie, wie auch die warme Wollmütze, selbst gestrickt hatte. »Gestern habe ich endlich den Mut gefunden, ihn zu fragen, was einen Amerikaner wie ihn zu dieser Jahreszeit nach London verschlägt und was er von Beruf ist«, rückte Kate mit ihrer interessanten Neuigkeit heraus, als sie auf die verschneite Straße traten.
»Und? Nun erzähl schon!«, drängte Liz. »Mach es nicht so spannend!«
»Er ist ein Novellist!«, verkündete Kate mit vergnügtem, fast stolzem Lachen, als hätte sie ein Verdienst daran.
Liz zog verständnislos die Brauen zusammen. »Ein … was?«
»Ein Romanautor, ein Schriftsteller eben!«, erklärte Kate amüsiert.
Liz war sichtlich beeindruckt. »Du meinst, er schreibt solch wundervolle Romane wie Francis Lloyd Wentworth?«, fragte sie aufgeregt. »So herrlich herzzerreißende Geschichten wie Die vertauschte Prinzessin oder Die Tochter des Fährmanns?«
Kate schmunzelte. »Nein, ich glaube nicht, dass er so etwas schreibt.«
»Was dann?«
»Nun, er ist nicht ins Detail gegangen, und ich wollte nicht indiskret sein, aber wie ich ihn verstanden habe, arbeitet er an einem großen, ernsten Roman.«
»Alle Romane von Francis Lloyd Wentworth sind groß und ernst, Kate. Sie sind über hundert Seiten lang und oft so ernst, dass mir die Tränen kommen«, verteidigte Liz ihren Lieblingsautor.
»Mr. Glenville hat aber doch eine andere Art von Roman im Sinn«, sagte Kate diplomatisch – sie wollte ihre Freundin nicht verletzen.
»Du meinst, so einen, der zwei Finger dick und schwer zu lesen ist und in Leder gebunden in Bibliotheken steht?«
Kate nickte.
Liz machte ein enttäuschtes Gesicht. »Schade. Aber ich nehme an, dass auch ein ernster Schriftsteller etwas für sich hat. Und immerhin machen diese Bücher auf dem Kaminsims oder so wirklich etwas her«, räumte sie großzügig ein – auch sie wollte ihre Freundin nicht verletzen.
Es fiel Kate schwer, nicht schallend zu lachen. »Ja, du hast recht, das ist viel wert.«
Im nächsten Augenblick bemerkte Kate den schlanken, hochgewachsenen Mann, der eilig die belebte Straße überquerte. Er trug einen langen, dunkelbraunen Mantel mit schwarzem Pelzbesatz auf dem breiten Kragen, einen braunen Hut mit geschwungener Krempe und passende Handschuhe. Kates Schritt stockte, ihr Herz schlug plötzlich schneller.
»Was hast du?«, fragte Liz verwundert.
»Der da über die Straße kommt, das ist er!«, flüsterte Kate aufgeregt. Liz warf dem Mann, der gerade einer Kutsche auswich, einen prüfenden Blick zu. Ihre Lippen verzogen sich zu einem anerkennenden Lächeln. »Alles was recht ist, Schwester Kate, er sieht wirklich gut aus, dein Amerikaner. Zehnmal besser als Sean Coolidge. Und er holt dich von der Arbeit ab, was Sean nie in den Sinn gekommen wäre.«
»Das ist sicher nur ein Zufall.«
Liz sah sie spöttisch an. »Er ist so zufällig hier, wie man zufällig schwanger wird«, sagte sie, stieß Kate sanft in die Seite und sagte grinsend: »Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch etwas besorgen muss. Bis morgen dann. Und mach mir bloß keine Schande, indem du dich übertrieben spröde und unnahbar gibst. Vergiss nicht, dass du nicht mehr im Dienst unter Oberschwester Agnes’ Aufsicht bist!«
»Liz, um Gottes willen, bleib!«, rief Kate der Freundin zu.
Doch die zwinkerte nur und eilte davon. Lautlos fiel der Schnee, legte eine weiße Decke über die Stadt und dämpfte alle Geräusche. Doch Kate meinte, dass das heftige Schlagen ihres Herzens laut zu hören sein müsse.
4
Die breite Krempe seines mit Schneeflocken gesprenkelten Hutes verwegen in die Stirn gedrückt und den Pelzkragen hochgeschlagen, kam James Glenville zielstrebig auf Kate zu. Er hatte ein Lächeln auf dem Gesicht, das längst die Spuren der schweren Krankheit verloren hatte.
Wie gut er aussieht, dachte Kate und wünschte, sie hätte an diesem Tag ihren netten Hut anstelle der selbstgestrickten Wollmütze aufgesetzt. Im nächsten Moment tadelte sie sich selbst für diesen dummen, eitlen Gedanken.
»Da komme ich ja gerade noch rechtzeitig!«, rief James vergnügt. »Um Himmels willen, was tun Sie bei dieser Kälte auf der Straße, James?«
»Sie nach Hause begleiten, Kate«, antwortete er fröhlich, und sein Atem dampfte in der kalten Luft.
Es irritierte sie, dass sie sich so sehr über sein unerwartetes Erscheinen und über sein Interesse freute. Sie versuchte, dieses Gefühl zu ignorieren, und besann sich ihrer Verantwortung. »Sie gehören ins Warme, oder wollen Sie einen Rückfall erleben?«, rügte sie ihn.
»Es wird keinen Rückfall geben. Ich bin warm angezogen.« Er deutete auf den Pelzkragen und den Schal aus weichem, warmem Flanell. »Ich musste mal an die frische Luft, und Dr. Boswell hatte nichts dagegen einzuwenden.«
»Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass Sie Dr. Boswell konsultiert haben?«, fragte sie leicht vorwurfsvoll.
»Weil mir sein Urteil nicht halb so wichtig ist wie Ihres, Kate.« Sein Lächeln und der Ausdruck seiner Augen verstärkten ihre Verwirrung – eine sehr angenehme, aufregende Verwirrung. »Dann lassen Sie uns gehen, bevor Sie hier auf dem Gehsteig festfrieren.«
»Bei Ihnen weiß ich mich in den allerbesten Händen«, erwiderte er lächelnd.
Kate schlug anfangs ein scharfes Tempo an, als wolle sie so schnell wie möglich nach Hause kommen. Doch bald hatte sie sich dem Schritt ihres Begleiters angepasst, einem gemächlichen Spaziergangsschritt, und es gefiel ihr. Der unaufhörlich fallende Schnee setzte den Dächern weiße, sanft gerundete Hauben auf, verzierte die Erker und Vorsprünge der Hausfassaden und verhüllte den Schmutz auf Gehwegen und Straßen.
James sog die kalte Luft tief und genießerisch ein, als steige ihm herrlicher Blumenduft in die Nase und nicht der Rauch von Holz und Kohle, der aus unzähligen dunkel aufragenden Schornsteinen quoll. »Ist das nicht ein wunderbarer Tag, Kate? Und ist London nicht schön und aufregend?«
»Ich habe noch nie darüber nachgedacht.«
Er machte eine ausholende Bewegung, die nicht nur den regen Verkehr der zahllosen Kutschen und Fuhrwerke und den Strom dahineilender Passanten meinte, sondern das ganze Viertel, ja ganz London. »Eine mehr als tausend Jahre alte Stadt, die über vier Millionen Einwohner zählt und niemals, zu keiner Stunde des Tages oder der Nacht, zur Ruhe kommt! Eine Stadt wie ein brodelnder Kessel, ein alles verschlingender Mahlstrom – doch auch wie ein weiter, majestätischer See mit vielen Seitenarmen und mit stillen Ufern.«
»Das haben Sie schön ausgedrückt«, sagte sie, während sie die Old Broad Street hinuntergingen.
Er winkte bescheiden ab. »Es sind Orte wie London und Menschen wie Sie, die das Beste in uns zutage bringen.«
Sie errötete und wagte nicht, ihn anzublicken. »Erzählen Sie mir von Ihrer Stadt, von San Francisco, James.«
»San Francisco ist auch eine sehr schöne und sehr aufregende Stadt. Doch sie ist auch jung, voller Dummheit, Arroganz und Rücksichtslosigkeit, und sie ist vor allem nie meine Stadt gewesen«, antwortete er, und seine Stimme klang plötzlich verändert – hart und angespannt.
»Und warum nicht?«
Er antwortete nicht sofort. Eine Weile stapfte er mit verschlossener Miene neben ihr durch den Schnee, als nehme er diese Frage übel. Dann sagte er: »Ich habe meine Gründe, Kate. Doch mir ist jetzt nicht danach, darüber zu sprechen.«
Irgendwie fühlte sie sich schuldig. »Entschuldigen Sie, James, ich wusste nicht …«
Er blieb kurz stehen und legte seine Hand auf ihren Arm. Sein Blick war wieder weich und voller Zuneigung, als er sie unterbrach: »Sie konnten nicht wissen, dass ich nicht daran erinnert werden will, Kate. Es tut mir leid, dass ich so abweisend reagiert habe. Ich habe einfach unschöne Erinnerungen an San Francisco, das ist alles.«
»Das tut mir leid für Sie.«
Er lachte wieder. »Es gibt nichts, was Ihnen leidtun müsste, Kate. An keinem Ort möchte ich jetzt lieber sein als hier in London, und mit keinem Menschen möchte ich lieber zusammen sein als mit Ihnen!«
Sie erglühte. Der Wollmantel und die Mütze schienen ihr auf einmal viel zu warm zu sein. »Mr. Glenville!«
»Sind wir darüber nicht schon längst hinaus, Kate?«
Im selben Moment trugen zwei Männer keine fünf Schritte vor ihnen einen Sarg aus einem Hauseingang und schoben ihn auf die Ladefläche eines am Straßenrand wartenden Fuhrwerks. Sie deckten den schlichten Sarg mit einer nicht ganz sauberen Plane zu. Der harte Winter forderte in diesem Jahr wieder einmal viel Opfer unter den Kranken, Armen und Alten.
Kate bekreuzigte sich.
»Ihr Glaube bedeutet Ihnen viel?«
»Ja, ich denke schon«, bestätigte sie nach kurzer Pause. »Aber ich bin nicht sehr religiös. Ich habe von meinem Vater vielmehr die Freiheit übernommen, nicht alles für richtig und befolgenswert zu erachten, was die Kirche lehrt.«
Er schmunzelte. »Also eine kleine Rebellin, ja?«
Sie schüttelte lachend den Kopf. »Nein, eher gläubig mit einer gesunden Skepsis gegenüber allen Gesetzen und Dogmen, die als unfehlbar und göttlich gelten sollen, obwohl sie doch von sehr fehlbaren Menschen aufgestellt worden sind.«
»Hat Ihr Vater Sie diese Skepsis gelehrt?«
»Nicht direkt. Er hat immer zu mir gesagt: ›Schau genau hin, was die Menschen tun, und vergleiche das mit dem, was sie sagen! Gebrauche deinen Verstand. Alles andere kommt von selbst.‹ Das war eine seiner Redensarten.«
»Er muss ein bemerkenswerter Mann gewesen sein. Ich wünschte, ich hätte ihn kennengelernt.«
Wehmut zeigte sich auf ihrem Gesicht. »Ja, er hätte Ihnen garantiert gefallen, obwohl er nur ein einfacher Mann war. Er hat dafür gesorgt, dass ich das Schwesternseminar der Florence Nightingale School am St. Thomas Hospital besuchen konnte. Jeden Penny hat er dreimal umgedreht, bevor er ihn ausgegeben hat. Ich habe ihn sehr geliebt. Und meine Mutter auch. Sie war eine fromme Frau mit einem unerschütterlichen Glauben an alles, was die Kirche sagt. Sie hat bei jedem Kirchgang einen Rosenkranz für meinen Vater und mich gebetet, um unseren Mangel an Gottesfurcht auszugleichen. Und wenn mein Vater sagte, dass Geistliche nicht viel taugen können, wenn sie Furcht vor Gott predigen, dessen Botschaft doch Verzeihen und Nächstenliebe sind, dann hat sie sich dreimal bekreuzigt und ist am nächsten Morgen in die Kirche gegangen, um für ihn zu beten und eine Kerze anzuzünden.« Kate lächelte bei diesen Erinnerungen. »Wenn sie noch lebte, würde sie mir täglich Vorwürfe machen, dass ich mein Seelenheil vernachlässige.«
»Aber Sie gehen doch jeden Sonntag zum Gottesdienst.«
»Eine Kirche ist für mich ein Ort besonderer Stille und innerer Einkehr– unabhängig von dem, was von der Kanzel gepredigt wird. Aber seit dem Tod meiner Mutter habe ich nicht mehr gebeichtet.«
»Fehlt Ihnen die Beichte?«
»Nein«, antwortete Kate ohne Zögern.
»Mir auch nicht«, sagte er leichthin. »Gut, ich bin zwar Protestant, aber ich glaube nicht, dass es einen getrennten Himmel für Katholiken und für Protestanten gibt. Und die Hölle ist bestimmt auch nicht in besondere Viertel für Muslime und Buddhisten unterteilt. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er mit Sicherheit nicht so engstirnig wie wir Menschen«, sagte James überraschend grimmig, »die meist nicht tolerieren können, dass es im Leben nicht nur eine einzige Wahrheit gibt und dass des einen Glück nicht auch des anderen Glückseligkeit bedeuten muss, sondern vielleicht das genaue Gegenteil.«
Kate beschlich das Gefühl, James’ Einschätzung der mangelhaften Toleranz der Menschen entspringe weniger theoretischen Überlegungen als vielmehr persönlichen Erfahrungen. Vorsichtig fragte sie: »Sie haben mir noch gar nichts über Ihre Familie erzählt, James. Sie haben doch noch Familie in San Francisco, nicht wahr?«
»Nein«, lautete seine fast schroffe Antwort. Dieses Nein war wie eine Mauer. Es schloss jede weitere Auskunft aus und machte dieses Thema unberührbar. Er war wie verwandelt. Doch dann bemerkte er ihre Betroffenheit, und so rang er sich zu einer kurzen Antwort durch. »Ich bin das einzige Kind meiner Eltern. An meine Mutter habe ich kaum Erinnerungen. Ich war erst zwei, als sie … als sie es vorzog, ihr Leben mit einem anderen Mann als meinem Vater zu teilen. Sie hatte wohl ihre Gründe dafür, doch ich konnte sie nicht danach fragen. Wo und mit wem sie gelebt hatte, erfuhr ich erst, als ich sechzehn war. Durch ein Telegramm. Am Tag ihrer Beerdigung.«
»Es tut mir leid, James«, murmelte Kate betreten. »Ich wusste nicht, dass ich mit meiner Frage so schmerzliche Erinnerungen wachrufen würde.«
Er zuckte die Achseln. »Wer weiß, wozu es gut war. Ich habe meine Mutter nie gekannt, und wir wären uns ja doch fremd geblieben. Es hätte ihr sicher nicht gefallen, wenn ich nach all den Jahren in ihr Leben hereingeplatzt wäre, ihr eine Menge vorwurfsvoller Fragen gestellt und sie an eine Zeit erinnert hätte, an die sie zweifellos nicht mehr erinnert werden wollte.«
Sie spürte den Drang, ihm tröstend eine Hand auf den Arm zu legen. Doch sie verbot sich diese vertrauliche Berührung. »Es muss sehr schwer für Sie gewesen sein.«
Er lachte bitter auf. »O nein, es gab Schlimmeres, Kate. Mein Vater …« Er stockte, als werde ihm bewusst, was zu sagen er im Begriff stand. Und dann fuhr er mit veränderter, fast sachlicher Stimme fort: »Mein Vater ist letzten Sommer gestorben. Nach einem relativ harmlosen Eingriff im Krankenhaus haben sich Komplikationen eingestellt. Und eine Woche später war er tot.«
Kate glaubte nun zu wissen, warum James um keinen Preis ins Krankenhaus hatte eingeliefert werden wollen – und warum er nach London gekommen war. Sie spürte jedoch, dass er nicht weiter darüber reden wollte, und geschickt brachte sie ihr Gespräch auf ein anderes Thema.
Sie kamen zum Duke’s Place, wo allerlei Trödler, Altwarenhändler, Tischler, Schreiner, Polsterer und Kupferschmiede ihre Geschäfte und Werkstätten hatten. Die Namen über den Läden und Werkstätten verrieten, dass dieses Viertel stark von jüdischem Leben geprägt wurde. Zu ihrer Linken ragte der obeliskenartige Turm der St. Botolph Church in den tief hängenden Schneehimmel. Es wurde nun rasch dunkel. Hinter vielen Fenstern brannte schon Licht, und die Straßenlaternen tauchten den Schnee zu ihren Füßen in einen gelblichen Schein. Die Dunkelheit war nicht mehr fern, und doch beschleunigten sie ihre Schritte nicht, während sie die Heneage Lane hinuntergingen und dann die breite Leadenhall Street überquerten. Das Elend des East End lag nur ein paar Straßen entfernt.
In ihr leicht dahinfließendes und doch sehr vertrautes Gespräch vertieft, folgten sie der Fenchurch Street. Essensgerüche drangen zu ihnen auf die Straße; und als sie an einer primitiven Garküche auf Rädern vorbeikamen, die ein bärtiger Mann im Schutz eines Torbogens betrieb, ließ der Duft der brutzelnden Rostbratwürstchen Kate das Wasser im Mund zusammenlaufen.
»Das hat wirklich gut gerochen, nicht wahr?«, fragte James.
»Mhm, ja, sehr gut sogar«, räumte sie ein wenig verlegen ein. »Aber jetzt sind wir ja bald zu Hause.«
»Aber bis Sie etwas Warmes auf dem Tisch haben, wird es bestimmt noch dauern. Und mir ist heute nicht nach aufgewärmtem Eintopf zumute. Warum gehen wir nicht hier etwas essen?«, schlug er vor.
Sie zögerte kurz, rief sich dann aber zur Vernunft. »Nein, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, James.«
»Ich lade Sie natürlich ein«, fügte er schnell hinzu.
Sie lächelte. »Danke, das ist sehr nett von Ihnen, James, und ich weiß Ihre Großzügigkeit auch zu schätzen, aber …«
Er ließ sie nicht ausreden. »Bitte, tun Sie mir den Gefallen. Ich möchte es so gerne, und ich kann es mir auch erlauben. Bitte sagen Sie nicht nein. Nach allem, was Sie für mich getan haben, müssen Sie mich auch etwas für Sie tun lassen!«
Wann war sie das letzte Mal zum Essen in einem Lokal eingeladen gewesen? Als sie Liz zu ihrer letzten Anprobe des Brautkleides bei Mrs. Applestrong begleitet hatte. Anschließend hatten sie eine Teestube unten bei den Fischhallen aufgesucht, und Liz hatte sie zu Tee und köstlichen kleinen Sandwiches eingeladen. Doch das war im letzten Mai gewesen und nun schon beinahe ein Jahr her.
Also war die Verlockung groß, zu groß. Und Kate gab nach. Sie bestand jedoch darauf, dass sie eine der einfachen Schankstätten aufsuchten. Für ein besseres Lokal fühlte sie sich nicht passend gekleidet. Denn unter ihrem Mantel trug sie ein schlichtes, hellgraues Kleid, schmucklos und bis zum Hals geschlossen, wie es im Krankenhaus als Schwesterntracht vorgeschrieben war.
James ging mit Kate ins Hoop and Grapes, eine altehrwürdige Taverne aus dem späten 17. Jahrhundert mit niedriger Balkendecke. Der Wirt legte nicht nur Wert auf Sauberkeit und anständiges Publikum, sondern sparte auch nicht am Lohn für eine gute Köchin.
Es war noch früh, und so fanden sie einen gemütlichen Ecktisch an einer gepolsterten Eckbank. Mit Kates voller Zustimmung bestellte James Hammelrücken mit Kartoffeln und Bohnen und gegen ihren schwachen Protest Sherry.
Kate kam aus einem irischen Haus und war daher dem Alkohol nicht abgeneigt. Aber sie hatte Alkoholisches noch nie in der Öffentlichkeit zu sich genommen, und es kam ihr sehr gewagt vor. Doch zu ihrer Verwunderung fand sie es auch ungeheuer aufregend, mit James in dieser Taverne zu sitzen und vorsichtig am Sherry zu nippen.
Das Essen übertraf ihre Erwartungen. Der Hammel war zart und gut gewürzt, die Kartoffeln nicht zu mehlig und die Bohnen hatten Biss. Aber auch wenn das Fleisch zäh, die Kartoffeln nur halb gar und die Bohnen zerkocht gewesen wären, sie hätte das Essen nicht weniger genossen. Denn es war der Zauber dieses fremden und doch so vertrauten Mannes, der aus diesem Mahl etwas Besonderes machte. Ihre Unterhaltung wurde nicht von Pausen der Verlegenheit unterbrochen, in denen sie sich fragten, womit sie das Schweigen füllen sollten. Ihr Gespräch floss dahin – mal ernst, mal beschwingt, doch immer mühelos.
Einmal kam ihr der Gedanke, wie anders er doch war als Sean Coolidge, ihr Cousin zweiten Grades, mit dem Onkel Liam sie hatte verheiraten wollen. Irgendwann hatte sie herausgefunden, dass ihr Onkel seiner Schwägerin, Seans Mutter, quasi sein Wort gegeben und sie Sean versprochen hatte! Sie wurde noch jetzt zornig, wenn sie nur daran dachte.
Sean stand eigentlich als Beispiel für alle Männer, die sie kannte. Als er ihr im Sommer ernsthaft den Hof gemacht – ernsthaft in seinem Sinn – und sie ausgeführt hatte, hatte er stets nur ein einziges Thema gekannt – und das war er selbst gewesen. Ständig hatte er ihr von seinen Plänen und seinen Vorstellungen und Meinungen erzählt. Sie konnte sich nicht erinnern, dass er sie auch nur ein einziges Mal nach ihren Träumen, Wünschen oder Ansichten gefragt hätte. Er war offensichtlich davon ausgegangen, dass sie seine Gedanken für genauso großartig hielt wie ihn selbst und dass sie sich seinen Vorstellungen in allem anschließen würde. Doch statt ihn mit verklärten Augen anzuhimmeln, brach sie in schallendes Gelächter aus, als er sie beim Picknick auf tollpatschige Weise zu küssen versuchte und dabei zwischen das Obst und die Sandwiches auf die Decke fiel und mit einer Hand in die Schüssel mit dem Pudding fasste. Das war nicht nur das Ende ihres Picknicks gewesen, sondern auch das seines Werbens, was sie mit großer Erleichterung und stiller Erheiterung aufgenommen hatte. Wie anders dagegen doch James Glenville! Er war ein wunderbarer Unterhalter und ein großartiger Zuhörer, der ihren Worten wirklich interessiert lauschte. Sie fühlte, dass ihm ihre Gedanken wichtig waren, und das ermutigte sie, von sich und von ihrer Familie zu erzählen.
Sie erzählte ihm von den ersten sechs Jahren ihres Lebens, die sie in einem armseligen Dorf eine Kutschenstunde südwestlich von Dublin verbracht hatte, und von ihrem Onkel, der Irland viele Jahre vor ihnen verlassen hatte, als Fischhändler in Billingsgate zu Geld gekommen war und ihnen die Reise nach London bezahlte, als ihr Vater nach einem bitteren Jahr noch immer ohne Arbeit war.
»Nein, Onkel Liam ist alles andere als großzügig«, widersprach sie, als James lobende Worte für dessen Hilfe fand. »Onkel Liam hat nie auch nur einen Pence verschenkt. Was er gibt, verlangt er auf die eine oder andere Art dreifach und mehr zurück.«
»Das klingt mir vertraut«, meinte James mit einem schiefen Grinsen.
»Mein Vater hat lange für seinen Bruder arbeiten müssen«, fuhr Kate fort. »Und er hat schwer arbeiten müssen, das können Sie mir glauben. Für einen sehr bescheidenen Lohn, der unter dem der anderen Männer lag, die für Onkel Liam arbeiteten. Als mein Vater nach vielen Jahren eine andere Arbeit annahm, für die er einigermaßen anständig bezahlt wurde, da hat Onkel Liam so getan, als habe mein Vater ihn verraten. Undank ist der Welt Lohn, das hat er ihm vorgehalten. Aber als meine Mutter die Schwindsucht hatte, dachte er nicht daran, meinem Vater einen höheren Lohn zu zahlen. Und der wusste nicht, wie er uns ernähren und den Arzt bezahlen sollte.«
»Verdammte Krämerseele!«, schimpfte James.
Kate nickte. »Mutter sei ohnehin nicht zu retten, ließ Onkel Liam durchblicken, als mein Vater ihn um ein Darlehen anging. Das stimmte zwar, linderte aber unsere Not nicht. Ich war damals zwölf und fühlte mich so verzweifelt hilflos. Ich sah, wie Mutter litt, aber ich konnte nichts tun, um ihr Leiden zu lindern. In dieser Zeit hat mein Vater bei Onkel Liam gekündigt. Er hätte es schon viel eher getan, doch Mutter wollte es nicht. Sie glaubte tatsächlich, wir alle stünden lebenslang in Liams Schuld.«
James sah Tränen in Kates Augen. »Und damals erwachte in Ihnen der Wunsch, Krankenschwester zu werden und kranken Menschen zu helfen, nicht wahr?«
Verblüfft sah sie ihn an. »Ja, das stimmt.«
Er lächelte. »Das war nicht schwer zu erraten, Kate. Sie sind für mich wie ein offenes, wunderschönes Buch«, sagte er zärtlich. »Obwohl ich zugebe, dass ich über die ersten Kapitel noch nicht hinausgekommen bin. Und ich kann es nicht erwarten, auch die anderen kennenzulernen.«
»Müssen Sie mich immer mit Schmeicheleien verlegen machen?«, fragte Kate mit sanftem Protest, während ihr das Blut in die Wangen stieg.
»Ich schmeichle Ihnen nicht, Kate. Ich sage nur, was ich denke … und vor allem fühle«, sagte er ernst und mit unverhohlener Zuneigung. Sie schluckte, während ihr Herz wie wild pochte. Ihr war auf einmal ganz heiß. Der Sherry und das reichhaltige Essen! Das musste es sein. Sie war das alles nicht gewohnt … auch nicht diese Worte und Blicke, mit denen James sie bedachte.
Die Bedienung hatte längst die Teller abgeräumt. James gab sich einen Ruck, fasste in seine Jackentasche und holte ein kleines flaches Kästchen heraus, das mit königsblauer Seide überzogen war. Er legte es vor Kate auf den Tisch. »Ich trage es jetzt schon drei Tage mit mir herum, ohne den Mut zu finden, es Ihnen zu geben!«
»Mir geben? Was … was ist das?«, fragte sie verwirrt.
»Ein Geschenk, Kate. Bitte machen Sie es auf. Ich hoffe, es gefällt Ihnen.«
Ihr Mund war auf einmal trocken. Allein die Schachtel sah so kostbar aus, dass sie zögerte, den Deckel zu öffnen. Als sie es dann tat, stockte ihr der Atem. Auf einem kleinen mitternachtsblauen Samtkissen lag ein wunderschönes goldenes Kreuz an einer goldenen Kette.
»James! … Nein!«, stieß sie hervor. »Das kann ich nicht annehmen!« Schnell klappte sie den Deckel zu, als fürchtete sie, schwach zu werden, wenn ihr Blick auch nur eine Sekunde länger auf diesem Schmuckstück ruhte.
»Doch, Sie können, Kate! Mein Gott, Sie haben mir das Leben gerettet!«, rief er heftig, dämpfte seine Stimme aber sofort, als sich zwei Männer am Nebentisch neugierig zu ihnen umblickten. »Sie dürfen es mir nicht verwehren, Ihnen meine Dankbarkeit und … und tiefe Zuneigung zu zeigen. Ich bitte Sie, mein Geschenk anzunehmen. Ich habe mir tagelang den Kopf zerbrochen, womit ich Ihnen eine besondere Freude bereiten könnte. Und ich … ich habe es mit so viel Liebe ausgesucht. Bitte machen Sie mir die Freude. Es bedeutet mir sehr viel.«
Seine Worte berührten sie tief, sie spürte seine Aufrichtigkeit – und noch einiges mehr.
»Oder gefällt es Ihnen gar nicht?«, fragte er und sah sie bang, fast bestürzt an.
»Es ist wunderschön, James«, flüsterte sie.
Er lächelte wie erlöst und klappte die Schachtel wieder auf, schob sie näher zu ihr heran. »Bitte, Kate!«, sagte er leise und eindringlich. Sie schüttelte den Kopf, lächelte jedoch dabei und nahm das kunstvoll gearbeitete Kreuz in die Hand. Die Kette glitt unter dem Samt hervor. Noch nie in ihrem Leben hatte sie etwas so Kostbares in der Hand gehalten, geschweige denn besessen. Wie warm das Gold im Licht der Lampen schimmerte! Das Geschenk rührte sie zu Tränen und machte ihr eigene Gefühle offenbar, über die sie bisher nicht hatte nachdenken wollen. Weil sie gefürchtet hatte, verletzt zu werden, ausgelacht wie Sean. Wie dumm von ihr! James würde niemandem wehtun, ihr schon gar nicht. Und diese Erkenntnis ließ sie erschauern.
»Würden Sie die Kette bitte jetzt gleich anlegen, damit ich sehe, wie sie Ihnen steht?«, bat er.
Schweigend erfüllte sie seine Bitte, doch sie hatte Mühe, die Kette im Nacken zu schließen, weil ihre Finger so zitterten.
»Wunderschön!«, flüsterte James, als das Kreuz auf dem perlgrauen Stoff ihres Kleides ruhte, über der verführerischen Wölbung ihres Busens. »Ich wusste es.«
Einen Augenblick sahen sie sich stumm an. Ihre Blicke tauchten ineinander, und jeder las in den Augen des anderen.
»Ich liebe dich«, sagte James schließlich mit leiser, aber fester Stimme. »Willst du meine Frau werden, Kate O’Hara?«
Ihre Augen leuchteten, und sie lächelte strahlend. »Ja, James! Ja, ich will!«
5
Die Trauung fand drei Wochen später an einem kalten, klaren Märztag statt. Kate trat in einem weißen Taftkleid, das mit Orangenblüten bestickt war und eine kleine Schleppe hatte, vor den Altar. Ein Traum in Weiß, wie man ihn bisher noch bei keiner Hochzeit im Viertel um St. Mary-at-Hill gesehen hatte.
James trug einen schwarzen Anzug aus bestem Tuch, dazu eine cremeweiße gefältelte Hemdbrust, einen weißseidenen Querbinder und modische Lackschuhe und machte damit nicht weniger Eindruck. Er war ganz Herr der Situation, nicht im Geringsten aufgeregt. Er erlebte jede Sekunde des Hochzeitstages bewusst – voller Liebe und Stolz. Sein Lächeln sagte allen, dass er nicht den leisesten Zweifel daran hegte, in Kate das Glück seines Lebens gefunden zu haben. Und dass ihm nichts wichtiger war als ihre Liebe. Kate empfand nicht anders, war aber nicht frei von Herzklopfen; und in manchen Momenten war ihre Aufregung so groß, dass sie fürchtete, keinen Schritt mehr gehen und vielleicht das Ehegelöbnis nicht über die Lippen bringen zu können.
Die drei Wochen, die seit James’ Heiratsantrag im Hoop and Grapes vergangen waren, waren nicht weniger aufregend gewesen. Es war so vieles zu organisieren gewesen. Und als bekannt wurde, dass Kate O’Hara den Amerikaner zu heiraten gedachte, bekam sie nicht nur Glückwünsche und Ratschläge zu hören, sondern auch unerfreuliche Bemerkungen und Warnungen.
»Ein Protestant!«, war der erste von vielen Einwänden Onkel Liams gewesen, eines bulligen Mannes mit Halbglatze und einem buschigen Schnurrbart. »Kein Priester wird dich mit einem Protestanten trauen! Und willst du vielleicht ohne den Segen der Kirche in Schande leben?«
Tante Anne nickte dazu düster. »Deine Mutter würde sich im Grab umdrehen, wenn sie davon wüsste!«
James schaffte dieses Problem schnell aus der Welt, indem er zum katholischen Glauben konvertierte. »Mir macht es nichts aus, Liebling«, beruhigte er sie, als sie Gewissensbisse plagten, dass er ihretwegen seinem Glauben abschwören sollte. »Dein Glaube bedeutet dir mehr als mir der meinige. Ich war bisher ein passiver Protestant gewesen; und nun werde ich eben ein passiver Katholik sein. Das sind doch nur Äußerlichkeiten. Oder hast du vielleicht gehört, dass Moses auf den Tafeln mit den zehn Geboten einen Zusatz gefunden hätte, wonach sie katholische oder protestantische Gebote wären?«
Kate lachte. »Nein, ich denke auch, die Gebote gelten für uns alle.«
Als Onkel Liam und Tante Anne erfuhren, dass James zum katholischen Glauben übergetreten war, blieb ihnen nur noch ohnmächtiger Groll. Sie hatten nun keinen Vorwand mehr, der es ihnen erlaubt hätte, ihren Pflichten nicht nachzukommen.
Liz konnte nicht verstehen, warum es Kate so wichtig war, dass ihr Onkel sie an Stelle ihres Vaters in die Kirche geleitete und sie ihrem zukünftigen Ehemann zuführte. »Du warst doch nie gut auf ihn zu sprechen. Warum ihm also diese Ehre erweisen?«
»Ich sehe das anders: Es ist etwas, was er mir schuldig ist«, antwortete Kate. Sie war sich wohl bewusst, dass sie noch einen tieferen Grund hatte: Sie wollte es auch, weil Onkel Liam ihren Vater so schändlich behandelt und außerdem geglaubt hatte, sie mit dem Mann seiner Wahl verheiraten zu können. Dies war ihre stille Rache.
Kate war eine atemberaubend schöne Braut, darüber herrschte Einigkeit, als sie der weißen Hochzeitskutsche entstieg, mit der James sie überrascht hatte. Sogar Onkel Liam gab einen Laut der Bewunderung von sich. Nur Sean, der nicht den Mut gefunden hatte, der Hochzeit fernzubleiben, machte ein finsteres Gesicht.
Kate gab James mit heller, bewegter Stimme, die sie entgegen ihren Befürchtungen im entscheidenden Moment doch nicht im Stich ließ, das Jawort.
Anschließend strömte die Hochzeitsgesellschaft – die Nachbarschaft und einige Freundinnen aus dem Krankenhaus – in den Saal von Gregory Lansbury, der den Pub Black Friar betrieb, ein paar Schritte von der Kirche entfernt. Dass die feuchtfröhliche Feier hier stattfinden würde, war von vornherein selbstverständlich gewesen. Es war im Viertel einfach Tradition, dass jedes großes Ereignis, das außerhalb der eigenen vier Wände gefeiert wurde, ob nun Beerdigung oder Hochzeit, im Black Friar seinen würdigen Rahmen fand. Gregory Lansbury hatte sich diesmal selbst übertroffen, was den Saalschmuck, die kulinarischen Künste und die exzellente Kapelle betraf. Dass James daran nicht unbeteiligt war – mit einigen intensiven Gesprächen und einer saftigen Extraprämie für die Sonderwünsche –, hielt der Wirt nicht für erwähnenswert, wenn er im Laufe der Feier, die bis tief in die Nacht dauerte, von begeisterten Gästen gelobt wurde. Es war eine rauschende Feier, von der im Viertel noch viele Jahre später gesprochen wurde. Und wer selber teilgenommen hatte, sagte voller Stolz und mit verklärtem Blick: »Die Hochzeit des Amerikaners! Ja, das war ein Fest!«
Kate und James schwebten auf einer Wolke des Glücks. Dass Onkel Liam, Tante Anne und Sean ihre Teilnahme nur als missliche Familienpflicht betrachteten, trübte ihre Stimmung nicht.
»Ein Amerikaner!«, hörte Kate ihren Onkel mit unversöhnlichem Groll zum Wirt sagen. »Ausgerechnet einen Amerikaner! Da hätte sie ja auch gleich einen verdammten Franzosen heiraten können!«
Kate sah keine Logik in diesen Sätzen, aber das kümmerte sie nicht: Verletzte Eitelkeit folgt nun mal nicht den Gesetzen der Logik.
»Für einen Amerikaner ist er aber ein verdammt patenter Kerl, der zudem noch fabelhaft aussieht, Mr. O’Hara«, erwiderte Gregory Lansbury trocken und fügte doppeldeutig hinzu: »Und dass er ein Geizkragen sei, kann man ihm wirklich nicht nachsagen.«
Dafür hätte Kate ihm am liebsten einen Kuss gegeben, denn der Onkel verstand die Anspielung sehr wohl. Er gab ein wütendes Schnaufen von sich und fragte, in Ermangelung einer passenden Antwort, verärgert: »Was stehen Sie hier rum und reden? Wo bleibt mein Whisky?«
Mitternacht war schon längst vorbei, als Kate und James die fröhliche Hochzeitsgesellschaft sich selbst überließen. Kate fühlte sich beschwingt, mehr vom Glanz des Tages als vom Punsch, und war glücklich, dass sie nun endlich mit ihrem Mann allein sein konnte. Doch sie hatte auch ein wenig Angst. Nicht vor James und ihrer Hochzeitsnacht. Auch nicht eigentlich vor dem, was Liz und andere Frauen verschämt als eheliche Pflicht bezeichneten und was ihr als Krankenschwester in der Theorie natürlich bekannt war. Sie quälte dabei vielmehr die Sorge, dass sie James enttäuschen könnte, denn sie wusste, welche Bedeutung ein Mann dem Akt der körperlichen Liebe beimaß.
In einem Moment intimer Offenheit hatte Liz ihr zwei Tage vor der Hochzeit gestanden, dass sie wenig Vergnügen an dieser Seite der Ehe fand, die ihrem William so wichtig sei. »Du musst es über dich ergehen lassen, Kate, und dabei an etwas Schönes denken. Aber du darfst nicht steif wie ein Stück Holz und mit abgewandtem Kopf daliegen und dir anmerken lassen, wie unerfreulich du dieses ganze … nun ja, Gestoße und Gestöhne findest. Denn wenn es William lustvolles Vergnügen bringt und er das Gefühl hat, dass ich mich ihm willig hingebe, dann ist er am nächsten Tag auch immer gut gelaunt, und dann kann ich ihn um den kleinen Finger wickeln.«
Kate fühlte Scham bei diesem Gedanken, denn ihr kam es unredlich vor, was Liz ihr geraten hatte. Und es passte nicht zu den Gefühlen, die sie für James empfand. Sie wollte ihn niemals täuschen und belügen, andererseits wollte sie ihn auch nicht enttäuschen und wusste nicht, was von ihr erwartet wurde. Dieses Dilemma machte sie still und angespannt.
James trug sie über die Türschwelle in seine Wohnung. Im Wohnzimmer gab er ihr einen langen Kuss. Kate schlang die Arme um seinen Hals, als wollte sie ihn nie wieder loslassen. »James …«
»Ja, mein Liebstes?«
»Ich liebe dich, wie man einen Menschen wohl nur lieben kann, doch ich … ich habe auch ein bisschen Angst«, flüsterte sie.
»Ich weiß«, flüsterte er zurück. »Aber du brauchst keine Angst zu haben, mein Liebling. Ich verspreche dir, dass alles gut sein wird. Vertraust du mir?«
Kate nickte stumm.
Behutsam löste er sich aus ihrer Umarmung. »Warte einen Augenblick. Und vergiss nicht, wie viel du mir bedeutest. Ich werde dir nie wehtun, Kate, niemals!« Mit diesem Versprechen verschwand er hinter der Tür zum Schlafzimmer.
Es vergingen nur ein paar Minuten, doch Kate wurde die Zeit lang. Immer wieder fuhren ihre Hände glättend über ihr Brautkleid, das sie schon in wenigen Augenblicken ablegen würde – wie auch Unterröcke, Strümpfe und Leibwäsche. Und dann … Ja, was dann?
Endlich kehrte James zu ihr zurück. »Schließ die Augen. Ich führe dich.« Er nahm ihre Hände, und mit geschlossenen Augen folgte sie ihm ins Schlafzimmer. Sie nahm intensiven Duft von Blumen und von Kerzenwachs wahr.
»Jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen.«
Kate stieß einen leisen Schrei der Überraschung und des Entzückens aus. »O Gott, James!«
Im Zimmer brannte ein Meer von Kerzen. Sie standen auf der langen Kommode neben der Tür, auf dem Bord des Kleiderschrankes, auf dem Nachttisch, auf dem Stuhl und sogar auf dem Boden. Doch es gab nur einen einzigen siebenarmigen Leuchter. Alle anderen Kerzen steckten in Einmachgläsern, die bunt bemalt waren, so dass das Zimmer in den warmen und gedämpften Schein farbiger Lichter getaucht war. Zwischen den Einmachgläsern standen Schalen mit Wasser, auf denen sowohl echte Blüten als auch getrocknete Blütenblätter schwammen und von denen ein berauschender Duft ausging.
Aber die Kerzen und die Duftschalen waren nicht die einzige Überraschung. Über dem Bett hingen drei handtellergroße Messingringe direkt unter der Decke. Durch diese Ringe liefen mehr als ein Dutzend armbreite lange Bahnen hauchzarten Voilegewebes. Die durchsichtigen Stoffe umhüllten das Bett mit einem kegelförmigen Zelt. »Gefällt es dir?«
»Es ist wunderschön, James.« Der Raum kam ihr wie verzaubert vor.
Er hielt noch immer ihre Hände. »Tausendundeine Nacht, für immer. Heute ist unsere erste gemeinsame Nacht, und ich möchte, dass du weißt, dass ich dir ein Leben voller Liebe und voller Wunder, voller Verheißungen und Abenteuer schenken möchte … da draußen, Kate, aber auch hinter verschlossenen Türen.«
Sie küssten sich. Dann begann er sie langsam zu entkleiden, und es war auf einmal keine Angst mehr in ihr, sondern die unerschütterliche Gewissheit, dass ihre Liebe sie führen und sie alles recht machen lassen würde. Sie liebten sich, was also konnte ihnen widerfahren? Ein großes Wunder. Ja, es erschien Kate als das größte Wunder ihres Lebens, was sie in dieser Nacht in seinen Armen erfuhr– und was sie in sich entdeckte, nämlich eine Lust und sinnliche Erfüllung, die ihr den Atem nahm.
Eheliche Pflichten? O Gott, es war ein himmlischer Rausch, eine Offenbarung für Körper und Seele, ein unglaublicher Taumel der Sinne, Hingabe und Erfüllung, die Krönung einer jeden Liebe. Wie konnte jemand so ein Wunder als Pflicht oder gar Bürde bezeichnen? Sie ahnte sehr wohl, dass den wenigsten Frauen das Glück zuteil wurde, in der Hochzeitsnacht so zärtlich und geduldig in die körperliche Liebe und Sinneslust eingeführt zu werden. Sie hatte geglaubt, ihren Körper und seine Reaktionen gut zu kennen. Dabei hatte sie von der beglückenden Welt, zu der ihr James das Tor aufgestoßen hatte, nichts gewusst.
»Warum weinst du?«, fragte er und küsste eine Träne von ihrer Wange, nicht ernstlich besorgt, denn sie lächelte ihn dabei an.
Sie hatten ein, zwei Stunden geschlafen und sich dann wieder geliebt, mit einer Leidenschaft und intimen Vertrautheit, wie er sie sich nicht zu erträumen gewagt hatte. Es dämmerte schon vor dem Fenster, und die Kerzen waren bis auf drei schwach flackernde Lichter verlöscht. »Weil ich so glücklich bin, wie ich es gar nicht beschreiben kann, James.«
»Ich auch«, sagte er und streichelte zärtlich ihre Brüste. »Und jetzt lass uns überlegen, wo wir unsere Flitterwochen verbringen wollen.«
»Hier, in unserem Liebeszelt.«
Er lachte. »Ich glaube kaum, dass wir hier viel Ruhe hätten und für uns allein sein könnten. Außerdem dachte ich, dass du gerne eine Reise machen würdest.«
Kate lächelte verträumt. »O ja, das würde ich gerne.«
»Wohin möchtest du am liebsten?«
»Mir ist alles recht, wenn du nur bei mir bist.«