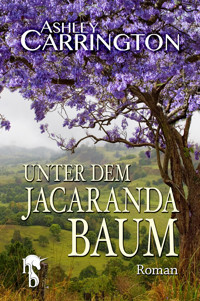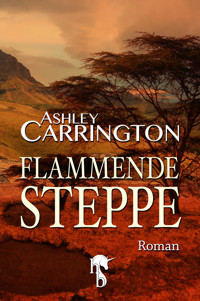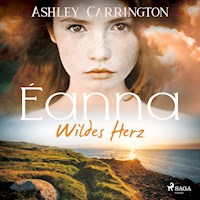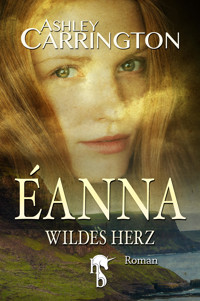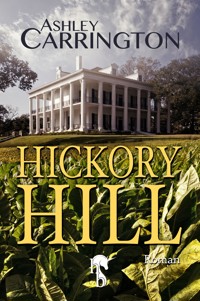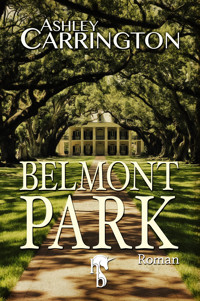4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Endlich scheint Éanna am Ziel ihrer Träume angekommen zu sein: Sie hat es mit Brendan und ihrer Freundin Emily bis nach New York geschafft. Doch das Leben in der Metropole gestaltet sich schwieriger als gedacht: Täglich erreichen Hunderte Flüchtlinge aus Irland die Stadt, die verzweifelt nach einer Unterkunft und Arbeit suchen. Wieder müssen sie jeden Tag aufs Neue ums Überlegen kämpfen. Als dann auch noch Patrick O’Brien auftaucht und ihnen helfen will, wird alles nur noch schlimmer. Denn so oft Éanna Brendan auch beteuert, dass sie nur ihn liebt – die Geschichte mit dem Schriftsteller steht nach wie vor zwischen den beiden … Band 3 der Éanna-Reihe von Ashley Carrington.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ashley Carrington
Éanna
Unbekanntes Land
Roman
1. Kapitel
»Ich kann es noch immer nicht recht glauben, dass dort Amerika ist! Es kommt mir wie ein Wunder vor, dass wir zu den Glücklichen gehören, die dem großen Sterben in Irland entkommen sind und diese entsetzliche Schiffsreise über den Atlantik überlebt haben, Éanna«, flüsterte Emily ihrer Freundin zu.
Ihr Blick war auf die Küste gerichtet, die vor ihnen aus der tiefblauen See wuchs und rasch an Konturen gewann; ihre Stimme klang belegt, als kämpfte sie mit den Tränen.
Und das tat sie auch, wie so viele andere der mehr als dreihundert irischen Auswanderer, die sich an Deck der Boston Glory drängten. Sie alle versuchten, so nahe wie irgend möglich an die Reling zu kommen, um einen Blick auf die neue Heimat zu erhaschen.
Nur die Schwerkranken und völlig Entkräfteten waren unter Deck in ihren sargähnlichen Kojen liegen geblieben. Sie fürchteten mit dem Nahen der Küste den Inspektor der New Yorker Quarantänestation.
»Ja, es ist ein Wunder«, erwiderte Éanna, nicht weniger bewegt, und strich sich eine Strähne ihres blonden lockigen Haars aus dem Gesicht, das einen leichten Rotschimmer aufwies und mit dem der Fahrtwind spielte.
Es kam ihr unwirklich vor, dass die Boston Glory an diesem Maitag im weichen Licht des frühen Nachmittags und unter gerefften Segeln auf die amerikanische Küste vor New York zuhielt, auf das Land der Verheißung und der Freiheit, wo auf sie und all die anderen Auswanderer an Bord des Schiffes ein neues Leben wartete. Ein Leben, von dem sie alle hofften, dass es nicht tagtäglich von nagendem Hunger und von der Ausbeutung durch skrupellose Großgrundbesitzer bestimmt wurde so wie in Irland. Es erschien ihr wie ein Traum, das Ziel ihrer Reise endlich erreicht zu haben, und fast fürchtete sie, gleich aus ihm zu erwachen. Aber es war kein Traum, voraus lag wahrhaftig das fremde Land Amerika, das zu ihrer neuen Heimat werden sollte!
Eine Hand legte sich um ihre Schulter und eine Stimme, die sie unter Tausenden erkannt hätte, flüsterte ihr ins Ohr: »Erinnerst du dich noch an Dublin, an den Platz vor der Kathedrale, als wir uns wiedergefunden haben? Es war bitterkalt, aber es war der schönste Tag meines Lebens. Und ich wusste, dass wir das hier einmal erleben würden, Éanna. Wir beide. Gemeinsam.«
Éanna schluckte. Sie konnte nicht antworten, sondern griff nur nach Brendans Hand, um sie festzuhalten, ganz fest.
Was lag nicht alles hinter ihr und dem ungestümen Rotschopf, den sie in ihr Herz geschlossen hatte! Das Elend der jahrelangen Hungersnot in Irland, die sie, Emily und Brendan zu Waisen gemacht und im letzten Winter zu einem Bettlerleben auf der Landstraße gezwungen hatte. Die Unmenschlichkeit im Armenhaus. Ihre Trennung in Dublin und schließlich die qualvoll lange Überfahrt über den Atlantik, während der sie Schiffbruch erlitten und unter menschenunwürdigen Zuständen im Zwischendeck zweier Auswandererschiffe, der Metoka und der Boston Glory, hatten hausen müssen.
Aber fast das Schrecklichste war Brendans übersteigerte Eifersucht auf Patrick O’Brien gewesen und zuletzt ihr Zerwürfnis, das so endgültig gewesen zu sein schien.
Ein Stich durchzuckte Éanna, als sie an Patrick dachte. Ausgerechnet er war es gewesen, dem sie ihre Versöhnung zu verdanken hatten, er hatte Brendan letztendlich davon überzeugt, zu Éanna zurückzukehren, wie schwer es ihm auch gefallen sein mochte. Er hatte es ihretwegen getan, das wusste sie und sie würde ihm auf ewig dankbar sein.
»Woran denkst du, Éanna?«, flüsterte Brendan ihr ins Ohr.
Éanna drehte sich halb zu ihm um und strich ihm schuldbewusst über die Wange. Wie konnte ihr gerade jetzt Patrick in den Sinn kommen?
Das war ihr Moment – ihrer und Brendans. All das, was geschehen war, lag hinter ihnen – und Amerika bot ihnen das, was sie sich so sehnlichst gewünscht hatten.
»An einen neuen Anfang, Brendan«, sagte sie entschieden. »An einen Anfang für uns beide.«
In diesem Moment schallten vom erhöhten Achterdeck Befehle über das Schiff und augenblicklich sprangen Matrosen in die Takelage und enterten auf, um in schwindelerregender Höhe noch mehr Segeltuch einzuholen.
Ein Ruf ging durch die Menge, den Brendan im nächsten Moment aufnahm, während er sich neben Éanna über die Reling beugte.
»Da kommt die Hafenschaluppe mit dem Lotsen, der uns durch die Enge zwischen Staten Island auf der linken Seite und Brooklyn auf der rechten in die Bucht von New York bringt!«, rief er aufgeregt und deutete auf einen kleinen Segler, der schnell wie ein Pfeil durch die See schnitt und Kurs auf die Boston Glory hielt. »Du musst nicht mehr lange auf unseren neuen Anfang warten! Bald haben wir wieder Land unter den Füßen, Éanna« Er lachte ausgelassen und strahlte sie an, und als Éanna ihm ins Gesicht blickte, wurde ihr warm ums Herz und alle Zweifel, ob es richtig gewesen war, sich mit ihm zu versöhnen und ein Leben mit ihm zu planen, waren in diesem Moment wie weggeweht.
»Schön wär’s, wenn es so schnell ginge, Rotschopf«, machte sich hinter ihnen sofort eine raue Männerstimme mit grimmigem Tonfall bemerkbar. »Vor der Ausschiffung in den Docks wird es für so manchen von uns noch bitteres Heulen und Zähneklappern geben, so wahr ich Michael Macaulay heiße.«
Éanna achtete nicht darauf, was der Mann sagte. Genau wie Hunderte andere Augenpaare verfolgte sie gebannt, wie die schnelle Hafenschaluppe mit einem eleganten Manöver längsseits kam. Gleich darauf wurde ein Beiboot zu Wasser gelassen und mit vier Ruderern bemannt, die einen hochgewachsenen Mann in weißer Uniform mit kräftigen Riemenschlägen an die Luvseite des Auswandererschiffes brachten.
Emily stieß die Freundin von der Seite an. »Hast du schon mal einen Mann in solch einer prächtigen Uniform gesehen, Éanna?«, entfuhr es ihr staunend. »Ob wohl alle Amerikaner so gut aussehen?«
Éanna lachte und war nicht weniger beeindruckt vom ersten amerikanischen Mann, den sie in ihrem Leben zu Gesicht bekam. Dass Gregory Richardson, der Kapitän der Boston Glory, und die meisten Mitglieder seiner Mannschaft ebenfalls Amerikaner waren, zählte für sie und ihre Landsleute in diesem Moment nicht. Dieser Lotse, der Augenblicke später mit der scheinbar mühelosen Eleganz und Leichtigkeit eines trainierten Turners die Strickleiter emporkletterte, hinterließ bei den abgemagerten und zerlumpten irischen Auswanderern einen tiefen Eindruck und bestätigte ihre Vorstellung von der neuen Heimat als dem Land des Reichtums, der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten.
Mit offenen Mündern begafften sie den jungen Mann und so manch einer hätte sich nicht gewundert, wenn er drei Füße und an jeder Hand sechs Finger gehabt hätte, so sehr beeindruckten sie seine Gestalt und sein selbstsicheres Auftreten. Wie stattlich und wohlgenährt er aussah! Wie gesund und weiß sein Gebiss war, fast so weiß wie seine Uniform! Nicht ein einziger fauler Zahn und nirgends eine Zahnlücke! Und wie freundlich er, ein bedeutender Vertreter der amerikanischen Obrigkeit, in die Runde lächelte, während er mit federnden Schritten durch die Gasse schritt, die die zurückweichenden Passagiere auf dem Deck für ihn bildeten. Wie anders waren da die Amtsmänner in der Heimat gewesen, die die einfache Bevölkerung Verachtung und Unterdrückung hatten spüren lassen.
»Na, wir werden wohl auch in New York noch genug dreckige Leute zu sehen bekommen«, stellte Brendan mit einem leicht neidischen Unterton in der Stimme fest. »Richtige Arbeit macht nun mal schmutzig!«
»Aber es ist trotzdem schön, so empfangen und begrüßt zu werden«, erwiderte Éanna zufrieden.
»Und wer sagt, dass die Aufgabe, ein Schiff in einen dicht befahrenen Hafen zu lotsen, keine richtige Arbeit ist?«, fügte Emily hinzu.
Brendan zuckte die Achseln und schwieg. Aber Éanna wusste genau, dass in seinen Augen nur derjenige zählte, der mit seiner Hände Arbeit etwas Sinnvolles schaffte – wozu das Einweisen eines Schiffes in einen Hafen für Brendan sicher nicht gehörte. Wahrscheinlich ebenso wenig wie das Verfassen von Büchern, ging es Éanna durch den Sinn.
Patrick O’Brien hätte in einigen Jahren die Brauerei seines Onkels übernehmen können, doch er hatte ein Leben in sattem Wohlstand ausgeschlagen, weil er davon träumte, Schriftsteller zu werden. Brendan hatte dafür nur Verachtung übrig, auch wenn er paradoxerweise wie jeder Ire eine gut erzählte Geschichte sehr wohl zu schätzen wusste.
Der Lotse nahm seine Arbeit auf und wenig später erreichte die Boston Glory unter seiner Führung die geschützte Bucht von New York, die sich vor der Südspitze Manhattans ausdehnte und vom Hudson und East River gespeist wurde. Und dann lag sie auf einmal direkt vor ihnen – die geschäftige, vor Leben pulsierende Hafenstadt New York.
Keiner der Auswanderer hatte bisher Vergleichbares gesehen: Entlang der Bucht und auf den beiden Flüssen, die Manhattan umflossen, herrschte ein unglaublicher Verkehr. Es wimmelte nur so von Schiffen und Booten jeder Art und Größe und aus aller Herren Länder. Ob Bark oder Brigg, stolze Neuengland-Clipper mit ihren vier himmelstürmenden Masten oder kleine Küstenschoner, ob Dampfer mit rauchenden Schloten oder winzige Ruderboote, sie alle glitten in einer atemberaubenden Vielfalt auf dem Wasser dahin. Einige von ihnen brachen mit neuer Fracht zu Reisen in ferne Länder auf, andere liefen nach Wochen oder gar Monaten der Überfahrt aus Indien, China oder Australien kommend den Hafen an oder kehrten von einer Fahrt ins Hinterland zurück. Und hinter dem Gewirr von Masten, Segeln und Schornsteinen zeichneten sich das dichte Häusermeer der Stadt mit den vielen hoch aufragenden Kirchturmspitzen und die Kaianlagen des Hafens ab, die zu beiden Seiten von Lower Manhattan wie die Zinken eines riesigen, scheinbar endlos langen Kamms ins Meer vorstießen und nicht von ungefähr »Straße der Schiffe« genannt wurden. Denn dort bildeten die vertäuten Schiffe ein noch dichteres Gewirr von Mast und Takelage als auf der Bay.
Das Staunen der irischen Auswanderer fand kein Ende. Kaum einer von ihnen konnte fassen, dass allein in Manhattan eine gute halbe Million Menschen leben sollte. So wie Éanna, Emily und Brendan kamen auch die meisten anderen Zwischendeckpassagiere der Boston Glory vom Land, viele waren in ihrer Heimat arme Kleinpächter gewesen, die selten einmal einen Ort mit einigen Hundert Einwohnern zu Gesicht bekommen hatten und sich schon in Dublin verloren wie in einem Ameisenhaufen vorgekommen waren. Doch gegen New York wirkte Dublin nun wie ein leicht überschaubares Dorf. Und die Vorstellung, in dieser riesigen fremden Stadt Fuß fassen zu müssen, jagte plötzlich nicht wenigen der Auswanderer Angst ein.
Die Boston Glory steuerte auf die Südspitze von Manhattan zu, wo ein kleiner baumbestandener Park bis ans Ufer reichte, der sich Battery Park nannte. Etwas links davon ragte das kreisrunde massive Steingebäude Castle Garden aus dem Wasser, eine frühere Festungsanlage, die dem Park ihren Namen gegeben hatte, aber schon seit einigen Jahrzehnten anderen Zwecken diente. Auf halber Strecke zwischen Staten Island und dem Battery Park ging die Boston Glory vor Anker.
»Jetzt heißt es, die letzte Hürde zu nehmen«, stellte der Mann, der sich als Michael Macaulay vorgestellt hatte, nüchtern hinter Éanna, Brendan und Emily fest. »Jetzt wird’s ernst. Denn jetzt droht uns allen die Gesundheitsprüfung durch den Quarantänearzt! Und Gott stehe den armen Seelen bei, die nicht vor ihm bestehen werden!«
Kaum hatte er das gesagt, da gab Captain Richardson seiner Mannschaft auch schon den Befehl, dafür zu sorgen, dass der Quarantänearzt seiner Arbeit trotz der Überbelegung des Schiffes unverzüglich und ordnungsgemäß nachgehen konnte.
Über die Hälfte der an Deck versammelten Auswanderer wurde mehr oder weniger rüde nach unten ins Zwischendeck geschickt, um mittschiffs Platz für die Prüfung zu schaffen.
Wenig später erklomm der Quarantänearzt in Begleitung von vier Gehilfen die Gangway. Er war ein wohlbeleibter Kahlkopf mit der besorgten und kummervollen Miene eines Mannes, der eine unerfreuliche, aber notwendige Pflicht zu erfüllen hat. Seine Begleiter, kräftige Männer, brachten vorsorglich mehrere Tragen und ein Bündel Leichensäcke mit, denn sie wussten aus Erfahrung, was sie auf einem solchen Schiff mit halb verhungerten irischen Auswanderern erwartete.
Zunächst sprach der Arzt mit Captain Richardson, ließ sich von ihm die vorgeschriebene Liste mit den persönlichen Daten der Passagiere aushändigen und fragte nach dem Stand der Toten und Kranken. Dann stieg er mit seinen Begleitern hinunter ins Zwischendeck.
Die Inspektion des Zwischendecks und die sich anschließenden Untersuchungen der Auswanderer auf dem Oberdeck dauerten mehrere Stunden. Zuerst wurden vier Tote unter bedrücktem Schweigen von Bord getragen, danach begann das verzweifelte Weinen und Schluchzen und erfolglose Betteln, als der Quarantänearzt sein Urteil über die Kranken fällte, die nicht mit ihren Familienmitgliedern an Land gehen durften.
Auf sie warteten der Abtransport mit dem Quarantäneschiff und das Marine Hospital auf Staten Island, wo sie bleiben mussten, bis sie von ihren Krankheiten genesen oder gestorben waren.
Viele von denjenigen, die in dieser Stunde von ihren erkrankten Lieben getrennt wurden, sollten ihre Kinder, Ehepartner oder Geschwister nie wiedersehen und nie erfahren, was aus ihnen geworden war: ob sie der Tod auf der Quarantänestation ereilt hatte oder ob sie überlebt und vergeblich versucht hatten, sie in dieser Stadt von einer halben Million Einwohnern zu finden.
»Ich bitte Euch, mein Herr, nehmt mir nicht auch noch meine Kinder!«, flehte eine abgehärmte, spindeldürre Frau, als der Arzt ihre fünfjährige Tochter und den etwa elfjährigen Sohn, die beide an einem rotfleckigen Ausschlag litten, für die Aufnahme in die Quarantänestation bestimmte. »Wie sollen sie mich denn jemals wieder in dieser Stadt finden? Ich weiß doch nicht, wo ich Arbeit und ein Dach über dem Kopf bekomme! Um Christi und der Muttergottes willen, habt Erbarmen! Der Tod hat mir schon meinen Mann, meinen Ältesten und die Schwester genommen!«
»Gute Frau, der Herr ist mein Zeuge, dass ich es wahrlich nicht gern tue. Aber es muss sein, glaubt mir«, sagte der Arzt mitfühlend, aber energisch. »Zu oft haben kranke Einwanderer für Cholera- und Typhusepidemien in New York gesorgt oder andere ansteckende Krankheiten in die Stadt getragen.« Mit einem kurzen Blick wies er seine Helfer an, der verzweifelten Frau die Kinder abzunehmen, die sich zitternd an sie drängten und der Mutter förmlich aus den Händen gerissen werden mussten.
»Die so bitter erkaufte Freiheit zum Greifen nahe und dann das«, murmelte Éanna erschüttert, die den Vorfall hilflos mit angesehen hatte.
Sie hatte schon so viel an Elend, Qual und Verzweiflung erlebt, aber das hier war noch schlimmer. Diese Menschen hatten die Rettung direkt vor Augen gehabt, als ihnen alles genommen wurde.
Auch Brendan war zutiefst betroffen. Als er Zeuge wurde, wie man eine junge Frau von ihrem Mann wegführte, den sie erst vor wenigen Monaten in Dublin geheiratet hatte und dem nun ununterbrochen die Tränen über das Gesicht liefen, ergriff er stumm ihre Hand.
Dann aber war die Inspektion endlich vorbei. Als der Arzt über die Strickleiter von Bord kletterte, ging ein leises Aufatmen, einem Seufzer gleich, durch die Menge. Die letzte Hürde war genommen! Amerika, das Land ihrer Träume, lag endlich offen vor ihnen.
Kurz darauf holte die Mannschaft der Boston Glory den Anker ein. Und unter dem aufbrandenden Jubel von mehr als dreihundert irischen Auswanderern zog das Schiff nahe am Kai des Battery Parks vorbei und legte das letzte Stück seiner Reise bis zu den Docks am East River zurück.
2. Kapitel
Das Hafenviertel entlang des East River mit seiner »Straße der Schiffe« erstreckte sich über geschlagene drei Meilen[1] von der Südspitze Manhattans bis hoch zur Flussbiegung bei Corlear’s Hook. Ähnlich beeindruckend war auch der Hafen auf der Westseite entlang des Hudson River. Doch während hier überwiegend kleinere Küstenschiffe vor Anker gingen, die Handel mit dem Hinterland bis hoch zu den Great Lakes betrieben, wurden die Piers am East River vor allem von großen Überseeschiffen angesteuert, die Waren und Passagiere aus der ganzen Welt nach New York brachten. Éanna, Emily und Brendan konnten sich nicht sattsehen an den unzähligen Anlegestellen, Werften, Handelskontoren, Lagerhäusern, Schiffsausrüstern, Werkstätten, Tavernen, Logierhäusern und den vielen anderen hohen Backsteingebäuden, die sich hier dicht an dicht und über mehrere Meilen hinweg entlang des Flusses drängten.
Hier in New York war einfach alles um ein unglaublich Vielfaches größer als in ihrer Heimat. Und das traf nicht nur auf die pompösen Hafenanlagen, sondern auch auf das lärmende Treiben auf den breiten Kaianlagen zu. Es war ein einziges Kommen und Gehen, dessen Zeuge die staunenden Auswanderer wurden, ein verstörendes Gewimmel von Kutschen, offenen Einspännern, hochbeladenen Fuhrwerken, Packeseln, Männern mit Handkarren, Reitern, Matrosen, Händlern, Taschendieben, Straßenverkäufern mit umgeschnallten Bauchläden, Gepäckträgern, grell geschminkten und herausgeputzten Frauen, denen man ihr Gewerbe schon von Weitem ansah, barfüßigen Botenjungen, Zeitungsverkäufern – und nicht zu vergessen Schleppern, die an den Piers herumlungerten und es auf frisch eingetroffene Einwanderer aus Irland, Deutschland, Russland und anderen Ländern abgesehen hatten.
Runner wurden diese gerissenen, skrupellosen Männer auch genannt, die mit der Ahnungslosigkeit und Gutgläubigkeit der Einwanderer ihr Geschäft machten. Meist standen sie in den Diensten von zwielichtigen Logier- und Mietshausbesitzern, die ihren Runnern für jeden Einwanderer, der sich bei ihnen einmietete, ein lukratives Kopfgeld zahlten.
Häufig kamen die Schlepper sogar aus demselben Land wie diejenigen, die sie so rücksichtslos übers Ohr hauten und in überteuerte Tavernen, Pensionen und baufällige Mietskasernen lockten.
Und das Geschäft lief gut in diesen Tagen in New York, denn täglich erreichten neue Schiffe mit Hunderten von Einwanderern an Bord die Stadt. Vielen von ihnen blieb gar nichts anderes übrig, als sich auf die zweifelhaften Dienste der Schlepper einzulassen, denn kaum einer hatte Verwandte oder Freunde vor Ort, die seine Ankunft erwarteten, ihm bei der Suche nach einer ersten Bleibe behilflich waren und ihn vor Betrügern warnen konnten.
Zwar gab es auch anständige Helfer – meist landsmännische Vereinigungen wie die irische Friendly Sons of St. Patrick, die schottische St. Andrew’s Society und die deutsche German Society –, die versuchten, sich ihrer Landsleute, so gut es ging, anzunehmen. Doch angesichts des beständigen Stroms der täglich neu eintreffenden Einwanderer aus der ganzen Welt blieb ihre Hilfe bescheiden.
Längst waren die Runner auf das große Auswandererschiff aufmerksam geworden, das unter amerikanischer Flagge in die Bucht gesegelt war und nun auf der Höhe der Oliver Street am Kai anlegte. Und so stürmte, als die Gangway herabgelassen wurde, eine gute Hundertschaft von ihnen das Schiff wie ein zu allem entschlossenes Enterkommando und fiel über die Einwanderer her. Jeder von ihnen versicherte seinen Opfern mit einschmeichelnden Worten und im vertrauenerweckenden heimischen Dialekt, nur er allein wäre von redlichem Charakter. Im Gegensatz zu all den anderen Halunken werde er ihr Gepäck, das bei vielen Zwischendeckspassagieren aus Koffern, Kisten und Säcken bestand, zu einem anständigen Preis tragen und sie zu einer guten und preiswerten Unterkunft für die ersten Tage fuhren.
Dabei arbeiteten oft zwei Schlepper Hand in Hand, während sie den nichtsahnenden Einwanderern gegenüber so taten, als würden sie miteinander konkurrieren. Ehepaare mit Kindern sprachen sie besonders gern an. Und während der eine sich rasch ein Gepäckstück griff und damit forsch von Bord marschierte, hievte sich sein Komplize ein anderes auf die Schulter, obwohl die Familie mit einem einzigen Träger gut ausgekommen wäre.
Völlig überrumpelt blieb den Unglücklichen nun nichts anderes mehr übrig, als sich geschlagen zu geben und zweimal einen völlig überteuerten Lohn zu zahlen. Und damit gehörten sie trotz finanziellem Aderlass noch zu den Glücklicheren. Denn nicht selten bekamen die Einwanderer es tatsächlich mit zwei konkurrierenden Schleppern zu tun. Und wenn dann der eine mit einem Koffer in die eine Richtung davoneilte und der andere, beladen mit einer Kiste, in die entgegengesetzte Richtung lief, blieb den Einwanderern in dem Menschengewimmel um sie herum meist nichts anderes übrig, als sich mit knirschenden Zähnen für einen der beiden Runner zu entscheiden, ihm so schnell wie möglich zu folgen und das andere Gepäckstück aufzugeben.
Éanna, Brendan und Emily hatten allerdings Glück im Unglück. Wie die wenigen anderen Schiffbrüchigen, die von der Boston Glory gerettet worden waren, hatten sie von den Schleppern nichts zu befürchten. Denn mit der Metoka war bis auf ein leichtes Notgepäck all ihr Hab und Gut, das sie in Dublin an Bord gebracht hatten, untergegangen.
»Sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich aus diesem Tumult heraus- und an Land kommen!«, schlug Brendan vor, nachdem die drei sprachlos den Ansturm der Schlepper auf das Schiff verfolgt hatten. »Tom hat von einem Seemann die Adresse eines anständigen Logierhauses bekommen, wo wir erst einmal ein paar Tage bleiben können.«
Tom Mahony, ein robuster Bursche mit einem kantigen Gesicht, der aus derselben Provinz stammte wie Brendan und mit dem er sich in den letzten Tagen angefreundet hatte, nickte nachdrücklich. »Ich sage euch, dieser Tipp ist bares Geld wert! Das Logierhaus Emerald Isle soll nur ein paar Straßen vorn Hafen entfernt in der Division Street liegen.«
Emily zuckte die Achseln. »Ansehen können wir es uns ja mal. Und wenn es doch nichts taugt, haben wir bis Einbruch der Dunkelheit immer noch genug Zeit, uns nach einer anderen Bleibe umzusehen.«
»Dann nichts wie los!«, drängte Brendan.
Sie begannen, sich einen Weg durch das wüste Gedränge auf Deck zur Gangway zu bahnen. Doch plötzlich blieb Éanna wie angewurzelt stehen. »Mein Gott, meine Bücher! Die hätte ich unten in meiner Koje jetzt beinahe vergessen!«
Erschrocken drehten sich Brendan und Emily zu ihr um. Bis auf ein wenig Bargeld war das Buchpaket – eine hochwertig gefertigte, sechsbändige Gesamtausgabe der Werke von Sir Walter Scott, die Patrick O’Brien Éanna kurz vor der Abreise nach Amerika geschenkt hatte – das Wertvollste, was sie nach dem Untergang der Metoka noch besaßen. Es war ihr Notgroschen, der ihnen das Überleben sichern würde, wenn ihr Bargeld aufgebraucht war, bevor sie in New York eine Arbeit gefunden hatten.
»Das hätte uns gerade noch gefehlt!«, stöhnte Brendan. »Also dann, sieh zu, dass du schnell zurück ins Zwischendeck kommst, bevor sich jemand in dem Getümmel daran vergreift und damit stiften geht!«
»Wir drei sollten besser unten auf dem Kai auf dich warten!«, sagte Tom Mahony. »Hier oben werden wir zu leicht über den Haufen gerannt und getrennt.«
Éanna wechselte einen Blick mit Brendan, dann nickte sie. »In Ordnung! Aber bleibt bloß in der Nähe der Gangway, damit ich nicht erst lange nach euch Ausschau halten muss!«
»Wird nicht passieren«, versprach Emily.
Entschlossen drehte sich Éanna um und zwängte sich durch die lärmende, wild bewegte Menge zurück zum Niedergang, der hinunter ins Zwischendeck führte.
Beim Hinuntersteigen schlug ihr der stechende Geruch entgegen, der in den letzten Wochen ständiger Begleiter der Zwischendeckspassagiere gewesen war. Es stank nach menschlichen Ausdünstungen, nach Erbrochenem, Urin und Fäkalien, kurz nach Krankheit, Elend und Tod. Und das, obwohl Captain Richardson, kaum dass die Küste von Amerika in Sicht gekommen war, angeordnet hatte, all die modrigen und grauenhaft stinkenden Strohsäcke, Matratzen, Decken und Kissen über Bord zu werfen, die Planken und Kojen mehrmals zu schrubben und das Zwischendeck dann kräftig auszuräuchern, um es vom allergröbsten Dreck und Gestank zu befreien.
Doch Éanna hatte andere Sorgen als den Geruch hier unten. Sie hastete durch den Mittelgang, vorbei an den langen Reihen von Stockbetten, die aus Brettern zusammengezimmert, dabei aber nicht ganz so eng bemessen waren wie die Betten auf der Metoka, wo jeder Auswanderer weniger Platz zum Schlafen gehabt hatte als in einem Sarg.
Zu ihrer grenzenlosen Erleichterung fand sie das Buchpaket, mehrfach mit Wachspapier umwickelt und mit fester Kordel verschnürt, dort vor, wo sie es zurückgelassen hatte – unter dem zerschlissenen Leintuch in ihrem Bett. Schnell bückte sie sich und nahm es an sich.
»Na, was Wichtiges vergessen, Schätzchen?«, ertönte in diesem Moment eine spöttische Frauenstimme unmittelbar hinter ihr. »Oder hast du vielleicht Brendan aus den Augen verloren und hier nach ihm gesucht? Also unter meinen Rock gekrochen ist er nicht. Aber das kann ja noch kommen, so wie ich ihn einschätze, was meinst du?«
Éanna wusste nur zu gut, wem die hämische Stimme gehörte. Das hatte ihr gerade noch gefehlt! Niemand anderes als die Dirne Caitlin stand vor ihr im Gang, die linke Hand aufreizend unterhalb des geschnürten offenherzigen Mieders in die Hüfte gestützt, mit der anderen einen kleinen, ramponierten Sonnenschirm haltend.
Caitlin ausgerechnet jetzt noch einmal zu begegnen, war das Letzte, was Éanna sich gewünscht hatte. Jedes Mal, wenn sie ihr während der Überfahrt begegnet war, war der Zorn wie bittere Galle in ihr aufgestiegen und auch diesmal erging es ihr nicht anders. Nie würde sie ihr verzeihen können, dass sie sich in Dublin an Brendan herangemacht und ihn in ihr Bett gelockt hatte. Dabei waren Caitlin und sie einst sogar Freundinnen gewesen und in Irland gemeinsam über die »Straße der Sterne« gezogen. Doch diese Zeit schien inzwischen unermesslich weit zurückzuliegen.
Éanna fixierte ihr Gegenüber mit grimmiger Miene. »Wir haben uns nichts mehr zu sagen, Caitlin! Schon lange nicht mehr. Also geh mir aus dem Weg und verspritz dein Gift woanders!«
Caitlin lachte. »Aber, aber, Kleines!« Gekünstelt zog sie die Augenbrauen nach oben und fuhr hämisch fort: »Wer wird denn gleich so ausfällig werden? Das kostet doch nur unnötig Kraft und das bisschen, was dir davon geblieben ist, wirst du jetzt bitter nötig haben, so wie du aussiehst. Bist ja nur noch Haut und Knochen. An einer wie dir wird sich Brendan bloß die Haut blutig schrammen!«
Éanna ballte die Fäuste und hätte Caitlin das gemeine Lächeln am liebsten aus dem wohlgenährten Gesicht geschlagen. Denn im Gegensatz zu ihr, Emily, Brendan und den meisten anderen Zwischendeckspassagieren bot Caitlin ein Bild praller, unverwüstlicher Gesundheit.
Was auch nicht weiter verwunderlich war, hatte sie sich doch Nacht für Nacht mit schamlosen Liebesdiensten für den Schiffskoch, den Quartiermeister und einige andere Seeleute üppige Extrarationen erkauft, wie Éanna wusste. Sogar Fleisch, Eier und weißes Brot aus der Offiziersmesse sollten der Lohn für Caitlins zweifelhafte Dienste gewesen sein, von Rum und Brandy sicher ganz zu schweigen.
Éanna bezwang das übermächtige Verlangen, es Caitlin mit gleicher Münze heimzuzahlen. Nein, sie durfte sich auf keinen Fall anmerken lassen, wie sehr die gehässigen und anzüglichen Bemerkungen sie noch immer trafen. Diesen Triumph gönnte sie ihrer Rivalin nicht.
Deshalb setzte sie ein betont überlegenes Lächeln auf und erwiderte mit kühl beherrschter Stimme: »Du kannst noch so viel bösartiges Gerede aus deinem dreckigen Schandmaul spucken, es ändert doch nichts daran, dass nicht du es bist, die mit Brendan an Land geht, sondern ich. Du dagegen kannst einem wirklich leidtun. Denn jemand wie du wird auch in einer neuen Stadt von Jahr zu Jahr tiefer sinken, bis er endgültig und für immer als abgetakelte Dirne in der Gosse landet!« Mit diesen Worten drängte sie sich energisch an Caitlin vorbei und lief, das kostbare Buchpaket fest an ihre Brust gepresst, an der endlosen Reihe der Stockbetten entlang zurück in Richtung Niedergang.
»Und du wirst mit Brendan Flynn noch dein blaues Wunder erleben, Schätzchen!«, schrie Caitlin ihr nach. Ihre Stimme überschlug sich vor Hass. »So ein unbedarftes Ding wie du hält jemanden wie ihn nie und nimmer, darauf kannst du Gift nehmen, Éanna! Dem steht der Sinn nach besserer Kost, als du sie ihm zu bieten hast! Eines Tages, wenn das böse Erwachen kommt, wirst du schon noch an mich denken, du Unschuld vom Lande!«
Éanna straffte die Schultern und ging hoch erhobenen Hauptes weiter. Doch so ganz konnte sie dennoch nicht verhindern, dass sich die bösartigen Worte in ihrem Kopf einnisteten. Was, wenn Caitlin doch recht hatte? Sie hatte schon einmal geglaubt, Brendan für immer verloren zu haben! Wer garantierte ihr, dass er diesmal wirklich bei ihr blieb?
Doch als sie endlich den Niedergang erreicht hatte und hinaufstieg, dem furchtbaren Gestank entkam und wieder an Deck gelangte, wo die Sonne warm auf ihr Gesicht fiel, schob sie diesen beunruhigenden Gedanken sofort energisch beiseite. Seit wann gab sie etwas auf Caitlins schändliches Gerede?
Auf dem Oberdeck herrschte noch immer wildes Gedränge und Geschiebe, Kinder schrien durcheinander, Gepäckstücke wurden von Bord getragen.
Éanna klemmte sich ihr Buchpaket fest unter den linken Arm und verhakte die Finger der rechten Hand unter den festen Kordelschnüren, um zu verhindern, dass ihr ein Dieb den kostbaren Besitz entreißen und mit der Beute in dem Durcheinander entkommen konnte.
Sie hatte schon fast die Pforte an der Reling erreicht, die hinaus auf die Gangway führte, da trat links vor ihr plötzlich Patrick aus der Menge.
Éannas Herz setzte für einen Moment aus. Er jedoch wirkte nicht überrascht, sie zu sehen, fast hatte es den Anschein, als habe er bereits längere Zeit nach ihr Ausschau gehalten, um sie abzupassen, bevor sie von Bord ging.
Éanna schluckte. Wie schon so oft zuvor wusste sie auch jetzt die widersprüchlichen Gefühle nicht einzuordnen, die sie empfand. War es spontane Freude, Scham und oder nur Beklommenheit? Sosehr sie es auch versucht hatte, sie konnte noch immer nicht die Liebeserklärung vergessen, die Patrick ihr damals in Dublin kurz vor ihrer Abreise gemacht hatte. Und schon gar nicht den innigen Kuss, der ein Abschiedskuss hätte sein sollen und eine Flut von verwirrenden Gefühlen in ihr ausgelöst hatte.
Nie hätte sie sich bei ihrer allerersten Begegnung träumen lassen, welche Rolle Patrick einmal in ihrem Leben spielen würde. Ohne Geld, Arbeit und Nahrung war sie damals durch Irland geirrt und vor dem Gasthof in der Kleinstadt Ballinasloe zufällig auf den jungen Herrn von sichtlich vornehmem Stand aufmerksam geworden, der einen teuren Spazierstock mit silbernem Knauf neben dem Kutschenschlag vergessen hatte. Es war ihr erster Versuch gewesen, etwas zu stehlen, und sie war dabei prompt auf frischer Tat ertappt worden. Von da an hatten sich ihre Wege immer wieder gekreuzt und ein ums andere Mal war es Patrick O’Brien gewesen, der Éanna aus den schlimmsten Notlagen gerettet hatte, ja, dem sie sogar ihr Leben verdankte. Im Gegenzug hatte sie ihm das ihre gegeben – wenn auch auf andere Weise, als sie sich hatte vorstellen können. Denn Patrick hatte in seinem ersten Buch die Hungersnot in seiner Heimat und das alltägliche Elend der Kleinpächter verarbeiten wollen und er hatte Éannas Schilderungen über all das, was sie erlebt hatte, bei ihren gemeinsamen Sonntagen in Dublin begierig gelauscht.
Éanna zögerte und wartete, bis Patrick bei ihr angelangt war. Er war ihr inzwischen so wohlvertraut, dass sie ihn wohl überall erkannt hätte. Er trug einen leichten hellbraunen Anzug mit kurzen Rockschößen. Das volle schwarze und leicht gewellte Haar war sorgfältig frisiert, nur über der Stirn standen einige kurze widerspenstige Strähnen nach oben. In der rechten Hand hielt er ebenjenen Spazierstock, der zu seiner ersten Begegnung mit Éanna geführt hatte. Und genau wie damals in Ballinasloe lag auch jetzt dieses seltsame Lächeln auf seinem markanten, braun gebrannten Gesicht, das so typisch für ihn war und das sie noch immer nicht recht zu deuten vermochte. War dieser Ausdruck, den sie auch in seinen dunkelblauen Augen wiederfand, doch eine eigenartige Mischung aus Spott, Selbstironie und einer Spur Wehmut.
»Wie schön, dass es mir vergönnt ist, dich noch ein letztes Mal zu sehen, Éanna«, sagte er leise. »Ich hätte es sehr bereut, dich zu verpassen, bevor du von Bord gehst.«
»Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es zu dieser Begegnung nicht ganz zufällig gekommen ist, Mister O’Brien«, erwiderte sie, bemüht, ihre Verlegenheit durch einen spöttischen Tonfall zu überspielen.
Patrick seufzte und machte ein gequältes Gesicht. »Muss es denn wirklich wieder Mister O’Brien sein, Éanna? Es gab eine Zeit, da hast du mich beim Vornamen genannt und mir dein ganzes Leben anvertraut. Und das waren die schönsten Stunden, an die ich mich erinnern kann.«
Éanna errötete bei seinen Worten. Noch vor wenigen Stunden hatte sie mit Brendan an der Reling gestanden und hatte jeden Gedanken an Patrick zur Seite geschoben. Und das war gut so gewesen.
Wasser und Öl ließen sich nun einmal nicht miteinander verbinden – ebenso wenig wie ein einfaches Mädchen vom Land, Tochter eines armen Kleinpächters aus Galway, eine Beziehung mit einem studierten Mann von seinem Stand eingehen konnte. Allein der Gedanke daran war schon ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Und sie hätte sich schon einmal um ein Haar dabei verbrannt. Das durfte nicht wieder geschehen! Ihr Wort und ihr Herz gehörten Brendan.
»Es muss und es wird dabei bleiben, Mister O’Brien«, antwortete sie deshalb mit fester Stimme, bemüht, den Abschied von ihm so rasch wie möglich hinter sich zu bringen. »Es ist besser so, sowohl für Euch als auch für mich.« Sie holte tief Luft. »Ich wünsche Euch von ganzem Herzen alles nur denkbar Gute auf Eurem Weg in Amerika und hoffe so sehr, dass Ihr hier einen Verleger für Euer erstes Buch findet. Und was auch passiert«, sie schluckte, weil sie merkte, wie ihre Stimme zu zittern begann, »– ich werde Euch nie vergessen, was Ihr für mich, Emily und auch für Brendan getan habt.« Sie hob ihren Kopf und lächelte ihn an, ein letztes Mal.
Doch so schnell ließ Patrick O’Brien sie nicht gehen. Mit sanftem Druck fasste er Éanna an der Schulter und hielt sie zurück. »Warte bitte, Éanna! Es gibt da etwas, das ich von Captain Richardson und seinen Offizieren erfahren habe und dir unbedingt sagen möchte!«, stieß er hastig hervor.
Sie zögerte. »Und was soll das sein?«
»Nun, es geht um die Bücher, die ich dir geschenkt habe – wie ich sehe, hast du sie retten können«, sagte er und deutete auf das verschnürte Paket unter ihrem Arm.
»Ja, zum Glück hat Emily noch im letzten Moment daran gedacht, als die Metoka sank«, erwiderte Éanna. Die Erinnerung daran, wie damals an Bord Panik ausgebrochen und die Menschen in Todesangst zu den provisorischen Flößen und Rettungsbooten gelaufen waren, um wenigstens das eigene Leben zu retten, reichte aus, um ihr einen Schauer über den Rücken zu jagen.
»Für die sechs Bände solltest du von einem seriösen Buchhändler mindestens zehn Dollar bekommen, eher sogar zwölf.«
Éanna hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, was zehn oder zwölf amerikanischen Dollar in englischen Pfund, Shilling und Pence entsprach, aber sie war sicher, dass Brendan und dieser Tom Mahony sich längst darüber informiert hatten. Stattdessen machte ihr etwas ganz anderes Sorge, doch Patrick hatte ihr schon genug geholfen. Ab jetzt waren sie auf sich gestellt, sie mussten ihren Weg allein finden.
Ein Lächeln huschte über Patricks Gesicht, seine Augen blitzten.
»Du fragst dich sicher, wo es in dieser riesigen Stadt Buchhandlungen gibt, wo man dir einen anständigen Preis für die Bücher zahlt?«
Éanna schrak zusammen. Wie war das nur möglich, dass er ihre Gedanken las? Dass er so offensichtlich wusste, was sie bewegte?
Patrick zog bereits einen Zettel aus der Innentasche seines Jacketts. »Mister Cole, der Erste Offizier, hat mir eine Adresse genannt, die ich dir hier aufgeschrieben habe. Der Buchhändler heißt Charles Templeton, sein Geschäft Templeton’s Fine Books. Es liegt an der Ecke Bleeker und Green Street, unweit vom Broadway und dem Washington Square. Man hat mir versichert, dass der Buchladen leicht zu finden und Charles Templeton ein ehrenwerter Mann ist, der niemanden übervorteilt.«
Éanna war sprachlos. Sie nahm den Zettel mit der Adresse entgegen und prägte sie sich gleich ein.
»Wie sieht es mit eurem Bargeld aus?«, fragte Patrick. »Habt ihr überhaupt noch genug, um die ersten Tage zu überstehen?«
Hastig versicherte sie ihm, dass er sich darum keine Sorgen zu machen brauchte. Sie wollte auf keinen Fall, dass er ihr wieder einmal Geld schenkte und sie erneut mit seiner Großmut beschämte. Denn ohne die fünfzehn Pfund, die er ihr in Dublin gegeben hatte, wäre es ihnen frühestens in einigen Jahren möglich gewesen, die zwei Schiffspassagen auf der Metoka zu bezahlen. Und dann hatte er ihr auch noch die kostbaren Bücher geschenkt! Nein, Patrick O’Brien hatte in der Vergangenheit wahrlich genug für sie getan.
»Und habt ihr auch Captain Richardsons Angebot an alle Auswanderer angenommen, das englische Geld in amerikanische Dollar und Cent umzutauschen?«, erkundigte er sich als Nächstes.
Éanna schüttelte den Kopf. »Brendan hat in Erfahrung gebracht, dass man ein bisschen mehr bekommt, wenn man sein Geld erst an Land umtauscht.«
Patrick machte ein besorgtes Gesicht. »Das mag wohl sein, obwohl Captain Richardsons Wechselkurs wirklich nicht schlecht war. Gebt beim Umtauschen an Land nur acht, dass euch niemand Banknoten aufschwatzt!«, warnte er sie.
»Wieso das nicht?«, fragte Éanna.
»Weil sie im Zahlungsverkehr oft weniger wert sind als der Betrag, auf den sie ausgestellt wurden. Also lasst euch nur hartes Münzgeld in Gold und Silber geben.«
Éanna bezweifelte, dass ihr Bargeld auch nur für eine einzige amerikanische Goldmünze reichte, sprach ihre Bedenken jedoch nicht aus. Es war Zeit, sich endgültig zu verabschieden, und Patrick wusste das ganz genau.
»Danke, Mister O’Brien«, sagte sie noch einmal. »Danke für alles.«
Sie wandte sich zum Gehen, doch Patrick hob ein letztes Mal seine Hand und berührte sie flüchtig am Arm. »Hör zu, Éanna. Wenn du irgendwann einmal in Schwierigkeiten sein solltest, zögere bitte nicht, dich mit mir in Verbindung zu setzen!«, sagte er eindringlich. »Und zwar über Mister Templeton. Ich werde seine Buchhandlung sicher regelmäßig aufsuchen, um zu sehen, was er an neuen interessanten Büchern hereinbekommen hat. Hinterlass bitte bei ihm eine Nachricht für mich, wo ich dich finden kann. Oder komm gleich zu mir. Ich werde bei ihm meine neue Adresse in New York hinterlegen. Die erste Zeit werde ich wohl im Shakespeare Hotel auf der Duane Street Quartier nehmen, aber das wird sicher keine Lösung auf Dauer sein.«
»Das wird bestimmt nicht nötig sein, Mister O’Brien«, erwiderte sie verlegen.
»Versprich mir einfach nur, dass du es annimmst, wenn du doch einmal in Not geraten solltest!«, beharrte er.
Sie nickte knapp. »Ihr habt mein Wort. Und nun lebt wohl!« Éanna stürzte förmlich davon, auf die Gangway zu. Keinen Moment länger konnte sie dieses Gespräch ertragen.
Ohne sich noch einmal nach ihm umzudrehen, tauchte sie rasch in der Menge ihrer Landsleute und der Schlepper unter, die mit Gepäckstücken beladen zum Nadelöhr der Gangwaypforte drängten. Auf dem kurzen Weg hinunter zum Kai musste sie so manchen groben Stoß von Ellbogen, Schultern und Koffern einstecken, aber sie merkte es kaum. Zu sehr hatte sie die Begegnung mit Patrick aufgewühlt.
Brendan, Emily und Tom Mahony warteten etwas abseits der Gangway auf sie. Bei ihnen stand ein älterer, bärtiger Mann, der auf dem Kopf eine Schirmmütze mit einem aufgestickten grünen Kleeblatt trug.
»Mein Gott, warum hat das denn bloß so lange gedauert?«, rief Brendan ihr ungeduldig entgegen, kaum dass Éanna sich aus dem Menschengewühl am Fuß der Laufplanke befreit hatte. »Wir dachten schon, dir wäre etwas zugestoßen!«
» So lange hat es nun auch wieder nicht gedauert«, widersprach Emily. »Hauptsache, sie hat das Buchpaket!«
Éanna war, als entdecke sie in Brendans Augen einen Anflug von Argwohn. Schnell wich sie seinem forschenden Blick aus und zuckte entschuldigend die Achseln. »Es ging nun mal nicht schneller. Da oben geht es immer noch zu wie in einem Tollhaus. Und auch im Zwischendeck gab es fast kein Durchkommen. Ich kann froh sein, dass ich den Niedergang so schnell wieder hochgekommen bin«, log sie und verspürte im selben Augenblick einen schmerzhaften Stich in der Brust. Warum konnte sie nicht einfach ehrlich sein und ihren Freunden von der Begegnung mit Patrick O’Brien erzählen? Trotz und Ärger flackerten für einen Augenblick in ihr auf und so fügte sie noch hinzu: »Außerdem hat das Biest Caitlin es sich nicht nehmen lassen, mir unter Deck den Weg zu verstellen und mir mit ein paar äußerst giftigen Bemerkungen Lebewohl zu sagen!«
Brendan zog unwillkürlich den Kopf ein wenig ein, als der Name Caitlin fiel, und schwieg.
»Ich hoffe, du hast diesem verdorbenen Schandmaul gehörig die Meinung gegeigt!«, erwiderte Emily stattdessen grimmig.
»Worauf du dich verlassen kannst!«, versicherte Éanna.
»Was ist nun, Leute? Können wir allmählich?« Tom Mahony trat schon die ganze Zeit ungeduldig von einem Bein auf das andere.
Emily nickte. Aber bevor sie sich auf den Weg machten, stellte sie ihrer Freundin den Mann mit der Schirmmütze vor, der noch immer abwartend neben ihnen stand. »Éanna, das hier ist Mister Frederick Calloway, ein Landsmann aus Cork, der schon seit mehr als zehn Jahren in New York lebt. Er gehört zu den Friendly Sons of St. Patrick und hat sich bereit erklärt, uns zum Logierhaus Emerald Isle zu führen.«
Frederick Calloway schenkte Éanna ein freundliches Lächeln, das seiner Mitgliedschaft in der Vereinigung alle Ehre machte. »Auch Euch ein herzliches Willkommen in New York, der Stadt, die wir Einheimischen voller Stolz auch Empire City nennen, Miss …«
»Sullivan … Éanna Sullivan«, sie erwiderte sein Lächeln, »und herzlichen Dank für Eure Hilfe, die wir gut gebrauchen können, Mister Calloway.«
»Also dann, guter Mann, waltet Eures freundlichen Amtes!«, drängte Tom Mahony erneut, dem ganz offensichtlich jedes Maß an Geduld fehlte, und warf sich seinen Kleidersack über die Schulter. »Machen wir uns auf den Weg!«
Als sie losgingen und – Brendan mit Tom Mahony und Frederick Calloway vorneweg – auf die nächste Seitenstraße zuhielten, drehte sich Éanna noch einmal kurz zur Boston Glory um. Ihr Blick fiel auf Patrick, der noch immer seitlich von der Gangwaypforte an der Reling stand. Er schaute ihr nach, hob langsam die Hand zum Abschied und winkte.
Éanna war versucht, den stummen Gruß zu erwidern, halb hatte sie schon den Arm gehoben. Doch dann ließ sie ihn schnell wieder sinken und wandte sich ab. Dabei fing sie Emilys Blick auf. Fragend und mit hochgezogenen Augenbrauen sah Emily sie an. Doch was immer der Freundin in diesem Moment durch den Sinn ging, sie behielt es für sich. Und dafür war Éanna ihr sehr dankbar.
3. Kapitel
Unter Frederick Calloways Führung ließen sie die East River Docks hinter sich und tauchten in den Menschenstrom auf der Catherine Street ein, wo es kaum weniger betriebsam zuging als im Hafenviertel: Die backsteinernen Geschäftshäuser und Kontore der Händler und Importeure reihten sich auch hier zu beiden Seiten der Straße wie die Perlen einer Kette aneinander, immer wieder unterbrochen von Tavernen und billigen Absteigen, die wegen ihrer direkten Nähe zum Hafen vor allem Seeleute anzogen.
»Na, an Schankstuben scheint es in New York keinen Mangel zu geben«, sagte Tom Mahony aufgekratzt und leckte sich genüsslich über die Lippen.
»Wahrlich nicht!«, bestätigte Mister Calloway. »Laut offizieller Zählung soll es gut fünftausend davon in der Stadt geben, fast ein Viertel besitzt keine Ausschanklizenz. Das sind dann meist die üblen Kellertavernen, wo billiger Fusel ausgeschenkt wird. Was dort als erstklassiger Brandy bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit verschnittener Whisky, den man mit dem roten Saft von Lebenseichen hübsch eingefärbt hat!« Brendan zuckte die Achseln. Er hatte in Dublin nicht nur als Kohlenschipper, sondern eine Zeit lang auch als Aufpasser für eine illegale Kellertaverne gearbeitet. »Nicht viel anders als bei uns in Dublin! In den Slums der Liberties ging es fast genauso her.«
Doch Frederick Calloway lachte nur spöttisch. »Junge, selbst die übelsten Slums von Dublin sind gegen Five Points, Hell’s Kitchen, Dutch Hill und bestimmte Hafenbezirke hier die reinsten Kinderspielplätze – und das sind nur einige der unzähligen verruchten Viertel New Yorks!«
Indigniert zog Brendan die Brauen hoch und brummte säuerlich: »Was Ihr nicht sagt.« Dass der Mann ihn mit Junge anredete, obwohl er bereits fast neunzehn Jahre alt war, passte ihm offensichtlich gar nicht. Doch Mister Calloway ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Ja, da gibt es Straßen, die nicht von ungefähr Poverty Lane, Misery Row und Death Avenue heißen, und dann diese entsetzlichen Mietshäuser mit Namen wie Gates of Hell und Brickbat Mansion! «, erzählte er, während sie nach rechts in die Lombardy Street einbogen.
Éanna verfolgte das Gespräch nur mit halbem Ohr. Viel zu sehr wurde ihre Aufmerksamkeit von den vielen Verkäufern und Händlern abgelenkt, die ihnen hier überall in den Straßen begegneten und in deutlichem Kontrast zu den gut gekleideten New Yorker Geschäftsleuten und Angestellten standen:
Da waren junge Mädchen in abgerissener, schäbiger Kleidung, die heiße Maiskolben, Blumen, Streichhölzer oder Ingwergebäck in Weidenkörben, Kistchen oder Lattengestellen durch die Straßen trugen und den Vorbeikommenden ihre Waren für ein paar Cent zum Kauf anboten. Zeitungsjungen, viele kaum älter als neun, zehn Jahre, standen an belebten Kreuzungen und schrien lauthals »Extra! Extra!«. Wenig später sah Éanna einen Schwarzen, der geröstete Schweineohren feilbot und mehrere Hüte übereinander trug, kurz darauf Frauen mit grauen, übermüdeten Gesichtern, die schwere Körbe voll schmutziger Wäsche schleppten. Merkwürdig aussehende Gestalten, die von den New Yorkern Sandwich-Männer genannt wurden, wie Frederick Calloway schmunzelnd erklärte, gingen mechanisch auf und ab, vor der Brust und auf dem Rücken je ein großes Pappschild, auf dem für irgendein Produkt oder ein Geschäft geworben wurde.
Was Éanna in diesen ersten Minuten in den Straßen und Gassen jenseits des Hafens sah, war das ihr nur allzu vertraute Gesicht der Armut, der verzweifelte Versuch, auf irgendeine Weise ein wenig Geld für den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Ihr Herz sank und sie ahnte, dass ihre Freude auf den neuen Anfang vielleicht zu voreilig gewesen war. Denn mit Gold waren die Straßen in New York wohl genauso wenig gepflastert wie in Dublin.
»Vor den vielen miteinander rivalisierenden Gangs von Five Points und der West Side solltet ihr euch in Acht nehmen.« Mister Calloway war stehen geblieben und drehte sich zu den Einwanderern um. »Ebenso müsst ihr euch von den Daybreak Boys und den River Rats, die nachts auf dem East und Hudson River kleinere Schiffe überfallen und ausrauben, fernhalten. All diese Banden sind in New York von einem ganz anderen Kaliber, als ihr es vielleicht von drüben gewohnt seid«, warnte er. »Und das trifft leider auch auf viele Besitzer von Mietshäusern zu: elende Schurken, die als Entgelt für ihre miesen Wohnlöcher rücksichtslos auch noch den letzten Cent aus vielen armen Leuten herauspressen. Also seht bloß zu, dass ihr schnell Arbeit findet, damit ihr euch eine annehmbare Unterkunft leisten könnt, und haltet euch von den gefährlichen und gottlosen Bezirken möglichst fern!«
»Ist es einfach, hier Arbeit zu finden?«, fragte Éanna.
»Nun ja«, Frederick Calloway klang nun deutlich zögerlicher. »Also direkt nachgetragen werden einem die Jobs hier nicht gerade, das ist mal sicher. Bei den Hundertschaften neuer Einwanderer, die täglich in die Stadt kommen, muss man sich schon ordentlich bemühen, um Arbeit zu finden, die einen auch gut ernährt. Aber das ist wahrlich kein Grund, den Kopf hängen zu lassen! Warum sollte euch nicht gelingen, was schon unzählige Iren vor euch geschafft haben! Viele von ihnen sind hier genauso arm angekommen wie ihr und haben mittlerweile doch ein ganz ordentliches Auskommen. Man muss nur Augen und Ohren offen halten, ein bisschen clever sowie willens sein, hart zu arbeiten.«
»Und weiß Gott, das sind wir!«, versicherte Brendan optimistisch.
»Klar, irgendetwas wird sich schon ergeben«, stimmte Tom Mahony ihm zu, doch seine Stimme hatte einen mürrischen Unterton. Die Vorstellung von harter Arbeit schien ihm wenig zu behagen.
»Und mit welchem Lohn kann man hier rechnen?«, stellte Emily die nächste drängende Frage.
»Das kommt ganz darauf an, welche Art von Arbeit ihr findet. Wer sich in New York als Näherin für einen der vielen Hemden- und Kleiderfabrikanten durchschlagen muss, der kann sich glücklich schätzen, nach zwölfstündiger Arbeit mit der Nadel seine zwanzig bis dreißig Cent verdient zu haben«, erklärte Frederick Calloway. »Zu mehr bringen es diejenigen, die frühmorgens auf den großen Märkten Obst und Gemüse einkaufen und damit durch die Straßen ziehen. Aber dafür braucht man schon einiges an Startkapital und vor allem eine verdammt gute Ausdauer, um sich bei der starken Konkurrenz einen verlässlichen Kundenstamm aufzubauen. Tja, und als Mann kann man mit ein wenig Glück in den Docks, beim Eisenbahnbau oder in den Steinbrüchen oben im Norden einen Job ergattern, wo oft neunzig Cent, manchmal sogar ein Dollar am Tag gezahlt werden.«
»Das sagt uns alles leider noch nicht viel. Was ist denn ein Dollar in englischem Geld wert?«, fragte Brendan sofort nach.
»Vier Shilling. Für ein englisches Pfund gibt es also fünf amerikanische Dollar.«
Brendan und Éanna warfen sich einen schnellen Blick zu. Ihre gemeinsame Barschaft machte elf Shilling und sieben Pence aus und Emily hatte in ihrem kleinen Geldbeutel noch drei weitere Shilling und einen Sixpence, wie sie wussten. Was bedeutete, dass ihnen zusammen etwas mehr als dreieinhalb Dollar zur Verfügung standen.
Damit ergab sich für sie sofort die Frage nach den Kosten, die sie im Emerald Isle für ihre Unterkunft zahlen mussten. Frederick Calloway wiegte den Kopf leicht hin und her. »Nun, das Emerald Isle hat einen recht ordentlichen Ruf. Ich schätze mal, dass ihr dort für Kost und Logis mit nicht mehr als vierzig, maximal fünfzig Cent pro Tag zu rechnen habt.«
»Für jeden von uns oder für uns alle zusammen?«