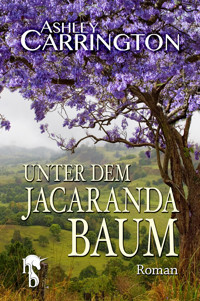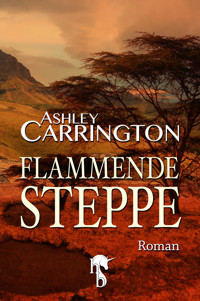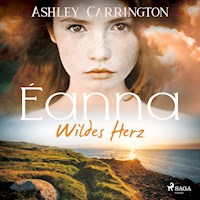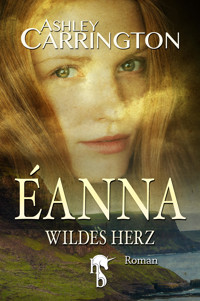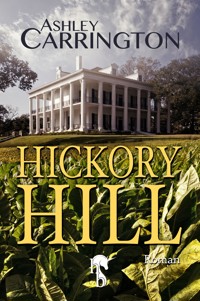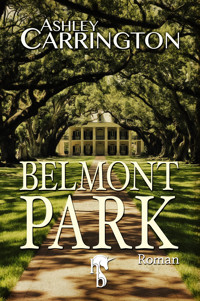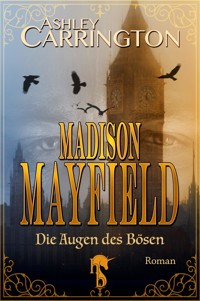
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
London, 1890. Seit ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen, lebt Madison Mayfield bei ihrem Onkel, Sir Edward Winslow, ihrer Tante und ihren Cousinen Alisha und Cora. Verständnis für Madison hat keiner von ihnen, im Gegenteil, man lässt sie ins Irrenhaus einweisen, als sie wieder einmal von quälenden Visionen heimgesucht wird. In diesen erlebt sie grausame Verbrechen, sieht aber immer nur die Opfer, nie den Täter. Nur ihre Gesellschafterin Leona, von den Winslows engagiert, unterstützt Madison, als sie damit konfrontiert wird, dass die Verbrechen, die sie bei ihren Anfällen vor Augen hatte, wohl wirklich geschehen sind. Wie ist das möglich? Und was haben ein inhaftierter Unterweltkönig und ein rätselhafter ehemaliger Detective von Scotland Yard damit zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Ähnliche
Ashley Carrington
Madison Mayfield
Die Augen des Bösen
Roman
Für Helga
Die Sinnenwelt erkennen wir;in der übersinnlichen Welt leben wir.
Johann Gottlieb Fichte, deutscher Philosoph (1762–1814)
All that we see or seemis but a dream within a dream.
Edgar Allan Poe, amerikanischer Schriftsteller (1809–1849)
1
Das Böse sprang sie unvermittelt an. Wie immer kam es lautlos, überfiel sie mit einer hinterhältigen Stille, in der sich das Grauen wirkungsvoller entfalten konnte, als wenn es von Geräuschen begleitet gewesen wäre.
Ein verzweifelter Laut, der mehr ein hilfloses Aufschluchzen als ein Schrei um Hilfe war, entrang sich Madison Mayfields Kehle, als sie spürte, was wieder einmal mit ihr geschah. Sie fasste sich an den Kopf und wankte wie unter einem unsichtbaren Schlag. Sie knirschte mit den Zähnen, während sie sich mit aller Willenskraft gegen den Ansturm der inneren Bilder zur Wehr setzte. Sie wusste jedoch, dass ihr Widerstand vergeblich sein würde.
Sowie das Böse über sie kam, verlor Madison Mayfield die Kontrolle über ihre Sinne. Das Andere, das Fremde, das Kranke in ihr überwältigte sie und machte sie schlagartig zu seiner wehrlosen Gefangenen. Der geharkte Kiesweg unter ihren Füßen und die Allee alter Ulmen und Eichen, über die ein feuchter, rauchgeschwängerter Wind Wolken von Herbstlaub wehte, lösten sich vor ihren Augen auf, als wäre der ganze weitläufige, in der blassen Nachmittagssonne liegende Park ein Trugbild gewesen, das nun von der schauerlichen Wirklichkeit davongefegt wurde.
Augenblicklich setzten auch der beklemmende Druck auf der Brust und die Atemnot ein, die jeden derartigen Anfall begleiteten. Dazu gesellten sich sogleich das wilde Hämmern und Stechen im Kopf, die dem rasenden Takt ihres Herzens folgten und ihre Quelle irgendwo hinter ihren Augen hatten.
Ihr war, als würde ein mächtiger Strom dunkler Empfindungen sie verschlingen und sie hinunter in einen dämonischen Abgrund ziehen, in dem gewaltige Strudel tobten.
Der Sog erfasste sie, und während sie in diesen gierig saugenden Schlund stürzte, der wie ein lebendiges Wesen pulsierte, strömte eine gewaltige Flut von Bildern über sie hinweg und umwirbelte sie. Bei der irrwitzigen Geschwindigkeit, mit der sie an ihr vorbeijagten, vermochte sie keine Einzelheiten auszumachen. Aber sie spürte, wie bei allen anderen Anfällen zuvor, dass sie von abgrundtiefer Schlechtigkeit erfüllt waren.
Madison wusste, was nun kam: Der dunkle Mahlstrom schleuderte sie durch den sich rhythmisch zusammenziehenden und wieder ausdehnenden Schlund, doch plötzlich riss der unfassbare Bilderwirbel um sie herum wie ein jäh durchtrennter Bindfaden ab. Gleichzeitig öffnete sich etwas in ihr wie eine mechanische Linse …
Die Augen des Bösen!
2
Madison stöhnte auf, als diese dunkle Kraft, der sie den Namen Augen des Bösen gegeben hatte, in ihr zum Leben erwachte und sie unter ihre lähmende Allmacht zwang. Hilflos war sie den Wahnbildern ausgesetzt, die ihr kranker Geist wieder einmal vor ihr entstehen ließ.
Dabei war ihr Blickfeld eingeengt, nur auf eine kleine Mitte begrenzt und von allen Seiten umgeben von flirrenden, rot geäderten Schattierungen von Schwarz und Grau. Zudem trieben dichte Schleier oder Nebelschwaden zwischen ihr und dem unheimlichen Geschehen. Was dazu führte, dass sie die sich ihr aufdrängenden Bilder und Szenenfolgen manchmal einige Sekunden lang gestochen scharf vor sich sah, um im nächsten Moment nur noch verschwommene Umrisse erkennen zu können.
In ihrer Wahnwelt gab es, bis auf wenige flüchtige Ausnahmen, keine Farbe, sondern nur Töne in Schwarz und Weiß. Alle Bilder machten einen etwas grobkörnigen Eindruck, als läge eine Art von Sieb über allem, das den Dingen die scharfen Konturen nahm. Dennoch war gut zu erkennen, was ihr die Augen des Bösen zeigten: zuerst eine kräftige, leicht behaarte Männerhand, die aus einer weißen Hemdmanschette ragte. Sie hielt ein Blatt Papier ins Licht eines einarmigen Kerzenleuchters mit einem blank polierten Reflektor aus leicht gewölbtem Messing oder Silberblech. Der Kerzenleuchter stand auf einem Schreibtisch, dessen Oberseite in drei mit Leder bezogene Felder aufgeteilt war.
Das Zimmer dahinter lag im Dunkel schwerer, zugezogener Vorhänge. Von rechts kam ein schwaches Glühen. Ein Kamin mit einem heruntergebrannten Feuer. Die sich kräuselnde Rauchfahne von einer daumendicken, langen Zigarre, die linker Hand in einem Kristallaschenbecher abgelegt war, zog ins Bild. Bei dem Blatt in der Hand des Mannes handelte es sich um einen Briefbogen mit einem Wappenzeichen über dem Adressenfeld. Das Anschreiben bestand aus einigen wenigen Zeilen in gestochen scharfer und schwungvoller Handschrift, die sich nach rechts neigte, sowie mehreren Zahlen.
Doch nichts von dem Niedergeschriebenen war scharf genug zu erkennen, noch hatte sie Zeit, es sich einzuprägen. Denn schon im nächsten Moment wurde das Bild trübe, verschwand hinter einemmilchigen Schleier. Als sie dann wieder schärfer sah, knüllte der Mann das Schreiben gerade zusammen. Die Faust mit dem Papierknäuel fuhr durch die Luft und hämmerte auf den Tisch. Der Kerzenleuchter tanzte bedrohlich unter dem wuchtigen Schlag und flüssiges Wachs spritzte von der Kerze auf die Lederbespannung. Dann schleuderte die geballte Faust das Papierknäuel in Richtung des Kamins.
Die andere Hand griff zitternd nach der Zigarre und führte sie zum Mund. Plötzlich legte sich Farbe wie ein dünner Film über die Szene. Für einen winzigen Moment war zu sehen, dass es sich bei den drei Feldern auf der Schreibtischplatte um moosgrünes Leder handelte, dass die dunkelbraunen Vorhänge mit goldenen Borten verziert waren und dass am Ringfinger des Mannes im Kerzenlicht ein Ring mit einem blutroten Rubin aufblitzte. Aber so unvermittelt, wie sich die Farben über die Szene mit dem Zimmer gelegt hatten, so schnell verblassten sie auch wieder und überließen den Grautönen die alleinige Herrschaft.
Dichte Rauchwolken vernebelten die Sicht. Der Mann erhob sich abrupt, trat um den Schreibtisch herum und schritt zum Kamin. Er hob den zusammengeknüllten Brief auf, der vom Kamingitter abgeprallt war, und warf ihn in die Glut. Die Zigarre, weit davon entfernt, heruntergeraucht zu sein, folgte. Seine Rechte griff zum Schüreisen, riss es unbeherrscht vom Haken. Der Ständer mit dem restlichen Kaminbesteck aus Zange, Schaufel, Handbesen und Blasebalg stürzte lautlos auf die marmorierten Bodenplatten vor der Feuerstelle.
Wieder wurde das Bild verschwommen. Vage war zu erkennen, wie der Mann den zusammengeknüllten Brief mit dem Eisen wild in die Glut hineinstieß. Funken stoben auf. Dann stiegen Flammen aus der Glut, züngelten nach dem Papier und loderten in die Höhe.
Mit hektischem flachem Atem torkelte Madison wie betrunken über den Kiesweg. Statt dem scharfen Bogen der Allee zu folgen, wankte sie weiter geradeaus und kam schon nach wenigen Schritten vom Weg ab. Mit der rechten Schulter schrammte sie an einem Baum vorbei. Dabei rutschte ihr der karierte Wollumhang von der Schulter und schleifte nun hinter ihr her über den Boden. Eine Gruppe Raben, die sich oben im schon stellenweise kahlen Geäst niedergelassen hatte, flatterte unter lautem Flügelschlagen und missmutigem Krächzen auf. Ihr blauschwarzes Gefieder leuchtete kurz wie schillerndes Perlmutt, als die Vögel durch einen Streifen blassen Oktobersonnenlichts flogen, der durch breite Lücken in den Baumkronen in die Allee fiel.
Das Zimmer mit dem Mann vor dem Kamin verlor plötzlich an Deutlichkeit. Es löste sich jedoch nicht gänzlich auf, sondern trat in den Hintergrund, verharrte dort wie ein Aquarellbild, das man auf einen halb durchsichtigen Schleier gemalt hatte. In den Vordergrund trat ein völlig neuer Ort: die Themse mit der breiten Uferbefestigung und einer ihrer Brücken. Es war eindeutig die Blackfriars Bridge mit ihren fünf schmiedeeisernen, halb elliptischen Bögen, die sich über den Fluss spannten.
Die Nacht lag über dem breiten Strom, dessen dunkle Fluten lautlos die mächtigen Brückenpfeiler umspülten. Auf jedem Pfeiler erhob sich eine mächtige Säule, die oben an der gusseisernen Balustrade eine vorspringende Kanzel trug, in die man vom Gehsteig der Brücke treten und hinaus auf den Fluss blicken konnte. Hinter der Blackfriars Bridge zeichnete sich die majestätische Kuppel der St. Paul’s Cathedral ab sowie ein Wald von Schiffsmasten. Das Bild hielt sich kurz in aller Deutlichkeit, um dann mit einem Schlag wie hinter einer Wand aus Sturzregen zu verschwimmen.
Ein nasser Zweig schlug Madison ins Gesicht, als sie durch ein Gebüsch brach. Sie spürte es nicht. Um ein Haar stürzte sie ins Gras, als sich hinter dem Gebüsch der Boden unter ihrem linken Fuß zu einer Mulde hin absenkte. Instinktiv ruderte sie mit den Armen durch die Luft und gewann noch rechtzeitig das Gleichgewicht zurück. Doch nun taumelte sie auf einen der Zierteiche zu.
Die Szene mit dem Zimmer trat ihr wieder klar vor Augen und zwang nun Themse und Blackfriars Bridge in den Hintergrund. Der Mann trat an den Schreibtisch zurück. Dort griff er zu Schere und einem Stück Karton. Er schnitt ein Stück von der Größe einer Visitenkarte heraus, umrahmte es mit schwarzer Tinte wie eine Todesanzeige und schrieb in die Mitte die beiden Buchstaben WV.
So plötzlich, wie die Szene mit dem Mann im Zimmer wieder in den Vordergrund getreten war, so plötzlich versank sie auch wieder. Die Ansicht von Themse und Blackfriars Bridge kehrte zurück, diesmal jedoch im dichten Londoner Nebel. Gelblich und voller feiner Rußpartikel hüllten die Nebelschwaden Fluss, Brücke und Kathedrale ein. Hilflos kämpften die runden Glaskugeln der Gaslaternen auf der menschenleeren Uferbefestigung und der Brücke mit ihren kläglichen winzigen Lichtinseln gegen die dicke Nebelsuppe.
Madison hörte Stimmen. Sie schienen aus weiter Ferne zu kommen, drangen jedoch nicht zu ihr durch. Blindlings taumelte sie weiter über den Rasenstreifen.
Ein Mann mit einem Leinenbeutel unter dem Arm schritt im Nebel auf der Westseite, wo steinerne Vogelskulpturen die Brüstungen schmückten, über die Brücke. Er hielt auf die zweite Kanzel zu, trat in die geräumige Ausbuchtung und zog ein Seil aus dem Beutel, den er achtlos über die Brüstung warf. Der Nebel verschluckte ihn. Das Seil war kurz, keine drei Meter lang. Ein Ende war zu einer Schlinge geknotet, das andere befestigte er am gusseisernen Geländer und ließ es in die Tiefe baumeln. Die Hände des Mannes steckten in schwarzen Lederhandschuhen.
»Miss Mayfield!«
Eine kräftig gebaute Frau in einem taubengrauen Kleid mit makellos weißer Schürze und ebenso tadelloser Haube aus steifem weißem Leinen auf der braunen Zopfkrone lief von einem schmalen Seitenweg auf Madison zu. Madison wollte sich ihr zuwenden, doch konnte sie sich von ihren inneren Bildern nicht losreißen.
Auf der Brücke tauchte ein zweiter Mann aus der wabernden Nebelwand vor der Kanzel auf. Er war von schmächtiger Statur und zog das linke Bein nach. Er trat in die winzige Lichtinsel der Gaslaterne. Auf seinem von Narben entstellten Gesicht lag ein verstimmter, aber keineswegs argwöhnischer Ausdruck. Er öffnete den Mund und machte eine unwillige Geste in den Nebel hinein, als verstünde er nicht, was der andere Mann an diesem Ort und zu dieser garstigen Nachtstunde von ihm wollte. Er trat zu ihm auf die Kanzel. Die Männer tauschten einen Händedruck. Das Bild mit den beiden Männern wurde kurz durchsichtig, und die behaarten Hände mit dem schwarz umrahmten Stück Karton auf der ledernen Schreibtischunterlage zeichneten sich für einen Moment dahinter ab.
»Miss Mayfield! … Miss Mayfield! … Madison! … Um Himmels willen, bleiben Sie stehen, sonst laufen Sie noch geradewegs in den Teich! … Madison! … O Gott, lass sie zu sich kommen – oder gib mir Flügel!« Die stämmige Frau, die Mitte vierzig sein mochte, raffte Röcke und Schürze und lief, so schnell sie konnte, quer über den feuchten Rasen auf Madison zu.
Der Mann, der auf den Hinkenden gewartet hatte, trat hinter ihn. Er hielt jetzt eine Drahtschlinge in den behandschuhten Händen, legte sie der schmächtigen Gestalt blitzschnell um den Hals und zog zu. Das Narbengesicht trat und schlug wild um sich, die Augen quollen ihm aus den Höhlen, sein Mund öffnete sich zu einem stummen Schrei. Er versuchte, seine Hände hinter den Draht zu krallen, aber dafür war es längst zu spät. Zu tief hatte dieser sich schon in sein Fleisch geschnitten. Zudem war er der Kraft des Mörders nicht gewachsen. Sein Widerstand brach zusammen und sein Körper erschlaffte schnell, das Gesicht zu einer entsetzlichen Maske aus Schmerz und Todesangst verzerrt.
Der Mörder warf die Schlinge in den Fluss, beugte sich zum Toten hinunter, zog ihm eine Art Rolle, die mit einem dünnen Lederriemen verschnürt war, aus der Innentasche seines Gehrocks und heftete ihm das schwarz umrahmte Stück Karton mit den Buchstaben WV in der Mitte mit einer Nadel ans Revers. Dann griff er nach dem Seil, legte dem Toten die Schlinge um den Hals, wuchtete den Leichnam auf die Brüstung und ließ sie am Seil hinab.
Die Brücke löste sich in den grau-gelblichen Nebelschwaden auf. Das Zimmer mit dem Schreibtisch sprang wieder in den Vordergrund, als dort eine Tür aufging, jemand ins Zimmer trat und …
3
»Miss Mayfield!«
Eine Hand, die zuzupacken verstand, hielt Madison am Arm fest, zerrte sie weg vom Teich und hin zum Seitenweg der Parkanlage, die andere verpasste ihr eine schallende Ohrfeige. Der Bann brach und die Wahrnehmung der Gegenwart setzte wieder ein, wenn auch mit einer gewissen Trägheit.
Madison sah die Frau blinzelnd an. »Schwester Audrey?«, keuchte sie atemlos und mit noch immer wild hämmerndem Herzen. Sie fühlte sich benommen und zittrig auf den Beinen, so wie sie es bisher nach jedem Anfall erlebt hatte. Dazu setzten die bohrenden Kopfschmerzen ein.
»Ja, ich bin es, Schwester Audrey Young!«
Madison rieb sich die Wange, kniff die Augen zusammen und fixierte die Frau eindringlich, als müsste sie sich erst noch vergewissern, dass sie es auch wirklich mit Schwester Audrey Young zu tun hatte, die sie stützte und führte. Dann setzte das bewusste Begreifen wieder ein und augenblicklich überkam sie Scham. Eine tiefe brennende Scham, die sie unvergleichlich mehr schmerzte, als Schläge es jemals tun konnten.
Schnell senkte sie den Blick, damit die Schwester nicht sah, wie elend sie sich fühlte, und zwar nicht allein körperlich.
»Das mit der Ohrfeige tut mir leid, aber es musste sein! Gütiger Gott, Sie haben überhaupt nicht auf meine Rufe und meine Zeichen reagiert!«, sagte Audrey Young entschuldigend, legte ihr den karierten Wollumhang wieder richtig über die Schulter und hielt mit ihr auf eine nahe Bank zu, die unter einer von Efeu überrankten und von Büschen umschlossenen Pergola stand.
Madison rang sich ein gequältes Lächeln ab und machte eine abwehrende Geste. »Was? … Oh, das! … Nicht … nicht der Rede wert, Schwester«, murmelte sie, immer noch nach Atem ringend, und wurde sich dann plötzlich mit jähem Erschrecken bewusst, welche Konsequenzen dieser Vorfall für sie haben konnte, wenn Schwester Audrey die richtigen Schlüsse zog und Meldung davon machte. Kalter Schweiß brach ihr bei dem Gedanken aus. Daher fügte sie hastig hinzu: »Ich muss wirklich … wirklich reichlich weit weg mit meinen Gedanken gewesen sein. Mir ist so viel durch den Kopf gegangen. Ich weiß, ich sollte besser aufpassen, aber manchmal bin ich wirklich so tief in meine Gedanken versunken, dass …, dass ich alles um mich herum vergesse.«
Die kräftig gebaute Schwester warf ihr einen schwer zu deutenden Seitenblick zu, ging jedoch nicht darauf ein. »Kommen Sie, setzen wir uns hier für eine Weile, damit Sie wieder richtig zu sich kommen und sich fassen können.«
»Nein, nein … das ist nicht nötig. Mir geht es gut, wirklich!«, beteuerte Madison. Sie war voller Angst, dass es schon zu spät war, um das drohende Verhängnis noch rechtzeitig abwenden zu können.
»Von wegen! Sie zittern ja wie Espenlaub!«, hielt die Schwester ihr entgegen.
»Ich weiß, es war nachlässig von mir, nur das dünne Wolltuch und nicht das warme Cape umgelegt zu haben. Der Wind vom Fluss ist doch frischer als gedacht.«
»Mit dem frischen Wind hat Ihr Zittern nicht das Geringste zu tun, und das wissen Sie so gut wie ich«, erwiderte Schwester Audrey trocken.
Die Angst würgte Madison. »Doch, ich bin nur …«
»Hören Sie auf damit! Und jetzt seien Sie vernünftig und setzen sich mit mir hier hin!«, sagte Schwester Audrey Young energisch und zog sie mit sich auf die Bank. »Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht!« Audrey Young machte eine kurze Pause, dann fügte sie leise und mit sorgenvoller Miene hinzu: »In Ihrem verstörten Zustand sollten Sie da drüben«, sie deutete mit dem Kopf in Richtung des mächtigen, lang gestreckten Gebäudes aus grauem Granit, das hinter den Bäumen drei Stockwerke hoch, über zweihundert Meter lang und mit einer mächtigen Glaskuppel über seinem Mitteltrakt in den Himmel aufragte, »… also, Oberschwester Malvina sollten Sie jetzt besser nicht unter die Augen treten, von Dr. Savage ganz zu schweigen.«
Madison schauderte. Vor der Oberschwester, die über die Galerie im dritten Stock herrschte, vor allem aber vor Dr. Savage fürchtete sie sich mehr noch als vor ihren Wahnanfällen, die sie ins Bedlam gebracht hatten. Um keinen Preis durfte auch nur einer von den beiden erfahren, was ihr soeben widerfahren war und dass sie um ein Haar in den Teich gewankt wäre! Das würde sie die hart errungene Freiheit kosten!
4
»So, und nun erzähl, Mädchen!«, forderte Audrey Young sie auf, nachdem Madison zu Atem gekommen war und einen einigermaßen gefassten Eindruck machte. Dass sie dabei die förmliche Anrede fallen ließ, war kein unbedachter Ausrutscher gegenüber einer Patientin aus gutem Haus. Auch wenn Madison selbst nicht von aristokratischem Stand war, so war sie doch das Mündel von Sir Edward Winslow, den die Zeitungen gern als Londons Eisenbahnbaron titulierten, und gegenüber einer solchen Person nahm man sich als einfache Schwester tunlichst keine Freiheiten heraus, auch nicht dann, wenn es sich bei ihr um ein gerade mal neunzehnjähriges Mädchen handelte. Die vertrauliche Anrede signalisierte vielmehr, dass Audrey Young nicht in ihrer offiziellen und damit bedrohlichen Rolle als Schwester des Bethlehem Lunatic Asylum Auskunft verlangte, sondern dass sie Madison als mitfühlende, fürsorgende Privatperson zum Reden über den Vorfall aufforderte.
Madisons Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »Da gibt es nichts zu erzählen, Schwester!«, sagte sie in spontaner, angsterfüllter Abwehr. Sie log aus Selbstschutz. Denn die Wahrheit würde ihre zum Greifen nahe Freiheit gefährden. »Wie ich es schon sagte: Ich hatte mich in meinen Gedanken verloren und schlichtweg nicht aufgepasst, das ist alles. Ich scheine für diese … diese Episoden, wo ich alles um mich herum vergesse, recht anfällig zu sein, das will ich ja gern zugeben. Aber mehr als Tagträumen ist das nicht.«
Schwester Audrey, deren etwas grobe Züge in einem starken Gegensatz zu ihrem gütigen Blick und ihrem warmherzigen Wesen standen, seufzte leise. »Ach, Madison. Ich verstehe ja, dass du lieber nicht über deine Episoden, wie du diese … Vorfälle nennst, reden möchtest. Aber mach mir bitte nichts vor. Ich weiß, was ich gesehen habe, und ich bin nicht erst seit gestern Schwester in solch einer Einrichtung.« Sie deutete in Richtung des monumentalen Gebäudes, das mittlerweile einen langen Schatten warf. »Also verkauf mich bitte nicht für dumm, indem du mir weismachen willst, du hättest dich in Tagträumen verloren!«
»Ich will Sie ja gar nicht …«, setzte Madison zu einer weiteren Beteuerung an.
Audrey Young ließ sie erst gar nicht ausreden. »Doch, das willst du! Dabei solltest du allmählich wissen, dass ich nicht darauf aus bin, dich hierzubehalten, sondern dass ich es nur gut mit dir meine und du mir vertrauen kannst. Oder habe ich dir in den zwei Wochen, die du nun bei uns bist, Grund gegeben, eine andersartige Meinung von mir zu haben?«
Madison wich dem leicht gekränkten Blick der Schwester aus, biss sich auf die Unterlippe und rang kurz mit sich selbst.
»Nein«, räumte sie schließlich kleinlaut ein. Dass man sie an diesem Nachmittag nun endlich wieder nach Hause lassen würde, verdankte sie in erster Linie Audreys stillschweigendem Wegschauen und ihrer mütterlichen Zuneigung sowie einer großen Portion Glück.
»Gut«, sagte die Schwester zufrieden und fuhr dann umgänglich fort: »So, und jetzt erzähl endlich. Du hast eben einen Anfall gehabt, nicht wahr?«
Unmerklich zuckte Madison zusammen. Wie sie dieses scheußliche ausgrenzende und brandmarkende Wort »Anfall« hasste! Sie verabscheute es aus tiefster Seele! Es klang nach Geistesgestörtheit – und seit ihrem zweiwöchigen Aufenthalt hier nun auch nach Zwangsjacken aus steifem Leinen, Gummizellen, eisigen Bädern, aufgezwungenen Einläufen, scharfer Karbolseife, vergitterten Treppen und Korridoren sowie rettungslos verlorenen Seelen!
Aber sie war nicht krank! Jedenfalls nicht so wie die mehr als vierhundert Insassen, die man hier im südlichen Stadtteil Southwark und fern von den Prachtbauten und vornehmen Vierteln Londons hinter hohen Mauern und Eisengittern wegsperrte und die man lunatics nannte! Sie gehörte nicht zu diesen Irrsinnigen! Ihr Geist war klar – bis auf diese kurzen, wahnhaften … Episoden.
»Erzähl, Mädchen. Es hilft, sich von der Seele zu reden, was einen bedrückt und verfolgt. Reden ist eine viel bessere Medizin als all diese Behandlungsmethoden und unsäglichen Drogen, auf die Dr. Savage und Oberschwester Malvina so schwören. Also erzähl, was dir widerfahren ist. Es wird dir guttun, du wirst sehen, Mädchen.« Schwester Audreys Stimme war ohne Drängen, sondern so sanft und liebevoll wie ihre Hand, die sie beruhigend auf den Arm des Mädchens neben sich legte.
Madisons Widerstand brach. Wenn es hier überhaupt jemanden gab, dem sie vertrauen konnte, dann war es Schwester Audrey. »Es war nur … nur wieder so ein grässlicher Albtraum am helllichten Tag.«
»Und du konntest dich wieder einmal nicht wehren gegen diese … diese eindringlichen Bilder und Eindrücke, die sich dir aufgedrängt haben?«, vergewisserte sich Schwester Audrey, obwohl sie die Antwort kannte. Sie hatte heimlich Einblick in die eigentlich von Dr. Savage unter Verschluss gehaltene Krankenakte genommen. Daher wusste sie im Detail, warum man das Mädchen mit dem kastanienbraunen Haar, dem blassen schmalen Gesicht, das um die Nase herum von einigen Sommersprossen gesprenkelt war, und den dunklen, traurigen Augen vor zwei Wochen zur Beobachtung und Begutachtung ins Bethlehem Lunatic Asylum gebracht hatte.
Bedlam hieß diese Anstalt im Volksmund, und seit mehr als zwei Jahrhunderten stand jene Verballhornung nicht nur für das Irrenhaus südlich der Themse, sondern der Begriff war im allgemeinen Sprachgebrauch auch gleichbedeutend mit Wahn, Chaos, Tumult und Unzurechnungsfähigkeit.
Madison schüttelte den Kopf. »Ich habe es versucht, aber es hilft alles nichts, Schwester. Wenn …, wenn es passiert, komme ich gegen diese grässlichen Bilder nicht an, die dann plötzlich vor meinen Augen auftauchen.« Sie kämpfte gegen ein Schluchzen an, das ihr plötzlich in die Kehle stieg.
»Ganz ruhig, mein Kind! Es ist ja vorbei.« Audrey Young tätschelte Madisons Arm. »Gottlob sind deine Episoden immer nur von kurzer Dauer. Und hinterher ist wieder alles gut mit dir, wie ich bisher feststellen konnte, nicht wahr?«
Madison nickte.
»So oder so, hier bei uns im Bedlam hast du jedenfalls nichts zu suchen, das steht für mich fest.«
Die Versicherung tat Madison gut. Und nun drängte es sie, sich die jüngsten Erlebnisse von der Seele zu reden. »Diesmal war es besonders schrecklich, was … was mir meine ›überspannte und nervöse Fantasie‹ vorgegaukelt hat«, gestand sie und benutzte dabei die Worte, mit denen Dr. Savage seine Diagnose am Vormittag ihr gegenüber zusammengefasst hatte. Abschließend hatte er ihr dann die erlösende Nachricht mitgeteilt, dass er keinen Grund sehe, sie noch länger im Bedlam zu behalten, und dass er ihre Entlassung noch für denselben Tag anordnen werde.
»Was genau hast du denn gesehen?«
Mit stockender, aber mittlerweile wieder fester Stimme beschrieb Madison ihr die seltsame Szene im verdunkelten Zimmer und dann den brutalen Mord auf der vom Nebel umwogten Blackfriars Bridge.
Mit einem Anflug von Bestürzung sah Audrey sie an. »Und das alles hast du ganz deutlich gesehen?«
Madison nickte. »So klar, wie ich Sie hier neben mir sitzen sehe … nun, vielleicht doch nicht ganz so deutlich und auch nicht in den natürlichen Farben«, korrigierte sie sich im nächsten Moment schnell. Es erschien ihr wichtig, Schwester Audrey gegenüber bei der Wahrheit zu bleiben. Das war sie ihr schuldig. »Manchmal war es zwar so, als lägen zwei verschiedene Bilder übereinander wie zwei Lagen bemalter Gaze. Und zeitweilig sah ich das Geschehen im Zimmer und auf der Brücke ganz verschwommen wie durch einen Schleier oder eine Regenwand.«
Schwester Audrey nickte und forderte sie mit einem aufmunternden Lächeln auf, weiterzuerzählen.
»Aber ich habe nicht nur den Mord genau vor Augen gehabt, sondern auch, wie er das Stück Karton ausgeschnitten und diese beiden Buchstaben in die schwarze Umrandung geschrieben hat«, fuhr Madison leise und beklommen fort. Das Erlebte in Worte zu fassen, mochte einerseits etwas Befreiendes haben. Es machte ihr aber andererseits das grausame Verbrechen noch einmal gegenwärtig. »Und auch das narbige Gesicht des Hinkenden konnte ich gut erkennen.«
»Und was ist mit der Person, die in deiner Fantasie dieses Verbrechen begangen hat, hast du sie auch gesehen?«
Madison verneinte.
Ein Anflug von Verwunderung trat auf Schwester Audreys Gesicht und war auch aus ihrer Stimme herauszuhören, als sie fragte: »Kann es sein, dass du in diesen Halluzinationen … also, dass du dich selbst in solch einer Gewaltszene siehst?«
Vehement schüttelte Madison den Kopf. »Nein, völlig unmöglich!«
»Was macht dich da so sicher?«
»Weil es die behaarten Hände eines Mannes gewesen sind, die den Hinkenden umgebracht und an das Brückengeländer gehängt haben!«, teilte Madison ihr mit. »Und er hat eine Zigarre geraucht.«
»Ich verstehe.«
»Außerdem zeigen mir die Augen des Bösen nie die Täter, sondern immer nur die Opfer«, entfuhr es ihr unbedacht. Und kaum waren ihr die Worte über die Lippen gekommen, als sie begriff, was sie da unwillkürlich preisgegeben hatte. Aber es war zu spät, um daran noch etwas zu ändern. Am liebsten hätte sie sich für ihre Dummheit selbst geohrfeigt.
Schwester Audrey fuhr denn auch gleich überrascht zu ihr herum und warf ihr einen bestürzten Blick zu. »Die Augen des Bösen? Was genau meinst du damit? Und woher hast du diese Bezeichnung?«
Madison wurde es heiß und kalt zugleich und ein Anflug von Übelkeit legte sich wie ein eklig saurer Lappen in ihren Mund. Herrgott, sie musste ihren Verstand zusammennehmen und besser aufpassen, was sie von sich gab, wenn sie ihre Freiheit nicht noch in den letzten Minuten verspielen wollte! Wie hatten ihr diese Worte bloß herausrutschen können?
Audrey Young mochte sie ins Herz geschlossen haben und vieles von dem, was im Bedlam zur alltäglichen Behandlung der Insassen gehörte, insgeheim nicht gutheißen. Aber sie war und blieb doch eine Anstaltsschwester und führte gewöhnlich gehorsam aus, was Dr. Savage und Oberschwester Malvina anordneten, auch wenn sie ernste Zweifel an der Wirksamkeit von Eisbädern, erzwungenem Erbrechen und Einläufen zur Beruhigung oder gar Heilung eines verwirrten Geistes hegte.
»Woher hast du diese schauderhafte Bezeichnung Augen des Bösen?«, wiederholte Audrey ihre Frage, beugte sich zu ihr und forschte sichtlich beunruhigt nach: »Und seit wann verbindest du deine … deine Episoden mit diesen Augen des Bösen?«
Madison schluckte krampfhaft, zuckte mit den Achseln und bemühte sich um ein verlegenes Lächeln, als wäre es ihr peinlich, dass ihr etwas so Haltloses und absolut Unsinniges über die Lippen gekommen war. »Um Gottes willen, nein! Das mit diesen … Augen des Bösen ist mir gerade ganz spontan eingefallen«, versuchte sie die Sache herunterzuspielen und schämte sich innerlich, Audrey anzulügen. Aber welche Wahl blieb ihr denn? Was immer es mit diesen Augen des Bösen auf sich hatte und was immer sie mit ihr machten, sie war nicht geistesgestört und gehörte daher auch nicht ins Bedlam! »Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber das ist natürlich eine ausgesprochen dumme …«
Ein Knacken und Rascheln in ihrem Rücken, die sofort wieder erstarben, ließen Madison mitten im Satz abbrechen. Erschrocken sprang sie auf, fuhr herum und versuchte, das Dickicht der Heckenbüsche, das die kleine Pergola mit der Bank auf drei Seiten umschloss und zu einem fast intim abgeschiedenen Ort machte, mit ihrem Blick zu durchdringen.
Wurden sie belauscht?
Es gab genug Insassen aus dem dritten Stock, wo die ungefährlichen Fälle untergebracht waren, die sich so wie sie bei gutem Wetter auf dem Hinterhof der Anstalt mit diversen Ballspielen die Zeit vertreiben oder sich in den weitläufigen Parkanlagen frei bewegen durften.
»Ist da wer?«, rief Madison und das Blut rauschte in ihren Ohren. »Wer lauscht da? Wir wissen, dass du da bist! Wir haben dich genau gehört! Los, komm raus und zeig dich!« Ihr Blick flog mit nervöser Anspannung über die dichte Wand aus Buschwerk.
Schwester Audrey erhob sich nun auch schnell von der Bank, fasste sie an der Schulter und drehte sie sanft zu sich herum. »Madison, beruhige dich! Da ist niemand! Da krabbelt höchstens ein Vogel oder ein Hörnchen durch das Unterholz. Oder es war der Wind.«
»Das klang mir aber nicht so!«, widersprach Madison. Doch wie zur Bestätigung von Schwester Audrey fuhr im nächsten Moment ein kräftiger Windstoß über den Park hinweg. Er fegte weitere welke Blätter von den Bäumen, riss den Laubteppich auf den Kieswegen auf und fuhr kraftvoll in die Sträucher und Büsche, die sich mit lautem Rascheln beugten und wiegten.
»Das Wetter schlägt um, jetzt wird der Nebel nicht mehr lange auf sich warten lassen«, stellte Schwester Audrey mit einem bekümmerten Blick zum Himmel fest. Eine graue Wolkendecke hatte sich vor die blasse, kraftlose Oktobersonne geschoben. »Zum Glück ist ja deine Kutsche schon eingetroffen, sodass du noch rechtzeitig nach Hause kommst, bevor London mal wieder in dieser fürchterlichen Nebelsuppe versinkt.«
»Was? Joshua wartet schon mit der Kutsche auf mich?«, stieß Madison überrascht hervor. Was freute sie sich darauf, den schlaksigen Kutschersohn zu sehen. Er war der Einzige im Haus der Winslows, mit dem sie eine herzliche, wenn auch absolut unschickliche Freundschaft verband, sehr zum Ärgernis von Lady Winslow1.
»Oh, sieh es mir nach, dass ich bei der Aufregung ganz vergessen haben, dir das mitzuteilen! Dabei ist das doch der Grund, warum ich hier im Park Ausschau nach dir gehalten habe«, sagte Schwester Audrey. »Ob der Kutscher Joshua heißt, der sich übrigens schon um dein Gepäck kümmert, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis. Aber wichtiger, als wer da heute auf dem Kutschbock sitzt, ist dir doch jetzt bestimmt, dass eure Kutsche gekommen ist, um dich nach Hause zu bringen, nicht wahr?« Sie zwinkerte ihr zu und tätschelte sie an der Schulter.
»O ja!«, bekräftigte Madison aus ganzem Herzen und fügte in Gedanken wie ein inständiges Stoßgebet hinzu: »Nichts wie weg von hier!«
Denn auch wenn sie das Stadtpalais der Winslows am vornehmen Berkeley Square niemals als ihr Zuhause im tieferen Sinne des Wortes empfunden hatte und es zweifellos auch niemals als solches ansehen würde, so war das Leben dort im Vergleich zur beklemmenden Welt hier im Bedlam doch nahezu himmlisch.
Eines hatte sie in den vergangenen beiden Wochen gelernt, nämlich dies: Ebenso wie man in glücklichen und sorglosen Zeiten nie annehmen sollte, dass es immer so bleiben werde, so sollte man auch beim Sturz ins Unglück nie glauben, schon den tiefsten Punkt erreicht zu haben. Offensichtlich hatte das Leben viel entsetzlichere Abgründe zu bieten, als Madison es selbst in ihren finstersten Zeiten bisher für möglich gehalten hatte.
»Ach ja, auch deine Leona ist mit der Kutsche gekommen, um dich auf der Heimfahrt zu begleiten«, fügte Schwester Audrey noch hinzu, als sie aus der Pergola auf den Kiesweg traten.
Madison runzelte die Stirn. »Leona? Von welcher Leona reden Sie?«
»Nun, von deiner Zofe natürlich.«
»Welche Zofe?«, fragte Madison verständnislos. »Ich habe keine Zofe, habe noch nie eine gehabt!«
Nun war es an Schwester Audrey, ein verblüfftes Gesicht zu machen. »Wirklich?« Im nächsten Moment lachte sie unbekümmert. »Nun, freu dich, jetzt hast du offenbar eine! Jedenfalls ist diese Leona gekommen, um dich abzuholen und nach Hause zu begleiten«, sagte sie, hakte sich bei Madison ein und zog sie forschen Schrittes mit sich fort.
Aus einem spontanen Impuls heraus drehte sich Madison Augenblicke später noch einmal um und warf einen Blick zurück auf die kleine, von Buschhecken umwachsene Pergola mit der Bank. Sie stutzte, war ihr doch so, als könnte sie den Schatten einer Gestalt wahrnehmen, die hinter den hohen Sträuchern in den dunklen Schatten eines dahinterliegenden Schuppens für Gartengerätschaften huschte.
Doch hatte sie die schattenhafte Bewegung tatsächlich gesehen oder gehörte auch diese dahinhuschende Gestalt zu den Wahnbildern, die sie neuerdings selbst bei helllichtem Tag und vollem Bewusstsein verfolgten?
Ein kalter Schauer überlief sie.
5
Die prächtige neoklassizistische Fassade des lang gestreckten dreistöckigen Anstaltsgebäudes mit der himmelwärts strebenden Domkuppel über seinem Mitteltrakt war zur parallel verlaufenden, geschäftigen Lambeth Street hin ausgerichtet. Es war, als wollte das Bedlam sich vor der Welt, die dort jenseits der hohen Mauern und Eisengittern in Freiheit ihrer Wege ging, stolz in Szene setzen und sich von seiner besten Seite zeigen.
Ganz besonders selbstbewusst, ja geradezu pathetisch erhob sich das vorgesetzte Eingangsportal mit seiner langen aufsteigenden Treppenanlage, die einem königlichen Palast zur Ehre gereicht hätte. Sechs mächtige dorische Säulen ragten bis über den dritten Stock hinauf, um in luftiger Höhe einen tempelartigen Giebelaufsatz zu tragen.
»Wer noch nie vom Bedlam gehört hat, könnte von draußen meinen, hier eine Art Tempel oder Kathedrale zu betreten«, fuhr es Madison sarkastisch durch den Kopf, während sie mit Schwester Audrey auf den Westflügel der Anstalt zuhielt, der den weiblichen Insassen vorbehalten war. Im Ostflügel waren die Männer untergebracht. Aber hinter der prächtigen Fassade warteten weder Trost noch Aufrichtung, geschweige denn Rettung und Erlösung, sondern nur vollkommene Entmündigung – und die schaurigen Torturen eines Dr. Savage, der nichts unversucht ließ, um seinem Namen gerecht zu werden!
Madison litt noch immer unter einem dumpfen Schmerz hinter den Augen und massierte sich verstohlen die rechte Schläfe. Sie wusste aus Erfahrung, dass es noch einige Zeit dauern würde, bis sich der Schmerz gelegt hatte. Das traf auch auf das Gefühl körperlicher Mattigkeit zu, wenngleich dieses einiges länger brauchte, um gänzlich von ihr zu weichen.
Als die letzten Bäume der Allee hinter ihr zurückblieben, hielt sie kurz Ausschau nach Joshua und der königsblau lackierten Kutsche der Winslows mit deren prächtigem Wappen. Sie hatte jedoch keine freie Sicht auf den Platz vor dem Portal, was aber nicht allein an den Ziersträuchern lag, die zusammen mit sorgfältig gepflegten Blumenbeeten die Auffahrt schmückten. Es waren vielmehr einige vergitterte Ambulanzdroschken, die vermutlich dafür verwendet wurden, kriminelle Geistesgestörte ins Bedlam zu bringen, und die mit ihren hohen kastenartigen Aufbauten den Blick blockierten.
Kurz darauf betraten sie den Westflügel durch den Seiteneingang. Madison händigte dem Wärter an der Tür ihre blaue Karte aus, die einem Insassen der Anstalt das kostbare Privileg des Freigangs gewährte. Nur wem Dr. Savage oder Oberschwester Malvina solch einen Passierschein aushändigte und dessen Name auf den Listen der Türwärter stand, durfte das Gebäude ohne Beaufsichtigung verlassen und sich auf dem rückwärtigen Freizeithof sowie in den Parkanlagen frei bewegen.
Sie stiegen in den dritten Stock hinauf. Schrilles Kreischen, tierähnliches Heulen und das dumpfe Hämmern von Holz gegen Eisen drangen gedämpft zu ihnen ins breite Treppenhaus, als sie auf der ersten Etage am Zugang zu den dortigen Zellen und Gemeinschaftsräumen vorbeikamen.
In diesem Stockwerk wurden im West- wie im Ostflügel die tobsüchtigen und gewalttätigen Geistesgestörten gehalten, hinter schweren, stets verschlossenen Eichentüren und mehreren dahinterliegenden Sicherheitsgittern. Ähnliche, aber nicht ganz so strenge Sicherheitsmaßnahmen galten für die Patienten im zweiten Stock, weil auch sie unter Umständen eine Gefahr für sich oder andere darstellten. Nur wem Dr. Savage bescheinigte, ungefährlich zu sein und problemlos unter Kontrolle gehalten werden zu können, der kam nach oben in den dritten Stock und damit in den Genuss eines gewissen Maßes an Freiheit und Komfort.
Schwester Audrey seufzte leise im Vorbeigehen. »Diese armen verlorenen Seelen«, murmelte sie.
Madison schluckte hart, beschleunigte unwillkürlich ihre Schritte und fragte sich einmal mehr mit Schaudern, ob auch sie sich auf dem Weg in dieses grauenvolle geistige Niemandsland befand, in dem diese armen verlorenen Seelen herumirrten.
Nein! Nicht sie! Sie würde diese entsetzlichen Zustände, diese Episoden irgendwie unter Kontrolle bekommen, würde sich von ihnen befreien und wieder zu der Madison werden, die sie einmal gewesen war!
Zwar hatte sie nicht den Schimmer einer Ahnung, wie sie ein solches Wunder vollbringen sollte, aber diese Hoffnung aufzugeben hieße, vor dem Bösen zu kapitulieren und sich selbst aufzugeben. Und dazu war sie nicht bereit. »Ich darf nur nicht den Glauben verlieren und aufhören, dagegen anzukämpfen, dann wird der Tag der Erlösung schon kommen!«, machte sich Madison im Stillen selbst Mut, während sie die letzten Treppenstufen hinauf ins dritte Stockwerk hinter sich brachte. Kurz darauf bog sie mit Schwester Audrey an ihrer Seite in den langen Korridor ein, der sich vor ihnen erstreckte.
Baulich waren die Trakte auf allen drei Etagen gleich. Sowohl im Westflügel als auch im östlichen Trakt bestanden sie aus einer langen Galerie mit hoher, leicht gewölbter Decke. Während sich auf der einen Seite eine scheinbar endlose Kette von fast deckenhohen Rundbogenfenstern reihte, gingen auf der gegenüberliegenden Seite die Türen zu den kleinen und recht spartanisch eingerichteten Zellen ab. Jede Kammer verfügte neben einem gerahmten Bibelspruch über ein Bett, einen Stuhl, einen Kleiderschrank, eine Wäschekommode, einen winzigen Tisch und ein kleines Fenster, das viel zu hoch oben in der Wand eingelassen war, als dass man hätte hinaussehen können.
Die Galerie im dritten Stock bot den Augen jedoch einen erfreulicheren Anblick als die unter ihr liegenden Korridore. Ein gefälliger Teppich, wenn auch aus grob gewebter Meterware, in gedeckten Farben und mit einem geometrischen Muster, verlief in der Mitte des scheinbar endlos langen Dielenganges von einem Ende bis zum anderen. Neben den Fenstern standen bequeme Lehnstühle aus robustem Korb sowie hier und da kleine Beistelltische. Gerahmte handkolorierte Stiche von Blumen, Vögeln und idyllischen Landschaften schmückten die Wände, Grünpflanzen hingen in bunten Tontöpfen vor den Fenstern, und hier und da zwitscherten bunt gefiederte Wellensittiche und Zebrafinken in kleinen Vogelkäfigen. Und auf halber Länge kämpfte ein ansehnliches Kaminfeuer hinter einem eingehängten Gitter gegen das graue Licht des sich draußen rasch verdunkelnden Himmels. Alles in allem bot die Galerie einen Anblick, an dem es wenig auszusetzen gab, zumal in einer derartigen Anstalt.
Und doch schnürte es Madison augenblicklich die Kehle zu, als sie in den langen Gang trat und vor sich die Gestalten erblickte, die den Gang bevölkerten und mit denen sie zwei Wochen lang hatte leben müssen. Es waren Frauen jeden Alters, überwiegend ordentlich frisiert und in sauberer und schicklicher Kleidung, doch im Geist verwirrt.
Schon nach wenigen Schritten die Galerie hinunter umhüllte sie die ganz eigene und beklemmende Geräuschkulisse, die bei Tagesanbruch einsetzte und erst mit Einbruch der Nacht allmählich erstarb. Sie glich einer unablässigen Brandung, die anschwoll und wieder in sich zusammenfiel, nie jedoch ganz zum Stillstand kam. Sie setzte sich zusammen aus vielerlei Arten von unverständlichem Gebrabbel, grundlosem Lachen und Kichern, endlosen Selbstgesprächen, Summen ohne wiederzuerkennende Melodie, grotesken Ausrufen, inhaltlosen Wortwechseln, unaufhörlichen Wiederholungen weniger Worte, Gesprächen mit eingebildeten Personen, knackenden Fingerknöcheln, schniefenden Nasen, Schnalzen, Schmatzgeräuschen sowie dem Schlurfen und den Schritten jener Frauen, die immer in Bewegung sein mussten und den langen Korridor in einer ewigen und ziellosen Wanderung Tag für Tag auf und ab gingen.
Nach der frischen Luft im Park widerte Madison der Geruch, der zu allen Tages- und Nachtzeiten auf dem Gang wahrzunehmen war und auch die Zellen nicht verschonte, stärker denn je an. Es war eine abscheuliche Mischung aus Bohnerwachs, Mottenpulver, billigem Lavendelduft, Talkumpuder, Paraffin, Körperausdünstungen, Essensgerüchen und scharfen Reinigungsmitteln. Dieser Geruch legte sich ihr wie eine Bleiplatte auf die Brust und gab ihr das Gefühl, nur mit Mühe atmen zu können.
Was ihr aber viel mehr und jedes Mal aufs Neue zusetzte, ihr eine Gänsehaut über den Körper jagte und sich wie eine Zange um ihre Kehle legte, war, wie paradox es auch klingen mochte, die mit Händen zu greifende Einsamkeit, die über all den vielfältigen Geräuschen, dem an- und abschwellenden Stimmengewirr und den vielen Personen lag, die sich auf dem Flur aufhielten.
Diese unnatürliche Einsamkeit, die jede dieser Frauen wie einen undurchdringbaren Kokon zu umschließen schien, machte für sie die wahre und erdrückende Atmosphäre auf der Galerie aus.
»Nirgendwo ist die Einsamkeit vollkommener als an einem Ort wie diesem!«, fuhr es Madison voller Schaudern durch den Kopf, und sie wäre am liebsten davongestürzt, um endlich all dem zu entkommen, was sich vor ihr auf der Galerie abspielte. Da war die grauhaarige Jane, die neben der Tür zum Gesellschaftsraum an einem alten ausrangierten Piano saß und mit verzückter Miene Klavier spielte. Die Notenblätter vor ihr standen wie üblich auf dem Kopf, und die Tasten gaben nur ein leises Klappern von sich, weil die Hämmerchen auf keine Saiten trafen, sondern im Resonanzkasten ins Leere schlugen.
Neben ihr im Lehnstuhl malte die achtzehnjährige Isabella eines ihrer ewig gleichen weißen Kreis- und Kringelbilder. Ihre Hand mit der Kreide fuhr qualvoll langsam, aber pausenlos Stunde für Stunde auf der Schiefertafel im Kreis herum, oft genug, ohne hinzugucken. War die Tafel mit Lagen weißer Kreide bedeckt, wischte eine Schwester sie mit einem Schwamm sauber, und Isabella begann von Neuem, Kreise und Kringel zu malen.
Die dicke Pamela spielte mit verzückter Miene vor einem unsichtbaren Publikum auf einer unsichtbaren Geige und verneigte sich alle paar Minuten in alle Richtungen, als umbrandete sie tosender Applaus.
Florence, ihre Zellennachbarin, die sich für die französische Königin Marie Antoinette hielt, ließ sich auf ihrem letzten Gang nicht beirren: Sie schritt hocherhobenen Hauptes und mit kalter Verachtung für die sie angeblich begleitenden Jakobiner zu ihrer öffentlichen Hinrichtung, und diesen Gang aufs Schafott trat sie seit Jahren täglich unzählige Male an. Hinter ihr ritt die schieläugige Rosanna auf einem eingebildeten Steckenpferd.
Und da waren die kleinwüchsige Frau, deren Namen Madison entfallen war und die mit dem Gesicht zur Wand am Boden kniete und unablässig stumm betete; das fast kahlköpfige fünfzehnjährige Mädchen namens Nancy, das leise summend durch die Galerie tänzelte und sich ein restliches Haar nach dem anderen ausriss; die blonde Schönheit Claire, die auf ihren rastlosen Wanderungen über den Gang nie von den Linien des Teppichs wich und einen hysterischen Anfall bekam, wenn man ihr nicht den Weg frei machte; da waren auch die beiden alten Witwen Agnes und Deborah in schwarzem Taft, die vor dem Gitterrost des Kamins standen, jede in das Gespräch mit einem anderen längst Verstorbenen vertieft, während der rote Schein des Feuers über ihre verhärmten, faltenreichen Züge zuckte.
Weiter unten gingen zwei andere Frauen Arm in Arm, die sich für Schwestern hielten, sich aber vor ihrer Einlieferung nie zuvor begegnet waren, und erfanden eine gemeinsame Vergangenheit. Und noch so viele andere von den mehr als sechzig Patientinnen, die auf dieser Etage untergebracht waren, hielten sich auf der Galerie auf, und von den meisten kannte sie weder den Namen noch die Umstände, die sie ins Bedlam gebracht hatten.
Aber wohin Madison auf dem Gang auch schaute, ihr Blick fiel fast überall auf Gesichter mit stumpfen, glanzlosen Augen, die durch sie hindurch und in eine endlose, unerreichbare Ferne starrten.
Hatte auch auf ihrem Gesicht ein ähnlicher Ausdruck der Verlorenheit gestanden, als Schwester Audrey sie vorhin wenige Schritte vor dem Teich gepackt und mit ihrer schallenden Ohrfeige aus dem Bann des Bösen gerissen hatte?
Madison spürte kalten Schweiß auf ihrer Stirn, und ihr war, als würde sie kaum noch Luft kriegen. Alles schrie in ihr danach, wegzulaufen. Aber sie ging weiter und zwang sich, nicht hektisch und flach zu atmen. Sie durfte sich nicht anmerken lassen, dass sie innerlich am Rand einer Panik stand! Sie musste nur noch wenige Minuten durchhalten, dann hatte sie es geschafft und ihre Freiheit zurückgewonnen!
6
»Das da ist sie, Miss Mayfield«, sagte Schwester Audrey vernehmlich, als sie gut ein Drittel der Galerie hinuntergegangen waren, und machte hier, in Hörweite anderer Schwestern, nun wieder von der korrekten Anrede Gebrauch. »Ihre Zofe Leona Shaw, die gekommen ist, um Sie abzuholen!« Dabei deutete sie auf die junge Frau, die neben der Tür von Madisons Zelle in einem Korbstuhl saß. Dass sie weder zum Personal gehörte noch eine neu eingelieferte Patientin sein konnte, sah ihr Madison sofort an.
Die fremde Frau, die Lady Winslow ihr geschickt hatte, mochte nur vier, fünf Jahre älter sein als sie. Sie trug ein hochgeschlossenes moosgrünes Kleid mit einem dezenten schwarzen Rankenmuster. Es war etwas altmodisch, schmucklos und machte nicht viel her, war jedoch aus einem guten Stoff geschneidert. Ihr Haar, dicht und sanft gewellt, war so tiefschwarz wie das Gefieder der Raben im Park und schlicht nach hinten frisiert. Es endete in einem kurzen Zopf mit einer unauffälligen schwarzen Samtschleife.
Ihre aufrechte und ungewöhnlich steife Haltung auf der Kante des Sitzes verriet ihre Anspannung angesichts der vielen geistig verwirrten Personen, von denen sie sich umgeben sah. Ihrem Gesicht, dem bei aller Ebenmäßigkeit der Züge eine etwas herbe Note anhaftete, war jedoch weder Verstörung noch Angst anzusehen. In ihren rauchgrauen Augen stand ein wachsamer Ausdruck, als registrierte sie jede Bewegung um sich herum und als wäre sie bereit, jederzeit blitzschnell auf eine veränderte, möglicherweise gefährliche Situation zu reagieren.
Leona Shaw hatte in ihre Richtung geblickt und mitbekommen, was Schwester Audrey beim Näherkommen zu Madison gesagt hatte. Sie erhob sich nun sofort und offenbarte, dass sie gut einen halben Kopf größer als Madison war. Sie besaß eine schlanke Gestalt und eine sehr gerade Haltung, aber ins Auge fallende weibliche Rundungen und Reize suchte man an ihrer Figur vergeblich.
Sie nickte Madison mit der Andeutung eines Lächelns zu und sagte dann an Audrey Young gerichtet und mit erstaunlich kräftiger Stimme: »Sie entschuldigen, dass ich Sie korrigiere, Schwester, aber ich bin nicht Miss Mayfields Zofe, sondern, wie ich vorhin schon sagte, hat mich Lady Winslow als …« Weiter kam sie nicht.
»Pardon, ich bitte um Nachsicht, Miss Shaw. Sie sind natürlich ihre Gouvernante«, fiel Schwester Audrey ihr hastig ins Wort, leicht peinlich berührt über das Fettnäpfchen, in das sie getreten war, bestand doch ein erheblicher Unterschied zwischen der gesellschaftlichen Stellung einer Zofe und der einer Gouvernante, auch wenn beide zu den Bediensteten der Winslows gehörten.
»Meine Aufgaben mögen sich gelegentlich mit denen einer Zofe und einer Gouvernante überschneiden, aber ich bin weder das eine noch das andere«, widersprach Leona erneut freundlich, aber auf Korrektheit bedacht. »Ich bin Miss Mayfields Gesellschafterin.« Und mit einer ehrerbietigen Neigung des Kopfes in Richtung von Madison fügte sie einschränkend hinzu: »Vorausgesetzt natürlich, dass Miss Mayfield Gefallen an meiner Person und der Ausübung meiner Dienste findet.«
Überrascht sah Madison sie an. Lady Winslow, die ihr bisher noch nicht einmal die Zofe ihrer Töchter gelegentlich zur Aushilfe zugestanden hatte, war plötzlich in sich gegangen und hatte für sie eine Gesellschafterin eingestellt? Warum? Und warum ausgerechnet jetzt? Was steckte hinter ihrer scheinbaren Großzügigkeit? Es war doch sonst nicht ihre Art, sich ihr herzlich zugeneigt zu zeigen und darum bemüht zu sein, dass sie sich im Haus am Berkeley Square als willkommener Teil der Familie fühlen durfte. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hatte sie doch eher das genaue Gegenteil verfolgt.
Aber schon im nächsten Moment regte sich in Madison eine erste Ahnung, was Lady Winslow bezweckte. Und ihre Vermutung war weit davon entfernt, bei Lady Winslow einen unverhofften Ausbruch von Fürsorge anzunehmen.
»Gewiss, gewiss, ganz wie Sie sagen«, murmelte Schwester Audrey indessen, sie war schon gar nicht mehr bei der Sache, galt ihre Aufmerksamkeit doch längst Oberschwester Malvina. Die stämmige, matronenhafte Herrscherin über den Frauentrakt, die das breite Kreuz eines Lastenträgers und die Kommandostimme eines Sergeanten besaß, kam mit unziemlich weit ausgreifenden Schritten und dabei laut um die Beine schlagenden Stoffbahnen den langen Korridor hochgestürmt, den zornig funkelnden Blick auf sie gerichtet.
»Schwester Audrey, wo zum Teufel haben Sie die ganze Zeit gesteckt, während wir Sie hier dringend brauchten?«, donnerte Oberschwester Malvina schon aus mehreren Schritten Entfernung.
»Gütiger Gott, was ist denn geschehen?«, entfuhr es Schwester Audrey erschrocken.
Das knochige, fast kahlköpfige Mädchen kam an ihnen vorbei und antwortete unter kindlichem Kichern: »Was? Noch nicht gehört? Die dicke Sally hat die Ophelia gemacht.« Sie riss sich eines ihrer wenigen restlichen Haare aus, wedelte es wie eine Trophäe durch die Luft und tänzelte kichernd weiter.
»Um Gottes willen!« Schwester Audrey wurde blass wie eine frisch gekalkte Wand, schlug die Hand vor den Mund und eilte Oberschwester Malvina entgegen, als könnte jeder Schritt, den sie auf sie zumachte, den Zorn ihrer strengen Vorgesetzten ein wenig mildern.
Sichtlich verstört blickte Leona Shaw zwischen den beiden Schwestern und dem fast kahlköpfigen, dahintänzelnden Mädchen hin und her und sah dann Madison an.
Madison ignorierte den fragenden Blick. Sie wusste nicht, was sie von der Fremden halten sollte und ob es ihr überhaupt gefiel, nun plötzlich eine Gesellschafterin zu haben. Aber all das interessierte sie im Augenblick nicht wirklich. Darüber würde sie sich später Gedanken machen.
»Hat Joshua schon all mein Gepäck geholt?«, fragte sie fast barsch und ohne jede Begrüßung.
»Joshua?«
»Der Kutscher!« Madison gab sich keine Mühe, ihre Ungeduld und ihr Missfallen zu verbergen. Was kümmerte es sie, was diese Leona Shaw von ihr hielt. Sie wollte weg von hier, und das so schnell wie möglich. Nichts anderes war von Bedeutung. Denn jede Sekunde länger in dieser Anstalt war ihr eine Qual.
»Ja, bis auf Ihren Umhang und die Gobelintasche mit Ihren persönlichen Dingen, Miss Mayfield«, antwortete Leona Shaw und deutete durch die offen stehende Tür auf die kleine bauchige Reisetasche, die auf dem Tisch stand.
»Wusste gar nicht, dass die anderen Sachen zu meinen unpersönlichen Dingen gehören«, erwiderte Madison, trat an ihr vorbei und griff nach dem Cape. Schnell warf sie es sich über die Schultern, bevor Leona Shaw Zeit hatte, ihr zur Hand zu gehen. Ebenso hektisch nahm sie die kleine Reisetasche an sich, wirbelte herum, stürzte wieder aus der Zelle und forderte ihre Gesellschafterin über die Schulter hinweg knapp und schroff auf: »Worauf warten Sie? Gehen wir!« Leona Shaw folgte ihr schweigend.
»Seit wann wissen Sie, dass Sie auf mich aufpassen sollen?«, fragte Madison im Treppenhaus mit beißendem Spott.
»Von Aufpassen war nicht die Rede, als ich mich heute Morgen Ihrer Mutter vorgestellt habe und mich …«
»Meiner Mutter haben Sie sich bestimmt nicht vorgestellt!«, fiel Madison ihr scharf ins Wort. »Das hätten Sie nicht einmal mit einem Gang zum Friedhof bewerkstelligen können!«
»Entschuldigen Sie!«, sagte Leona Shaw hastig und errötete leicht unter der harschen Zurechtweisung. »Ich meine Lady Winslow …«
»… die nach dem Gesetz meine Tante ist und vor ihren Bekannten die Rolle der geplagten, aber wohlmeinenden und tapferen Verwandten spielt, und dieses Schmierenstück spielt sie sogar ausgesprochen gut«, schnitt Madison ihr erneut das Wort ab. »Und? Aufgrund welcher besonderen Befähigungen hat Lady Winslow Sie eingestellt? Haben Sie Erfahrungen mit Geisteskranken?«
Leona Shaw machte ein betroffenes Gesicht. »Nein, aber so, wie ich Lady Winslow verstanden habe …«
Wieder ließ Madison sie nicht ausreden. »Nun, dann werden Sie jetzt welche machen, sofern Sie die Nerven und den Magen dafür haben, Miss Shaw!«, sagte sie und wünschte schon im nächsten Moment, sie könnte ihre Worte zurücknehmen. Diese Gemeinheit hatte die Frau nicht verdient, auch wenn Madison nichts mit ihr zu schaffen haben wollte und sie am liebsten auf der Stelle weggeschickt hätte.
Sie biss sich auf die Lippen. Sie war nicht verrückt und gehörte schon gar nicht in solch eine Anstalt! Also warum redete sie solch einen haarsträubenden Unsinn? Nur um diese »Gesellschafterin« zu erschrecken, auf dass sie möglichst bald kündigte?
Von Leona Shaw kam keine Erwiderung. Sie schwieg, sei es aus Bestürzung oder aus Höflichkeit.
Unten angekommen, passierten sie die Sicherheitskontrollen. Als sie kurz darauf durch die weitläufige Eingangshalle auf den Ausgang zuschritten, bemerkte Madison, dass Leona Shaws Blick auf zwei verwitterte Steinskulpturen in einer großen Wandnische fiel. Sie stellten zwei muskulöse, nackte Männer mit kahl geschorenen Köpfen dar. Die Handgelenke der rechten Skulptur waren mit einer schweren Fessel aneinandergekettet. Der Kopf war seitlich geneigt und halb in den Nacken gelegt und der steinerne Mund in einem endlosen stummen Schrei der Verzweiflung geöffnet.
Madison blieb vor den Figuren stehen. »Das sind die hirnlosen Brüder«, erklärte sie, bevor ihre Gesellschafterin danach fragen konnte.
»Die hirnlosen Brüder?«, echote Leona Shaw sichtlich beklommen.
»Ja, ihre Namen sind Mania und Dementia. Sie sollen den delirierenden und den melancholischen Wahnsinn darstellen, habe ich mir sagen lassen. Früher standen sie mal draußen über dem Eingang, wohl als Warnung vor dem Schrecken, der hier hinter dem Tor lauert. Bruder Wahnsinn ist übrigens der mit der Kette«, erklärte Madison und ging schnell weiter.
Leona Shaw blieb an ihrer Seite, ließ einige Sekunden verstreichen und sagte dann etwas zögerlich: »Darf ich Sie etwas fragen?«
Madison zuckte die Achseln.
»Was hat dieses Mädchen gemeint, als es sagte, die dicke Sally habe die Ophelia gemacht?«
Madison warf ihr einen spöttischen Blick zu. »Schon mal was von Shakespeare gelesen?«, fragte sie spitz. »Steht nämlich alles im Hamlet.«
Leona Shaw schluckte. »Oh, das ist gemeint! Dann hat sich diese Sally also …?« Sie stockte.
»… ertränkt?«, vollendete Madison den Satz für sie und fügte hinzu: »Ja, hat sie offenbar, aber nicht in einem Fluss, sondern wohl eher im Bad oder in der Waschküche. Soll gar nicht so selten sein, dass hier eine ›die Ophelia macht‹. Kommt sogar mehrmals im Jahr vor, habe ich mir sagen lassen. Wäre also fast ein Modell für eine dritte Steinskulptur, finden Sie nicht auch?« Sie wusste, dass sie schon wieder gemein und gefühllos klang und Leona Shaw nichts getan hatte, womit sie ihre Grobheiten verdient hätte, aber sie konnte nicht dagegen an.
»Ich muss Sie noch etwas fragen«, sagte Leona Shaw Augenblicke später, als sie aus dem Schatten des hohen Säulenportals traten und die breite Treppenanlage zu den wartenden Kutschen hinuntergingen.
»Wenn Sie das müssen, will ich Sie nicht daran hindern«, erwiderte Madison und hielt Ausschau nach Joshua und der Kutsche der Winslows.
Aber zu ihrer großen Enttäuschung, die sogleich eine dunkle Ahnung in ihr weckte, standen dort unten nur eine gewöhnliche Hackney-Mietdroschke, eine zweiachsige Kutsche mit dem Kutschbock vor der geschlossenen Kabine, in der bis zu sechs Fahrgäste Platz finden konnten, sowie ein nicht weniger gewöhnlicher einachsiger Hansom Cab, der nur zwei Personen transportieren konnte. Beim Hansom, der billiger als ein Hackney und auch wegen seiner besonderen Wendigkeit zu Tausenden auf den Straßen Londons anzutreffen war, gab es nach vorn hin keine schützende Wand. Der Fahrgastraum mit der zweisitzigen Bank war vielmehr nach vorne hin offen. Auch saß hier der Kutscher nicht vor den Fahrgästen, sondern lenkte das Gefährt von einem Sitz aus, der hoch oben an der Hinterwand des Gefährts angebracht war, sodass der Kutscher halb über den schwarz lackierten Kasten hinausragte und die Zügel über das Dach laufen lassen konnte. Auf den Schmalseiten der Kabine waren unterhalb der Droschkenlaternen verglaste Fenster in die Seitenwände eingelassen.
»Wie möchten Sie, dass ich Sie anrede, Miss Mayfield?«, erkundigte sich Leona Shaw vorsichtig und steuerte dabei auf den offenen, zweirädrigen Hansom zu.
Madison zögerte kurz. Ihre Freundinnen in Brighton hatten sie ausnahmslos Maddie genannt. Aber den Namen hatte sie schon seit Langem nicht mehr gehört, zumindest nicht in der Koseform, weil sie schlichtweg keine Freundinnen mehr hatte. Und wenn ihre Cousinen Alisha und Cora einmal den Namen Maddie in den Mund nahmen, dann nur mit der Absicht, sie zu verletzen. Denn nichts klang ihrer Ansicht nach besser als die Alliteration mad Maddie, und genau das war sie für die beiden ja auch – die verrückte Maddie!
Vielleicht wäre das Leben im Winslow House eine Spur erträglicher gewesen, wenn Archibald, der drei Jahre ältere Bruder der Zwillinge, mit ihnen im Haus am Berkeley Square gelebt hätte. Archibald hatte sich nie an den Bösartigkeiten seiner Schwestern beteiligt, sondern hatte Madison vielmehr vor ihnen beschützt und sich ihr gegenüber immer ausgesprochen liebenswürdig verhalten. Aber Sir Edwards Sohn und Erbe ließ sich nur noch selten im Elternhaus blicken. Nach Jahren in Eton studierte er nun in Cambridge – sofern man das Studieren nennen konnte. Nach dem, was Madison von der Dienerschaft aufgeschnappt hatte, verbrachte Archibald mehr Zeit mit diversen Vergnügungen und romantischen Affären als mit dem Studium der Jurisprudenz. Auch war immer wieder die Rede von hohen Spiel- und damit Ehrenschulden, die Sir Edward in aller Eile begleichen musste, um einen Skandal zu vermeiden.
Leona Shaw wartete noch immer auf eine Antwort, als sie schon beim Hansom Cab angelangt waren.
Als der Kutscher zum Gruß nachlässig mit den Fingerknöcheln gegen die Krempe seines hohen schwarzen Hutes tippte und die Trittstufe herunterklappte, erinnerte sich Madison wieder ihrer Frage. Sie wandte sich kurz ihrer Gesellschafterin zu.
»Belassen wir es doch erst einmal bei Miss Shaw und Miss Mayfield!«, sagte sie mit einem reservierten, kühlen Lächeln und stieg in den Hansom.
7
Kies knirschte unter den eisenbeschlagenen Rädern, als der Einspänner sich mit einem Ruck in Bewegung setzte und vom Gelände der Anstalt rollte. Augenblicke später ratterten sie über die geschäftige Lambeth Street nach Westen und das Bethlehem Lunatic Asylum fiel mit seinen hohen Mauern und Eisengittern schnell hinter ihnen zurück.
Erlöst, dem schrecklichen Ort entkommen zu sein, sank Madison in die rissigen Lederpolster des Hansom. Der beklemmende Druck, der sie in den vergangenen Wochen zu keiner Stunde verlassen hatte, wich von ihr. Nun hatte sie das Gefühl, endlich wieder frei atmen zu können. Dass die Luft vom Rauch unzähliger Schornsteine einen bitteren Beigeschmack von Ruß, Schwefel und Kohlengas in sich trug, nahm sie als kleineres Übel in Kauf.
Außerdem war die Luftqualität zu dieser frühen Nachmittagsstunde für Londoner Verhältnisse noch recht erträglich, obwohl auch jetzt schon über den Dächern der Stadt schier endlose Wolken übler Schwaden aus den zahllosen Schloten quollen. Dies war jedoch nichts im Vergleich zu dem dichten beißenden Rauch, den die Schornsteine mit Einbruch der Dunkelheit ausstießen, wenn überall in den Küchen und Wohnzimmern die Kohlenfeuer aufloderten. Und dann wartete meist auch schon der feuchte Nebel von den Flussniederungen darauf, sich mit dem Rauch all dieser Feuerstellen zu einem giftig gelben Smog zu verbinden, der in den Augen brannte und die Sicht nicht selten auf nur ein, zwei Schritte begrenzte.
Madisons Freude darüber, ihre Freiheit wiedererlangt zu haben, hielt jedoch nicht lange. Noch bevor sie die Themse erreichten und den Fluss über die Lambeth Bridge überquerten, gewannen die alten Kümmernisse und Ängste in ihr wieder die Oberhand. Sie sah nicht den dichten Strom aus Kutschen, Fuhrwerken, Karren und Fußgängern aus fast allen gesellschaftlichen Schichten, der sich wie träge fließender Teer über die Brücke wälzte. Ihr Blick ging ebenso durch den von Pferden gezogenen, voll besetzten Omnibus hindurch, der vor ihnen über das Pflaster rumpelte und dessen schmale, in Fahrtrichtung verlaufende Sitzbank auf dem Dach sogar noch bis auf den letzten Platz besetzt war. Und sie nahm auch nicht die vielen Dampfbarkassen, Frachtkähne, Fischerboote, Raddampfer, Fährschiffe und all die anderen Boote und Segelschiffe wahr, die unter der Brücke in allen Richtungen ihre Bahn durch die dunklen Fluten der breiten Themse zogen und es in dem Gewimmel wundersamerweise fertigbrachten, eine Kollision mit anderen Flussschiffen zu vermeiden. Ein Kunststück, das durch die Rauchwolken der Dampfer und die ersten jetzt schon über das Wasser ziehenden Nebelschleier zunehmend erschwert wurde.
Madison rechnete damit, dass ihre Gesellschafterin versucht sein würde, sie aus ihrem dumpf brütenden Schweigen zu reißen und in ein Gespräch zu verwickeln. Sie wappnete sich schon dagegen und hatte für diesen Fall eine scharfe Zurechtweisung auf der Zunge, mit der sie die Frau sofort wieder zum Verstummen bringen und in ihre Schranken weisen würde.
Doch Leona Shaw besaß offenbar ein feines Gespür dafür, dass sie mit solch einem Versuch keinem von ihnen einen Gefallen tun würde, am allerwenigsten sich selbst. Und dass sie ihr abweisendes, ja geradezu finsteres Schweigen respektierte, nötigte Madison nun ihrerseits einen gewissen Respekt ab. Ihre unerbetene Gesellschafterin saß still neben ihr und zeigte sich nicht im Geringsten unbehaglich oder gekränkt.
Auf der Nordseite der Themse schlug die einachsige Kutsche einen Bogen um die City. Dort wären sie zu dieser Stunde im erdrückend dichten Verkehr unweigerlich stecken geblieben und bestenfalls nur noch im Schritttempo vorangekommen. Der Kutscher suchte sich seinen Weg ins vornehme Viertel von Mayfair durch die weniger verstopften Seitenstraßen von Pimlico, folgte hinter dem Hyde Park der breiten Park Lane nach Norden und bog auf halber Höhe rechts in die Mount Street ab, die sie wenige Minuten später zum Berkeley Square brachte.
Madison fuhr aus ihren trüben Gedanken auf, als die Kutsche in den Platz einbog und die gigantischen Platanen mit ihren glatten, gesprenkelten Stämmen vor ihr in den rauchgrauen Himmel aufragten. Der Anblick dieser stattlichen, mehr als hundert Jahre alten Bäume, die die ovale Parkanlage im Herzen des Berkeley Square beherrschten, hatte merkwürdigerweise eine tröstliche Wirkung auf sie.
Die Platanen, an deren schwarzen Zweigen nur noch wenig welkes Blattwerk hing, erschienen ihr wie stolze, stumme Wächter, die sich von der steinernen Pracht und Arroganz der sie umgebenden feudalen Residenzen nicht beeindrucken ließen. Und vielleicht deshalb war dieses Bild Balsam für ihre gequälte Seele.
Mayfair galt als das teuerste und eleganteste Wohnviertel von London. Hier im West End der Stadt konzentrierten sich die vornehmen Stadtpalais und feudalen Herrschaftssitze mit ihren schier endlosen Zimmerfluchten und prunkvollen Gesellschaftsräumen sowie die nicht weniger exklusiven Herrenclubs der Aristokratie und des hohen Landadels wie nirgendwo sonst. Viele dieser Stadtpalais verfügten noch immer über eigene rückwärtige Stall- und Remisenhöfe.