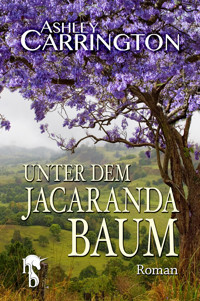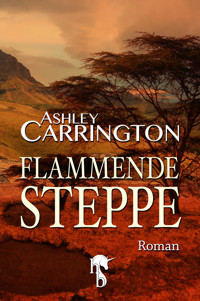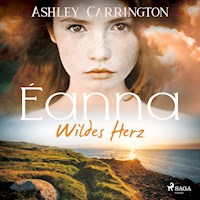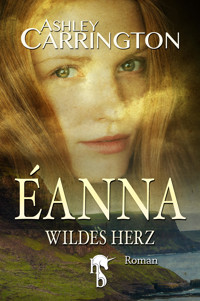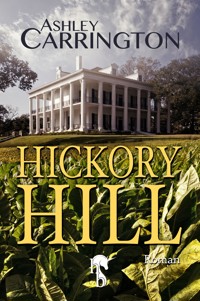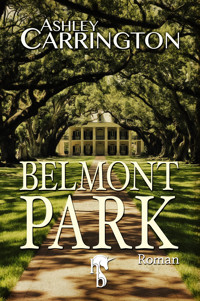6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Australien zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Nach dem Tod ihrer Eltern kämpft Lena Seewald um ihr Zuhause, das Weingut Maralinga im Barossa-Tal. Lena muss sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern, die Weinreben stehen schlecht und ihre reichen Nachbarn drängen sie zum Verkauf des Weinguts. Trotz aller Sorgen und Nöte gelingt es Lena, die Familie zusammenzuhalten. Aber als der Erste Weltkrieg ausbricht, werden die deutschstämmigen Seewalds plötzlich zu feindlichen Ausländern. Und Maralinga ist erneut gefährdet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ashley Carrington
Maralinga
Roman
In LiebeFür Axel, Elisaund Anna-Katharina Schröder
»… Aber sprachlos war unsere Liebe und mit Schleiern umhüllt. Nun aber ruft sie laut zu dir und möchte unverhüllt vor dir stehen. Und von jeher war es so, dass die Liebe erst in der Stunde der Trennung ihre eigene Tiefe erkennt …«
Der Prophet,
Khalil Gibran
1
Am Tag der Tragödie erwachte Schwester Lena, lange bevor die kleine Klosterglocke mit ihrem hellen Klang dem Konvent kurz vor vier Uhr das Ende der Nacht verkündete und zum frühmorgendlichen Chorgebet in die Klosterkirche rief.
Die warme Sommerluft, die durch die weit geöffneten Fenster in den kleinen Schlafsaal drang, war erfüllt vom intensiven Duft des wilden Jasmin, der unten an der Klostermauer eine lange Hecke bildete und noch immer in voller Blüte stand. Das frische Menthol-Aroma der hohen und immergrünen Eukalyptus-Bäume, die den Konvent der Sisters of the Sacred Heart in den Hügelketten östlich von Adelaide mit einem breiten, schattenspendenden Gürtel umschlossen, vermochte auf dieser Seite der Anlage gegen die manchmal fast schon betäubende Schwere der Jasmin-Sträucher nichts auszurichten.
Schwester Lena bekreuzigte sich, sowie die Schläfrigkeit von ihr abfiel, und sprach leise ihr morgendliches Dankgebet: »Herr, ich danke Dir für den neuen Tag, den Du mir schenkst. Befreie mich von den falschen Bindungen an das Irdische und mache mich empfänglich für die Gaben des Himmels. Lass mich mit jedem Tag bewusster in Deiner Gegenwart leben und bleibe mir allzeit nahe mit Deinem Erbarmen. Darum bitte ich durch Christus, unseren Herrn. Amen.«
Dann schlug sie das dünne Laken zurück, setzte sich auf, streckte sich und blieb einen Augenblick auf der harten Bettkante sitzen, während sie in die jasminschwere Dunkelheit lauschte. Deutlich hörte sie den regelmäßigen Atem der drei anderen jungen Frauen, mit denen sie den Raum über dem Refektorium teilte. Schwester Emily und Schwester Bridget, die beiden Postulantinnen, lebten erst seit wenigen Monaten im Kloster, und Schwester Angela, die wie sie selbst kurz vor dem Ende ihres Noviziats stand und mit ihr der ersten Profess, dem zunächst zeitlich begrenzten Ordensgelübde, entgegenfieberte, erwachte nie frühzeitig. Die kleine, etwas pummelige Frau besaß zudem die segensreiche Gabe, sich von einem Augenblick zum anderen in tiefen Schlaf fallen lassen zu können, wann immer sich ihr die Möglichkeit zu einem Nickerchen bot. Für eine Nonne, die in einem kontemplativen Orden nach der benediktinischen Regel lebte, bedeutete solch eine Gabe ein wahres Geschenk Gottes. Denn das Offizium, das Lob Gottes, mit seinen festgelegten Gebetszeiten beherrschte nicht nur weitgehend den Tag, sondern verkürzte auch den Nachtschlaf ganz erheblich.
Mit nackten Füßen huschte Schwester Lena über den rauen Steinboden in den angrenzenden Waschraum. In den gottlob nur kurzen Wintermonaten ging oft eine durchdringende Kälte von den Fliesen aus. Doch jetzt, in der zweiten Februarhälfte, spürten ihre Fußsohlen nicht einmal mehr die Ahnung von Kühle. Dabei beugte sich der Hochsommer nach hitzeflirrenden Monaten nun doch den milderen Temperaturen des herannahenden Herbstes.
Das Wasser, das Schwester Lena aus dem bauchigen Steinkrug in die Waschschüssel goss und mit den Händen zum Gesicht führte, war so warm wie die Luft und brachte wenig Erfrischung. Ohne sich abzutrocknen, kehrte sie in den kleinen Schlafsaal zurück. Leise schlüpfte sie in ihr Ordensgewand, schloss die lange Knopfleiste, schlüpfte in ihre Sandalen und setzte die gestärkte Haube auf. Mit raschen, längst zur Routine gewordenen Handgriffen richtete sie das lange Schultertuch der Haube und vergewisserte sich, dass auch nicht eine einzige Strähne ihrer kurzen blonden Locken am Rand hervorlugte. Nachlässigkeiten dieser Art hatten unweigerlich einen Tadel der Mutter Oberin zur Folge; Mutter Laurentia führte den Konvent der Sisters of the Sacred Heart mit äußerst strenger Hand, was diese Dinge betraf. Und das war auch gut so, erwies sich das Fleisch doch nur allzu oft als erschreckend schwach und leicht geneigt, der Versuchung nachzugeben.
Schwester Lena nahm vom Nachttisch das ledergebundene Stundenbuch, das ihre Mutter ihr am Vorabend ihres Eintritts ins Kloster geschenkt hatte, und verließ den Schlafsaal, ohne eine ihrer jungen, fest schlafenden Mitschwestern zu stören. Die Dunkelheit in den langen Gängen und auf der Treppe machte ihr nichts mehr aus; sie bewegte sich, ohne zu zaudern. Nach drei Jahren fand sie sich im Kloster notfalls auch mit verbundenen Augen zurecht.
Der Kreuzgang, der zu allen Zeiten eine besondere Faszination auf sie ausübte, schien sie wie ein guter Freund mit seinem tiefen, friedvollen Schweigen zu begrüßen. Wie viele Stunden hatte sie hier schon im Gebet und in stiller Betrachtung verbracht! Diesen Ort würde sie ihr Leben lang lieben, dessen war sie sich gewiss.
Die von Säulen getragenen Rundbögen wirkten vor dem etwas helleren Innenhof wie die Silhouetten schwarzer Scherenschnitte. Leise knirschte der Sand unter ihren Sandalen, als sie sich hinaus in den vom Kreuzgang umschlossenen Hof begab, dessen üppige Blumenpracht und Fülle von blühenden Sträuchern das Werk von Schwester Apollonia war.
Schwester Lena setzte sich auf eine der Bänke und genoss eine Weile die stille Morgenstunde. Der neue Tag war nicht mehr fern. Der Himmel über ihr verlor schon seine samtene Schwärze, und mit ihr verblasste auch das Funkeln der Sterne. Sie verspürte auf einmal den Wunsch, hier bis zum Sonnenaufgang sitzen zu bleiben und zuzusehen, wie die ersten Wogen goldenen Lichtes den Himmel eroberten, über das Dach des Konvents fluteten, schließlich in den Innenhof des Kreuzgangs herabfielen und sich mit leuchtender Kraft über die Blumenpracht ergossen.
Sie schalt sich jedoch sofort für diesen törichten Gedanken, den man wohl einer jungen, unreifen Postulantin nachsehen konnte, nicht jedoch einer Novizin wie ihr, die in wenigen Wochen die Profess ablegen wollte. Wie konnte sich in ihr bloß der Wunsch regen, das Gotteslob im Kreise ihrer Mitschwestern für ein verträumtes Stündchen im Innenhof eintauschen zu wollen! Für diesen Moment der Schwäche musste sie Abbitte leisten.
Schnell erhob sie sich von der Bank und begab sich in die Gnadenkapelle, in der neben dem ewigen Licht zwei Kerzen vor dem Marienaltar brannten. Sie kniete nieder, nahm ihren Rosenkranz zur Hand und versenkte sich mühelos in das vertraute Gebet.
Kurz vor vier Uhr schlug die Glocke auf dem Dach des Wohntraktes und rief die Nonnen zum Chorgebet. Schwester Lena nahm in der Klosterkirche auf der Nonnenempore, die ein gutes Stück in das Kirchenschiff hineinragte, ihren angestammten Platz im Chorgestühl ein. Als der Gesang der versammelten Kommunität nicht nur bis in den entferntesten Winkel des Gotteshauses drang, sondern Schwester Lena auch im Innersten bis in die letzte Faser erfüllte, konnte sie über ihren Moment der Schwäche nur noch lächeln. Nichts vermochte dieses Gefühl der Hingabe und Erfüllung zu übertreffen, mit dem sie hier im Kloster täglich aufs Neue beschenkt wurde.
Und als später beim feierlichen Hochamt helles Sonnenlicht durch die Kirchenfenster flutete, in bunten Kaskaden gefächert über den Steinboden fiel und sie mit ihren Mitschwestern das »Gloria« sang, dachte sie mit andächtigem Staunen an die Wunder Gottes, an seine unbegreifliche Schöpfung, erfüllt von Dankbarkeit, wie wunschlos glücklich und gesegnet sie doch war.
2
Fast zur selben Stunde, gute vierzig Meilen nordöstlich von Adelaide im Barossa-Tal, kämpfte Ludwig Seewald, ein kräftiger, untersetzter Mann von fünfzig Jahren, schwitzend mit den Tücken des technischen Fortschritts, der sich Automobil nannte, von der Mehrzahl der Landbevölkerung aber immer noch als »pferdelose Kutsche« bezeichnet wurde.
Ludwig Seewald musste hinter der scharfen Kurve herunterschalten, weil die staubige Straße vor ihm anstieg und der halb offene Talbot mit seinen vierzehn Pferdestärken die Steigung hinauf nach Finnegan’s Park sonst nicht bewältigt hätte, wie er insgeheim fürchtete. Mehrmals heulte der Motor gequält auf, als er den Gang wechseln wollte und dabei wiederholt zu viel Gas gab. Ein heftiger Ruck ging durch den Wagen, als der Gang schließlich fasste und den Talbot nach vorn schießen ließ.
»Heilige Muttergottes, der Motor wird doch wohl nicht gleich explodieren, oder?«, stieß Anna Seewald, die sonst nichts so leicht aus der Fassung brachte, erschrocken auf dem Beifahrersitz hervor und bekreuzigte sich hastig. »Halt besser an!«
»Ach was! Ich bin nur noch nicht so richtig vertraut mit dem Automobil«, beruhigte Ludwig Seewald seine Frau. Sie trug wie er einen langen Staubmantel und eine klobige Schutzbrille, die ihrem Gesicht ein etwas groteskes Aussehen verlieh, wie selbst er zugeben musste. Auf die Lederkappe mit den herabhängenden Ohrenschützern, die er selbst mit solchem Stolz trug, hatte sie allerdings verzichtet; ihr faustdicker Zopfkranz, mit dem sie ihr streng nach hinten frisiertes Haar krönte, passte nicht darunter. Ein Kopftuch leiste ihrer Überzeugung nach weit bessere Dienste, zumal an solch heißen Sommertagen wie diesen, wo man der Hitze noch nicht einmal in den frühen Morgenstunden zu entrinnen vermochte.
»Ich wünschte, wir hätten Prinz oder den robusten Zeus vor den Buggy gespannt und dieses … lärmende Ungetüm im Schuppen gelassen! Da hätten meine Nerven weniger gelitten, ganz abgesehen von den blauen Flecken, die uns so erspart geblieben wären«, bedauerte Anna Seewald. »Und wir wären auch nicht dermaßen staubig wie in so einer pferdelosen Kutsche!«
»Warum sollen wir nicht zeigen, was wir uns hart erarbeitet haben, Anna?«, hielt er ihr fröhlich entgegen.
»Weil es eitle Hoffart und nicht gottgefällig ist – und weil wir das Geld für anderes viel dringender benötigt hätten, wie du sehr wohl weißt!«, hielt sie ihm leicht ungehalten vor. »Hast du mal ausgerechnet, wie viele neue Rebstöcke wir dafür hätten kaufen können? Das Geld hätte mit Sicherheit gereicht, um eine neue Rebsorte auf Maralinga anzupflanzen! Und zwei neue Weinpressen hätten wir auch ganz gut gebrauchen können, wo unsere doch ständig ausfallen, weil hier etwas bricht und dort etwas klemmt. Einmal ganz abgesehen davon, dass die Ernte dieses Jahr nicht so ausfallen wird, wie wir es uns erhofft haben. Zumindest hättest du warten müssen, bis wir wissen, wie viele Kisten Wein Mister Cavendish von unserer letzten Abfüllung in seinem Weingroßhandel in Adelaide hat absetzen können. Ein wenig Geld auf der hohen Kante hätte uns in dieser Situation bestimmt gutgetan. Denn wer weiß, was das Jahr noch an Unvorhergesehenem bringt! Zudem muss einiges am und im Haus dringend ausgebessert und renoviert werden. Ach, ich könnte dir noch so vieles aufzählen, wofür wir das Geld zehnmal sinnvoller hätten verwenden können.«
Damit traf Anna Seewald einen wunden Punkt, und ihr Mann reagierte darauf mit einer ärgerlichen Geste, hinter der er sein schlechtes Gewissen zu verbergen versuchte. »Nun fang bloß nicht wieder davon an!«, erwiderte er gereizt. »Gar so schlecht wird die Ernte schon nicht ausfallen, und den Wagen habe ich verhältnismäßig günstig bekommen.«
»Ja, aber eben nur verhältnismäßig günstig! Wenn ich nur Sixpence in der Tasche habe, ist und bleibt eine große Zuckertüte für fünf Pennies ein sündhaft teures Vergnügen!«, grollte Anna Seewald.
Ludwig Seewald zog es vor, diesen berechtigten Vorwurf einfach zu überhören. Der Wagen hatte die lange Steigung mittlerweile überwunden und tauchte auf der Kuppe der Anhöhe in den Schatten der Palmen-Allee, die sich über eine Viertelmeile erstreckte und zum herrschaftlichen Landhaus der Finnegans führte, das nicht zu Unrecht den Namen Finnegan’s Park trug.
»Außerdem ist es ganz gut, wenn wir in einem Automobil vorfahren. Das wird gehörig Eindruck machen. Eine solche Anschaffung ist nun mal ein unübersehbarer Beweis dafür, dass es uns gut geht und wir nicht auf Almosen angewiesen sind.« Er zwinkerte seiner Frau zu.
Diese gab ein ärgerliches Schnauben von sich. »Hör auf mit diesen Reden! Du streust dir doch nur selbst Sand in die Augen, Ludwig! Uns geht es alles andere als gut! Genau genommen leben wir von der Hand in den Mund.«
»Nun mach es mal nicht so dramatisch, Liebes«, sagte er besänftigend. »Wir haben auf Maralinga schon mehr als eine Krise gemeistert, oder etwa nicht?«
»Schon, aber allmählich werde ich dafür zu alt. Und leider ist auf Krautscheid auch kein Verlass mehr. Statt dir ins Gewissen zu reden, sieht er tatenlos zu, wie du die Zügel auf Maralinga schleifen lässt.«
Er winkte fröhlich ab. »Nun hör mal mit deinem Gemäkel auf, Anna. Ich sage dir, James Finnegan wird es diesmal nicht wagen, uns die Daumenschrauben anzulegen und uns herunterzuhandeln. Wenn er wie üblich einen Teil unserer Ernte für seine Weinkellerei haben will, wird er einen guten Preis zahlen müssen!«
»Dein Wort in Gottes Ohr!«, seufzte Anna Seewald und verfiel in sorgenvolles Schweigen. Einmal mehr wünschte sie, ihr Ludwig könnte besser mit Geld umgehen, der Realität nüchtern in die Augen sehen und mehr geschäftlichen Weitblick entwickeln. Nur gut, dass sie bei fast allen wichtigen geschäftlichen Verhandlungen stets zugegen war. Zwar hatte ihnen das zu Anfang spöttische Bemerkungen und so manch eine indignierte Reaktion eingebracht, besonders bei Männern wie James Finnegan. Aber die Leute hatten sich schnell daran gewöhnt, dass sie, Anna Seewald, nicht nur ihren Mann bei der harten Arbeit in den Weinbergen von Maralinga stand, sondern auch über alle geschäftlichen Belange unterrichtet und bei wichtigen Entscheidungen mit einbezogen sein wollte, selbst wenn sie das Reden und Verhandeln ihrem Mann überließ. Nur, viel hatte das auch nicht geholfen, das Weingut endlich auf eine solide finanzielle Basis zu stellen. Ihr Mann liebte das gute Leben einfach zu sehr, um vorsichtiger mit seinen Ausgaben zu sein. Sie gab es nicht gern zu, nicht einmal vor sich selbst, aber seine Unbekümmertheit jagte ihr immer mehr Angst ein, je älter sie wurde.
»Ah, da sind wir ja schon!«, rief Ludwig Seewald betont munter, als sie das Ende der Palmen-Allee erreichten, um eine gepflegte Rasenfläche mit Blumenbeeten herumfuhren und Augenblicke später vor dem prächtigen Domizil der Finnegans anhielten.
Das Gebäude bestand aus massivem Barossa-Bluestone und ähnelte mit seinen Erkern und dem Turmaufsatz über dem Mitteltrakt einem kleinen, aber für die örtlichen Verhältnisse doch sehr beeindruckenden englischen Landsitz. Remise, Pferdestallungen und einige weitere Wirtschaftsgebäude lagen seitlich im Schatten hoher Bäume.
Obwohl Missgunst ihm eigentlich völlig fremd war und gar nicht seiner unbekümmert lebensfrohen Natur entsprach, befiel Ludwig Seewald beim Anblick dieses herrschaftlichen Anwesens doch jedes Mal ein Anflug von Neid. Es wurmte ihn, dass ausgerechnet James Finnegan, der vor gut fünfunddreißig Jahren im Hafen von Adelaide mit entschieden weniger Geld in der Tasche von Bord eines britischen Einwandererschiffes gegangen war als er, dass dieser irische Handlanger eines Dubliner Schankwirtes und Weinhändlers es mit seiner Durchtriebenheit und Geschäftstüchtigkeit so weit gebracht hatte, während er, Ludwig Seewald, sich nach kaum weniger Jahren in Australien noch immer abmühen musste, um seine Familie und Maralinga über Wasser zu halten.
Er tröstete sich schnell damit, dass Reichtum zwar seine unbestrittenen Vorteile besaß, aber eben doch noch längst kein Garant für Glück war, wofür James Finnegan ein gutes Beispiel darstellte. Das kleine Weingut Maralinga, das Anna und er hier im Barossa-Tal im Schweiße ihres Angesichtes aufgebaut hatten, würde ihn sicherlich nie zu einem vermögenden Mann machen. Aber was das Glück betraf, das Herz und Seele erfüllte und wirklich zählte, so hatte er, Ludwig Gottlieb Seewald aus der Pfalz, die weitaus größeren Reichtümer vorzuweisen, nämlich vier gesunde, prächtige Kinder und eine nicht minder prächtige Frau, deren Tüchtigkeit ebenso unerschöpflich war wie ihre Herzensgüte und ihre eheliche Liebe und Treue. Dagegen war James Finnegan mit seinen desolaten Familienverhältnissen wahrhaftig ein bedauernswert bettelarmer Tropf.
Dieser Gedanke vertrieb den neidvollen Groll, der sich flüchtig in Ludwig Seewald geregt hatte. Er stellte den Motor aus, setzte die Schutzbrille ab und stieß schwungvoll den Wagenschlag auf. Dabei sagte er in regelrechter Hochstimmung zu seiner Frau: »Nun denn, Anna, dann wollen wir dem alten Halsabschneider mal die Ehre geben!«
»Der alte Halsabschneider, wie du ihn nennst, ist zweiundfünfzig und damit gerade mal anderthalb Jahre älter als du«, erinnerte Anna ihn trocken, die selbst gerade erst die vierzig überschritten hatte.
»Aber ich fühle mich mindestens fünfzehn Jahre jünger, und ich denke, das habe ich allein dir zu verdanken«, flüsterte er und tätschelte Anna die Hüfte.
»Ludwig!«, gab sie sich entrüstet, während ihr in Erinnerung an die vergangene Nacht das Blut ins Gesicht schoss; schnell entzog sie sich seiner Hand mit einer Drehung.
Er lachte vergnügt. »Weißt du, dass du noch immer wie ein junges Mädchen errötest … und dass es noch genauso verführerisch auf mich wirkt wie damals, als ich dich vor einundzwanzig Jahren auf dem Hof der Bäckerei in Tanunda nach deinem Namen gefragt habe?«
»Du bist wirklich unverbesserlich, Ludwig Seewald!«, erwiderte sie kopfschüttelnd, doch ihre Augen leuchteten voller Liebe, und um ihren Mund spielte ein weicher, zärtlicher Zug.
Douglas, der älteste Sohn von James Finnegan, kam über den Vorplatz auf sie zu. Der sechsundzwanzigjährige, athletisch gebaute Mann trug einen Tennisschläger unter dem Arm. Er machte eine blendende Figur in der weißen Tenniskleidung, bestehend aus langer Leinenhose und kurzärmeligem Hemd. Sie bildete einen eindrucksvollen Kontrast zu seinem vollen, tiefschwarzen Haar und seinem sonnengebräunten Gesicht mit den überaus markant-männlichen Zügen. Er ähnelte seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten; sogar die kantige Kinnpartie hatte er von ihm geerbt.
Er begrüßte die beiden und sagte dann mit einem Blick auf den Talbot ein wenig spöttisch auf Barossa-Deutsch: »Ich sehe, Sie gehen auf Maralinga mit der Zeit, Herr Seewald!«
»Ich weiß, mit der Zeit zu gehen, gilt eigentlich als das alleinige Privileg der Jugend. Aber ich habe mir erlaubt, mich nicht daran zu stören, Mister Finnegan«, antwortete Ludwig Seewald in fast akzentfreiem Englisch.
In der eigenen Familie und mit den meisten Nachbarn sprach er in dem deutschen Dialekt, der sich im Laufe der Zeit ausgeprägt hatte. Er mochte es jedoch nicht, wenn Australier britischer Abstammung Barossa-Deutsch mit ihm redeten; es hatte etwas Herablassendes, Gönnerhaftes an sich. Im Gegensatz zu den vielen Tausend deutschen Einwanderern zumeist altlutherischen Glaubens, die das Barossa-Tal seit den Dreißigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts besiedelt hatten und bis in die Gegenwart unbeirrt an ihrer deutschen Sprache sowie ihren Sitten und Gebräuchen festhielten, hatte er sich vom ersten Tag an eisern bemüht, diese fremde Sprache zu beherrschen, wie sie in diesem Land unter dem Kreuz des Südens gepflegt wurde, und sich der neuen Kultur anzupassen. So hatten er und Anna auch ihre Kinder erzogen. Sie hatten zwar automatisch auch Deutsch gelernt, doch stets im Schatten des Englischen, das nun eben die Sprache ihrer Heimat war. Und nach mehr als achtundzwanzig Jahren, die er nun schon hier lebte, fühlte sich Ludwig Seewald auch längst nicht mehr als Deutscher, sondern als Südaustralier, der tief in diesem Land verwurzelt war. Die Einbürgerung, die er vor zehn Jahren vorgenommen hatte, als sich am 1. Januar 1900 die einzelnen eigenständigen britischen Kolonien in diesem Land zu einer Föderation zusammengeschlossen und den modernen Staat Australien gebildet hatten, diese Einbürgerung hatte nur offiziell bestätigt, was in seinem Selbstverständnis schon lange verankert war – nämlich das Bewusstsein, genauso Australier wie all die anderen Einwanderer zu sein, die seit der Ankunft der ersten Sträflingsflotte im Jahre 1788 den roten Kontinent besiedelten, und genauso stolz auf seine Pionierarbeit in diesem Land sein zu dürfen.
»Vater schwört auf Daimler und Lanchester, und wir haben mit beiden Wagen auch wirklich nur die allerbesten Erfahrungen gemacht«, erklärte Douglas selbstgefällig, um mit einem nachsichtigen Lächeln hinzuzufügen: »Aber dieser kleine Talbot soll ja auch seine Vorzüge haben.«
Anna Seewald reckte angriffslustig das Kinn. »In der Tat! Vorzüge, die sich allerdings nicht jedem gleich erschließen!«, antwortete sie spitz, um im nachsichtig mütterlichen Tonfall fortzufahren: »Und jetzt lassen Sie sich nicht länger aufhalten, junger Mann. Sie wollen bestimmt zum Spielplatz.«
Das überhebliche Lächeln des jungen Mannes gefror.
»Das heißt Tennisplatz, meine Liebe«, bemerkte Ludwig Seewald und hatte Mühe, sich ein Schmunzeln zu verkneifen. Seine Frau reizte man nicht ungestraft.
Anna zuckte die Achseln. »Das läuft ja wohl auf dasselbe hinaus«, meinte sie ungerührt, fuhr aus dem Staubmantel und legte ihn in den Wagen.
»Genau genommen heißt es court, aber das können Sie ja nicht wissen«, korrigierte Douglas sie schmallippig. »Und ich komme gerade von dort zurück. Ich habe meinen Halbbruder glatt in drei Sätzen geschlagen. Aber auch das wird Ihnen vermutlich nicht viel sagen.«
»Ich denke, wir sollten Ihren Vater nicht länger warten lassen«, sagte Ludwig, der sich gerade auch seines Staubmantels entledigte und ihn zusammengefaltet auf die Rückbank legte, zu Douglas. Er streifte auch die Lederkappe vom Kopf und strich sich durch sein schütteres, schon früh ergrautes Haar.
Douglas nickte knapp und winkte mit herrischer Geste einen der Bediensteten heran. »Fahr den Wagen in die Remise, Orville!«, befahl er dem hageren Mann, der von den Stallungen herbeieilte.
»Danke, das werden wir nachher bestimmt zu schätzen wissen«, meinte Ludwig versöhnlich. »Wenn gleich die Sonne hinter dem Dach hervorkommt, werden die Sitze im Handumdrehen so heiß, dass man Speck auf ihnen braten kann.«
Douglas lächelte mit kühler Höflichkeit. »Dad erwartet Sie hinten auf der Terrasse«, erklärte er und bedeutete den beiden, ihm zu folgen. Er führte sie durch die hohe und herrlich kühle Halle, die mit weißen und schwarzen Marmorplatten im Schachbrettmuster ausgelegt war, und geleitete sie durch einen der erlesen eingerichteten Salons hinaus auf die rückwärtige Terrasse.
Ludwig Seewald blieb unwillkürlich stehen, als er hinter Douglas durch die Tür trat und sich ihm das einzigartige Panorama darbot, das noch jeden Besucher von Finnegan’s Park in Bewunderung versetzt hatte – und zwar bei jedem Besuch wieder aufs Neue. Vor seinem Auge erstreckte sich das Barossa-Tal, das mit seinem Herzstück gerade mal zwanzig Meilen in der Länge und acht Meilen in der Breite maß. Sanfte Hügelketten durchzogen die fast parkartige Landschaft. Kleine Siedlungen und Ortschaften ruhten wie Inselchen in dieser behutsam wogenden See aus Weinbergen, Obsthainen, Feldern, Weiden und Ackern. Und nie mussten die Augen weit schweifen, um auf einen der vielen weiß gestrichenen Kirchtürme zu stoßen, die überall im Barossa-Tal spitz wie Stifte aufragten und überwiegend lutherischen Gotteshäusern angehörten.
Der Blick schweifte ungehindert weit über die Tanunda- und Nuriootpa-Ebene bis zu den Bergen der Mount Lofty Range im Norden und Osten hinaus. Und im Süden stiegen, scheinbar zum Greifen nahe, über den dicht bewaldeten Hängen einer weiteren Bergkette die Zwillingsspitzen des fast zweitausend Fuß hohen Kaiserstuhls mit seinen steilen Flanken aus dem Barossa-Tal auf. Einzig der Blick auf die Greenock Hills, die den Talkessel im Westen begrenzten, blieb einem von der Terrasse aus verwehrt.
Ludwig konnte sich nie sattsehen an dieser anmutig sanften Landschaft aus gestaffelten Hügelketten, die in einem mauvefarbenen Ton schimmerten und überall von den dunkelgrünen Bändern der Weinberge durchzogen wurden. Barossa bedeutete: »Hügel der Rosen«.
Ludwig Seewald seufzte kaum hörbar. Auf Erden gab es kein Paradies, aber das Barossa-Tal kam dem Garten Eden, so wie er ihn sich vorstellte, schon sehr nahe. Wie sehr er dieses Tal doch liebte!
James Finnegan saß in einem bequemen weißen Korbsessel unter der von immergrünem Efeu überwachsenen Pergola und studierte die Tageszeitung, als sein ältester Sohn mit Ludwig und Anna Seewald auf der Terrasse erschien. Breitschultrig, von hochgewachsener Gestalt und mit einem überaus markanten Gesicht, dessen scharf geschnittene Züge noch von einem dichten, akkurat gestutzten Vollbart von eisengrauer Farbe unterstrichen wurden, wirkte er sogar noch im Sitzen auffallend stattlich und Respekt einflößend.
Ohne Hast faltete James Finnegan die Zeitung zusammen, legte sie auf den Tisch und erhob sich. Er ging seinen Besuchern jedoch nicht einen einzigen Schritt entgegen, sondern erwartete, dass sie zu ihm kamen. Während er den linken Daumen in die linke Westentasche seines Anzuges aus bestem schwarzen Tuch hakte, zog er mit der rechten Hand aus der anderen Westentasche eine goldene Taschenuhr hervor, die an einer gleichfalls schweren goldenen Kette hing. Er ließ den mit seinem Monogramm versehenen Deckel aufspringen, warf einen kurzen Blick auf das Zifferblatt und nickte dann zufrieden, als hätte er von Ludwig und Anna Seewald auch nichts anderes als Pünktlichkeit erwartet.
James Finnegan begrüßte die beiden auf seine distanziert freundliche Art, bat sie, Platz zu nehmen, und bot ihnen eine Tasse Tee an. »Erste Darjeeling-Pflückung. Das Feinste vom Feinen, was unsere unruhige Kronkolonie Indien zu bieten hat. Frisch aufgegossen«, versicherte er. »Albert hat die Kanne erst vor einem Augenblick gebracht.«
»Gern«, sagte Ludwig, und auch seine Frau nahm das Angebot mit einem Nicken freundlich lächelnd an. Die Tasse Tee gehörte, wie das Gespräch über das Wetter, bei fast jedem Geschäft zum unverzichtbaren Ritual.
»Wenn du dann bitte so freundlich wärst einzugießen, Douglas«, bat James seinen Sohn, der sich auch zu ihnen an den Tisch gesetzt hatte.
»Mit Vergnügen«, antwortete Douglas, und ein feines Lächeln zuckte um seine Mundwinkel, als er sich vorbeugte und nach der Silberkanne griff, um die hauchzarten Porzellantassen der Gäste zu füllen.
Ludwig bemerkte dieses eigenartige Lächeln, und es gefiel ihm gar nicht. Zudem irritierte und beunruhigte es ihn, dass Douglas sich wie selbstverständlich zu ihnen gesetzt und James das wortlos hingenommen hatte. In all den Jahren, die Anna und er nun schon Geschäfte mit James Finnegan machten, hatte bisher keiner seiner beiden Söhne an derartigen geschäftlichen Unterredungen teilgenommen. Dass Douglas nun mit am Tisch saß, konnte also weder Zufall noch Gedankenlosigkeit sein. Nicht bei einem derart bestimmenden Vater wie James Finnegan, der nicht nur seine Firma, sondern auch seine Familie mit buchstäblich eiserner Faust regierte – und auch sonst nichts dem Zufall überließ. Douglas goss auch sich eine Tasse Tee ein, zog dann ein silbernes Zigarettenetui hervor und steckte sich eine Zigarette an, während sein Vater dem Ritual Genüge tat, indem er mit Ludwig und Anna Seewald Gemeinplätze über das Wetter und den besorgniserregend niedrigen Wasserstand des North Para River sowie seiner Nebenarme austauschte, der in diesem Abschnitt des Barossa-Tals für die Landwirtschaft von größter Bedeutung war.
Als James Finnegan seine Tasse geleert hatte und sie von sich wegschob, wusste Ludwig, dass der unverbindliche Teil ihrer Unterredung sein Ende gefunden hatte und es nun ans Geschäftliche ging.
»Die Ernte wird dieses Jahr nicht viel Freude bringen«, sagte James. »Wir hatten zu viel Regen zur falschen Zeit und zu früh zu starke Hitze.«
»Nun ja, es hat gewiss schon bessere Jahre gegeben«, räumte Ludwig freimütig ein. »Aber was die Trauben auf Maralinga angeht …«
»So erreichen sie vermutlich nicht einmal die Qualität, die wir zur Verarbeitung unseres billigsten, verschnittenen Branntweins brauchen, der in den Kaschemmen der Hafendocks ausgeschenkt wird«, fiel Douglas ihm kühl ins Wort.
Ludwig fuhr verdutzt zu ihm herum und war im ersten Moment sprachlos. Er rechnete damit, dass Finnegan seinen Sohn augenblicklich ob dieser Unverschämtheit zurechtweisen würde. Ihm einfach ins Wort zu fallen war schon ungebührlich genug. Aber zugleich auch noch zu behaupten, dass seine Trauben nicht einmal zur Herstellung von billigstem Brandy taugten, konnte man nur als unverfrorene Frechheit bezeichnen.
Aber anstatt Douglas zu ermahnen, sagte James völlig ungerührt von dem ungehörigen Benehmen seines Sohnes: »Ja, so schmerzlich es auch ist, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber die Trauben von Maralinga sind dieses Jahr in der Tat von besonders schlechter Qualität.«
»Das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein! Und was heißt hier überhaupt von besonders schlechter Qualität?«, stieß Ludwig entrüstet hervor. »Das klingt ja so, als hätten wir schon in den vergangenen Jahren Trauben von minderer Qualität geliefert!«
»Das haben Sie ja auch«, bestätigte James kühl. »Aber die Qualität Ihrer Trauben reichte eben immer noch aus, um sie zur Herstellung von preiswertem Brandy zu verwenden. Dieses Jahr sieht es allerdings anders aus.«
»Das ist ja … lachhaft!«, entgegnete Ludwig empört und spürte, wie sich sein Puls beschleunigte. Er blickte kurz zu Anna hinüber, die stumm und mit blassem Gesicht zwischen ihm und James saß. Aber warum sagte sie denn nichts? Sie hielt doch auch sonst nicht mit ihrer Meinung hinter dem Berg?
Anna hatte sich insgeheim zwar schon darauf eingestellt, dass James ihnen in diesem Jahr schwer zusetzen würde, aber mit einer derartigen Offensive hatte sie nicht gerechnet.
James Finnegan rief nach seinem persönlichen Bediensteten Albert. »Bring uns die Schüssel, die Douglas auf der Anrichte bereitgestellt hat!«, forderte er ihn auf.
Einen Augenblick später erschien Albert, der in seiner unauffälligen Person die Position des Kammerdieners, Sekretärs und Chauffeurs für James Finnegan in sich vereinigte, mit einer schweren Kristallschale. Er stellte die Schale, in der mehrere Dolden lagen, in die Tischmitte und zog sich mit der ihm eigenen Diskretion sofort wieder zurück.
»Das sind Maralinga-Trauben von jener Rebsorte, die ich Ihnen seit Jahren abkaufe«, erklärte James. »Wollen Sie immer noch behaupten, Sie könnten mir Trauben von annehmbarer Qualität liefern?«
»Wer hat Ihnen gestattet, in unsere Weinberge zu gehen und sich ohne unser Wissen Dolden von unseren Rebstöcken zu schneiden?«, wollte Ludwig erregt wissen.
»Halten wir uns doch jetzt nicht mit Lappalien auf!«, erwiderte James mit aufreizender Gelassenheit, während sein Sohn sich vorbeugte und ein paar Trauben von der obersten Dolde abpflückte. »Was tut es groß zur Sache, ob Sie mir eine Probe bringen oder ich mir vorher schon selbst eine beschaffe?«
Douglas ließ die Trauben durch die Finger gleiten. »Tatsache ist, dass sie nichts taugen«, sagte er und warf sie verächtlich auf den Tisch.
Nun blitzten Annas Augen auf. »Frechheit macht aus einem Rotzbengel weder einen Mann, noch fördert sie Geschäftsbeziehungen!«, fauchte sie James an. »Sagen Sie das Ihrem Flegel von Sohn, der offenbar vergessen hat, was Manieren sind!«
»Wie verwunderlich, dass Sie es für schlechte Manieren halten, wenn man die Dinge beim Namen nennt, Frau Seewald«, entgegnete Douglas unbeeindruckt von ihrem Protest und bestimmt nicht zufällig auf Barossa-Deutsch.
»Das sehe ich nicht anders«, stimmte sein Vater ihm kühl zu. »Und da wir schon mal dabei sind, die Dinge ungeschminkt beim Namen zu nennen: Ob Sie nun einfach nur eine Menge Pech gehabt, miserabel gewirtschaftet oder sich mit Maralinga schlichtweg übernommen haben – fest steht nun mal, dass Sie Ihr Weingut nicht länger halten können, mein lieber Seewald.« Er machte eine kurze Pause, um die Worte wirken zu lassen. »Sie sind am Ende. Endgültig. Sie wissen es bloß noch nicht.«
Ludwig starrte ihn ungläubig an und schnappte dann wie unter Atemnot nach Luft. Das Blut schoss ihm in den Kopf und pochte heiß in seinen Schläfen. »Sie … Sie … müssen nicht recht bei Sinnen sein!«, stieß er schließlich wutentbrannt hervor und sprang auf. »Und ich denke nicht daran, mir noch länger Ihre … Ihre ebenso lächerlichen wie beleidigenden Reden und die Unverschämtheiten Ihres Sohnes anzuhören. Komm, Anna! Wir sind doch nicht auf das Wohlwollen von Mister Finnegan angewiesen!«
»Wahrhaftig nicht!«, bekräftigte Anna und stand abrupt auf.
»Sie irren«, widersprach James. »Ohne meine Großzügigkeit sind Sie erledigt, Seewald; dann kommt Maralinga unter den Hammer. Und die wenigen Bieter, die sich dann einfinden dürften, werden es sich dreimal überlegen, ob sie es wagen sollen, gegen mich zu bieten. Sie tun also besser daran, sich Ihre Empörung für geeignetere Zeiten aufzuheben, sich wieder zu setzen und sich anzuhören, was ich Ihnen zu offerieren habe.«
Ludwig zögerte.
Anna warf ihm einen unsicheren, verstörten Blick zu.
»Wollen Sie denn nicht wissen, welche Abrechnung Ihnen Mister Cavendish vorlegen wird?«, fragte James und bedachte sie mit einem überlegen spöttischen Lächeln.
Diese Frage löste bei Ludwig augenblicklich Beklemmungsgefühle aus. Er wehrte sich gegen die Wahrheit, die sich ihm nun förmlich aufdrängte. »Mister Cavendish ist ein Ehrenmann, und ich will nicht wissen, wie Sie sein Vertrauen oder das eines seiner Angestellten missbraucht haben, um Kenntnis …«
Nun war es James, der ihm schroff ins Wort fiel. »Mister Cavendish ist vor allem Geschäftsmann, und während seine Geschäfte ob der Weine von Maralinga katastrophal daniederliegen, wie er Ihnen wohl nächste Woche eröffnen wird, macht er blendende Profite mit den Erzeugnissen aus der Finnegan Winery. Er wird Ihnen nächste Woche zwei hochbeladene Fuhrwerke mit unverkäuflichen Maralinga-Weinen und einen Scheck über die lächerliche Summe von elf Pfund bringen und Ihnen mitteilen, dass er Ihre Weine nicht mehr in sein Sortiment aufnimmt.«
»Mister Cavendish ist nicht der einzige Spirituosenkontorist im Land«, antwortete Ludwig grimmig, konnte aber nichts gegen das Schwächegefühl tun, das ihn plötzlich befiel und ihn zwang, sich doch wieder zu setzen.
»Ja, wir werden schon einen anderen finden«, pflichtete Anna ihm bei, doch ihre Stimme zitterte, und auch sie nahm wieder Platz, als hätte sie die Kraft verlassen.
»Das glaube ich nicht«, bemerkte Douglas und griff wieder nach seinem Zigarettenetui. »Und nicht allein wegen der minderwertigen Qualität der Maralinga-Weine. Sie haben einfach die Zeichen der Zeit übersehen und zu sehr darauf vertraut, dass …«
James brachte ihn mit einer herrischen Geste zum Schweigen. »Lassen Sie uns nicht um den heißen Brei herumreden, Seewald. Maralinga mit seinen gut vierzehn Hektar Land trägt sich nicht oder zumindest nicht mehr bei den Ausgaben, die Sie mittlerweile haben. Sie und Ihre Frau haben dieses Weingut in langen, mühsamen Jahren aufgebaut, doch bei der Auswahl der Rebsorten und der Bestellung des Landes sind Ihnen eine Menge Fehler unterlaufen.«
Ludwig funkelte ihn wütend an. »Das behaupten Sie!«
Ein mitleidiges Lächeln flog über das bärtige Gesicht von James Finnegan. »Sehen Sie sich doch bloß Ihre Zahlen an, Seewald!«, forderte er ihn auf. »Wie viele Tonnen Trauben haben Sie denn bei der letzten Ernte eingefahren? Doch gerade mal eine pro Hektar. Das ist weniger als die Hälfte von dem, was die meisten anderen Weingüter erzielen. Wenn diese Tonne Trauben wenigstens noch von akzeptabler Qualität wären, könnten Sie immerhin noch an die fünf Pfund brutto pro Hektar machen. Nach Abzug aller Kosten bliebe dann zwar nicht mehr viel übrig, und mit dem mageren Profit über die Runden zu kommen wäre hart, aber bei einem bescheidenen Lebensstil durchaus möglich. Ihre Trauben hingegen haben schon im letzten Jahr keine drei Pfund gebracht – und dieses Jahr sind sie nicht mal zwei Pfund pro Tonne wert. Sie werden auf ihnen sitzen bleiben – und Ihre Verbindlichkeiten werden Sie im Handumdrehen finanziell strangulieren.«
»Das werden wir ja sehen!«, knurrte Ludwig, doch das Schlucken fiel ihm schwer, und der Schweiß brach ihm aus allen Poren. Er wünschte, er könnte den restlichen kalten Tee trinken, der noch in seiner Tasse stand. Doch er zwang sich, nicht danach zu greifen, weil er fürchtete, seine Hand könnte zittern und verraten, wie es in Wirklichkeit um seine innere Verfassung stand. Diese Blöße wollte er sich nicht geben, schon wegen Douglas Finnegan nicht, dessen überhebliches Grinsen ihn mit ohnmächtiger Wut erfüllte.
»Ich garantiere es Ihnen«, fuhr James unbeirrt fort. »Natürlich kann man Maralinga wieder zu einem produktiven Weingut machen. Aber das kostet eine Menge Geld und wird Jahre dauern. Und da Sie nicht über die nötigen Reserven verfügen, um diese bittere Zeit zu überstehen, die bedeutend mehr Kosten als Einnahmen bringt, wird Maralinga immer mehr herunterkommen. Und das möchte ich vermeiden. Deshalb will ich Ihnen Maralinga abkaufen. Ich biete Ihnen einen Preis, der weit über dem liegt, was Sie erhalten werden, wenn Sie an jemand anderen verkaufen – ganz zu schweigen von der schäbigen Summe, die Ihnen nach einer Zwangsversteigerung bleibt.«
Heftig schüttelte Ludwig den Kopf. »Nein! Maralinga ist mein Lebenswerk. Unser Sohn Andreas wird das Weingut eines Tages übernehmen, und wenn seine Zeit gekommen ist, werden seine Kinder in seine und die Fußstapfen ihres Großvaters treten. Wofür sonst haben wir uns denn all die Jahre abgerackert?«, stieß er gepresst hervor und sprang auf. »Ich verkaufe nicht! Niemals! Für keinen Preis!«
»Und schon gar nicht an Sie!«, fügte seine Frau erbittert hinzu und stellte sich an seine Seite.
Douglas lachte geringschätzig auf. »Sie werden verkaufen, weil Ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Dafür werden wir schon sorgen!«, sagte er mit unverhohlener Drohung und blies ihnen den Rauch seiner Zigarette ins Gesicht.
James schoss ihm einen wütenden Blick zu. »Ich glaube, es wäre doch besser gewesen, wenn du nicht an diesem Gespräch teilgenommen hättest! Deine Manieren lassen in der Tat zu wünschen übrig!«, fuhr er ihn an. »Wir unterhalten uns lieber ohne dich weiter; geh jetzt, und zwar flott.«
Douglas verzog das Gesicht und zuckte mit den Achseln. »Ganz wie du willst, Dad«, sagte er und drückte erst noch mit provokativer Ruhe seine Zigarette im Aschenbecher aus, bevor er sich aus dem Sessel erhob.
»Auch das wird nichts an meinem Entschluss ändern!«, erklärte Ludwig und registrierte zu seiner Verwirrung, dass Douglas gelangweilt, ja fast schon amüsiert und nicht im Mindesten verlegen oder gar eingeschüchtert wirkte. Dabei hatte eine derart barsche Zurechtweisung seines Vaters bislang doch immer Wirkung gezeigt. Diesmal jedoch schien die Maßregelung wie Wasser von einer Ölhaut abzuperlen. Aber was machte er sich darüber Gedanken, was zwischen James und seinem Ältesten vor sich ging? Er hatte jetzt wirklich andere Sorgen.
Während sich Douglas von der Terrasse trollte, stand der alte Finnegan schnell aus seinem Sessel auf und hielt Ludwig am Arm zurück. »Gehen Sie nicht im Zorn, Seewald. Und legen Sie vor allem nicht die Worte meines Sohnes auf die Goldwaage. So sind junge Leute eben; sie glauben, schon alles besser zu wissen und zu können, während sie in Wirklichkeit noch die Eierschalen hinter den Ohren kleben haben. Meine Söhne machen da leider keine Ausnahme«, redete er begütigend auf ihn ein und zog ihn zum Tisch zurück. »Lassen Sie uns das besser noch einmal in aller Ruhe besprechen. Es kostet Sie doch nur ein wenig Zeit. Sie vergeben sich doch nichts, wenn Sie sich anhören, was ich Ihnen anzubieten habe. Und vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit, mit der wir alle gut leben können.«
Widerwillig ließ Ludwig sich darauf ein. Alle nahmen wieder unter der schattigen Pergola Platz.
James Finnegan bot ihnen eine stolze Summe, die in der Tat um einiges über dem lag, was Maralinga zurzeit wert war, wie Ludwig im Stillen zugeben musste. Und James erklärte sich sogar bereit, sie und ihre Kinder noch zwei Jahre in ihrem Haus wohnen zu lassen und ihn, Ludwig, offiziell als seinen Verwalter einzustellen. Das würde ihm helfen, sein Gesicht in der Gemeinde zu wahren, und ihm ausreichend Zeit geben, sich in aller Ruhe nach einem neuen Anwesen umzuschauen.
»Sie müssen sich nicht sofort entscheiden, Seewald. Nehmen Sie sich ruhig ein paar Tage Zeit, um in aller Ruhe und Nüchternheit das Für und Wider meines Angebotes abzuwägen. Sie werden dann gewiss zu dem Schluss kommen, dass ich Ihnen eine goldene Brücke aus dem finanziellen Ruin baue, der Ihnen droht«, erklärte er abschließend. Dann rief er Albert und trug ihm auf, seine Gäste hinauszugeleiten.
Der Talbot stand schon vor dem Haus in der sengenden Sonne – und neben der Fahrertür wartete Douglas auf sie.
»Gehen Sie mir aus dem Weg!«, herrschte Ludwig ihn grimmig an und schob ihn grob beiseite. »Sie werden Maralinga nicht bekommen!«
»Ach, nein?«, fragte Douglas gedehnt.
Ludwig ließ den Motor an. Das Blut hämmerte ihm im Kopf und die Sachen klebten ihm schweißnass am Körper, als er von ohnmächtiger Wut erfüllt hinter das Lenkrad rutschte. Staubmantel, Schutzbrille und Lederkappe ließ er unbeachtet auf der Rückbank liegen.
»Flegel!«, zischte Anna.
Der Wagen machte einen Satz nach vorn, als Ludwig den Gang mit einem wütenden Ruck einlegte und auf das Gaspedal trat. Die Reifen schleuderten Sand und kleine Steine nach hinten weg, sodass Douglas in eine Staubwolke gehüllt wurde.
Doch anstatt sich zu ärgern, schickte Douglas ihnen nur ein spöttisches Lachen hinterher.
»Um Gottes willen, was tust du? Du fährst zu schnell!«, rief Anna erschrocken, als ihr Mann mit Vollgas die Palmen-Allee hinunterbrauste. »Nimm den Fuß vom Gas!«
»Zum Teufel mit der ganzen Finnegan-Bande!«, fluchte Ludwig, als sie mit hoher Geschwindigkeit aus dem Schatten der Allee kamen und die Straße abschüssig wurde. Seine Hände hielten das Lenkrad so fest umklammert, dass die Knöchel weiß hervortraten. Der Schweiß rann ihm nur so über das hochrote Gesicht, und sein Herz jagte. Deutlich spürte er das Pochen seiner Adern an den Schläfen. »Sie werden uns nicht um unser Lebenswerk betrügen!«
»Nein, das werden wir nicht zulassen! Sie werden Maralinga nicht bekommen!«, stimmte Anna ihm zu. »Mit Gottes Hilfe werden wir schon irgendwie zurechtkommen. Aber jetzt fahr doch endlich langsamer!«
»Ist ja schon gut, Frau«, sagte Ludwig, trat auf die Bremse und gab plötzlich einen erstickten Schrei von sich. Seine rechte Hand löste sich vom Lenkrad und wirbelte zum Kopf, während er sich im Sitz krümmte.
»Ludwig!«, schrie Anna entsetzt und packte ihn an der Schulter. »Jesus, Maria und Josef, was hast du?«
Ludwig antwortete nicht. Sein Körper bäumte sich noch einmal auf, begleitet von einem erneuten erstickten Aufschrei, und sackte dann in sich zusammen. Der Kopf rollte zur Seite.
Anna blickte in weit aufgerissene, leblose Augen, die an ihr vorbei ins Nichts starrten.
Entsetzt schrie Anna auf. Ihr Mann war tot!
Indessen schoss der Talbot schlingernd die abschüssige Straße hinunter.
3
Im gestreckten Galopp kam Patrick Finnegan über die westliche Hügelkette und preschte auf dem vertrauten rotsandigen Pfad durch den Eukalyptus-Hain. Die unteren Äste schienen von beiden Seiten nach Pferd und Reiter zu greifen und sie für ihre Kühnheit mit Peitschenhieben bestrafen zu wollen; doch nicht ein einziger Zweig berührte Patrick oder seinen Rotfuchs Minerva.
Patrick liebte den Rausch der Geschwindigkeit und den Nervenkitzel, sich erst im letzten Moment unter den heranfliegenden Ästen hinwegzuducken und den Windhauch im Nacken zu spüren. Mit Minerva konnte er sich dieses nicht so ganz ungefährliche Spiel erlauben, war seiner vollblütigen sechsjährigen Fuchsstute doch jegliche Schreckhaftigkeit fremd.
Als der Pfad gegen Ende des kleinen Wäldchens breiter und sicherer wurde, richtete er sich im Sattel auf und ließ Minerva in einen erholsamen Trab fallen. Nach diesem scharfen Ritt hatten sie sich beide eine Atempause verdient. Ihm klebte nicht nur das Hemd völlig durchnässt am Körper, sondern er schmeckte auch den Schweiß, der ihm über das Gesicht lief, bittersalzig auf den Lippen. Und durch die Hosen spürte er die feuchten Flanken seines Pferdes.
Patrick ließ den Eukalyptus-Hain hinter sich und ritt durch das fast kniehohe, goldbraune Wallaby-Gras auf die große alte Akazie zu, die einsam am Rand der Kuppe stand. Von dort hatte man einen wunderbaren Blick auf die Palmen-Allee von Finnegan’s Park. Im Schatten der mächtigen Krone zügelte er Minerva, holte seinen silbernen, mit Brandy gefüllten Flakon aus der Satteltasche und nahm einen kräftigen Schluck.
Mit windzerzaustem Haar, das fast die Farbe des verdorrten Grases aufwies, und grimmiger Miene starrte er zu dem Anwesen hinüber und dachte voller Groll an seinen fünf Jahre älteren Halbbruder Douglas, der es mal wieder geschafft hatte, ihn mit seinem beißenden Spott und seiner Arroganz bis aufs Blut zu reizen … und, nun ja, auch mit seiner überlegenen Sportlichkeit, wie er widerwillig einräumen musste. Zusätzlich hatte Douglas ihn bei ihrem Tennis-Match auch noch um fünf wichtige Punkte geprellt, als ob er ihn nicht auch so hätte schlagen können. Aber er wollte wohl auf Nummer sicher gehen. Lachend war Douglas vom Platz stolziert, während in ihm ohnmächtige Wut gekocht hatte. Früher hatte Douglas ihn durch die Kraft seiner Fäuste spüren lassen, wer von ihnen beiden der Liebling des Vaters war und später einmal Herr auf Finnegan’s Park werden würde. Heute prügelten sie sich längst nicht mehr mit Fäusten, denn Douglas hatte seit Jahren sehr viel wirkungsvollere und schmerzhaftere Mittel, ihn zu verletzen und zu demütigen. Worte konnten Wunden schlagen, die viel tiefer gingen und sehr viel länger schmerzten als selbst die brutalsten Faustschläge.
Gewöhnlich brauchte Patrick sich nach solch einer Auseinandersetzung mit seinem Bruder nur in den Sattel zu schwingen und eine Weile allein durch die Hügel zu reiten, um den Aufruhr in seinem Inneren einigermaßen unter Kontrolle und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Diesmal wollte der bittere Zorn jedoch einfach nicht von ihm weichen.
Er nahm einen zweiten langen Zug aus dem Flachmann, um den Knoten in seinem verkrampften Magen mit einem weiteren Schluck scharfen Brandy zu bekämpfen. Er musste sich förmlich zwingen, den Flakon nicht auf einmal auszutrinken und ihn wieder wegzustecken.
Patrick hörte den Wagen, der drüben über die Palmen-Allee von Finnegan’s Park kam, während er sich noch an seiner Satteltasche zu schaffen machte. Der gellende Schrei, der im nächsten Augenblick zu ihm auf die andere Hügelkette drang, ließ ihn erschrocken hochfahren.
Auch wenn er von dem anstehenden Besuch der Seewalds bei seinem Vater nichts gewusst hätte, hätte er doch sofort erkannt, wem der schwarze Talbot gehörte. Er registrierte auch, dass der Schrei von Anna Seewald kam und dass irgendetwas mit ihrem Mann nicht stimmte. Der Winzer hing in einer grotesken Stellung hinter dem Lenkrad, während der Wagen unkontrolliert die Straße hinunterschlingerte! Hatte Ludwig Seewald die Gewalt über sein Automobil verloren?
Ohne lange zu überlegen, trieb Patrick seine Fuchsstute an und jagte in wildem Galopp den Hang hinunter. Ein eisiger Schreck durchfuhr ihn, als er sah, wie Anna Seewald, die nun ohne Unterlass schrie, ihren Mann mit beiden Händen packte und verzweifelt schüttelte, ihn im nächsten Moment jedoch schon wieder losließ, um nach dem Lenkrad zu greifen.
Hatte Ludwig Seewald es nicht mit dem Herzen?, ging es ihm durch den Kopf, und plötzlich ahnte er, welch eine Tragödie sich dort gerade vor seinen Augen abspielte: Der Mann musste das Bewusstsein verloren haben, oder vielleicht war ihm etwas noch viel Schlimmeres zugestoßen, dass er so in seinem Sitz hing, während der Wagen auf der abschüssigen Straße immer mehr an Fahrt gewann.
Patrick feuerte Minerva an, und als würde die Fuchsstute spüren, dass es bei diesem wilden Ritt nicht um ein flüchtiges Vergnügen, sondern um Leben und Tod ging, mobilisierte sie alle Kräfte, die in ihrem jungen, muskulösen Leib steckten. Die Hufe trommelten immer schneller über den Boden. Doch schon nach wenigen Pferdelängen erkannte Patrick, dass sie es auch in gestrecktem Galopp nicht schaffen würden, den Talbot noch früh genug vor der scharfen Kurve zu erreichen. Die Entfernung war einfach zu groß – und der Wagen schon viel zu schnell.
»Ziehen Sie seinen Fuß vom Gaspedal!«, schrie er Anna Seewald verzweifelt zu. »Den Fuß vom Pedal! … Und den Wagen vorsichtig nach links lenken! Weg von der Straße und den Hang hoch! … Nach links! … Steuern Sie nach links!« Als nur noch vierzig, fünfzig Yards Pferd und Reiter vom Wagen trennten, hörte Anna Seewald endlich, was Patrick ihr zurief. In ihrer Panik riss sie das Lenkrad zu scharf herum, was bei dieser Geschwindigkeit sogar auf ebener Straße ein tödlicher Fehler gewesen wäre. Hier machte das abrupte Lenkmanöver jedoch keinen Unterschied mehr, denn es war schon zu spät, die Tragödie noch abzuwehren.
Mit Grauen sah Patrick, wie der Wagen herumschwang, sich auf die Seite legte und wie von unsichtbarer Hand hochgehoben wurde. Er überschlug sich mehrmals, flog dabei über die fast rechtwinklige Kurve hinaus und stürzte unter entsetzlichem Getöse in das steinige Flussbett des Capricorn Creek. Die anschließende Stille jagte Patrick einen Schauer durch den Körper.
Obwohl er wusste, dass niemand solch einen grauenhaften Unfall überleben konnte, schonte er weder sich noch Minerva, um so schnell wie möglich zu den Seewalds zu kommen. Hastig sprang er im Bogen der Kurve aus dem Sattel. Er stürzte auf die schmutzige Straße, wobei er sich die Hose an den Knien aufriss und sich Hautabschürfungen an Hand und Unterarm zuzog, sprang jedoch sogleich wieder auf, um zum Flussbett hinunterzurennen.
Anna Seewald war beim Aufprall aus dem Wagen geschleudert worden und lag mehrere Schritte vom Wrack entfernt mit dem Gesicht nach unten zwischen den rundgewaschenen Steinen. Patrick drehte sie vorsichtig um und stieß einen erstickten Schrei aus, als er sah, wie schrecklich zugerichtet sie war. Ihr konnte kein Sterblicher mehr helfen. Er zog sie schnell hoch ins Gras, zerrte die zerfetzte Schürze vom Körper der Toten und bedeckte damit ihr Gesicht.
Ludwig Seewald fand er auf der anderen Seite des völlig demolierten Automobils, ein Bein im zusammengestauchten Blech verklemmt. Seltsamerweise hatte ihn der Unfall nicht halb so schlimm entstellt wie seine Frau, aber tot war er natürlich auch – und das wohl schon, bevor der Wagen sich noch überschlagen hatte, wie Patrick annahm.
Es kostete ihn einige Mühe, das eingeklemmte Bein aus der metallenen Klammer zu befreien und den schweren Körper des Winzers auf die andere Seite des Bachlaufes und ein Stück den Hang hinauf zu hieven. Als er ihn neben den Leichnam seiner Frau legte, näherte sich oben auf der Straße aus der Richtung von Finnegan’s Park ein Wagen.
Patrick blickte auf und sah die vertraute, burgunderrote Karosserie des Lanchester, den sein Bruder steuerte – und mit einem abrupten Bremsmanöver mitten in der Kurve zum Stehen brachte. Die Reifen radierten über Sand und Steine und wirbelten zu der Staubfahne, die der Wagen auch so schon wie eine rotbraune Schleppe hinter sich hergezogen hatte, eine zusätzliche Wolke auf.
Douglas sprang mit einer eleganten Grätsche aus dem Wagen, ohne den Wagenschlag zu öffnen.
»Die Seewalds sind mit ihrem Talbot verunglückt! Sie sind beide tot!«, rief Patrick ihm mit zitternder Stimme zu, die seine Erschütterung nicht verbergen konnte. Aus seinem Gesicht war jegliche Farbe gewichen.
»Na, dann ist ja kein Grund zur Eile«, meinte Douglas trocken und kam ohne Hast den kleinen Abhang hinunter.
Der Schock saß Patrick noch derart in den Gliedern, dass er diese gefühllose Bemerkung seines Bruders zuerst gar nicht richtig registrierte. »Ich glaube, Ludwig Seewald ist schon vorher verstorben«, sagte er und berichtete stockend, was er beobachtet hatte. »So verdreht, wie er im Sitz hing, war er zumindest bewusstlos. Oder er hat einen Herzinfarkt erlitten. Sicher bin ich mir natürlich nicht, aber das ändert jetzt auch nichts mehr an dieser Tragödie!«
Douglas blickte ohne großes Mitgefühl auf die beiden Toten hinunter und zuckte die Achseln. »Der alte Seewald ist selber schuld. Er hätte besser daran getan, Vaters blendende Offerte anzunehmen, anstatt sich so aufzuspielen. Lächerlich von ihm zu glauben, er könnte sein heruntergewirtschaftetes Weingut noch vor dem Ruin bewahren. Na ja, für diese Dummheit hat er jetzt einen viel höheren Preis bezahlt, als wenn er seinen unabwendbaren wirtschaftlichen Bankrott eingesehen und Maralinga an uns verkauft hätte«, erwiderte er ungerührt. »Jetzt werden wir sein Weingut sogar noch um einiges billiger bekommen.«
Patrick sah ihn entrüstet an. »Wie kannst du nur so etwas Gefühlloses denken, geschweige denn aussprechen, wo die Seewalds hier vor deinen Augen liegen und ihre Körper noch nicht einmal kalt sind?«, warf er ihm vor.
»Weil es nun mal die Wahrheit ist – und weil Geschäfte bekanntlich nichts mit Gefühlen, sondern mit Tatsachen und Zahlen zu tun haben«, antwortete Douglas völlig unbeeindruckt vom Vorwurf seines Bruders. »Ich habe die Seewalds mit ihrem frommen Getue nie gemocht, und ich denke nicht daran, jetzt etwas zu heucheln, was ich nicht empfinde. Diesen sentimentalen Quatsch überlasse ich gerne dir. In solchen Sachen bist du ja unübertroffen. Wirklich schade, dass du kein Mädchen geworden bist, dann hätte dir dieses Getue noch besser zu Gesicht gestanden.«
»Sehr witzig!«
Douglas zog sein Zigarettenetui hervor und ließ es aufschnappen.
»Du steckst dir hier besser keine Zigarette an! Oder riechst du nicht das Benzin, das da ausläuft?«, warnte Patrick ihn verdrossen und deutete auf die Pfütze, die sich unter dem Wrack rasch ausbreitete.
»Klar rieche ich es, sehr gut sogar«, erwiderte Douglas, steckte sich aber dennoch eine Zigarette zwischen die Lippen, riss ein Streichholz an und setzte die Zigarette in Brand. Dann zögerte er jedoch und zog die Stirn kraus. »Mhm, vielleicht sollte ich hier ja wirklich nicht rauchen.«
»Ja, das wäre wirklich …« Weiter kam Patrick allerdings nicht, denn in diesem Moment tat Douglas etwas ihm Unbegreifliches: Sein Bruder machte zwei schnelle Schritte nach vorn, beugte sich vor und schleuderte das brennende Streichholz in Richtung Benzinlache, um dann sofort einen Satz nach hinten zu machen. Flackernd flog das Zündholz durch die Luft und fiel in einen der armlangen Ausläufer der Gasolinpfütze.
Eine gewaltige Stichflamme, begleitet von einem dumpfen Knall und einer spürbaren Druckwelle, schoss aus dem Bachbett hoch und hüllte das Wrack augenblicklich in ein Meer von Flammen.
»Bist du verrückt geworden?«, schrie Patrick entsetzt und taumelte vor der Flammenwand zurück, deren lodernde Hitze ihm wie der heiße Atem eines Raubtieres ansprang. »Warum hast du das getan? Hast du vergessen, wie trocken hier alles ist? Damit kannst du einen Buschbrand auslösen!«
Douglas schnippte seine Zigarette ins Feuer. »Du bist und bleibst ein Hasenfuß, Halbbrüderchen«, spottete er. »Hier im Bachbett ist nicht viel, was brennen könnte. Aber ich werde gleich ein paar von unseren Leuten zum Löschen schicken, damit du dir nicht in die Hose machst.« Und nach einer kurzen Pause fügte er noch mit einem spitzbübischen Lächeln hinzu: »Damit wir nicht zwei unterschiedliche Versionen vom tragischen Hergang von uns geben: Das Wrack fing Feuer, kaum dass wir die beiden Toten in Sicherheit gebracht hatten. Alles andere würde ja auch sehr abenteuerlich klingen, findest du nicht auch?« Er klopfte ihm kurz auf die Schulter, wandte sich um und kehrte auf die Straße zu seinem Wagen zurück.
Fassungslos sah Patrick ihm nach. Manchmal hasste er Douglas mit einer derart blindwütigen Kraft, dass er glaubte, zu allem fähig zu sein. So wie in diesem Augenblick. Und dieses hasserfüllte Verlangen machte ihm mehr Angst, als Douglas ihm je hätte einflößen können.
4
Nach der schweißtreibenden Arbeit im Klostergarten genoss Lena die Kühle im Arbeitszimmer von Schwester Dominika, die im Konvent der Sisters of the Sacred Heart schon seit vielen Jahren das verantwortungsvolle Amt der Novizenmeisterin ausübte. Sich im Sommer vor der brütenden Hitze in diesen kühlen Raum zurückziehen zu dürfen, machte jedoch nur einen Teil der beglückenden Empfindung aus, die Lena erfüllte. Mehr noch als die belebende Kühle schätzte sie die regelmäßigen Lehrstunden mit Schwester Dominika, die sie seit ihrem Eintritt in den Konvent täglich eine Stunde in Bibelkunde, Spiritualität und der rechten klösterlichen Lebensweise unterwies.
Schwester Dominika, die schon auf die fünfzig zuging, war von kleinem, zarten Wuchs, überragte jedoch alle im Kloster, was ihre geistigen Fähigkeiten anging. Ihr theologisches Wissen erstreckte sich über viele Fachgebiete und reichte in geistige Tiefen, die Lena nur erahnen konnte. Und von welch hervorragender Qualität ihre Betrachtungen zum Alten Testament, zu Fragen der Psalmenauslegung und der Spiritualität im Karmel waren, bezeugte die Veröffentlichung mehrerer theologischer Bücher in angesehenen Fachverlagen. Zudem besaß sie im Gegensatz zur manchmal einschüchternden Strenge vieler Mitschwestern ein ungemein gewinnendes, sanftmütiges Wesen, das ebenso von geistiger Regheit wie von Verständnis, Geduld und feinsinnigem Humor geprägt wurde.
Lena bewunderte die Novizenmeisterin fast so sehr, wie sie die heilige Hildegard von Bingen verehrte, deren Vornamen sie am Tag ihres Gelübdes als Zeichen ihres neuen Lebens als geweihte Braut Christi annehmen wollte. Und sie hatte allergrößte Mühe, sich diese schwärmerische Bewunderung für Schwester Dominika nicht allzu deutlich anmerken zu lassen. Denn solch eine profane Verehrung ziemte sich nicht als Nonne und galt insbesondere bei einer Novizin, die nach drei Jahren der Prüfung kurz vor ihrer ersten Profess stand, als Zeichen von Unreife und einer noch zu starken weltlichen Verbundenheit. Mutter Laurentia, die resolute Oberin, hatte schon aus weit geringerem Anlass ein Noviziat kurz entschlossen um ein volles Jahr verlängert, wie Lena zu Ohren gekommen war.
Niemand konnte sie jedoch daran hindern, sich Schwester Dominika insgeheim zum leuchtenden Vorbild zu nehmen und ihr nach besten Kräften nachzueifern. Wenn es ihr eines fernen Tages mit Gottes Hilfe und großer eigener Anstrengung gelänge, sich der Novizenmeisterin in ihrer Selbstbescheidung, ihrem Gebetsleben und ihrer Hingabe auch nur anzunähern, könnte sie wohl dankbar sein und sagen, dass ihr Gott geweihtes Leben fruchtbar gewesen sei. Ja, so wie Schwester Dominika wollte sie sein, wenn sie mit fünfzig auf ihr Leben und ihre Entwicklung als Braut Christi zurückblickte. Und sie nahm nicht an, dass sie Father MacKinnon, dem Beichtvater ihres Konvents, von diesen schwärmerischen Gedanken erzählen musste. Bei ihrer regelmäßigen Gewissenserforschung, der sie sich stets mit großer Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit unterzog, war sie bislang immer noch zu dem Schluss gekommen, dass solche Gedanken in die Kategorie der lässlichen Sünden fielen. Ein zusätzliches Rosenkranzgebet reichte völlig aus, um für diese Schwäche angemessen Buße zu tun.
»Wir wollen uns heute weiter mit den Doppelgleichnissen beschäftigen, die uns Matthäus im Kapitel 13, Vers 44 bis 46 überliefert hat«, erklärte Schwester Dominika, nachdem Lena neben ihr auf einem der Holzstühle Platz genommen hatte. »Aber lass uns vorher noch einmal rekapitulieren, was wir gestern bei der Auslegung des Sämannsgleichnisses als Kern der Botschaft herauskristallisiert haben.«
Lena räusperte sich. »Nun, dass der Samen des Evangeliums ausgesät ist und Gottes Reich heranreift, mag auch die zerstörerische Kraft der Widersacher noch so groß sein. Und dass Gott sich in der Welt, wie verdorben und verkommen und unrettbar sie uns auch scheinen mag, doch durchsetzen und seine Verheißungen erfüllen wird.«
»Ja, aber er greift nicht mit Gewalt in die Geschichte der Welt ein und zerstört sie, um sein Reich zu errichten, wie es die Apokalyptiker lehren«, führte Schwester Dominika den Gedanken noch einmal zur Vertiefung aus. »Jesus bedient sich zwar manchmal apokalyptischer Bilder, ist aber kein Apokalyptiker, sondern weist die Lehren der jüdischen Apokalyptik sogar ausdrücklich zurück. Das beweisen ganz eindeutig seine Wachstumsgleichnisse. Er spricht dort nicht abstrakt vom Weltenbaum, sondern er verweist uns mit seinen Bildern vom winzigen Senfkorn auf den ganz alltäglichen Gemüsegarten und beim Gleichnis vom Sauerteig auf das, was jede Hausfrau jeden Tag tut – nämlich Mehl mahlen, Sauerteig kneten und Brot backen. Und er berichtet von den dürren, armseligen Ackern Palästinas, die voller Steine, Disteln und Dornen sind, wenn er die Geschichte mit dem Sämann erzählt. So, und nun wollen wir uns mit den glücklichen Findern einzigartiger Schätze befassen – und mit der Frage, wie sich die Macht Gottes und die Freiheit des Menschen vereinbaren lassen.«
Lena wusste, was sie zu tun hatte. Sie schlug ihre Bibel auf und las die betreffende Stelle vor: »›Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie.‹« Erwartungsvoll blickte sie von der Heiligen Schrift auf.
»Was, meinst du, verbirgt sich hinter der Offensichtlichkeit dieser beiden Geschichten?«, fragte die Novizenmeisterin.
Lena überlegte kurz. »Die Finder sind von dem, was sie gefunden haben, dermaßen überwältigt, dass sie alles, was ihnen bisher wert und teuer gewesen ist, umgehend verkaufen, um diesen Schatz zu besitzen.«
Schwester Dominika nickte. »Und für was stehen der Schatz im Acker und die besonders wertvolle Perle in den beiden Gleichnissen?«
»Für das Evangelium, den Glauben an den Herrn, das Reich Gottes«, antwortete Lena, ohne zu zögern.
Schwester Dominika lächelte. »Richtig, aber dies ist eigentlich erst die vordergründige Bedeutung. Denn Jesus vergleicht die Gottesherrschaft nicht einfach nur mit diesem Schatz und der Perle, er vergleicht sie vielmehr mit dem ganzen Vorgang, nämlich wie die Männer auf ihre Schätze stoßen und dann auf den Fund reagieren.«
Lena zog leicht die Stirn kraus, weil sie nicht recht wusste, worauf die Novizenmeisterin hinauswollte.
»Sehen wir uns doch einmal den Mann an, der den Schatz im Acker gefunden hat«, begann Schwester Dominika ihre Auslegung der Gleichnisse. »Er ist vermutlich ein armer Tagelöhner gewesen, weil er all sein Hab und Gut verkaufen musste, um diesen Acker überhaupt erwerben zu können. Und er hat, im Gegensatz zu dem Händler, gar nicht nach einem Schatz gesucht, das ist ganz wichtig bei diesem Gleichnis. Er war wohl mit vielen anderen Dingen beschäftigt, als er plötzlich zufällig auf den Schatz stieß – so wie es eben viele Menschen gibt, die – obwohl sie gar nicht nach Gott gesucht haben – durch irgendeinen Zufall unvermittelt auf Gott stoßen und von ihm überwältigt sind.«
Lenas Gesicht leuchtete auf. »Natürlich!«, rief sie. »Und der Perlenhändler stellt die andere Sorte von Menschen dar, die schon lange auf der Suche sind und endlich das finden, wovon sie all die Jahre geträumt haben!«
Schwester Dominika lächelte anerkennend. »Ja, der arme Tagelöhner und der reiche Händler geraten aus absolut unterschiedlichen Ausgangssituationen an genau denselben Punkt, aber von da an unterscheidet sie nichts in ihrem Handeln. Beide Finder wissen sofort, was sie zu tun haben, und sie zögern nicht einen Augenblick in ihrer Entscheidung. Sie sind vom Glanz des Schatzes und der einzigartigen Schönheit der Perle dermaßen überwältigt, dass sie auf der Stelle all ihre Besitztümer verkaufen, um in den Besitz des Schatzes zu gelangen.«
»Weil alles andere vor dem Glanz des Gefundenen, vor Gottes Ruf verblasst!«, warf Lena mit echtem Novizeneifer und strahlenden Augen ein.
»Bedeutsam ist dabei, im Blick zu halten, dass das Gewicht bei dieser Parabel nicht auf dem Verkaufen all des Hab und Gutes liegt«, betonte die Novizenmeisterin, »sondern auf der Faszination, der übergroßen Freude und dem unstillbaren Verlangen, die von diesem einzigartigen Fund ausgehen. Es fällt diesen Menschen überhaupt nicht schwer, alles für ihren Schatz wegzugeben. Im Gegenteil: Sie wissen, dass sie im tieferen Sinne des Wortes das Geschäft ihres Lebens machen. Aber wir wollen nicht aus den Augen verlieren, dass jeder Mensch die Freiheit hat, Ja oder Nein zu Gott zu sagen, und dass die Kosten dieser Freiheit hoch sind, manchmal sogar erschreckend hoch.«
Lena setzte zu einer Frage an, wurde aber durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen.
»Ja, bitte?«, rief Schwester Dominika.
Die Tür öffnete sich, und Schwester Benedikta trat einen Schritt ins Zimmer. Die korpulente Nonne, die etwa im Alter der Novizenmeisterin sein musste und mit recht herrischer Hand über das Küchenreich des Klosters regierte, entschuldigte sich für die Störung und sagte dann: »Die Mutter Oberin schickt mich. Ich soll ausrichten, dass sie mit ihr sprechen muss!« Dabei deutete sie mit dem Kopf in Richtung Lena, anstatt sie direkt anzusprechen. »Und sie soll unverzüglich kommen. Die Mutter Oberin erwartet sie in ihrem Arbeitszimmer!«