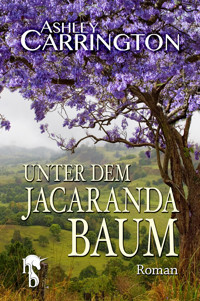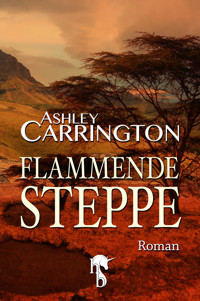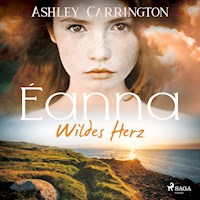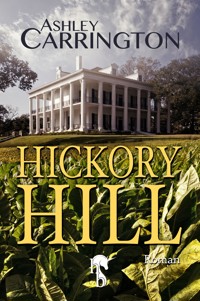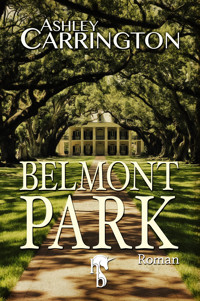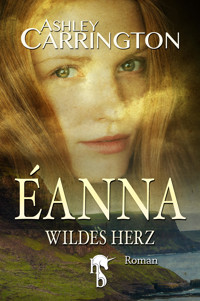
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Irland, 1845: Mehrere Missernten führen das ganze Land in eine schreckliche Hungersnot. Wie so viele verliert auch Éanna ihr Zuhause und ihre Familie. Bettelarm und ganz auf sich allein gestellt, kämpft sie fortan jeden Tag aufs Neue ums Überleben. Bis sie auf Brendan Flynn trifft, der einen Ausweg aus ihrer verzweifelten Lage zu kennen scheint: Ihre letzte Chance ist die rettende Schiffspassage nach Amerika. Doch dafür müssen die beiden erst das nötige Geld auftreiben. Und kann Éanna dem jungen Iren überhaupt vertrauen? Band 1 der Éanna-Reihe von Ashley Carrington.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ashley Carrington
Éanna
Wildes Herz
Roman
Prolog
Nie sollte Éanna Sullivan jene verhängnisvolle Sommernacht vergessen, in der alles begann und das entsetzliche Unheil lautlos wie ein Dieb in der Nacht seinen Anfang nahm. Bis ans Ende ihrer Tage verfolgten sie der heimtückische Nebel und die Prophezeiung von Granny Kate.
In jener Nacht erwachte Éanna Sullivan aus den wirren Träumen ihres Schlafs, weil etwas über ihr Gesicht strich. Es fühlte sich wie eine schwielig raue Hand an, die im Vorübergehen ihre Wange streifte. Sie schlug die Augen auf. Das letzte Stück Torf glimmte noch im Feuer. Der schwache Schein vermochte nicht viel gegen die nächtliche Dunkelheit in dem einzigen Raum der Bauernkate auszurichten. Er reichte gerade noch aus, um die Umrisse ihrer Eltern und vier Geschwister erkennen zu können. Wie schutzsuchend lagen sie dicht gedrängt auf dem harten, festgestampften Erdboden. Doch zwischen ihrer Mutter und ihrer Schwester Mary klaffte ein Spalt, die dünne Strohmatte war leer. Dort hatte Granny Kate Donnegan, die Großmutter, ihren angestammten Schlafplatz auf dem Lehmboden.
Ein leises Knarren kam von der Tür. Éanna drehte ihren Kopf zur anderen Seite und erhaschte einen Blick auf ihre Großmutter, die in diesem Moment durch den Türspalt hinaus in die Nacht schlüpfte. Jetzt wusste sie, was sie aufgeweckt hatte. Es musste ein Zipfel von Granny Kates Umhang gewesen sein, als die Großmutter an ihr vorbei zur Tür geschlichen war. Doch was trieb Kate bloß zu dieser nächtlichen Stunde aus dem Haus? Nach den vielen Regentagen der vergangenen Wochen saß ein hartnäckiger Husten in ihrer Brust und wollte einfach nicht weichen.
Éanna überlegte nicht lange. Da sie nun schon mal wach war, konnte sie auch ebenso gut aufstehen und ihrer Granny nach draußen folgen. Zu groß war ihre Neugier, was Kate bewogen haben mochte, sich der feuchten Nachtkühle auszusetzen.
Éanna fand ihre Großmutter hinter der Lehmhütte. Ihre hagere, nach vorn gekrümmte Gestalt stand vor ihrem Kartoffelfeld, das sich über den sanft ansteigenden Hang eines Hügels erstreckte. Oben auf der Kuppe hoben sich Bäume und Strauchwerk als schwarze Silhouetten vor dem bewölkten Nachthimmel ab. Nur wenig Mondlicht fiel durch einige Löcher in der Wolkendecke und warf hier und da helle Flecken auf das Land.
Reglos stand Kate am Rand des Kartoffelackers, der bald reif zur ersten Ernte sein würde, und wandte nicht den Blick vom Hügel. Sie schaute sich nicht einmal um, als Éanna sich in ihrem Rücken mit einem herzhaften Gähnen bemerkbar machte.
Éanna trat neben sie, um zu sehen, was ihre Großmutter so aufmerksam zur Anhöhe blicken ließ. Sie konnte jedoch nichts Bemerkenswertes entdecken. Nur einige zerfranste Nebelschleier trieben dort oben heran und wogten wie milchiger Schaum über die niedrigen Ginsterbüsche zwischen den beiden Weißdornbäumen.
»Warum bist du aufgestanden, Granny? Konntest du nicht schlafen oder hat dich hier irgendetwas geweckt? Treibt sich jemand da oben herum?« Éanna wusste nicht genau, weshalb sie ihre Stimme senkte, aber sie hatte das Gefühl, dass es besser sei, leise zu sprechen.
Granny Kate gab ein trockenes Husten von sich und zog den alten, verschlissenen Umhang fester um ihre hageren Schultern.
»Da, sieh nur!«, raunte sie heiser, und ihre knochige Hand deutete den Hügel hinauf. »Da kommt er! Er hat den Streit für sich entschieden.«
Éanna war beklommen zumute. Granny Kate sah manchmal Gesichter und Dinge, die anderen verborgen blieben. Sie wusste Geschichten über Geisterwesen zu erzählen, die einem eisige Schauer durch den Körper jagten und Gänsehaut auf die Arme trieben.
Die Leute in ihrem Bezirk von Galway sagten, Kate Donnegan habe das dritte Auge. So mancher mied sie deshalb und schlug lieber einen großen Bogen, als ihr über den Weg zu laufen. Sogar in der Dorfkirche blieb der Platz neben ihr häufig leer.
»Meinst du den Nebel?«, wisperte Éanna und wünschte sich plötzlich, sie wäre im Haus beim Feuer liegen geblieben. Denn nun hegte sie keinen Zweifel mehr, dass ihre Großmutter etwas sah, das ihr, Éanna, sicherlich Angst machen würde, wenn sie davon erfuhr.
Auf einmal erschienen ihr die Nebelschleier unheimlich. Hatten sie nicht einen beunruhigend ungewöhnlichen Stich ins Blauschwarze? Und konnten das nicht Geisterarme mit spinnenlangen Fingern an ihren Enden sein, die da links und rechts lautlos hinter dem Dickicht hervorglitten und sich ihrem Kartoffelfeld entgegenstreckten? Ja, so sah es aus! Als würden sich dort milchig blaue Klauenhände auf die oberen Reihen der kräftigen Kartoffelpflanzen legen, Klauenhände, die lang und immer länger wurden! Aber zum Weglaufen war es nun zu spät. Das würde die Großmutter nicht dulden. Dem Unabänderlichen im Leben müsse man immer mutig ins Auge blicken und ihm nie den Rücken zukehren, war einer ihrer gestrengen Regeln. Wer sich nicht daran hielt, dem sitze das Unheil noch viel boshafter im Nacken als demjenigen, der sich ihm furchtlos stelle.
»Es ist nicht nur Nebel, Kind«, raunte Granny Kate. »Das, was du da siehst, ist Fear Liath, der Graue Mann!«
Éanna stellten sich die Nackenhaare auf. Sofort schob sie ihre Hände in die weiten Ärmel ihres Kleides und verschränkte die Arme vor der Brust, als könnte sie das schützen. Fear Liath, der Graue Mann, war das gefürchtetste aller Geisterwesen, die in den irischen Mooren, Seen und Bergen hausten und sich nächtens am Himmel bekämpften. Nicht wenige Iren stellten an den Orten, die sie für von Geistern bewohnt glaubten, sogar Holzschalen mit Milch und anderer Nahrung als Opfergaben auf, um sie freundlich zu stimmen.
»Er hat die anderen Geister vertrieben, weil er sie für sich allein will«, fuhr Granny Kate mit unheilvoller Stimme fort. »Und jetzt kommt er, um sie sich zu holen!«
Éanna brauchte nicht zu fragen, was Kate mit »sie« meinte. Es waren immer die Kartoffeln, um die sich Geisterwesen wie der Graue Mann mit anderen Fairies stritten. Sie wollten den Iren die Erdfrucht rauben und sie dadurch ins Elend stürzen. Dabei waren die Kartoffeln für die bitterarme Landbevölkerung Irlands das Einzige, was sie vor dem Verhungern bewahrte. Die Sommerzeit hieß nicht nur bei den Sullivans, sondern auch bei fast allen anderen Bauern nur »Sommerhunger«. Denn der knappe Vorrat an Haferflocken, den sie spätestens im Mai bei den Kaufleuten für sündhaft viel Geld kaufen mussten, reichte nie bis zur ersten Kartoffelernte im späten August. Er musste arg gestreckt werden. Dann gab es tagaus, tagein nur wässrigen Porridge und dünne Kohlsuppen, selten einmal einen Hering. An Eierspeisen oder gar Fleisch war nicht zu denken. Und so wartete jeder voller Ungeduld darauf, dass die Felder endlich reif wurden und ihren Segen freigaben. Und nur wenn diese und die zweite Ernte im Oktober gut ausfielen, konnte eine Familie ohne allzu große Angst dem langen Winter entgegensehen. Es waren diese Kartoffeln, die ihr Überleben sicherten, nach denen der unersättliche Graue Mann jetzt seine Hände ausstreckte!
»Vielleicht irrst du dich diesmal, Granny«, sagte Éanna und hatte Mühe, das Zittern in ihrer Stimme zu unterdrücken. »Vielleicht ist das dort wirklich nur gewöhnlicher Nebel!«
Kate Donnegan schüttelte den Kopf. »Oh nein, es ist der Graue Mann! Sieh nur, wie er über das Feld fährt. Er will alles. Jede Pflanze, die er berührt, gehört ihm. Und er wird nicht eine auslassen.«
»Du machst mir Angst«, flüsterte Éanna. Der Nebel wurde dichter und wallte nun von allen Seiten den Hang hinunter. Immer mehr Kartoffelreihen verschwanden unter seiner Decke. Dabei wogte das milchige Weiß auf und ab, als würde Fear Liath alle Kartoffeln aus dem Boden reißen und sie mit maßloser Gefräßigkeit verschlingen. Nicht mehr lange, und die ersten Schlieren würden sie erreicht haben.
»Lass uns zurück ins Haus gehen.«
Granny Kate verharrte noch einen langen Moment am Fuß des Kartoffelfeldes. Sie schien den wabernden Nebelschwaden – nein, dem Grauen Mann die Stirn bieten zu wollen. Erst als der Husten sie wieder überfiel, drehte sie sich um.
»Er nimmt uns alles. Der Winter wird bitter, Kind«, prophezeite sie. Ihre Stimme klang dabei so ruhig, als hätte sie eine so gewöhnliche und unumstößliche Tatsache wie das Fallen der Blätter im Herbst ausgesprochen. »Du wirst tapfer sein müssen, Éanna. Du bist jetzt schon dreizehn und die Älteste. Du wirst deinen Geschwistern ein Vorbild sein müssen. Denn wir werden hungern, Éanna. Hungern wie nie zuvor.«
Am nächsten Morgen bedeckte ein dicker bläulicher Nebel das Land, so weit das Auge reichte. Gegen Mittag verdunkelte sich auch noch die Sonne. Sie schien ihr Antlitz verhüllen zu wollen, um das Unheil nicht länger anschauen zu müssen. Der Himmel trug eine bedrohliche Farbe, wie sie selbst die Ältesten nie zuvor gesehen hatten.
Drei schrecklich lange Tage hielt sich der Nebel. Seltsamerweise konnte man in der beklemmenden Stille dennoch eine Stimme auf eine Meile Entfernung hören. Es war, als hielte das Land entsetzt den Atem an. Dann endlich löste sich der Nebel auf und gab den Blick frei auf die Katastrophe.
Auf allen Feldern waren die Kartoffelpflanzen wie kraftlos zusammengefallen. Blätter und Stiele hatten sich schwarz verfärbt. Ein entsetzlicher Gestank von Fäulnis trieb mit dem weichenden Nebel über das Land. Er verkündete auch noch dem Ahnungslosesten, welch entsetzliches Unglück Irland heimgesucht hatte.
Granny Kate erlebte den grauenvollen Winter und den großen Hunger nicht mehr. Als die erste und auch die zweite Ernte des Jahres 1845 überall nur schwarze, verfaulte Kartoffeln zutage brachte, lag sie schon in ihrem Grab auf dem Friedhof hinter der Dorflärche. Ihr Tod bewahrte sie auch davor, die verfaulten Kartoffeln und kläglichen Ernten der nächsten beiden Jahre zu durchleiden. Und er ersparte ihr die Tragödie, mit ansehen zu müssen, wie ihr Schwiegersohn und vier ihrer Enkelkinder nacheinander der bitteren Hungersnot zum Opfer fielen und neben ihr an der Steinmauer zu ihrer letzten Ruhe gebettet wurden.
1. Kapitel
Ein nur leicht bewölkter, sonniger Himmel warf sein mildes Septemberlicht über das Hinterland von Galway. Doch nicht ein Schimmer davon drang in die armselige Bauernkate der Sullivans. Die geschlossenen Schlagläden verdunkelten die beiden schmalen Fenster neben der Tür, die ebenfalls zugezogen war.
Éanna wusste, dass es nichts nutzen würde, hier im Dunkeln zu sitzen und leise zu beten. Das Wunder, das sie herbeiflehten, würde nicht eintreten. Nichts konnte Henry Burke davon abhalten, sie die unerbittliche Härte des Herrn von Parkmore Manor spüren zu lassen. Er würde die Befehle, die er von Esquire Francis Bland Russell erhalten hatte, ohne das geringste Mitleid ausführen.
»Lass uns noch einen Rosenkranz beten!«, sagte Éannas Mutter mit zitternder Stimme in der Dunkelheit. Es roch im Raum nach kaltem Rauch und Angst. Das Torffeuer war erloschen, die Glut erkaltet. So etwas war in ihrem Haus noch nie passiert. Es war ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Frau des Hauses darüber wachte, dass zu jeder Tages- oder Nachtzeit wenigstens Glut unter der Asche war. Wer in seinem Haus das Feuer erlöschen ließ, der taugte nicht als Ehefrau und Mutter und brachte Schande über den Familiennamen.
»Es wird uns nichts helfen, Mutter«, wandte Éanna ein, und die Angst schnürte ihr die Kehle zu. »Es wird geschehen, wie es schon so viele getroffen hat.«
»Du darfst nie den Glauben verlieren, Éanna«, wies Catherine Sullivan sie mit brüchiger Stimme zurecht.
Éanna schwieg und murmelte wie verlangt den Rosenkranz. Ihre Mutter war immer eine starke Frau gewesen. Vor keinem hatte sie den Blick gesenkt, weder vor Father Murphy noch vor Henry Burke und auch nicht vor dem Esquire. Sie mochte eine arme Pächtersfrau sein, aber ihren Stolz hatte sie sich nicht nehmen lassen. Und nie hatte sie das Feuer ausgehen lassen. Niemals!
Éanna hatte ihre Mutter für all das bewundert, zu ihr aufgeschaut und sich schon als kleines Kind vorgenommen, so wie sie zu werden.
Doch wie wenig war von dieser einstigen Stärke noch geblieben! Das Elend war nicht nur ihrem abgemagerten Körper anzusehen. Die Hoffnungslosigkeit stand ihr ins Gesicht geschrieben, das in den letzten beiden Jahren so bestürzend schnell gealtert war. Seit der Vater vor zwei Monaten im Steinbruch verunglückt und bald darauf gestorben war, hatten Angst und die Gewissheit, vom Schicksal nun endgültig geschlagen zu sein, scheinbar das letzte Aufbegehren in ihr zum Verlöschen gebracht.
Unten von der Biegung der Straße, wo die wenigen noch lebenden Familienmitglieder der McDermots und der Crowleys wohnten, drangen herrische Stimmen, die ohnmächtigen Flüche eines Mannes und das Klagen von Frauen gedämpft zu ihnen herauf.
»Bitte für uns Sünder …«, murmelte Kate Sullivan.
»Gleich werden sie bei uns sein«, sagte Éanna. Sie hob den Kopf. Lange würde es nicht dauern, was Henry Burke und seine Männer dort bei den Nachbarn im Auftrag des englischen Großgrundbesitzers zu tun hatten. »Lass uns gehen, Mutter!«
Die magere Hand von Catherine Sullivan tastete in der Dunkelheit nach ihrer Tochter und hinderte sie am Aufstehen. »Nein! Du bleibst. Mit uns wird er Erbarmen haben. Die Crowleys haben noch ihren Vater.«
Éanna lachte bitter auf. »Es geht dem Esquire doch nicht darum, bei welchen Pächtern der Mann noch lebt«, erwiderte sie zornig. Für einen Moment vergaß sie ihre eigenen Ängste. »Es geht allein um die Pacht, Mutter! Nur ums Geld geht es! Und wir haben nicht einmal einen halben Shilling. Geschweige denn die vielen Pfund, die wir im Rückstand sind!«
»Bete mit mir!«, befahl Catherine Sullivan.
Trotzig presste Éanna die Lippen zusammen. Noch vor wenigen Monaten hätte sie nicht gewagt, den Befehl ihrer Mutter zu verweigern, doch der Hunger hatte alles geändert.
»… jetzt und in der Stunde unseres Todes.«
Catherine ließ den Rosenkranz sinken. Es war so weit. Der Hufschlag von mehreren Pferden und das Klirren von Waffen waren zu vernehmen. Die Geräusche wurden rasch lauter. Die Männer kamen die Straße hoch zur letzten Hütte am Ende des gewundenen Weges, der von der Landstraße zum Dorf abzweigte. Zur Kate der Sullivans.
»Catherine Sullivan«, ertönte die Reibeisenstimme von Henry Burke. »Im Namen von Esquire Russell, komm raus mit deiner Tochter! Auf der Stelle raus da, oder ich lasse euch die dreckige Hütte über dem Kopf anstecken!« Einem seiner Begleiter rief er herrisch zu: »Hugh, reiß Reet vom Dach und mach eine Fackel daraus! Ich werde nicht lange bitten. Wir haben heute noch mehr zu erledigen!«
»Vielleicht wäre es besser für uns zu bleiben«, flüsterte Catherine.
Éanna sprang auf. »Wie kannst du so etwas sagen, Mutter?«, keuchte sie. »Ich will nicht sterben! Und schon gar nicht bei lebendigem Leib verbrennen! Dann lieber verhungern!« Sie holte tief Luft und beugte sich zu Catherine herunter. »Jetzt komm endlich. Es hat doch keinen Zweck mehr!«
Damit packte sie den kleinen Beutel, der alles enthielt, was ihnen noch geblieben war: zwei Holzschüsseln, zwei hölzerne Löffel, die der Großvater geschnitzt hatte, zwei verbeulte Blechbecher, ein einfaches Messer, zwei gestrickte Wollmützen, eine löchrige Decke, drei Talgstummel, ein Stofffetzen mit drei Nähnadeln sowie Feuerstein, Schlagstahl und Zunder. Alles andere war längst den Weg zum Pfandleiher in Waterford gegangen. Sogar die Stiefel, den Gürtel und den Mantel des Vaters hatten sie versetzen müssen. Essen befand sich nicht im Sack. Nicht einmal ein Krümel.
Catherine fasste sich. »Du hast recht«, murmelte sie beschämt und stand auf. »Ich komme ja schon.«
Éanna war vor ihr an der Tür, klappte den Holzriegel hoch und stieß die Tür auf. Im ersten Moment war sie vom hellen Sonnenschein geblendet. Sie legte eine Hand über die Augen und blinzelte ins Licht.
»Wurde ja auch Zeit!«, knurrte Henry Burke ungnädig.
Der Verwalter von Francis Bland Russell, Engländer wie sein Herr, saß auf einer kräftigen Rotfuchsstute. Auf sein breites Kreuz hätte man eine ganze Ochsenseite legen können, ohne dass etwas von ihr seitlich hervorgeschaut hätte. Sein grobschlächtiges Gesicht war von einem dichten Vollbart umgeben. Er hielt eine Reitgerte in der Rechten und schlug sie ungeduldig auf sein Sattelhorn.
Begleitet wurde der Gutsverwalter von drei Knechten und einer sechsköpfigen Eskorte der verhassten Rotröcke. Die englischen Soldaten in ihren roten Uniformen und hohen Mützen waren mit Gewehren und Säbeln bewaffnet, als ginge es in eine Schlacht und nicht gegen wehrlose, halb verhungerte Bauern. Der kalte Stahl der aufgesteckten Bajonette funkelte wie eine stumme Drohung im Sonnenlicht. Verachtung stand in ihren verschlossenen Gesichtern.
Catherine fiel vor dem Verwalter auf die Knie. »Ich flehe Euch an, lasst uns bleiben, Master Burke! Wenigstens noch über den Winter!«, bettelte sie.
Éanna musste an sich halten, als sie sah, wie sich ihre Mutter erniedrigte. Ihn mit Master anzusprechen, obwohl er alles andere als ein solcher war, mochte ihm vielleicht schmeicheln. Aber erweichen würde sie ihn damit noch lange nicht.
»Hast du die Pacht?«, fragte Henry Burke barsch. Er wusste sehr wohl, wie überflüssig die Frage war.
»Woher sollten wir das Geld nehmen, Master?«, fragte Catherine leise und rang verzweifelt die Hände. »Ihr wisst selber, wie entsetzlich wenig die letzte Ernte gebracht hat. Nicht einmal ein Siebtel des Üblichen. Nur für einen Monat hat es trotz Hungern gereicht. Und wo wir doch so gut wie kein Saatgut mehr hatten …«
»Du hast die ausstehende Pacht also nicht!«, fiel der Verwalter ihr ins Wort.
»Nein, Master Burke.«
»Dann mach, dass du aus dem Weg kommst, Weib! Und lieg mir nicht mit euren verfluchten Kartoffeln in den Ohren!«, blaffte er. »Ihr seid selber schuld an eurer Misere. Warum habt ihr all die Jahre diese elende Sorte angebaut, die doch nur als wässriges Pferdefutter taugt?«
»Weil diese Kartoffeln eine größere Ernte abwerfen und sich länger in den Vorratsgruben und auf den Brettern unterm Dach halten, wie jeder Dummkopf weiß, wenn er nicht gerade Engländer ist!«, hätte Éanna ihm am liebsten zugerufen, doch sie biss sich auf die Lippen. Wozu Worte verlieren, die sie ebenso gut gegen eine Wand hätte sprechen können?
»Aber so war es doch immer, Master!«, schluchzte ihre Mutter.
»So war es immer! So war es immer!«, äffte Henry Burke sie verächtlich nach. »Nun, jetzt ist endlich Schluss mit euren stinkenden Pferdekartoffeln. Der Esquire will euch Lumpenpack, das ständig die Pacht schuldig bleibt, nicht länger auf seinem Land haben. Der Dreck wird untergepflügt, und dann entstehen hier Schafsweiden. Das wirft wenigstens etwas ab. Und jetzt verschwindet endlich!«
Seine drei Gutsknechte herrschte er an: »Was steht ihr denn noch so faul herum? An die Arbeit, Männer! Aber ein bisschen flott! Na los, reißt die stinkende Hütte ein!«
Einer der Knechte lenkte sein Pferd an die niedrige Kate heran und kletterte aus dem Sattel auf das Dach. Ein anderer warf ihm ein Seil mit einem dicken Eisenhaken am Ende zu. Der Mann auf der Kate riss die Reetabdeckung auf, legte den Haken um den obersten Dachbalken und kletterte wieder hinunter.
Augenblicke später spannte sich das Seil unter der Zugkraft des Pferdes, und der Längsbalken brach an beiden Giebelseiten aus dem Mauerwerk aus Lehm und Astgeflecht. Er riss im Sturz das ganze Dach ein und nahm dabei auch gleich noch die Hälfte des Kamins mit. Die splitternden Latten und die Reetmatten der Abdeckung stürzten in den Innenraum und begruben unter sich, was einmal das Heim der Sullivans gewesen war. Staub, Dreck und Reet wirbelten auf.
»Reißt auch die Wände ein, damit keiner von dem Gesindel auf die Idee kommt, sich hier heimlich verkriechen zu wollen!«, befahl der Verwalter.
Mit dem hakenbewehrten Zugseil, Äxten und schweren Brechstangen rückten die drei Gutsknechte den Lehmmauern zu Leibe.
Éanna schnürte es beim Anblick ihrer brutalen Zerstörungswut Herz und Kehle zu. »Komm, Mutter«, presste sie hervor und zog Catherine auf die Beine. Sie konnte nicht länger mit ansehen, wie die Knechte des Esquire ihr Zuhause einrissen. Hier war alles verloren.
Tränen strömten ihrer Mutter über das ausgemergelte Gesicht.
»Wo sollen wir denn hin? Was soll werden?«, weinte sie.
»Psst, Mutter.« Éanna zog sie hoch. »Wir finden eine Lösung. Es gibt immer einen Weg, das hast du selbst vor nicht allzu langer Zeit gesagt.«
Catherine sah sie in stummer Verzweiflung an, aber sie ließ sich von ihrer Tochter auf die Beine helfen, und gemeinsam kehrten sie ihrem Zuhause den Rücken.
Der entsetzliche Laut des wegstürzenden Mauerwerks begleitete sie auf ihrem Weg hinunter ins Dorf.
Seit einer Woche wütete Henry Burke mit seinen Männern auf den Ländereien des Esquire und jagte die Kleinpächter unbarmherzig auf die Straße. Und damit folgte er nur dem Beispiel vieler anderer Großgrundbesitzer, die auf ihrem Grund und Boden Massenräumungen befohlen hatten. Die ersten Dörfer in der Umgebung waren mittlerweile menschenleer. Wovon sollten die Handwerker und kleinen Krämer auch leben, wenn es rundherum keine Bauern mehr gab?
Unten auf der Landstraße stießen Éanna und ihre Mutter auf die McDermotts und die Crowleys. Ein Mann, zwei Frauen und vier halbwüchsige Kinder, von denen der fünfzehnjährige Michael McDermott das älteste war. Sie alle waren von Hunger und Hoffnungslosigkeit gezeichnet. Unschlüssig standen sie auf der Straße und fragten sich, wohin es nun gehen sollte.
Als Éanna den gleichaltrigen Michael sah, musste sie daran denken, was seine Mutter Sarah vor einem halben Jahr getan hatte.
Als ihr Mann damals gestorben war, hatte Sarah McDermott in ihrer Verzweiflung ihrem gerade sechs Wochen alten Neugeborenen die Milch verwehrt und es damit dem Tod ausgeliefert. Was sie noch an Muttermilch hatte geben können, war fortan ausschließlich ihrem ältesten Sohn Michael zugute gekommen. Er musste dringender als jeder andere in ihrer Familie am Leben bleiben. Denn er allein hatte Arbeit als Steinbrecher bei einer der öffentlichen Arbeitsprogramme gefunden, die von der englischen Krone ins Leben gerufen worden waren. Wenn auch ihn der Hunger entkräftete und er darüber seine Arbeit verlor, war das Schicksal seines neunjährigen Bruders und seiner Mutter besiegelt.
Niemand hatte Sarah McDermott deswegen einen Vorwurf gemacht. Sie hatte getan, was sie noch hatte tun können – ja, tun müssen, damit wenigstens einige von ihrer Familie die Hungersnot überlebten. Andere Mütter hatten dieselbe schreckliche Wahl treffen müssen, und nicht einmal der gestrenge Father Murphy hatte darüber auch nur ein Wort in seinen Sonntagspredigten verloren. Was hätte er auch sagen sollen? Dass in einer Familie wie die McDermotts besser alle starben, als zu entscheiden, wen es zuerst treffen und wer bei Kräften bleiben sollte?
Éanna fragte sich, ob ihre Mutter genauso gehandelt hätte, wenn es noch ein Baby gegeben hätte. Sie wusste es nicht. Ihr Vater hatte auch in der schlimmsten Zeit eisern darauf bestanden, dass alle den gleichen Anteil bekamen. Er hatte keinen Unterschied gemacht – wie entsetzlich wenig es auch gewesen war, was jeder zugeteilt bekam. Oft hatte er selbst verzichtet, obwohl er für die schwere Arbeit alle Kräfte gebraucht hätte.
Als sie sich den McDermotts und den Crowleys näherten, sah Éanna erleichtert, wie sich Catherine entschlossen die Tränen aus dem Gesicht wischte.
Michael McDermott empfing sie mit bitterer Miene. Sie erfuhren, dass die Familien beschlossen hatten, zusammen hinunter zur Küste zu ziehen, nach Galway. In der großen Hafenstadt an der Mündung des Corrib hofften sie auf Arbeit. Und notfalls wollten sie sich vor einem dieser grauenvollen Arbeitshäuser in die langen Schlangen jener einreihen, die dort um Aufnahme bettelten.
Als Michael den Sullivans anbot, sich ihnen anzuschließen, richtete Catherine sich auf und schüttelte entschieden den Kopf. »Eher sterbe ich auf der Straße, als ins Armenhaus zu gehen!«, erklärte sie.
Das erste Mal an diesem Tag spürte Éanna so etwas wie Zuversicht. Da war sie wieder – die alte Stärke ihrer Mutter, die Sicherheit, die Éanna immer an ihr bewundert hatte. Es tat gut zu hören, dass sie sich offenbar doch noch einen Rest von Stolz und Selbstachtung bewahrt hatte. Und Éanna spürte, wie sich ein bisschen davon auf sie selbst übertrug.
An der Gabelung der Landstraße verabschiedeten sie sich von den Nachbarsfamilien. Ein letzter müder Segenswunsch, und dann bogen die McDermotts und Crowleys nach links ab, wo es über die Dörfer Claregalway und Ballybrit nach Galway im Westen ging.
Éanna schlug mit ihrer Mutter die östliche Richtung ein. Hinter ihnen – zwischen den herbstlichen Feldern und den grünen Hügelketten – ragte die Ruine ihrer Kate in den Himmel.
Doch keiner von ihnen blickte sich nach ihrem ehemaligen Zuhause um.
2. Kapitel
Die Straße der Sterne, so nannten sie die Bauern mit bitterem Hohn. Sie nahm die bettelarme Landbevölkerung auf, wenn sie von ihren Pachthöfen vertrieben wurden.
Was es bedeutete, auf der Straße der Sterne unterwegs zu sein, das sollten Éanna und ihre Mutter nur allzu bald erfahren. Es vergingen keine fünf Minuten, ohne dass ihnen Eselskarren und Fuhrwerke begegneten, auf denen Leichen zur Beerdigung lagen. Gefolgt von ihren Angehörigen, nicht selten aber auch nur von einem einzigen überlebenden Mitglied der Familie.
Éanna dachte daran, wie glücklich sich solch eine Familie noch schätzen konnte. Die Toten lagen wenigstens in einem Brettersarg, auch wenn er noch so billig und schäbig sein mochte. Und die Hinterbliebenen hatten immerhin so viel Geld, um den Leichenbestatter bezahlen und ihre Verstorbenen auf einem Friedhof in geweihter Erde beerdigen zu können.
Die Mehrzahl der Opfer, die der jahrelange Hunger schon gefordert hatte, lag entlang der Straßen irgendwo verscharrt. Oft hatte die Kraft nur noch für ein paar Steine gereicht, mit denen man den Leichnam bedeckt hatte. Aber wenigstens schützte das die Verstorbenen vor streunenden Hunden und anderem Getier, das noch nicht in den Fallen der Hungernden sein Leben gelassen hatte.
Doch auf den Überlandstraßen stieß man auch auf Tote, die keinerlei noch so armseliges Begräbnis erhalten hatten. Sie lagen in den Gräben und vor den niedrigen grauen Steinmauern, die Felder und Gehöfte eingrenzten. Sie ruhten dort, wo der Tod sie ereilt und ihr Leiden beendet hatte. Kaum eine der zerlumpten, zu Skeletten abgemagerten Gestalten, die sich mit leerem Blick über die Straße schleppten, schenkte ihnen Beachtung. Es waren ihrer einfach zu viele, um von ihrem Anblick nicht längst abgestumpft zu sein.
Éanna jedoch stiegen bei jedem Toten, auf den ihr Blick fiel, jedes Mal von Neuem die Tränen in die Augen. Insbesondere wenn es sich um kleine Kinder handelte. Viele lagen mit angezogenen Beinen und Armen scheinbar friedlich im Gras, als hätten sie sich nur für eine Weile schlafen gelegt und sich dafür schützend vor Wind und Wetter eingerollt.
»Wohin wollen wir, Mutter?«, brach Éanna schließlich das Schweigen. Alles war besser, als wortlos der Landstraße zu folgen und nichts weiter zu tun zu haben, als die Leichenwagen vorbeirumpeln zu sehen.
Ihre Mutter schien sich darüber Gedanken gemacht zu haben. Denn ihre Antwort kam unverzüglich, und wieder klang etwas von der alten Stärke in ihrer Stimme mit. »Nach Knockmoy Abbey. Ich habe gehört, dass hinter dem Kloster eine neue Straße gebaut werden soll«, sagte sie. »Vielleicht bekommen wir dort Arbeit.«
Éanna warf einen kurzen Blick auf den Stand der Sonne. »Bis zum Kloster sind es bestimmt noch sechs, sieben Meilen«, wandte sie ein. »Wenn wir dort eintreffen, wird es schon fast dunkel sein. Und du weißt doch, man muss sich spätestens morgens um sechs bei diesen Arbeiten einfinden, wenn man auch nur eine Chance haben will, vom Aufseher für den Tag ausgewählt zu werden.«
»Gerade deshalb ist es gut, wenn wir schon heute mit ihm sprechen«, erwiderte Catherine energisch. »So wird er uns leichter wiedererkennen, wenn wir morgen früh in der Menge stehen.«
Éanna nickte. »Damit könntest du recht haben«, sagte sie, auch wenn sie insgeheim an den Worten ihrer Mutter zweifelte. Aber sie wollte die wiedergewonnene Entschlossenheit und Zuversicht ihrer Mutter nicht ins Wanken bringen. Dringender denn je zuvor brauchte sie Catherine – denn was es hieß, dass ihre Mutter sich selbst und Éanna aufgab, das hatte sie in jenem schrecklichen Moment erlebt, als Catherine davon gesprochen hatte, in der Hütte sterben zu wollen.
Schweigend setzten sie ihren Weg nach Knockmoy Abbey fort – vorbei an den einheimischen irischen Polizisten, die mit finsteren Gesichtern die Schaf- und Rinderherden, fruchtbare Äcker und weite Getreidefelder bewachten.
Éanna sah sie und ballte insgeheim die Fäuste. Sie wusste nur allzu gut, dass es in Irland nicht an Lebensmitteln fehlte. Die herrschende Klasse dachte nur nicht daran, sie auf den heimischen Märkten zu verkaufen, sondern verschiffte sie dorthin, wo sie den besten Preis erzielten. Woche für Woche transportierten Dutzende Frachtschiffe die reichen Erträge der Großgrundbesitzer nach England. Die Hungersnot der Landbevölkerung kümmerte die meisten wenig. Sie begrüßten vielmehr die angebliche Strafe Gottes, die nun endlich dafür sorgte, dass sich die Zahl von Irlands Katholiken endlich drastisch verringerte – durch Tod oder Auswanderung. Manche Großgrundbesitzer äußerten sogar in aller Öffentlichkeit, dass die Missernten und die Hungersnot »ein Segen für Irland« wären.
Das Kloster und die Baustelle, der Éanna und ihre Mutter entgegenstrebten, gehörten zu den viel zu späten und nur halbherzigen Hilfsmaßnahmen des englischen Parlamentes, das nach langem Verzögern schließlich eine Reihe von öffentlichen Bauprojekten für Irlands hungernde Bevölkerung beschlossen hatte. Die Löhne waren trotz der knochenbrechenden Arbeit so karg bemessen, dass auch sie kaum zum Überleben einer Familie reichten.
Je länger Éanna durch den Staub der Landstraße wanderte und je mehr Leidensgenossen sie begegnete, desto größer wurde ihr Zorn über die verhassten Engländer.
Sie hatte nur wenige Monate eine der »Heckenschulen« besuchen dürfen – Unterricht im Freien, meist im Schutz einer Steinmauer oder einer Hecke –, aber den Lehrern war es bei schwerer Strafe verboten gewesen, die Kinder in irischer Geschichte und in ihrer eigenen gälischen Sprache zu unterrichten.
Doch von ihrem Vater wusste Éanna, was es mit der englischen Herrschaft auf sich hatte – er hatte es ihr im Schutz der Kate erzählt, flüsternd.
Es war Henry VII. gewesen, der im fahre 1535 seinem Reich den evangelischen Glauben aufgezwungen hatte. 1690 brachen dann britische Truppen in der fürchterlichen Schlacht am Boyne River Irlands Widerstand endgültig. Seitdem standen die Iren in ihrem eigenen Land unter der harten Knute der sogenannten Penal Laws. Die vom britischen Parlament erlassenen »Strafgesetze« sollten verhindern, dass die Iren jemals wieder zu Einfluss und militärischer Macht gelangten und damit für England zu einer Bedrohung werden konnten. Die Gesetze verboten es allen katholischen Iren – und damit dem Großteil der Bevölkerung –, an Wahlen teilzunehmen, ein öffentliches Amt zu bekleiden, Feuerwaffen zu besitzen und bestimmte Berufe auszuüben. Wer sein Land nicht verlieren und den vielen anderen Beschränkungen dieser Gesetze entgehen wollte, war gezwungen, seinem Glauben und seiner Treue zum Papst in Rom abzuschwören und Protestant zu werden.
Inzwischen waren einige dieser Penal Laws gelockert worden. Aber an der Tatsache, dass die Engländer als herrschende Klasse Irland ausbeuten konnten, hatte sich nichts geändert.
»Komm weiter, Éanna«, sagte ihre Mutter plötzlich und zog sie am Arm.
Éanna schreckte auf. Sie hatte gar nicht gemerkt, wie sie stehen geblieben war und auf eines der schwer bewachten Herrenhäuser starrte, das entlang der Straße stand. Diese trutzigen, festungsähnlichen Schlösser befanden sich ausnahmslos im Besitz adliger Engländer oder irisch-englischer Protestanten. Viele von ihnen kamen nur gelegentlich einmal aus England, um ihren Besitzungen einen kurzem Besuch abzustatten, etwa zur Jagdsaison.
Nur widerwillig setzte Éanna sich in Bewegung. Der Unterschied zur Straße der Sterne könnte nicht größer sein, dachte sie bitter bei sich.
Die Sonne hatte sich auf ihrer Bahn schon tief nach Westen über die Küste von Galway geneigt, als sie endlich den Bauplatz am Kloster erreichten. Doch das Bild, das sich ihnen hinter der Biegung der Landstraße bot, ließ ihnen das Herz sinken.
3. Kapitel
Es war ein gewaltiger Steinbruch, in dem mehr als hundert Männer mit primitivstem Werkzeug Felsbrocken aus der Wand brachen oder sie mit Vorschlaghämmern in kleine Stücke zertrümmerten. Frauen und Kinder, viele von ihnen barfuß, karrten das Gestein in Schubkarren davon oder schleppten es in schweren Körben aus dem Steinbruch die steile Böschung hinauf und von dort zu jener Stelle, wo der Schotter für den Bau der neuen Straße gebraucht wurde. Jeder von ihnen bot einen Anblick des Elends. Die Kleider schlotterten in den längst viel zu weit gewordenen Kleidern. Die Gesichter grau, verdreckt und verzerrt von verzweifelter Anstrengung und der kaum zu bewältigender Last. Und in den tief liegenden Augen saß bei jedem die Angst, die Kraft nicht mehr lange aufzubringen und von einem anderen Hungerleider ersetzt zu werden.
Zwischen den Arbeitern gingen Aufseher unablässig auf und ab. Sie wurden Whip-up genannt, Einpeitscher. Ein sehr zutreffender Name. Denn unerbittlich trieben sie Männer, Frauen und Halbwüchsige an, nur ja nicht langsamer zu werden. Immer wieder ließen sie ihre Peitschen knallen. Manche machten sich dabei einen Spaß daraus, die Lederschnur ihrer Peitsche möglichst nahe am Körper eines Tagelöhners durch die Luft zucken zu lassen.
Wer das vorgegebene Tempo nicht mehr mithalten konnte, wurde aus der Kolonne gezerrt und zum Oberaufseher geführt, der seinen Namen aus seinem Lohnbuch strich. Was nicht selten einem Todesurteil für ihn und diejenigen gleichkam, die sein schäbiger Tageslohn von zehn, elf Pence bislang vor dem Verhungern bewahrt hatte.
»Es sieht nicht schlecht für uns aus«, raunte Catherine. »Sieh nur, es ist kaum noch jemand da, der uns morgen einen Platz streitig machen könnte!«
»Keiner ist vielleicht etwas übertrieben«, gab Éanna leise zurück. Rund um den Steinbruch und den Bauplatz kauerten sogar zu dieser Abendstunde noch arbeitslose Männer, Frauen und Kinder im Gras. Aber es waren wirklich erstaunlich wenige, wie auch sie feststellte, höchstens zwei Dutzend. Jeder von ihnen hoffte darauf, einen jener ersetzen zu können, die bei der Arbeit zusammenbrachen. Die meisten von ihnen sahen jedoch so aus, als hätten sie selbst kaum noch Kraft, um sich vom Boden zu erheben, geschweige denn Steine zu zertrümmern und schwere Körbe zu tragen.
Éanna erinnerte sich daran, was ihr Vater ihnen von den Vorkommnissen in jenem Steinbruch erzählt hatte, in dem er für einige Zeit Arbeit gefunden hatte. In den frühen Morgenstunden hatten sich dort stets mehr als hundert Tagelöhner versammelt. Sie warteten darauf, dass wieder einer der Unglücklichen aus der Arbeitskolonne herausgetrieben wurde. Nicht selten hatten sie sich dann auf dem Weg zu dem Oberaufseher, der das Lohnbuch führte, gegenseitig umgestoßen.
Éanna nahm an, dass diejenigen, die noch besser bei Kräften waren und lange Morgenstunden vergeblich auf einen Arbeitsplatz gehofft hatten, inzwischen weitergezogen waren. Vermutlich zu dem Brückenbau, den man östlich von hier in Angriff genommen hatte. Von diesem weiteren Bauprojekt hatten sie und ihre Mutter auf der Straße gehört.
»Das muss dort drüben der Ganger sein«, flüsterte ihre Mutter, als sie sich Steinbruch und Bauplatz näherten. Verstohlen deutete sie dabei auf einen Mann oben am Rand der Böschung, der im Schutz einer nach vorn offenen Bretterhütte hinter einem Tisch saß. »Das ist bestimmt der Mann, der hier das Sagen hat. Mit ihm müssen wir reden!«
Ganger war die gebräuchliche Bezeichnung für den obersten Aufseher, dem die Überwachung der Arbeit eines Bauprojektes vor Ort unterstand und der den Lohn auszahlte. Die Ganger waren den Berichten nach raue, hartherzige Kerle, denen das tägliche Elend längst keinen Funken Mitgefühl mehr entlockte. Und der Ganger dieses Bauprojektes, ein bullig gebauter Mann mit dem plattnasigen Gesicht eines Boxerhundes, schien keine Ausnahme zu sein.
Einer seiner Unteraufseher hatte soeben einen Mann, kaum mehr als ein mit Lumpen behangenes Skelett, vor den Tisch seines Vorgesetzten gezerrt. Auf Knien beschwor er den Ganger, ihn nicht aus seinem Lohnbuch zu streichen.
»Gebt mir noch eine Chance, Mr Nicholson!«, flehte er ihn mit trockenem Schluchzen an. »Morgen wird es mir nicht wieder passieren. Ihr habt mein Wort! Denkt an meine beiden kleinen Kinder, die letzten, die mir geblieben sind. Drei andere und meine Frau habe ich schon zu Grabe getragen. Lasst mir die Arbeit, in Gottes heiligem Namen!«
»Er hat mehr als genug Chancen gehabt. Und sein heiliger Papistengott zahlt ja wohl hier nicht die Löhne aus«, sagte der Unteraufseher zynisch über den Kopf des vor dem Tisch knienden Mannes hinweg. »In der letzten Stunde hat er die Schubkarre gleich dreimal umgekippt! Und das wird auch nicht besser mit ihm werden. Glaub mir, der Kerl ist erledigt, Arsenath.«
Wortlos schlug der Ganger sein Lohnbuch auf, ließ sich den Namen des Mannes nennen, strich ihn mit einem kurzen, energischen Federstrich aus der langen Liste, notierte einen Lohnbetrag hinter dem Namen, knallte das ledergebundene Buch wieder zu und warf dem Mann seinen restlichen Lohn vor die Füße. Bei all dem kam ihm nicht ein einziges Wort über die Lippen. Kein Muskel regte sich in seinem harten Gesicht.
»Éanna«, raunte Catherine. »Halte dich ja aufrecht, und mach ein freundliches Gesicht, wenn wir uns dem Ganger nähern. Du musst lächeln, hörst du? Zeige bloß nicht, dass du müde bist! Der Ganger soll sehen, dass wir schon lange das können, was die anderen leisten müssen!«
»Ja, Mutter«, murmelte Éanna und bemühte sich um einen freundlichen Gesichtsausdruck.
Doch wie schwer ihr das fiel! Der Hunger fraß wie eine tollwütige Ratte in ihr, und ihre Füße brannten von dem stundenlangen Marsch wie Feuer.
Aber sie wusste, dass Catherine recht hatte. Die Arbeit im Steinbruch war die einzige Möglichkeit zu überleben. Und wenn ein Lächeln half, und sei es noch so aufgesetzt, dann musste sie sich eben dazu zwingen. Éanna straffte ihre Schultern und folgte ihrer Mutter zu dem Tisch des Gangers.
»Was wollt ihr?«, fragte der Oberaufseher schroff. Argwohn und Ärger flammten in seinen Augen auf. Er hatte gerade nach einem knusprig gebackenen Brotlaib gegriffen, von dem noch drei Viertel übrig waren. Offensichtlich nahm er an, sie wollten ihn anbetteln. »Hier werden keine milden Gaben verteilt! Sucht euch gefälligst die nächste Suppenküche.«
Catherine deutete eine steife Verbeugung an. »Nichts liegt uns ferner, als Euch anbetteln zu wollen, Mr Nicholson«, sagte sie höflich, aber auch mit einem gewissen Stolz in der Stimme. »Wir haben unseren Lebtag lang von unserer ehrlichen Hände Arbeit gelebt, und so wird es auch bleiben.«
»So? Und was wollt ihr dann?«, brummte der Ganger, doch es klang nicht mehr ganz so harsch.
Éanna schielte auf das Brot, das neben einer großen ovalen Blechdose lag. Das Behältnis enthielt sicherlich noch anderes Essen, das der Ganger mit zur Arbeitsstelle gebracht hatte. Hinter der Dose ragte der Stiel eines Blechlöffels hervor. Vielleicht hatte ihm seine Frau eine dicke Suppe bringen lassen, womöglich sogar mit Fleischstücken? Das Wasser lief Éanna im Mund zusammen, als sie sich ausmalte, was sich unter dem verschrammten Blech alles an Köstlichkeiten verbergen mochte. Sie schluckte mehrmals, doch ihre Kehle fühlte sich trocken und rau an.
»Sullivan ist mein Name, Catherine Sullivan. Das ist meine Tochter Éanna, Mr Nicholson«, stellte sich die Mutter vor, als wollte sie sich in einem Herrenhaus um eine Anstellung bewerben. Ganz bewusst nannte sie jedes Mal seinen Namen. »Wir suchen Arbeit, Mr Nicholson. Und wir sind kräftig genug, um diese Arbeit verrichten zu können.«
Éanna nickte und zwang sich weiterzulächeln, doch den Blick konnte sie dabei nicht vom Brot nehmen.
»Du scheinst den Sonnenuntergang mit dem Sonnenaufgang verwechselt zu haben«, spottete der Ganger und verzog den Mund. »Oder glaubst du vielleicht, um diese Stunde gäbe es noch Arbeit für euch? Kommt morgen früh wieder.«
»Das haben wir auch vor«, erwiderte Catherine ruhig. »Aber wir wollten uns heute Abend schon einmal vorstellen, damit Ihr morgen wisst, auf wessen Arbeitskraft Ihr Euch verlassen könnt, Mr Nicholson.«
Ein Anflug von Belustigung, aber auch Überraschung zeigte sich auf dem plattnasigen Gesicht des Gangers. »So, vorstellen wollt ihr euch! Sieh an!« Er lachte kurz auf und schüttelte den Kopf, als wäre ihm ein solch törichtes Ansinnen noch nie zuvor begegnet. Und mit bissigem Sarkasmus fragte er: »Ein Empfehlungsschreiben habt ihr aber nicht dabei, oder?«
Die Mutter bewahrte Haltung. »Wir sind, was Ihr vor Euch seht, Mr Nicholson: Catherine und Éanna Sullivan, zwei kräftige Frauen, die hart zu arbeiten wissen und keine Schwierigkeiten machen«, gab sie bestimmt zur Antwort. »Und wir wären Euch zu großem Dank verpflichtet, wenn Ihr morgen früh …«
»Schon gut!«, fiel ihr der Ganger säuerlich ins Wort. »Spart euch das. Und wiederholt nicht ständig euren Namen, Catherine … Sullivan!« Er verdrehte die Augen. »Ich leide noch nicht unter Gedächtnisschwund, dass ich einen Namen in wenigen Minuten gleich zehnmal hören muss, um ihn nicht zu vergessen.«
»Verzeiht meine Aufdringlichkeit«, murmelte Catherine und senkte den Blick. »Ich hatte nicht vor, Euch …«
»Genug!«, schnitt er ihr erneut das Wort ab. »Ich weiß, was ihr wollt und wie ihr heißt, Frau. Kommt morgen wieder. Dann werde ich sehen, was sich machen lässt. Aber glaube ja nicht, dass ihr damit schon in meinem Buch steht. Bei mir gibt es keine Vorzugsbehandlung. Bei mir geht alles mit Recht und Ordnung zu.«
»Das glaube ich Euch. Und ich weiß, dass Ihr tun werdet, was Ihr könnt«, sagte Catherine dankbar. »Erlaubt mir eine letzte Frage, Mr Nicholson.«
Der Ganger runzelte die Stirn. »Was ist denn jetzt noch?«
Éanna schielte noch immer zum Brot hinüber.
»Wisst Ihr vielleicht, wo wir hier in der Umgebung die Nacht verbringen können? Irgendeine Behausung, die ein wenig Schutz vor Wind und Wetter bietet?«
Das Gesicht des Gangers verzog sich vor Zorn. »Was kümmert es mich, wo du mit deiner Tochter die Nacht verbringst, Catherine Sullivan?«, knurrte er. So, wie er ihren Namen diesmal aussprach, klang es wie eine Warnung, den Bogen nicht zu überspannen.
»Entschuldigt vielmals«, sagte Éannas Mutter hastig. Sie hatte ihren Fehler sofort erkannt. »Wir werden morgen pünktlich sein. Komm, Éanna!«
Ein letzter Blick auf das Brot, ein schweres Schlucken, und dann riss Éanna sich von dem Anblick los.
Kaum hatte sie sich jedoch umgedreht, als der Oberaufseher ihr knurrig zurief: »He, du da! Éanna! Komm her!«
Erschrocken fuhr Éanna unter seinem Anruf herum. Sie fürchtete, durch irgendetwas den Zorn des Gangers erregt zu haben, obwohl sie beim besten Willen nicht wusste, was sie getan haben könnte.
Und dann traute sie ihren Augen nicht, als Arsenath Nicholson zum Brotlaib griff. Er brach ein gut vier Finger breites Stück davon ab und hielt es ihr hin.
»Nimm schon!«, blaffte er sie an, als gäbe er ihr kein Almosen, sondern eine scharfe Zurechtweisung. »Und halte ja den Mund, verstanden? Ich habe keine Lust, dass mir das Pack gleich die Bude einrennt und mich für eine verdammte Suppenküche hält. Steck es weg und verschwinde!«
Éanna konnte ihr Glück kaum fassen. Ein dickes Stück Brot! Ihre Mutter und sie würden jeder zwei Scheiben Brot haben! Hastig trat sie zu ihm an den Tisch, nahm das Brot mit zitternder Hand und ließ es schnell unter ihrem Umhang verschwinden. »Gott segne Euch«, flüsterte sie.
Der Ganger machte eine unwirsche Handbewegung, als wollte er eine lästige Fliege verscheuchen.
Éanna lief zu ihrer Mutter, in deren Augen sie Tränen schimmern sah. »Hast du das gesehen?«, raunte sie ihr zu. »Er hat mir ein dickes Stück von seinem Brot gegeben!«
Catherine nickte. Sie legte ihren Arm um sie und drückte sie an sich. »Du hast recht, Kind. Er mag ein rauer Klotz sein, aber das täuscht. Jetzt bin ich zuversichtlich, dass er uns morgen in sein Lohnbuch schreibt!« Sie klang regelrecht aufgedreht. »Wir werden nicht einfach nur namenlose Gesichter in der Menge sein, sondern Catherine Sullivan und ihre Tochter Éanna. Wir werden Arbeit haben, Éanna! Der Lohn wird reichen, um den ärgsten Hunger zu stillen. Vielleicht können wir ja sogar jeden Tag ein, zwei Pence zurücklegen, wenn wir das Geld umsichtig einteilen.« Sie lachte und weinte zugleich. »Ach, Éanna! Es wird noch alles gut!«
»Du hast das auch sehr geschickt gemacht, Mutter«, lobte Éanna sie. Sie fühlte nach dem Brot unter ihrem Umhang, und es kam ihr vor, als ob damit alles anders geworden wäre. »Fast wie eine Dame bist du aufgetreten. Er hat es nicht zeigen wollen, aber bestimmt hat es Eindruck auf ihn gemacht.« Das mit der Dame mochte sehr an den Haaren herbeigezogen sein, so abgerissen wie sie aussahen. Aber was tat das zur Sache? Endlich gab es wieder Hoffnung!