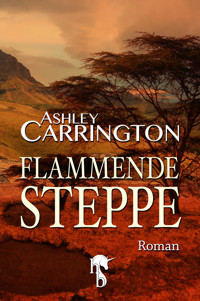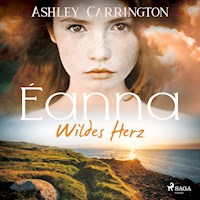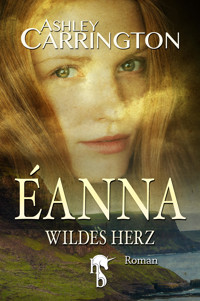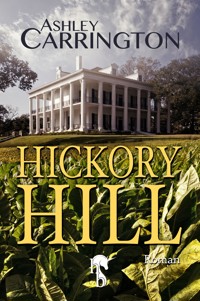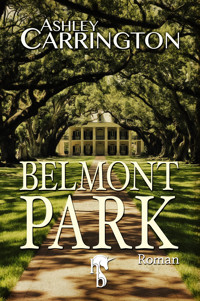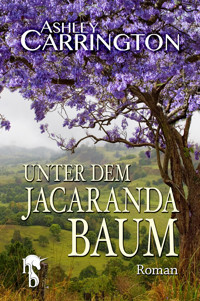
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Familiengeschichte beginnt im Jahr 1908 als Moira Mayfield mit ihrer Mutter ins australische Hinterland umsiedeln muss. Nur widerwillig gewährt ihnen ihre Tante Unterschlupf und Moira, die davon träumt Malerin zu werden, fühlt sich unerwünscht. Wann immer es geht, streunt sie in der Weite des Buschlands umher. Trost und einen kreativen Rückzugsort findet die sensible Moira unter der mächtigen Krone eines Jacarandabaums. Dem schüchternen Adrian Flynn dient der Baum ebenfalls als Zuflucht. Hier beginnt mit einem ersten Kuss die zaghafte Liebesgeschichte, die Moira schließlich bis nach Sydney und Melbourne führt. Doch der Jacarandabaum lässt sie niemals ganz los ... eine Familiengeschichte fürs Herz!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 768
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ashley Carrington
Unter dem Jacarandabaum
Roman
Für Helgain Liebe und Dankbarkeit
»Suchen und etwas ganz anderes finden, das ist die wahre Natur des Lebens.«
Anselm Grün, OSB
ERSTES BUCHFremde Heimat1908-1914
ERSTES KAPITEL
Der Raddampfer, der Eleanor Mayfield und ihre zwölfjährige Tochter Moira am ersten Dezembertag des Jahres 1908 von Mildura nach River Bend brachte, trug den Namen Lady Eliza – und glich eher einer alten, heruntergekommenen Schlampe. Nach Fisch, Schweinen und Ziegen stinkend, rußspuckend und mit gefährlich ächzendem Dampfkessel kämpfte sich das Flussschiff die dreiundzwanzig Meilen den breiten Murray stromaufwärts.
Aber hatte sie, Eleanor Mayfield, denn etwas Besseres verdient? Nein, es geschah ihr ganz recht so. Die Fahrt auf diesem dreckigen, stinkenden Flussboot, für die sie auch noch dankbar sein musste, machte den Verlust ihres letzten Restes von Stolz und Selbstachtung vollkommen und bereitete sie angemessen auf die Demütigung und Selbsterniedrigung vor, die sie in River Bend erwarteten. Was hinter ihr lag, hatte sie sich ebenso selbst zuzuschreiben wie das, was sie nun auf sich nehmen musste. Und sie wusste, dass es bitter für sie werden würde – selbst wenn das Schicksal ihr gnädig war!
Das schmale Frachtboot von gerade mal sechzig Fuß Länge hatte auf dem offenen Vorderdeck Wellbleche geladen. Eleanor und ihre schmächtige Tochter Moira saßen achtern in der prallen Sonne auf zwei Kisten zwischen Ruderhaus und Schaufelrad, das am Heck die gelbbraunen Fluten des Murray nur mühsam zum Schäumen brachte. Nach den katastrophalen Überflutungen in den ersten Oktobertagen hatte der Sommer in diesem Jahr schon ungewöhnlich früh seine sengende Hitze über das australische Hinterland am Murray River gebracht. Der wenige Schatten, den die hinter dem kurzen Ruderhaus aufgespannte Segeltuchplane bot, war den Dutzenden Kerosinkanistern sowie den Schweinen und Ziegen in ihren Lattenkäfigen vorbehalten. Das Wohlergehen der Tiere hatte allemal Vorrang vor dem Befinden der beiden einzigen Passagiere der Lady Eliza, zumal diese ihre Passage in Mildura mehr erbettelt als bezahlt hatten.
»Sie werden uns nicht abweisen, Kind! ... Sie können nicht! ... Nicht zu dieser Zeit, wo wir doch bald Weihnachten haben ... und wo doch ein Shilling und Sixpence alles sind, was uns an Geld geblieben ist! ... Was immer auch gewesen ist, Josepha ist meine ältere Schwester und fest im Glauben. Sie und ihr Mann William sind die einzige Familie, die ich ... nein, die wir noch haben!«, stieß Eleanor Mayfield mit beschwörender Stimme hervor, als wollte sie weniger ihre Tochter überzeugen, als die quälenden Zweifel in sich selbst endgültig zum Schweigen bringen. »Mach dir keine Sorge, es wird alles gut, mein Kind! ... Sie werden uns nicht die Tür weisen, sondern christliche Barmherzigkeit walten lassen!« Dabei drückte sie die Hand ihrer Tochter und wollte ihr aufmunternd zulächeln. Doch ihr Gesicht brachte nur eine maskenhafte Grimasse zustande. Und dahinter lauerte die nackte Angst, die wie eine mühsam gebändigte Gewalt bloß darauf wartete, jeden Moment die dünne Fassade letzter Selbstbeherrschung zu durchbrechen.
Moira nickte nur stumm. Denn sie spürte, dass ihre Mutter jetzt nicht ein Wort, ja nicht einmal einen Blick des Zweifels von ihr ertragen konnte, ohne sofort wieder in Tränen der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit auszubrechen. Die Angst ihrer Mutter, dass sich ihre letzte Hoffnung, die sie auf ihre fünfzehn Jahre ältere Schwester in River Bend gesetzt hatte, als Selbsttäuschung erweisen könnte, begleitete sie schon seit vier Tagen. Seit sie ihre wenigen Habseligkeiten überstürzt in einen alten Pappkoffer und zwei schäbige, abgewetzte Taschen gestopft und ihre winzige Hinterhofwohnung in Adelaide mitten in der Nacht wie Diebe verlassen hatten. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass sie sich so davongestohlen hatten. Wie oft hatten sie nicht schon bei Nacht und Nebel ihre Wohnung aufgegeben, weil wieder einmal nicht genug Geld dagewesen war, um die seit Wochen überfällige Miete zu bezahlen! Aber beim letzten Mal waren sie nicht nur ihrem Vermieter Geld schuldig geblieben, sondern ebenso den beiden großherzigen Ladenbesitzern ihres Viertels, bei denen sie auch noch in der letzten Woche hatten anschreiben dürfen, als man ihnen anderswo schon längst jeden weiteren Kredit verwehrt hatte.
Moira wollte nicht länger an diese schreckliche, demütigende Zeit denken, in der ihre Mutter stets sie in die Läden geschickt hatte. Im Grunde genommen war sie bei den Krämern um die Ecke nicht einkaufen, sondern betteln gegangen. Denn das Geld, das ihre Mutter durch gelegentliche Näh- und Wascharbeiten verdient hatte, hatte trotz aller Einschränkungen vorn und hinten nicht gereicht. Aber das war ja nun vorbei, wo sie Unterschlupf und Sicherheit im Haus von Tante Josepha und Onkel William in River Bend finden würden.
Ja, Moira wollte nur zu gern daran glauben, dass jetzt alles gut werden und endlich Ruhe in ihr unstetes, von Not und Angst geprägtes Leben kommen würde. Doch schon im nächsten Moment bohrte sich die bange Frage, warum dann Tante Josepha nicht auf die Bettelbriefe ihrer Mutter geantwortet hatte, wie ein bösartiger Stachel in ihre Seele.
Der schrille Ton, den die Dampfsirene der Lady Eliza plötzlich ausstieß, fuhr Moira durch Mark und Bein und riss sie aus ihren beklemmenden Gedanken. Der Fluss vollführte wieder einmal eine seiner unzähligen Schleifen, und die Lady Eliza schob sich schwerfällig um die S-förmigen Windungen des Murray. Dabei kamen sie dem rechtsseitigen Ufer näher, das schon zu New South Wales gehörte, wie Moira sich erinnerte. River Bend dagegen lag auf dem südlichen, dem linksseitigen Ufer des Murray und damit noch im australischen Bundesstaat Victoria.
Bis vor vier Tagen hatte die Welt für Moira nur aus dem Labyrinth der Straßenzüge um die Hafenviertel von Port Augusta und Adelaide bestanden, wobei sie sich an Port Augusta nur noch sehr vage erinnern konnte, waren sie von dort doch schon weggezogen, als sie noch keine fünf gewesen war. Voller Staunen blickte sie daher zu den Eukalyptusbäumen hoch, die mit ihrem immergrünen Blätterkleid und ihren grauweißen und rot marmorierten Stämmen die hohen, steil abfallenden Ufer des Flusses zu beiden Seiten säumten. Sie entdeckte auf den Ästen Vögel mit unglaublich buntem Gefieder. Aus einem schräg stehenden Baum, dessen Äste weit über den Fluss hinaushingen und dunkle Schattenfelder auf das Wasser warfen, drang ein lautes Geräusch, das dem spöttischen Gelächter eines Menschen täuschend ähnlich klang, doch von einem Vogel kam, den man Kookaburra nannte – so jedenfalls hatte es ihr einer der Flussschiffer erklärt. Wie fremdartig diese Landschaft im Innern Australiens doch war. Und erst dieser gewaltige Himmel! Sie hatte noch nie einen so unglaublich hohen, weiten und blauen Himmel gesehen!
Trotz der Sonne, die auf sie herab brannte, und ihrer viel zu warmen Kleidung durchfuhr Moira auf einmal ein kalter Schauer. Wie die scheinbar endlose und menschenleere Weite des kargen Landes, das sich jenseits der Ufer bis zum Horizont ausdehnte, so hatte auch dieser schier grenzenlose Himmel etwas Erschreckendes. Sie fürchtete, sich darin zu verlieren und zu einem Staubkorn, zu einem Nichts zusammenzuschrumpfen, wenn sie zu lange, mit dem Rücken zur Sonne, in diese blaugrelle Helligkeit hinaufblickte. Ein Gefühl des Verlorenseins stieg in ihr auf, doch sie kämpfte tapfer dagegen an und presste die Lippen fest aufeinander. Bald mussten sie in River Bend ankommen, und dann würden ihre und Moms Ängste und Sorgen ein für allemal ein Ende haben!
Die Sonne hatte sich schon ein gutes Stück gen Westen geneigt, als die Lady Eliza in die weite Biegung einfuhr, die sich wie ein riesiges, auf der Seite liegendes U aus gelbbraunem Flusswasser in die karge Landschaft gegraben hatte und an dessen östlichem Ufer River Bend lag.
»Schau, da ist es!«, machte sie einer der abgerissenen Flussschiffer auf die Siedlung aufmerksam. »Und die lange Pier, das ist die Moama Wharf, wo wir gleich anlegen werden!« Aufgeregt und erlöst, dass die lange Reise und die quälende Zeit der Ungewissheit nun endlich so gut wie vorbei waren, sprang Moira auf. In ihrer Bewegung lag so viel Schwung, dass sie dabei fast ihr Bonnet verloren hätte. Sie hielt den Strohhut mit der linken Hand fest und spähte mit zusammengekniffenen Augen in die Richtung, in die der Flussschiffer deutete.
Eleanor Mayfield blickte jedoch nicht auf. Sie beugte vielmehr den Kopf, gab einen unterdrückten Seufzer von sich und hielt plötzlich ihren Rosenkranz in der Hand, zu dem sie erst seit wenigen Monaten wieder regelmäßig griff, wie Moira aufgefallen war. »Heilige Muttergottes ...«
Die zittrige Stimme ihrer Mutter erhob sich wie ein müder Vogel, der zum Himmel aufsteigen wollte, aber schon nach wenigen Flügelschlägen mutlos und entkräftet ins trockene Buschgras hinunterflatterte. Ihr Gebet ging im Rattern des Schaufelrades unter, und Moira wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Ort zu, der ihre neue und endlich sorgenfreie Heimat werden sollte, wie Mom ihr versprochen hatte.
Je näher sie River Bend jedoch kamen, desto stärker wuchs Moiras Enttäuschung. Nicht, dass sie eine ähnlich große und geschäftige Hafenstadt wie Adelaide mit ihren Tausenden von Häuserzeilen erwartet hätte. Ihre Mutter hatte sie vorgewarnt und mehr als einmal betont, dass River Bend keinen Vergleich mit Port Augusta und schon gar nicht mit Adelaide aushalten konnte. Doch sie hatte den Wohnort von Tante Josepha und Onkel William am Murray River auch nicht näher beschrieben. Insgeheim hatte Moira deshalb zumindest auf eine »kleinere Stadt« gehofft. Diese Hoffnung fiel nun wie Hefeteig bei kalter Zugluft in sich zusammen. Denn was sie sah, war mehr als ernüchternd: River Bend schien offenbar bloß aus einer etwa dreihundertfünfzig Fuß langen Pier in Form einer klobigen, dreistöckigen Balkenkonstruktion zu bestehen, die bis zur Oberkante des hoch aufsteigenden Ufers reichte, aus einigen Dutzend wenig ansehnlichen Schuppen und Lagerhäusern sowie einigen anderen kleineren Gebäuden, die sich alle längs der Anlegestelle aneinanderreihten. Die Dächer bestanden fast ausschließlich aus einfachem Wellblech, das entweder von Rost gezeichnet war oder einen verblichenen Anstrich trug. Moiras Augen erblickten trotz aller Anstrengung nichts, was auch nur annähernd an einen wenigstens kleinstädtischen Charakter erinnert hätte. River Bend war eine armselige Flusssiedlung, ein schäbiges Dorf irgendwo am Ende der Welt!
Moira wagte jedoch keinen Ton zu sagen, sondern biss sich auf die Lippen, um die Tränen der Enttäuschung zurückzuhalten. Sie hatte sich geschworen, tapfer zu sein, was immer auch kommen mochte. Und wenn sie nun auch fürchtete, dass sie viel mehr unangenehme Überraschungen erleben würde, als sie gedacht hatte, so wollte sie sich doch nichts anmerken lassen – um ihrer Mutter willen.
Die Lady Eliza legte wenig später an der Moama Wharf an, und das dröhnende Schlagen des Schaufelrads erstarb, wie auch das angestrengte Keuchen der altersschwachen Dampfmaschine in ein stilles, müdes Schnaufen überging. Leinen flogen, und die Flussschiffer tauschten mit den anderthalb Dutzend Männern und Frauen, die sich auf der Pier eingefunden hatten, fröhliche Zurufe.
Eleanor nahm den Koffer, der mit einfachen Hanfstricken zugebunden war, sowie die schwerere der beiden Taschen auf, bedankte sich gesenkten Blickes beim Eigner und Captain des Flussbootes für seine Großzügigkeit, dass er sie so gut wie kostenlos von Mildura nach River Bend mitgenommen hatte, und ging dann rasch an Land, gefolgt von Moira, die sich die zweite Tasche über die Schulter gehängt hatte.
Die Flutwellen in der ersten Oktoberwoche hatten das miteinander verbundene, gewaltige Flusssystem des Darling, des Murrumbidgee und des Murray River bis zu 34 Fuß über seinen Normalstand anschwellen lassen, riesige Flächen unter Wasser gesetzt, die Evakuierung Tausender Landbewohner erzwungen und mehr als ein Dutzend Tote gefordert. Doch jetzt, gerade acht Wochen später, war davon nichts mehr zu sehen. Zumindest nicht in der Gegend um River Bend. Der Wasserstand des Murray war mit der Hitze des viel zu frühen Sommers wieder so tief gesunken, dass die Lady Eliza auf der untersten der drei Etagen der Moama Wharf vertäut lag. Im kühlen Dunkel der mächtigen Balkenkonstruktion stiegen sie die Treppen zur Straßenebene hoch. Ein Höhenunterschied, der mehr als zwanzig Fuß betrug und der darauf hinwies, wie hoch der Murray bei Hochwasser steigen konnte.
Als sie wieder die Nachmittagssonne auf ihrer Haut spürten, blieb Eleanor Mayfield nach einigen Schritten stehen, setzte ihr Gepäck ab und wandte sich mit prüfendem Blick ihrer Tochter zu. »Lass dich anschauen, Kind. Nun ja, es könnte noch schlimmer sein.« Sie seufzte. »Zieh den rechten Strumpf hoch, und dreh dein Bonnet mehr nach hinten, damit man die Löcher nicht so sieht. Ja, so ist es schon besser.«
Moira stand still. Sie wusste nur zu gut, wie wenig vorteilhaft sie in dem grob geflickten, abgelegten Kleid aussah, das eine gutherzige Nachbarin ihr vor zwei Jahren geschenkt hatte, als sie noch nahe der Konservenfabrik gewohnt hatten und ihre Mutter schon mehr als acht Monate ohne feste Arbeit gewesen war. Der stumpfe, olivfarbene Stoff mit dem groben Blumenmuster und dem nachträglich aufgesetzten rostbraunen Rüschenkragen passte so gar nicht zu ihrem üppigen kastanienfarbenen Haar, auf das sie so stolz war, weil es manchmal wie poliertes Kupfer schimmerte. Genauso wenig wie die schiefergrauen, kratzigen Strümpfe zum Kleid und zu ihren alten, abgelaufenen Halbstiefeln passten. Und die Löcher in ihrem Strohbonnet wurden nur sehr notdürftig von dem viel zu breiten Hutband kaschiert, das ihre Mutter aus einem Stück Unterrockstoff zusammengenäht hatte.
»Es ist wichtig, dass wir bei Tante Josepha einen guten ersten Eindruck machen, Moira! Meine Schwester hat immer viel auf eine makellose Erscheinung gehalten. Nicht auffällig, aber adrett und das Beste aus dem machen, was man hat, das ist immer ihre Devise gewesen.«
»Ja, Mom.«
Während ihre Mutter mit nervösen Fingern an ihrem verschlissenen Rüschenkragen herumzupfte, ohne dabei etwas zum Besseren zu richten, weil dies ein Ding der Unmöglichkeit war, erwiderte Moira die Musterung mit verstohlenem Blick. Der erbarmungswürdige Anblick ihrer Mutter, der ihre große Not auch ohne Worte deutlich zum Ausdruck brachte, schnitt ihr schmerzhaft ins Herz.
Das einst königsblaue Wollkleid, das einmal Eleanor Mayfields bester Sonntagsstaat für Kirchgang und Tanzabende gewesen und längst schwarz eingefärbt worden war, hatte schon viele Ausbesserungen hinter sich, wies mehrere blank gescheuerte Stellen auf und saß viel zu locker um Hüften und Oberkörper, die einmal voll anmutiger Rundungen gewesen waren. Dass sie stark an Gewicht verloren hatte, verriet auch ihr Gesicht, das in besseren Zeiten von rosiger Fülle und ansprechenden, strahlend lebensfrohen Zügen gekennzeichnet gewesen war, nun aber unter den Hitzeflecken regelrecht grau und eingefallen aussah. Zudem hatten bittere Not und Enttäuschungen tiefe Linien in ihr Gesicht gegraben. Was die schwarzen Wollstrümpfe ihrer Mutter anging, so bestanden diese mehr aus Stopfflicken als aus dem ursprünglichen Gewebe. Ihre Schnürschuhe waren so löchrig wie bei einem Landstreicher, und ihr schwarzer Hut taugte nur noch dazu, in der Hand gehalten zu werden, weil Risse und Löcher beim besten Willen nicht mehr zu flicken waren.
Moira wusste, dass ihre Mutter in zwei Monaten ihren neunundzwanzigsten Geburtstag hatte, und sie vermutete, dass man mit so viel Lebensjahren allmählich schon zu den verbrauchten, alten Frauen zählte, auch wenn sich im Haar ihrer Mutter noch kein Grau fand.
»Wenn wir gleich zu Tante Josepha und Onkel William kommen, hältst du die Tasche besser in der Hand, statt sie über der Schulter zu tragen, und zwar nimmst du sie in die linke Hand und hältst sie dicht gegen dein Kleid gepresst«, trug Eleanor ihr nun auf. »Dann sieht man den aufgesetzten Flicken auf der linken Seite nicht gleich.«
Moira nickte gehorsam. Sie zögerte und sagte dann entschuldigend: »Ich muss mal, Mom.«
»Nicht jetzt!«, wehrte Eleanor unwillig ab. »Du wirst es dir noch ein paar Minuten verkneifen müssen. So dringend wird es ja wohl nicht sein, oder?«
Moira war sich dessen nicht so sicher, schüttelte aber den Kopf, um ihre Mutter nicht zu enttäuschen. »Ich glaube, ich kann es schon noch aushalten.«
»Gut. Und noch etwas ... Schau mich an, Kind!« Eleanor legte eine Hand unter Moiras Kinn und machte eine kurze Pause, um dann mit leicht bebender Stimme fortzufahren: »Was immer du auch hörst und was immer irgendjemand auch sagen mag, deine Mutter ist eine ehrenwerte Frau, deren du dich nicht zu schämen brauchst! Eine ehrenwerte, anständige Frau, die jedem offen ins Auge schauen kann, hast du mich verstanden, Moira?«
»Ja, Mom!« Der ernste, beschwörende Ton ihrer Mutter, die ihr Kinn mit der Hand nun fest umschlossen hielt, erschreckte sie. »Ich würde mich nie für dich schämen! Bestimmt nicht, Mom!«
»Das brauchst du auch nicht. Ich habe gewiss vieles in meinem Leben unbedacht und falsch gemacht, als ich jung war und so manches besser zu wissen glaubte als meine seligen Eltern. Doch ich bin eine ehrbare Frau, die sich nichts weiter vorzuwerfen hat, als dass sie zu leichtgläubig und blind vor Liebe gewesen ist! Ich möchte, dass du dir das in dein Herz schreibst und nie vergisst, auch wenn dir einmal gehässige Worte über deine Mutter zu Ohren kommen sollten, hörst du?«
»Ja, Mom, ich verspreche es dir!«, beteuerte Moira noch einmal und hatte das unbestimmte Gefühl, dass ihre Mutter in Wirklichkeit gar nicht mit ihr redete, sondern etwas einübte, was für eine andere Person gedacht war – vielleicht für Tante Josepha oder Onkel William. »Aber du ... du ... tust mir mit deiner Hand weh!«
»Was?... Oh, tut mir leid, mein Kind!« Eleanor gab Moiras Kinn frei und tätschelte ihre Wange mit einem gequälten Lächeln. »So, und jetzt lass uns gehen. Gleich haben all unsere Sorgen ein Ende. Das Geschäft von Tante Josepha und Onkel William ist nicht weit. Es liegt in der Nebenstraße, an der Ecke Victoria und Bourke Street. Das hier ist die River Street, die Hauptstraße von River Bend. Komm, gib mir deine Hand!«
Die Hand ihrer Mutter war kalt und feucht.
»Bist du hier in River Bend aufgewachsen, Mom?«, fragte Moira, als sie die lange Straße hinuntergingen, die sich parallel zum Fluss erstreckte. Hier und da entdeckte Moira auch mal ein aus dunkelbraunen Backsteinen errichtetes Gebäude zwischen den Schuppen, Werkstätten und Schenken, bei denen es sich überwiegend um einfache Holzkonstruktionen handelte. Doch immerhin besaßen fast alle Häuser weit vorgezogene, schattenspendende Vordächer oder Veranden. Es gab sogar Straßenlaternen, wenn auch in großen Abständen.
»Wir Mayfield-Töchter sind ein paar Bootsstunden weiter flussaufwärts aufgewachsen, in einem Ort namens Swan Hill. Nein, außer Tante Josepha und Onkel William kennt uns hier in River Bend, wo ich in meiner Jugend nur zweimal kurz zu Besuch gewesen bin, keiner – und dem Himmel sei Dank dafür!«, lautete die Antwort ihrer Mutter, begleitet von einem tiefen Stoßseufzer.
Moira setzte zu einer weiteren Frage an, besann sich dann aber eines anderen. Ihr hatte der Einwurf auf der Zunge gelegen, dass sie ihre Verwandten gar nicht kannte. Ja, dass sie von ihrer Existenz überhaupt erst seit einigen wenigen Monaten wusste, nämlich seit sie, Moira, in ihrer eisigen Wohnung im Winter mit einer schweren Lungenentzündung auf Leben und Tod gerungen hatte. Sie hatte Wochen gebraucht, um danach wieder auf die Beine zu kommen. Damals hatte ihre Mutter gestanden, dass sie doch noch lebende Verwandte besaßen, und ihr von Tante Josepha und Onkel William in River Bend am mächtigen Murray River erzählt. Damals hatte sie auch damit begonnen, ihrer Schwester Briefe zu schreiben. Briefe, auf die sie jedoch nie eine Antwort erhalten hatten. Aber dieser Einwurf war wohl unangebracht ...
Ein Fuhrwerk rumpelte an ihnen vorbei und hüllte sie in eine dichte Wolke von rotbraunem Staub. »Mom ...«, begann Moira zaghaft, während sie an der Hand ihrer Mutter nach links in eine breite Straße einbog, die in einem rechten Winkel von der River Street abzweigte und ins Hinterland führte.
»Zapple nicht so nervös herum!«, wies Eleanor ihre Tochter mit angespannter Stimme zurecht und nickte an ihrer Hand. »Kopf hoch, es kommt schon alles in Ordnung! Und vergiss nicht zu lächeln! Du hast die hübschesten Sommersprossen und Grübchen von ganz South Australia gehabt – und nun sind es mit Sicherheit die hübschesten von ganz Victoria!« Sie redete hastig weiter, als könnte sie mit einer unablässigen Flut von Worten, die alle anderen Gedanken erstickte, eine in ihr immer stärker werdende Nervosität bekämpfen. »Wir sind jetzt auf der Victoria Street, die mit der River Street ein T bildet und die unten bei der Ziegelei in die Landstraße zu den umliegenden Farmen und Stations übergeht. Die Stuart und die Bourke Street sowie ein paar noch kleinere Gassen kreuzen die Victoria Street ...«
Geschäfte, Werkstätten und bedeutend mehr Wohnhäuser, als sich auf der Straße parallel zum Fluss fanden, beherrschten das Bild der Victoria Street, die breit und staubig in der Nachmittagssonne lag. Ein gefleckter Hund hatte es sich mitten auf der Straße im Dreck bequem gemacht und hob mit nur schwachem Interesse den Kopf, als sie vorbeikamen.
»River Bend hat jetzt bestimmt schon gut dreihundert, wenn nicht gar vierhundert Einwohner. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Weißt du, wenn ich ehrlich sein soll, habe ich mir eigentlich nie etwas aus der Stadt gemacht. Ich bin sicher, dass wir uns bald einleben und wohl fühlen werden. Eine kleine überschaubare Ortschaft wie River Bend hat vieles für sich. Natürlich braucht es Zeit, sich umzustellen, aber mit ein wenig gutem Willen von uns allen ...«
Moira hörte nur mit halbem Ohr auf das, was ihre Mutter in ihrer nervösen Anspannung vor sich hinplapperte, ohne von ihr eine Antwort zu erwarten. Sie passierten die Stuart Street und kamen schließlich zur zweiten Kreuzung, wo die bedeutend schmalere Bourke in einem schrägen Winkel die Victoria Street schnitt. Eleanor hielt nun auf das zweistöckige, hölzerne Eckhaus zu, das auf beiden Straßenseiten von einer Veranda umgeben war, zu der jeweils drei Bretterstufen hinaufführten. Und auf beiden Straßenfronten hing ein langes Schild unter dem Vordach, auf dem mit einem Brenneisen in dicken, eckigen Buchstaben eingebrannt stand: McGregor’s Emporium.
Plötzlich blieb Eleanor abrupt stehen. »Oh mein Gott, hilf uns!«, stieß sie hervor und drückte dabei schmerzhaft die Hand ihrer Tochter. »Da! ... Josepha! ... Meine Schwester! ... Heilige Muttergottes, sei uns gnädig, und gib ihr ein weiches Herz!«
Moira folgte dem Blick ihrer Mutter und bemerkte nun auch die Gestalt, die auf der Front zur Bourke Street am hinteren Ende der Veranda im tiefen Schlagschatten stand, die Bohlen fegte – und nun plötzlich innehielt, als fühlte sie die auf sich gerichteten Blicke. Moira spürte, wie sich in diesem Moment ihr Magen zusammenzog und ihr Herz zu jagen begann, als die Angst ihrer Mutter auf sie übersprang.
»Es wird alles gut!«, flüsterte Eleanor und ging mit zögernden steifen Schritten auf ihre Schwester zu. »Es wird alles gut. Sie ist meine Schwester ... die einzige Familie, die wir haben.« Am Fuß der Verandatreppe blieb sie stehen.
Josepha McGregor löste sich aus dem Schatten nahe der Hauswand und trat nach vorn an die Kante, wo Sonnenlicht auf sie fiel. Die linke Hand in die Hüfte gestemmt und die rechte auf den Besen gestützt, stand sie da. Stumm und mit einem verkniffenen, abweisenden Ausdruck auf dem Gesicht.
Verstört blickte Moira zu ihr hoch. Sie hatte ganz selbstverständlich mit einer Frau gerechnet, der man ansah, dass sie die Schwester ihrer Mutter war. Doch Tante Josepha besaß nicht die geringste Ähnlichkeit mit Mom. Sie war eine untersetzte, schwergewichtige Frau mit einem mächtigen Busen, dem wohl auch ein fest geschnürtes Korsett nur mühsam Halt zu geben vermochte, wie es den Anschein hatte. Ihre Arme waren so fleischig wie ihr rundes Gesicht, das stark gerötet war und in ein Doppelkinn überging. Das dunkelbraune, schon stark mit Grau durchsetzte Haar trug sie in der Mitte streng gescheitelt und im Nacken zu einem dicken Knoten zusammengesteckt. Schmucklos und schiefergrau, aber von guter Qualität war das hochgeschlossene Kleid, das sie trug.
»Josepha! ... Schwester!« Eleanor hatte hörbar Mühe, ihre zitternde Stimme unter Kontrolle zu halten, und gab die Hand ihrer Tochter frei. »Wie lange haben wir uns nicht gesehen. Eigentlich war ich ja noch ein Kind, als ...« Sie ließ den Satz unbeendet und machte eine vage Handbewegung.
Josepha McGregor zeigte sich von dem Wiedersehen im wahrsten Sinne des Wortes unbewegt. Weder rührte sie sich von der Stelle, noch brach sie ihr feindseliges Schweigen. Ihr stechender, abschätziger Blick richtete sich kurz auf Moira, die ihre Tasche mit beiden Händen umklammert hielt. Sie erinnerte sich an die Ermahnung ihrer Mutter, dass sie einen guten ersten Eindruck machen und lächeln sollte. Doch sie brachte kein Lächeln zustande, denn Angst schien jeden Muskel in ihrem Gesicht zu lähmen. Und dann nahm Tante Josepha ihren Blick auch schon wieder von ihr und fixierte ihre Mutter.
»Es war eine schrecklich lange Reise, und wir sind so froh, dass wir nun endlich in River Bend angekommen sind, Josepha. Wir hatten nicht genug Geld, um die ganze Strecke mit Eisenbahn und Droschke zu fahren. Wir mussten mit dem vorliebnehmen, was wir bekommen konnten – und das waren meist Fuhrwerke.« Ein flehender Ton schwang in Eleanors Worten mit.
Nun löste sich Josepha McGregor aus ihrer wortlosen, abweisenden Starre. »Ach nein! Unsere kleine Prinzessin hatte also ein paar Unbequemlichkeiten zu erleiden, ja?«, höhnte sie. »Nur weiter! Mir kommen gleich die Tränen!«
Eleanor senkte den Kopf. »Es ist jetzt über zwölf Jahre her. Ich bin längst nicht mehr die, die ich einmal war, Schwester«, erwiderte sie schuldbewusst und setzte Koffer und Tasche auf der Treppe ab.
»Was fällt dir ein? Wer hat dir erlaubt, hier deinen Plunder abzustellen?«, herrschte Josepha sie sofort an.
Erschrocken nahm Eleanor Koffer und Tasche von der Stufe und stellte sie neben sich in den Dreck der Straße. Ihr alter Hut, den sie zwischen die Träger der Tasche geklemmt hatte, rollte zu ihren Füßen in den Staub. »Du hast doch meine Briefe bekommen, nicht wahr?«, stieß sie ängstlich und beschwörend zugleich hervor.
Moira schaute schamhaft zur Seite und bemerkte dabei das Mädchen, das auf der anderen Straßenseite im Schatten eines Jasminbusches hockte, der vor der Veranda eines kastenförmigen Hauses wuchs. Das kräftige Mädchen, das etwa in ihrem Alter war, hatte schwarzes Haar, das ihr in zwei dicken langen Zöpfen rechts und links über den Kragen ihres blassblauen Kleides fiel. Sichtlich aufmerksam blickte sie zu ihnen herüber und versuchte wohl auch, das eine oder andere Wort aufzuschnappen.
»Es ist wirklich erstaunlich, wie gut man sich plötzlich wieder an Dinge erinnert, von denen man so viele Jahre lang nichts wissen wollte. Dinge, die man von heute auf morgen einfach so aus seinem Leben gestrichen hat!«, erwiderte Josepha nun bissig.
»Das ist nicht wahr!«, widersprach Eleanor, jedoch ohne Nachdruck, sondern vielmehr schuldbewusst.
»Mom?«, meldete sich Moira zaghaft zu Wort. Doch weder ihre Mutter noch ihre Tante schenkten ihr Beachtung.
»Und ob es wahr ist!«, fauchte Josepha und warf ihr mit wachsender Erregung vor: »Erst hast du mich ausgelacht, als ich dich gewarnt habe und zur Vernunft bringen wollte. Später dann bist du mir jedes Mal patzig über den Mund gefahren und hast mich eine rückständige Landpomeranze und engstirnige Krämerseele genannt. Und dann bist du mit diesem Blender, diesem Nichtsnutz und Schwätzer durchgebrannt! Du hattest noch nicht einmal Anstand genug, um mit deiner schändlichen, gottlosen Verfehlung zu warten, bis meine Tochter unter der Erde war!«
Eleanor schoss das Blut heiß ins Gesicht. »Das ist nicht wahr, Josepha! Niemand konnte wissen, dass ... dass Patricia so schnell ihrer Schwindsucht erliegen würde!«
»Aber du wusstest nur zu gut, wie schwer krank sie war. Wie du auch wusstest, dass ich im Jahr davor eine schwere Niederkunft gehabt und meinen Sohn keine vier Wochen nach der Geburt zu Grabe getragen hatte!«, hielt Josepha ihr erregt, aber mit gedämpfter, zischender Stimme vor.
»Aber du wolltest meinen Beistand doch nie!«
Moira brach der Schweiß aus; sie zupfte verstohlen am Kleid ihrer Mutter. »Mom? ... Mom!« Doch ihre Mutter reagierte nicht. Sie war ganz im Wortwechsel mit ihrer älteren Schwester gefangen.
»Ich habe meine Leiden und Kümmernisse nie vor mir hergetragen, wie ich mich auch immer auf meine eigene Kraft verlassen habe!«, erwiderte Josepha mit bitterem Stolz. »Aber wem erzähle ich das! Was verstehst du schon davon, was es heißt, Jahr um Jahr hart zu arbeiten, mit einem rechtschaffenen Mann aus dem Nichts etwas aufzubauen, Verantwortung zu tragen und trotz schwerster Schicksalsschläge weder im Glauben zu wanken noch seine Pflichten zu vergessen. Du weißt ja noch nicht einmal, was Anstand und Scham bedeuten!«
»Ich weiß, ich habe dir damals großes Unrecht getan. Es tut mir schrecklich leid, dass ich so überheblich zu dir gewesen bin und geglaubt habe, alles besser zu wissen und besser zu machen. Und es war ein noch größerer Fehler, dass ich mit Matthew durchgebrannt bin. Aber damals war ich ein junges Ding, noch keine achtzehn und so unendlich naiv und leichtgläubig!« Eleanors Stimme bettelte förmlich um eine Spur von Verständnis. »Inzwischen sind zwölf lange Jahre vergangen, und ich bin längst nicht mehr dieselbe Person, die du einmal als deine Schwester gekannt hast.«
»Ja, das ist offensichtlich!«, schnappte Josepha. »Du hast deine Schande mit einem Bastard besiegelt!«
Eleanors Gestalt straffte sich. »Untersteh dich, meine Tochter so in den Schmutz zu ziehen!«
Josepha stieß mit einem kurzen, fleischigen Finger nach ihrer Schwester. »Du bist es und niemand anders, der sie und dich gleich mit dazu mit der Schande der unehelichen Geburt beschmutzt hat!«, erwiderte sie angewidert. »Ich sehe nämlich keinen Ehering an deinem Finger! Und in deinen Jammerbriefen stand auch nichts davon, dass dieser ehrlose Geselle von Matthew Winslow dich in all den Jahren zu einer ehrbaren Frau und seinen Bastard wenigstens nachträglich vor Gott und der Welt zu seinem legitimen Kind gemacht hätte!«
Eleanor ballte die Fäuste. »Sag dieses schlimme Wort nie wieder, Schwester, wenn du dich nicht selbst schwer versündigen willst! Du hast alles Recht der Welt, mich deinen Zorn und auch deinen Abscheu spüren zu lassen, denn ich weiß, dass ich es verdient habe. Aber lass deine Verachtung nicht an meiner Tochter aus! Moira ist doch nur ein Kind! Mach sie nicht für das verantwortlich, was ich falsch gemacht habe. Ich habe für meinen Fehltritt schwer gebüßt und in den letzten Jahren bitteres Lehrgeld gezahlt, wie ich dir geschrieben habe ...«
»Du hast gebüßt und Lehrgeld gezahlt? Einen Dreck hast du!«, fiel Josepha ihr grob und wutentbrannt ins Wort. »Du kannst gar nicht lange genug leben, um Buße für das zu leisten, was du unseren Eltern angetan hast! Du hast ihren Tod auf dem Gewissen! Nicht mal zu ihrer Beerdigung bist du gekommen!«
»Das stimmt nicht!«, widersprach Eleanor, und es war fast ein entsetzter Aufschrei, der ihr über die Lippen kam. »Es war diese entsetzliche Epidemie, die sie und so viele andere dahingerafft hat! Und ich habe von ihrem Tod doch erst Wochen später in Port Augusta erfahren.«
»Aber du hast ihnen das Herz gebrochen, als du mit diesem Schönling von Herumtreiber durchgebrannt bist. Damit hast du ihnen die Kraft geraubt, den Lebenswillen zerstört, denn sonst hätten sie die Krankheit bestimmt überlebt!«, beharrte Josepha. Bleich wie ein Leichentuch zuckte Eleanor bei dieser Anklage wie unter Schlägen zusammen. Ihr schon gebeugter Körper schien endgültig in sich zusammenzufallen. »Josepha, was immer auch gewesen ist und was ich an Schuld auf mich geladen habe, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr, und du weißt, warum ich mit Moira gekommen bin. Soll ich erst vor dir auf die Knie fallen?«
»Untersteh dich, auf offener Straße eine Szene zu machen!«, fauchte Josepha. »Außerdem verfangen theatralische Gesten bei mir nicht!«
Eleanor fasste in ihre tiefe Rocktasche. Als sie die Hand wieder herauszog, ihrer Schwester hinstreckte und öffnete, lagen zwei Münzen in ihrer Handfläche. »Ein Shilling und Sixpence, das ist alles, was ich noch besitze. Und in den Taschen und dem Koffer ist nichts mehr, was noch wert wäre, zum Pfandleiher gebracht zu werden. Ich flehe dich an, dein Herz nicht zu verschließen und uns bei euch aufzunehmen.«
»Ja, das hast du dir wirklich schön ausgedacht. Nachdem dein Matthew dich mit einem Kind hat sitzenlassen und du es in der großen Stadt mit eigener Kraft nicht zu einem ordentlichen Leben geschafft hast, willst du jetzt also bei uns unterkriechen und die Früchte unserer jahrelangen knochenharten Arbeiten genießen, ja? Das sieht dir ähnlich, Prinzessin!«
Erneut zerrte Moira am Kleid ihrer Mutter, und mit leiser, aber eindringlicher Stimme begann sie: »Mom, bitte! Ich ...« Und aus den Augenwinkeln bemerkte sie, dass das schwarzhaarige Mädchen mit den Zöpfen noch immer schräg gegenüber neben dem üppigen Jasminbusch hockte und mit ungebrochener Neugier zu ihnen über die Straße starrte.
»Wirst du wohl gefälligst still sein und mit dem Herumzappeln aufhören?«, herrschte Eleanor ihre Tochter an, das Gesicht angespannt und von hektischen Flecken übersät. In ihren Augen stand panische Angst. Und ohne eine Antwort von ihr abzuwarten, wandte sie sich wieder ihrer Schwester zu. »Du und William, ihr habt ein großes Haus, in dem ihr bestimmt noch eine leere Kammer für uns findet. Gebt uns ein Dach über dem Kopf und zu essen, und ihr werdet es bestimmt nicht bereuen. Ich habe zu arbeiten gelernt, in der Fabrik und auch anderswo, und Moira ist ein sehr anstelliges Kind. Wir werden alle Arbeiten ohne zu klagen verrichten, das verspreche ich dir. Jede Arbeit wird uns recht sein. Josepha, ich flehe dich an, nimm uns bei euch auf – wenn nicht meinetwegen, so doch wenigstens des Kindes wegen! Immerhin ist sie deine Nichte, und ...«
Josepha funkelte sie wütend an. »Komm mir jetzt bloß nicht damit, Schwester!« Sie spuckte das Wort förmlich aus.
Moira vermochte dem Drang nicht länger zu widerstehen und gab den Kampf auf. Im ersten Augenblick empfand sie nichts als Erlösung. Dann spürte sie, wie der warme Urin ihre knielange Unterhose erst im Schritt nässte, dann an ihren Beinen entlanglief und auch noch in ihre Strümpfe bis zu den Schuhen hinuntersickerte. Auf einmal trat an die Stelle grenzenloser Erleichterung tiefe Scham. Sie schlug die Hände vors Gesicht und begann unter lautem Aufschluchzen zu weinen.
»Also gut, du sollst deinen Willen bekommen, Eleanor!«, rief Josepha da ärgerlich. »Du hast es zwar nicht verdient und vermutlich werde ich meine Gutherzigkeit eher noch heute als morgen bereuen, aber ich will Gnade vor Recht und gerechter Strafe ergehen lassen. Ihr könnt erst einmal bleiben!«
»Ich danke dir, Josepha! Ich danke dir von Herzen, und ich verspreche, dass du es auch ganz bestimmt nicht bereuen wirst!«, versicherte Eleanor, und aus ihrer Stimme sprach unsägliche Erleichterung.
»Das werden wir ja sehen. Und glaubt bloß nicht, dass ihr euch auf unsere Kosten einen faulen Lenz machen könnt! Bei uns im Haus stiehlt keiner dem Herrgott die Zeit durch Müßiggang und Lotterleben!«, warnte sie voller Groll, dass sie ihre Schwester und deren Kind nun in ihrem Haus aufnehmen musste. »Es wird euch nichts geschenkt, damit ihr es gleich wisst!«
»Das wollen wir auch nicht«, antwortete Eleanor unterwürfig und mit einem stillen, befreiten Lächeln. In ihren Augen schimmerten gar Tränen der Dankbarkeit. »Wir werden alles tun, was du sagst, Schwester, das schwöre ich bei Jesus, Maria und allen Heiligen!«
»Dann fang gleich damit an, deiner Göre das Gegreine abzugewöhnen!«, blaffte Josepha. »Bei mir wird nicht wegen jeder Kleinigkeit geflennt und gerotzt, sonst könnt ihr gleich wieder eure Sache packen und euch nach einem anderen Dummen umsehen, der euch bei sich aufnimmt! Für solch kindische Unbeherrschtheiten und Zimperlichkeiten habe ich nämlich nichts übrig! Sie soll mir also bloß nicht heulend unter die Augen kommen, wenn ihr die Arbeit nicht schmeckt, die sie zu verrichten hat!«
»Keine Sorge, das wird nicht passieren, Josepha!«, beteuerte Eleanor hastig. »Moira ist sonst nicht so. Es ist die lange Reise, die ihr wohl etwas zugesetzt hat. Wir sind seit vier Tagen unterwegs, und wir hatten auch nicht viel zu essen. Aber bestimmt fließen einige der Tränen auch aus Dankbarkeit ihrer Tante gegenüber, die uns ein Heim gibt, nicht wahr, mein Kind?« Und raunend setzte sie hinzu: »Nimm die Hände vom Gesicht!«
Moira ließ die Hände sinken und nickte folgsam, blickte jedoch nicht auf. Noch immer rann der Urin an ihren Beinen hinab. Gleich würden es alle riechen, dass sie sich in die Hose gemacht hatte.
Josepha gab einen unwilligen Grunzlaut von sich und machte eine wegwischende Handbewegung. »Dann macht, dass ihr von der Straße und ins Haus kommt! Ihr könnt die beiden Kammern oben unter dem Dach haben! Aber geht mir bloß nicht durch das Geschäft, so abgerissen, wie ihr gekleidet seid. Geht durch den Hof, und nehmt die Hintertür beim Abort!«, befahl sie ihnen.
»Ja, Schwester!« Eleanor hängte sich hastig die Tasche über die Schulter, nahm den Koffer auf, klemmte sich achtlos den sowieso nutzlosen Hut unter den Arm und zerrte ihre Tochter in den Hinterhof von McGregor’s Emporium, in den man von der Bourke Street aus gelangte.
Kaum hatte sie das Brettertor hinter sich zugeworfen, als Eleanor alles fallen ließ, einen unterdrückten Jubelschrei ausstieß, sich zu ihrer Tochter hinunterbeugte und sie fest in ihre Arme schloss.
»Habe ich es nicht gesagt, dass alles gut werden und in Ordnung kommen wird? Wir haben es geschafft, mein Engel! Die Sorgen haben ein Ende«, rief sie überglücklich. »Josepha hat uns aufgenommen. Ich wusste, dass sie uns nicht die Tür weisen würde.«
»Sie mag uns nicht, Mom«, sagte Moira unter Tränen. »Unsinn, mein Kind! Man darf nur nicht jedes Wort, das sie sagt, auf die Goldwaage legen. Sie hat zwar eine spitze Zunge und eine raue Schale, aber darunter liegt ein weicher Kern. Bei ihr und Onkel William sind wir gut aufgehoben, du wirst sehen«, redete sie ihr gut zu. »Und du warst wunderbar, mein Herz! Du hast wirklich den richtigen Zeitpunkt mit deinem Weinen abgepasst. Deine Tränen haben sie sehr angerührt, auch wenn sie das abgestritten hat. Moira, ich bin stolz auf dich!«
Moira schüttelte den Kopf. »Ich ... ich habe nicht wegen Tante Josepha geweint. Es hatte gar nichts damit zu tun, dass sie so böse zu dir war.«
Eleanor sah sie verwundert an. »Nicht? Womit dann?« »Dass ich es einfach nicht länger zurückhalten konnte. Ich habe es versucht, aber es ging nicht länger.« Beschämt und mit gesenktem Kopf fügte sie leise hinzu: »Mom, ich habe mir in die Hose gemacht. Ich ... ich bin nass bis in die Schuhe.« Und wieder rannen ihr Tränen über das Gesicht.
Im ersten Moment machte ihre Mutter ein verdutztes Gesicht. Dann brach sie in schallendes Gelächter aus und schloss sie erneut in ihre Arme. »Oh, mein Liebling! Das behalten wir aber besser für uns!«
Moira stimmte nur halbherzig in das Lachen ein. Denn gleichzeitig spürte sie, dass in dem Lachen ihrer Mutter etwas Dunkles, Schmerzliches mitschwang – so als hätte sie soeben von irgendetwas Schönem und Wichtigem Abschied genommen, von dem sie nicht wusste, ob es jemals wieder in ihr Leben zurückkehren würde.
ZWEITES KAPITEL
Tante Josepha hielt Wort. Sie schenkte ihnen wirklich nichts. Noch am selben Tag entließ sie Maggie Finley, ihr Hausmädchen, das von einer der umliegenden Farmen stammte und seit einem guten Jahr bei den McGregors in Brot und Arbeit stand. Die junge, knochige Frau schien über die plötzliche Aufkündigung ihrer Anstellung jedoch mehr erleichtert als betrübt zu sein, wie Moira bemerkte. Und als sie sah, wie regelrecht beschwingt Maggie Finley ihr Bündel packte und das Haus verließ, beschlich sie die beklemmende Ahnung, dass ihre Mutter und sie für Tante Josephas Wohltätigkeit wohl einen hohen Preis zahlen müssten. Sie irrte sich nicht. Tante Josepha strafte sie mit blanker Tyrannei.
Onkel William, ein großer und kräftiger Mann mit breiten Bartkoteletten, akkurat getrimmtem Schnurrbart, einem kantigen Gesicht und klaren Augen, zeigte sich auch nicht gerade begeistert darüber, nun die junge Schwester seiner Frau und deren kleine Tochter im Haus und bei allen Mahlzeiten an seinem Tisch zu haben. Er begegnete ihnen wahrlich nicht mit großer Liebenswürdigkeit. Auch er sparte nicht mit scharfen Vorhaltungen und Kommentaren am Tage ihrer Ankunft. Seine Worte ließen an Deutlichkeit über die Meinung, die er sich über seine Schwägerin und ihr skandalöses Verhalten von vor zwölf Jahren gemacht hatte, nichts zu wünschen übrig. Damit aber war die Sache für ihn auch erledigt, zumindest nach außen hin. Es schien, als habe er, ganz der auf den Penny korrekte Krämer, einige seit langem offenstehende Beträge aufgerechnet und summiert, einen Strich darunter gezogen, diese alte Rechnung dem Gläubiger in aller Schärfe präsentiert – und dann als erledigt abgehakt.
Danach nahm er ihre Anwesenheit als ein lästiges häusliches Übel hin, an das man sich am besten dadurch gewöhnte, indem man die Vergangenheit ruhen ließ und sich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens konzentrierte – was für ihn seine Arbeit unten im Geschäft war. Leider ließ er seiner Frau völlig freie Hand im Haushalt und in der Behandlung ihres Personals. Und dieses billige Personal im Haus der McGregors waren nun Moira und ihre Mutter.
Tante Josepha kommandierte sie vom ersten Tag an unerbittlich und nicht selten gehässig herum. Sie deckte sie von morgens bis abends mit Arbeiten ein. Ständig fand sie neue Aufgaben für sie. Und niemals war sie mit einer fertigen Arbeit zufrieden. An allem hatte sie etwas auszusetzen. Die Dielenbretter, die ständig auf Knien geschrubbt werden mussten, waren ihr nie sauber genug – ebenso wenig wie Töpfe und Pfannen nach dem Abwasch. Mit dem Bügeleisen und in der Waschküche erwies sich ihre Mutter angeblich als tölpelhaft, und ihre Kochkünste konnte man nur erbärmlich nennen und keiner aufrechten Christenseele zumuten, wenn man den ständigen Mäkeleien von Tante Josepha Glauben schenken wollte.
Moira litt mehr unter der täglichen Erniedrigung ihrer Mutter und deren widerspruchsloser Unterwerfung als unter ihren eigenen zahlreichen Pflichten. Was sie dabei am meisten schmerzte, war, dass ihre Mutter sich auch dann nicht wehrte, wenn Tante Josepha ihr ganz offensichtlich Unrecht tat.
»Warum lässt du dir das nur gefallen, Mom?«, stellte Moira sie am Ende der ersten Woche zur Rede, nachdem Tante Josepha ihre Mutter für etwas, was sie gar nicht getan hatte, abgekanzelt und in Tränen zurückgelassen hatte. Sie fühlte sich zwischen Schmerz und Zorn hin- und hergerissen. »Das ist doch gar nicht deine Schuld gewesen! Du hast die Streichhölzer nicht verlegt, das weiß ich! Und sie bestimmt auch. Ich habe nämlich selbst gesehen, wie Tante Josepha gestern die Streichhölzer aus der Blechschachtel genommen und da hinten aufs Bord gelegt hat!«
»Ach, es ist schon gut, Kind«, wehrte ihre Mutter ab und tupfte sich mit einer Ecke ihrer Schürze die Tränen aus den Augenwinkeln.
»Nein, es ist nicht gut!«, widersprach Moira zornig. »Ständig hackt Tante Josepha auf dir rum, was schon schlimm genug ist. Aber noch schlimmer ist es, dass du es einfach so hinnimmst und dich nicht einmal wehrst, wenn sie dir Unrecht tut! Nie stellst du die Dinge richtig!«
»Sie meint es nicht so, wie es oftmals klingt, Kind.«
Moira stampfte auf, und ihre Augen blitzten. »Und ob sie es so meint, Mom! Jedes Wort! Sie ist regelrecht gemein, besonders zu dir! Sie lässt kein gutes Haar an dir und demütigt dich, wo sie nur kann. Und du nimmst es einfach hin!«, machte sie ihrem Zorn und ihrer Unverständnis Luft. »Du hast ihr nicht einmal widersprochen, wenn sie dich für etwas heruntergemacht hat, was in Wirklichkeit völlig in Ordnung gewesen ist.«
»Und ich werde deiner Tante auch nicht widersprechen – wie auch du ihr keine Widerworte geben wirst!«
»Und warum nicht?«, wollte Moira wissen; ihre Miene war so trotzig wie ihre Stimme.
»Weil das nun einmal der Preis ist, den wir dafür zahlen müssen, dass wir ein ordentliches Dach über dem Kopf haben und uns um unseren Unterhalt nicht mehr zu sorgen brauchen – und diese Sicherheit ist ein großes Geschenk. Oder hast du vielleicht schon vergessen, wie es uns die letzten Jahre ergangen ist?«
»Nein.«
»Na also! Wir dürfen nie vergessen, wie dankbar wir Tante Josepha und Onkel William für ihre Barmherzigkeit sein müssen, dass sie uns bei sich aufgenommen haben!«, ermahnte ihre Mutter sie.
»Ich will auch nicht undankbar sein, Mom«, versprach Moira. »Aber ich möchte auch nicht, dass Tante Josepha so gehässig zu dir ist und dich immer schlechtmacht. Das ist nicht richtig ... und schon gar nicht barmherzig!«
Ihre Mutter sah sie mit einem schmerzlichen Lächeln an. »Du musst dir einfach nichts dabei denken, mein Engel. Es ist schon recht so, wie mir geschieht, auch wenn du es in deinem Alter noch nicht verstehen kannst. Ich habe schwere Verfehlungen in meinem Leben begangen, und dafür muss ich nun Buße tun. Das habe ich mittlerweile eingesehen. Ich werde die Buße, die mir meine Schwester auferlegt, klaglos hinnehmen, das habe ich mir geschworen. Und ich flehe dich an, es mir gleich zu tun und deiner Tante in allem zu gehorchen, was sie dir aufträgt, und ihr nicht zu widersprechen.« Ihr Blick war von beschwörender Eindringlichkeit, hinter der sich der dunkle Abgrund der Angst verbarg, wieder auf der Straße zu stehen – ohne Arbeit, Geld und Unterkunft.
»Das ist nicht gerecht, Mom!« Moira war sich keiner Schuld und keiner Verfehlung bewusst, deren sie sich schämen und für die sie Buße tun musste.
Ihre Mutter seufzte. »Das mag sein, aber so ist es im Leben nun mal. Und wenn ich dir sage, dass du eine stets dankbare und demütige Haltung zu Tante Josepha und Onkel William an den Tag legen sollst, dann gehorchst du auch, wie schwer es dir auch fallen mag!«, wies sie Moira mit wachsender Strenge zurecht. »Oder möchtest du vielleicht, dass es dir eines Tages so ergeht wie mir? Sei klug, lerne aus den Fehlern deiner Mutter und höre auf das, was man dir sagt, bis du wirklich alt genug bist, verantwortungsvolle eigene Entscheidungen und Urteile zu treffen! So, und jetzt geh wieder an die Arbeit!«
Moira fügte sich, jedoch unter großem innerem Widerstreben und allein um ihrer Mutter willen. Sie wollte, dass ihre Mutter stolz auf sie war, ihre Angst verlor und wieder die wurde, die sie einst gewesen war – nämlich eine Mutter, die zuversichtlich und fröhlich war und mit ihr lachte und ihr wundersame Geschichten erzählte. Nur deshalb beugte sie sich widerspruchslos dem Joch ihrer Tante. Doch Tag für Tag zu erleben, wie ihre Mutter alle Demütigungen ihrer Schwester nicht nur klaglos hinnahm, sondern sie auch noch als gerechte und willkommene Buße ansah, veränderte etwas in ihrer inneren Beziehung zu ihr. Nicht, dass sie sie weniger geliebt hätte. Doch in diesen ersten Wochen in River Bend verlor sie ihren unerschütterlichen Kindesglauben an die Einzigartigkeit und strahlende Großartigkeit ihrer Mutter, der sie bis dahin jedes Wunder zugetraut hätte – so als wäre sie nur geringfügig weniger als die Heiligen. Nicht einmal in den Zeiten ärgster Not hatte sie daran gezweifelt, dass ihre Mutter zu allem fähig war, wenn sie nur wollte. Es tat deshalb sehr weh, erkennen zu müssen, dass dies alles nur kindliches Wunschdenken gewesen und die eigene Mutter ganz und gar nicht allmächtig war, sondern vielmehr hilflos, schwach und unterwürfig aus Angst und Schuldgefühlen.
Moira verabscheute ihre Tante für das, was sie aus ihrer Mutter gemacht hatte, nämlich ein ebenso folgsames wie eilfertiges Dienstmädchen, das jegliche Selbstachtung aufgegeben und auf dem Altar der Bußfertigkeit geopfert hatte. Aber auch ohne die willig hingenommene Demütigung ihrer Mutter hätte sie, wie sie fand, allen Grund gehabt, tiefe Abneigung für ihre Tante zu hegen. Denn zu den täglichen Pflichten, die Josepha McGregor ihr zugeteilt hatte, gehörten unter anderem nicht nur das Entleeren des Ascheneimers und das morgendliche Entfachen des Herdfeuers in aller Frühe, sondern es zählte auch zu ihren täglichen Aufgaben, alle Nachttöpfe im Haus zum Abort auf dem Hinterhof hinauszubringen, sie zu leeren und gründlich zu säubern. »Und da du dann schon mal bei der Arbeit bist, kannst du auch gleich dafür sorgen, dass der Abort sauber ist und nicht so von Kakerlaken wimmelt!«, hatte Tante Josepha hinzugefügt, als sie ihr am ersten Tag ihre Pflichten – und mit welcher Sorgfalt diese auszuführen waren – erklärt hatte.
Ihre Mutter hatte Tante Josepha sofort darum gebeten, doch sie mit dieser täglichen Aufgabe zu betreuen. Worauf diese ihre Mutter scharf angefahren hatte: »Keine Sorge, für dich bleibt noch genug anderes, Eleanor. Oder ist sich deine Tochter für solch eine Arbeit vielleicht zu schade? Dann wäre es nämlich wohl besser, ihr packt eure Sachen gleich wieder und sucht euch ein Hotel, wo ihr euch bedienen lassen könnt!« Und damit waren das Thema und der Versuch ihrer Mutter, sie vor dieser Arbeit zu bewahren, beendet gewesen.
Tante Josepha machte regen Gebrauch vom Nachtgeschirr, und das nicht erst in den Nachtstunden. Sie hatte nämlich oft Wasser in den Beinen, und so schwergewichtig, wie sie war, geriet sie beim Treppensteigen rasch außer Atem. Deshalb ersparte sie sich häufig schon in den frühen Abendstunden den Gang hinaus zum Bretterhäuschen auf dem Hinterhof. So unangenehm diese Arbeit auch war und wie sehr Moira oftmals auch die Wut packte, wenn sie hörte, wie sich ihre Tante den Gang zum Abort sparte, so vermochte sie dies alles mit der Zeit doch noch leichter zu ertragen als ihre heuchlerischen Gebete bei Tisch.
Im Haus der McGregors wurde vor jeder Mahlzeit gebetet, wie es auch Moira gewohnt war. Obwohl sie sich auch noch gut daran erinnern konnte, dass es eine Zeit gegeben hatte, wo ihre Mutter und sie nie vor einer Mahlzeit dem Herrgott für die Gaben seiner Schöpfung gedankt hatten. Die Gebete gehörten erst seit gut dreieinhalb Jahren bei ihnen zum Alltag – zusammen mit der schrecklichen Winterkälte in ihrer ungeheizten Behausung, dem Hunger und den Drohungen der Vermieter.
Onkel William und Tante Josepha lösten sich bei den Tischgebeten ab. Und wenn ihr Onkel den Dank sprach, dann gab es daran auch nichts zu beanstanden. Ob es nun der gesunde Appetit war, mit dem er genau wie seine Frau gesegnet war, oder ob es an seiner kaufmännischen Natur lag, ein klares Geschäft nicht noch unnötig kompliziert zu machen, sondern es korrekt und ohne falsche Schnörkel unter Dach und Fach zu bringen, er hielt sich in seinem Lobpreis auf jeden Fall kurz und knapp.
War jedoch Tante Josepha an der Reihe, machte sie aus dem Tischgebet eine halbe Buß- und Strafpredigt, die ihren ungeliebten Verwandten galt, insbesondere ihrer Schwester. Denn während sie mit gefalteten Händen und geheuchelt andächtiger Miene den Kopf neigte, trieften ihre Worte nur so vor Selbstgerechtigkeit und kaum verborgener Verurteilung ihrer Schwester.
Ihre Tischgebete waren angefüllt mit scheinheiligen Bitten um Gnade und Vergebung, die in Wirklichkeit ihre Mutter treffen und einmal mehr demütigen sollten. Sie spickte ihre Gebete mit Redewendungen wie: »Herr, lass uns unsere Nichtswürdigkeit und Sündhaftigkeit erkennen und wie wenig wir Deiner Segnungen und Barmherzigkeit würdig sind, die uns unter diesem Dach bereitet werden!« oder »Gütiger Gott, wir wissen, wie sehr wir wider Deine Gebote verstoßen und uns dem schrecklichen Laster der Hoffart und der sündigen Sinneslust hingegeben haben. Gib uns die Kraft, unsere Sünden und die Schande aufrichtig zu bereuen, die wir über unsere Familien und Mitmenschen gebracht haben!«
Moira hatte bald den Eindruck, dass Onkel William über diese langen, scheinfrommen und allzu durchsichtigen Sermone seiner Frau nicht gerade erbaut war. Sein ungeduldig wippender Fuß unter dem Tisch verriet jedes Mal, wie sehr er darauf wartete, dass sie endlich zum Ende kam. Aber er schritt nicht dagegen ein, sondern ließ sie gewähren, so wie er sie eben in allen Dingen gewähren ließ, die nicht das Geschäft betrafen.
Tante Josepha hatte die Angewohnheit, nach ihrer letzten scheinheiligen Formulierung eine lange Pause zu machen, damit ihre Worte tief eindringen und ihre volle gehässige Wirkung entfalten konnten. Dann erst bekreuzigte sie sich unter einem geplagt geseufztem »Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist«, so als reichte die Last, die sie mit der barmherzigen Aufnahme ihrer sündigen Schwester und ihres Bastards auf sich genommen hatte, fast an ein Martyrium.
In der dritten Woche, an einem Montag und wenige Tage vor dem Weihnachtsfest, hatte Moiras Selbstbeherrschung ein Ende. Sie ertrug es nicht länger, zu hören, wie Tante Josepha ihre Mutter mit ihrem heuchlerischen Tischgebeten immer wieder aufs Neue demütigte und an ihre Verfehlungen erinnerte. Sie hatte noch gut die Sonntagspredigt von Father O’Reilly in den Ohren, der ein guter Prediger war und zudem auch ein netter, umgänglicher Mensch zu sein schien.
Als Tante Josepha nun wieder ihre große Pause machte, damit die Giftpfeile ihrer Worte auch schön unter die Haut gingen, platzte es aus Moira heraus: »Und Herr, lass uns wirklich barmherzig sein, wie Jesus und Father O’Reilly es uns gestern aufgetragen haben. Wir sollen einander aufrichtig verzeihen und Nächstenliebe üben und keinen Groll auf unseren Nächsten in unserem Herzen bewahren, weil wir nämlich oft nur den Splitter im Auge des anderen und nicht unseren eigenen Balken sehen ... und weil wir alle Sünder sind und nicht durch eigenes gerechtes Tun erlöst werden, sondern nur durch Gottes Gnade!« Hastig sprudelte sie hervor, was ihr von Father O’Reillys Predigt in Erinnerung geblieben war.
Alle am Tisch waren sprachlos vor Verblüffung.
Dann schoss Tante Josepha das Blut ins Gesicht. Puterrot lief sie an, wie bei einer schändlichen Verfehlung auf frischer Tat ertappt. Mit wütender Empörung sprang sie halb von ihrem Stuhl auf, beugte sich vor und versetzte Moira eine schallende Ohrfeige. »Du ungezogenes, nichtsnutziges Ding! Was nimmst du dummes Gör dir hier heraus? Mir ins Wort zu fallen, wenn ich das Tischgebet spreche?«, herrschte sie sie an. »Wenn ich deine Mutter wäre, würde ich mich für diesen Mangel an Anstand und Erziehung zu Tode schämen!«
Moiras Wange brannte wie Feuer, doch sie bereute nicht, was sie getan hatte, auch wenn ihre Mutter ihr einen entsetzten Blick zuwarf und hilflos den Mund für eine Entschuldigung öffnete, ohne jedoch ein Wort herauszubekommen.
Es war Onkel William, der die Situation rettete. »Es gehört sich wirklich nicht, was du da gerade getan hast!«, rügte er Moira mit missbilligend gefurchter Stirn, um dann zu ihrer Überraschung mit gnädiger Stimme hinzuzufügen: »Es ist aber recht löblich, dass du so viel von Father O’Reillys gestriger Predigt behalten hast. Du musst wirklich gut zugehört haben, und das Zuhören lohnt sich bei ihm immer. Er ist ein rechter Gottesmann, dessen Worte man sich stets zu Herzen nehmen sollte. So, und nun lasst uns essen!« Er schlug das Kreuz und rammte die Gabel in den Hammelbraten.
Tante Josepha warf ihm einen bitterbösen Blick zu und stocherte in ihrem Essen herum. Ihr war der Appetit vergangen, hatte sie die versteckte Zurechtweisung doch genauso verstanden wie Moira und ihre Mutter.
Moira brannte noch den ganzen Abend die Wange. Doch sie fand, dass die Sache den Schmerz allemal wert war. Und dabei ahnte sie zu dieser Zeit noch nicht, dass Tante Josepha nach diesem Zwischenfall nie wieder das Tischgebet sprechen würde. Von nun an erbat allein Onkel William den Segen bei Tisch – kurz, knapp und ohne große Wärme, aber auch ohne Gehässigkeit.
Tante Josepha zeigte sich empört, als Moiras Mutter sich bei ihr schon am Tag nach ihrer Ankunft nach der Schule in River Bend erkundigte.
»Dein feiner Matthew hat keinen Sohn gezeugt, sondern dich mit einem hageren, sommersprossigen Mädchen sitzenlassen, für das du eine üppige Mitgift brauchst, um sie später einmal unter die Haube zu bringen! Was, um alles in der Welt, sollte sie also in der Schule lernen, das ihr später einmal von Nutzen sein könnte? Ich bringe ihr schon bei, was sie beherrschen muss, wenn sie später Aussichten auf eine anständige Anstellung im Haushalt haben will!«, beschied Tante Josepha ihre Mutter gallig. »Die Zeit, wo ihr euch in der Stadt ein gutes Leben auf Kosten anderer gemacht habt, ist vorbei! Ihr werdet euch an ein anderes Leben gewöhnen müssen! Und je schneller ihr euch daran gewöhnt, desto besser werden wir miteinander auskommen, Schwester!«
Im Haus der McGregors gab es in der Tat vieles, an das sich Moira erst gewöhnen musste. Die Tyrannei von Tante Josepha sowie die unangenehmen Pflichten, die sie ihr auferlegt hatte, waren nur ein Teil davon. Dass Zucker- und Mehlbehälter jeweils auf einem Schemel in einem mit Wasser gefüllten Blech stehen mussten, um die Ameisen abzuhalten, gehörte ebenso dazu wie das Glas Eisenwasser, das sie nun jeden Tag trinken musste, weil sie nach Überzeugung ihres Onkels angeblich unter Eisenmangel litt. Abends warf er drei fingerlange Nägel in ein Glas Wasser, das sie morgens unter seinen Augen leeren musste, nachdem er die Nägel entfernt hatte. Lästig fand sie auch das tägliche Einreiben aller Gelenke mit Eukalyptusöl, das ein gesundes Wachstum fördern sollte. Was jedoch jedes Mal ihren Ekel hervorrief, war die wöchentliche Vernichtung der Kakerlaken in den Schlafkammern. Die Kakerlaken, die jede Ritze zu nutzen wussten, waren eine grässliche Plage. Sie ließen sich einfach nicht ausrotten, sondern bestenfalls unter Kontrolle halten. Dazu gossen die McGregors jede Woche einmal eine scharfe, mit Kerosin vermischte stinkende Brühe in die Eisenrohre der Bettgestelle, in denen das Ungeziefer mit Vorliebe nistete. Die übelriechende Mixtur, die Onkel William selbst herstellte und in seinem Laden verkaufte, trieb die Kakerlaken aus ihren dunklen Verstecken und in die Bleche, die mit einem wassergefüllten Umlauf versehen waren, so dass sie nicht flüchten konnten. Moira verabscheute Kakerlaken, während ihr Spinnen wenig ausmachten. Doch noch mehr ekelte es sie davor, diese Käfer mit einer Art hölzernem Stampfer auf den Blechen zermalmen zu müssen.
In der ersten Woche kam Moira nur zweimal aus dem Haus. Ihre Mutter, die mit ihrem Eingeschlossensein recht zufrieden schien, spazierte in der Stunde vor der Abenddämmerung mit ihr zur Moama Wharf, wo es immer etwas zu beobachten gab – und wenn es auch nur der Fluss war, wie er schlammig trüb und mit gefährlichem Treibholz in Form von entwurzelten Bäumen zwischen den hohen Uferbänken dahinfloss, die meist schon im tiefen abendlichen Schatten lagen. Es trieb ihre Mutter leider immer nur zu schnell wieder in das Haus der McGregors zurück, als fürchtete sie, erkannt und mit Blicken oder gar Fragen verfolgt zu werden.
Wirklich dankbar war Moira ihren Verwandten für die kleine Kammer, die sie ganz allein für sich hatte. Es machte nichts, dass sie direkt unter dem Dach lag und dementsprechend heiß war. Moira fand, dass dieser Makel von der Aussicht, die sie von ihrem Fenster aus hatte, mehr als wettgemacht wurde. Ihr Zimmer lag nämlich über dem Anbau, der in den Hinterhof führte und Onkel Williams Lager beherbergte, und ging zur Bourke Street hinaus. Da die gegenüberliegenden Häuser ein Stockwerk niedriger waren, vermochte sie nicht nur die Victoria Street zu überblicken, sondern sogar auch Teile der River Street. Deutlich konnte sie die beiden hölzernen Ladekräne an der Landungsbrücke erkennen sowie mehrere hohe Lagerhäuser und das plumpe, eckige Backsteingebäude des Royal Victoria Hotel. Es erhob sich unmittelbar neben der Pier und erhielt zumindest im rotgoldenen Licht der Morgen- und Abendsonne für kurze Zeit ein leuchtend herrschaftliches Aussehen.
In den billigen Quartieren in Adelaide hatten sie stets nur in die dunklen Schluchten schmaler Hinterhöfe oder auf nackte Steinwände geschaut, und Moira war sicher, dass es in Port Augusta nicht besser gewesen war. Sie liebte deshalb den ungehinderten Blick, den sie von ihrer Kammer aus über einen Teil von River Bend hatte. Am liebsten hockte sie in der Abendstunde, wenn der Himmel in Flammen stand, auf dem breiten Fensterbrett und überließ sich ihren sehnsüchtigen Träumen. Und pünktlich wie die Uhr kam Samuel Walsh, der glatzköpfige Lampenanzünder, jeden Abend auf seinem Fahrrad gemächlich die Victoria Street herunter geradelt. Er trug eine schmale, aufklappbare Leiter auf den Rücken geschnallt, die er an die Lampenpfosten lehnte. Ohne Eile, vielmehr bedeutungsvoll und im Bewusstsein seines wichtigen Amtes kletterte er jedes Mal die Leiter hoch, öffnete das Glastürchen der Straßenlaterne, füllte den Behälter mit Kerosin für eine Nacht auf, zündete den Docht an, schloss die Glasöffnung wieder, schaute kurz auf die Flamme, nickte knapp, als hätte die Flamme seine kritische Prüfung bestanden, und kletterte dann wieder hinunter, um sich wenig später die Leiter auf den Rücken zu schnallen und zur nächsten Laterne zu fahren.
Die Lampen standen zu weit auseinander und die Lichter waren zu schwach, um die Straße bei Nacht auch nur halbwegs ausreichend zu erleuchten. Der einzige gute Zweck, den diese Laternen besaßen, war, wie Onkel Williams einmal spöttisch sagte, dass sie einem mit ihrem schwachen Glimmer in einer wirklich stockfinsteren Nacht zumindest die ungefähre Richtung angaben, in die man gehen musste. Moira wurde es jedoch nie müde, dem Lampenanzünder bei seiner Arbeit mit ihren Blicken zu folgen. Wie unzureichend der Schein der Straßenlaternen auch sein mochte, die beständige Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit, mit der er Abend für Abend seiner Tätigkeit nachging, waren in Moiras Augen ein Beleg dafür, für wie ernst und wichtig er seine Aufgabe nahm.
Als Tante Josepha sie nach zehn Tagen endlich in die Schule gehen ließ, fühlte sich Moira ganz und gar nicht erleichtert. Sie hatte böse Vorahnungen, die sich auch bestätigten. Denn in dem Brettergebäude, in dem es nur drei Klassenräume gab und in dem die ersten vier Altersgruppen in einem Raum unterrichtet wurden, traf sie das Mädchen mit den schwarzen Zöpfen wieder, das sie am Tage ihrer Ankunft bei dem Jasminbusch gesehen hatte – und hinterher mehrmals vom Fenster aus. Sie hieß Emily, und sie war die älteste Tochter von Alex Dickinson, der als Vormann in der Sägemühle arbeitete. Die Dickinsons, zu denen noch zwei Kleinkinder gehörten, wohnten auf der Bourke Street im Haus gegenüber.
Emily Dickinson, deren pechschwarzes Haar ebenso das Erbe ihres Vaters war wie die robuste Statur, hatte es vom ersten Tag an auf sie abgesehen. Sie und ihre Busenfreundinnen Ella, Shirley und Norma hatten schon auf sie gewartet. Auf dem staubigen Hof stellten sie sich ihr am Morgen ihres ersten Schultages sogleich in den Weg.