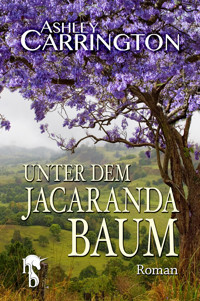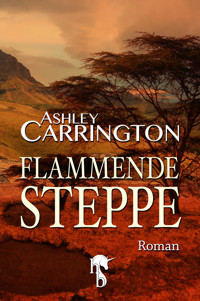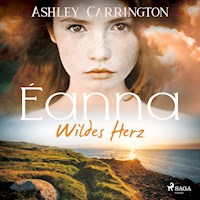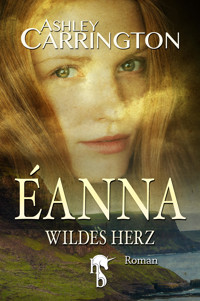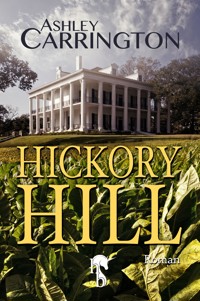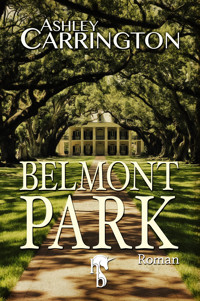4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amerika, 1849: Éanna ist fest entschlossen, gemeinsam mit Brendan endlich ihren Traum von einem unabhängigen Leben zu verwirklichen. Mit einigen Freunden kehren sie New York den Rücken und schließen sich einem Treck nach Kalifornien an. Doch der Weg in den Westen ist weit. Und in all den Monaten voller Gefahren und Entbehrungen lässt Éanna eines keine Ruhe: Sie schafft es einfach nicht, den Schriftsteller Patrick O’Brien zu vergessen … Der vierte und letzte Band der Éanna-Reihe von Ashley Carrington.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ashley Carrington
Éanna
Traum vom Glück
Roman
1. Kapitel
»Oh nein! Das hat uns gerade noch gefehlt!«, stöhnte Éanna und ließ enttäuscht ihren Kleidersack auf die dicken Bohlen der Bootsanlegestelle fallen.
Müde und erschöpft stand sie im Hafen von St. Louis und beobachtete das geschäftige Treiben. Trotz des dicken Wollmantels und des Schals, den sie sich doppelt um den Hals gewickelt hatte, fröstelte sie. Es war später Nachmittag und ein nasskalter Aprilwind fegte über den Mississippi. Er setzte den Wellen kleine weiße Schaumkappen auf und verwirbelte den Dreck auf den Piers mit den rußigen Rauchwolken der Raddampfer, Fährboote und Barkassen. Der Wind schnitt scharf in Éannas sommersprossiges Gesicht und zerzauste ihr blond gelocktes Haar. Gewöhnlich schimmerte es kupferrot, doch nun war es völlig verfilzt und verdreckt. Auch Éannas Begleiter Brendan, Emily und Liam sahen nicht besser aus. Emily hatte ihr langes dunkelbraunes Haar schon vor Tagen mit einem Stück Schnur zu einem Zopf zusammengebunden, um nicht gänzlich verwahrlost zu wirken. Aber genau wie die bauschigen Lederkappen, die Brendan und Liam sich in New York als Kohlenschlepper zugelegt hatten, half dies nur wenig gegen das erbärmliche Bild, das die vier Freunde abgaben.
Vor gut einer Woche waren sie von New York nach Missouri aufgebrochen, um sich im Grenzland bei Independence einem Siedlertreck nach Westen anzuschließen. Seitdem hatten sie in baufälligen Lagerschuppen und windschiefen Feldscheunen übernachtet und sich wie Landstreicher auf Vieh- und Güterwaggons geschlichen. Keine unnötige Ausgabe sollte ihre mühsam zusammengesparten Rücklagen belasten. Und so trugen sie den Dreck klobiger Fuhrwerke und offener Achterdecks mit sich, den Staub verrußter Eisenbahntrassen und schmutzstarrender Bretterverschläge. Doch die Strapazen hatten sich gelohnt, denn endlich waren sie in St. Louis angekommen. Allerdings war ihre Reise noch lange nicht zu Ende, sondern fand hier erst ihren eigentlichen Ausgangspunkt.
Die Hafenstadt am schlammig braunen Mississippi war seit Langem das Tor in den Westen. Doch seit einigen Jahren brach nicht mehr nur die mutige, aber kleine Schar der Trapper und Pelzjäger in die schier endlosen Weiten auf. Tausende und Abertausende suchten mittlerweile ihr Glück in den noch kaum besiedelten Gebieten. Einige hofften darauf, fruchtbares Land zu besiedeln und bald eine Farm ihr Eigen nennen zu können, andere waren seit den sensationellen Goldfunden im fernen Sacramento-Tal vom Goldfieber gepackt. Doch ganz egal, aus welchen Gründen sie sich auf die beschwerliche und gefahrvolle Reise machten: Wer sich einem der zahllosen Überlandtrecks anschließen wollte, kam auf seiner Reise fast zwangsläufig nach St. Louis. Von hier aus ging es mit einem Flussschiff erst knappe zwanzig Meilen den Mississippi hinauf und dann auf dem Missouri fast vierhundert Meilen bis zu einer der Pioniersiedlungen Independence, Westport, Fort Leavenworth oder St. Joseph. Von dort brachen die Wagentrecks im Frühjahr zu ihrer monatelangen Reise nach Westen auf. Sie folgten dem mehr als zweitausend Meilen langen, berühmt-berüchtigten Oregon-Trail, von dem neuerdings hinter den Rocky Mountains der Kalifornien-Trail zu den Goldfeldern jenseits der Sierra Nevada abzweigte.
Seit dem Goldrausch legten in St. Louis Tag für Tag durchschnittlich zehn voll belegte Flussdampfer von den Kais ab und nahmen Kurs auf die Grenzorte. Hunderte von Passagieren wurden auf jedem dieser Dampfer eng zusammengepfercht, und doch waren alle überglücklich, wenn sie einen Platz ergattert hatten.
An diesem ungemütlichen Tag in der ersten Aprilwoche würden es sogar noch mehr sein. Denn soeben legte von der benachbarten Pier unter weit schallendem Sirenenklang die Gallant, ein eleganter Zweidecker, ab. Es war bereits das zehnte Schiff des Tages, das den Hafen von St. Louis verließ. Und gleich würde ihr die Lewis & Clark folgen, die auf ihren hohen schwarzen Doppelschornsteinen die Farben einer konkurrierenden Dampferlinie trug. Ihre Kessel standen schon unter Dampf, wie die aus den Schornsteinkronen hervorquellenden Rauchwolken verrieten. Den Captain drängte es offensichtlich, so schnell wie möglich die Leinen loswerfen zu lassen und aus dem Hafen zu kommen. Das Gerücht ging um, dass sich die beiden Raddampfer ein Wettrennen nach Independence liefern würden, und scheinbar wollte der Schiffsführer den Vorsprung der Gallant unter keinen Umständen zu groß werden lassen. Wohl deshalb durfte plötzlich niemand mehr an Bord.
»Das kommt davon, wenn man es mal nicht als blinder Passagier versucht, sondern einen ehrlichen Fahrpreis bezahlt«, murmelte Liam müde und verzog das Gesicht zu einer Grimasse, während er Emily an der Hand hielt. Fürsorglich achtete er darauf, sie in dem Gedränge auf der Pier sicher an seiner Seite zu halten. Liam hatte ein solch ausgeglichenes Wesen, dass er sogar in dieser misslichen Situation Ruhe und Gelassenheit bewahrte.
Ganz im Gegensatz zu Éannas Freund Brendan. Im ersten Moment entgeistert, dann mit sichtbarer Empörung starrte er den bulligen Bootsmann an, der ihnen mit einem dicken Prügel in der Hand den Weg zur Lewis & Clark versperrte. Hinter ihnen drängte sich unter dem dunklen Nachmittagshimmel eine ungeduldige Menge aus Männern, Frauen und Kindern jeden Alters und jeder Gesellschaftsklasse. Sie alle wollten möglichst schnell auf den Raddampfer, denn in der letzten Stunde waren schiefergraue Wolken über St. Louis aufgezogen und schon fielen die ersten Regentropfen. Eben noch hatte Brendan geglaubt, sich in wenigen Augenblicken mit Éanna und den anderen im Schutz der überdachten Decks unterstellen zu können – und nun hatte der Bootsmann dem Einschiffen ein abruptes Ende bereitet.
»Das kann nicht Euer Ernst sein, Mann!«, stieß Brendan ungläubig hervor. »Wir haben Tickets für das Schiff! Verfluchte acht Dollar hat jeder dafür bezahlt und damit haben wir das Recht, ebenfalls an Bord zu gehen!«
Der Bootsmann, ein Schrank von einem Mann, dessen kantiges Gesicht von Narben übersät war, bedachte den Achtzehnjährigen mit einem geringschätzigen Blick.
Brendans rotes Haar stand wirr in alle Richtungen von seinem Kopf ab und die Nasenflügel bebten vor Zorn. Doch weder seine Wut noch seine kräftige Statur beeindruckten den Bootsmann, denn er überragte Brendan um Haupteslänge.
»Sehe ich vielleicht aus, als würde ich Scherze machen, Paddy?«, blaffte er laut genug zurück, damit ihn auch die übrigen Wartenden auf der Pier hörten. »Wasch dir gefälligst deine dreckigen Ohren! Ich sage es nur noch einmal: Die Lewis & Clark ist voll! Das war’s! Ihr könnt auf den nächsten Dampfer nach Independence warten.«
Und während die Menschen in der Menge laut aufstöhnten, fügte er noch hämisch hinzu: »Außerdem ist die Lewis & Clark kein Schiff, sondern ein Boot, kapiert? Aber für solche Unterscheidungen fehlt euch irischen Kartoffelfressern wahrscheinlich der nötige Grips.« Er steckte sich ein daumenlanges Stück Kautabak in den Mund und grinste provozierend. »Sonst noch was, Paddy?«
Brendan schoss das Blut ins Gesicht. Nur mühsam konnte er sich beherrschen, die Beleidigung des Bootsmanns nicht mit einem Faustschlag zu beantworten.
»Das kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir auf irgendeinen anderen Dampfer warten!«, stieß er hervor. »Ich sehe doch, dass auf der Lewis & Clark noch Platz für uns ist! Euer Captain will nur so schnell ablegen, damit er den Anschluss an die Gallant nicht verliert! Oder glaubt Ihr vielleicht, wir hätten nicht von Eurem dämlichen Wettrennen gehört?«
»Und?«, gab der Bootsmann höhnisch zurück, während in seinem Rücken zwei weitere muskelbepackte Männer Aufstellung nahmen. »Es bleibt dabei. Die Lewis & Clark legt ohne euch ab. Geht das langsam mal in deinen Irenschädel, Paddy?«
»Lass es gut sein, Brendan. Bitte!«, flüsterte Éanna eindringlich und fasste ihn am Arm. Niemals würde der Bootsmann sie an Bord lassen. Vielmehr schien er nur darauf zu warten, seinen Prügel gegen Brendan schwingen zu können. Und Éanna kannte Brendan gut genug, um zu wissen, dass jetzt nicht mehr viel fehlte, bis er die Beherrschung verlieren und den ersten Schlag austeilen würde. Dieser sinnlose Wortwechsel konnte nur ein böses Ende nehmen. »Es bringt doch nichts.«
»Ja, und auf einen halben Tag mehr oder weniger kommt es nun auch nicht mehr an«, pflichtete Liam ihr rasch bei.
Emily nickte. »Das bisschen Verzögerung lohnt die Aufregung wirklich nicht, Brendan. Wir kommen schon noch früh genug nach Independence, um uns dem Treck von diesem Nathan Palmer anzuschließen. Wir haben es doch viel schneller hierher nach St. Louis geschafft als gedacht.«
Éanna warf ihnen einen dankbaren Blick zu. »Genau. Ob wir nun heute oder erst morgen den Fluss hochfahren, macht wirklich keinen großen Unterschied.«
Doch Brendan reagierte nicht, sondern nahm seinen Blick nicht eine Sekunde vom verächtlich grinsenden Gesicht des Flussschiffers. Éanna sah ihm an, dass er innerlich kochte. Sie wusste, wie sehr er es hasste, wenn man ihn abfällig mit »Paddy« anredete. Und zwar nicht allein deshalb, weil »Paddy« und »Bridget« die Schimpfnamen waren, mit denen überhebliche Amerikaner Einwanderer aus Irland zu titulieren pflegten. Seit die Iren zu Hunderttausenden vor der entsetzlichen Hungersnot in ihrer Heimat flohen und nach Amerika auswanderten, standen sie bei den weißen Einheimischen auf der Beliebtheitsskala weit unten. Tatsächlich rangierten sie nur wenig über den Indianern und Schwarzen, die in Amerika völlig rechtlos und geächtet waren.
Nein, der Name »Paddy« war Brendan auch noch aus einem ganz anderen, sehr privaten Grund zutiefst zuwider. Denn »Paddy« stand für Patrick und so hieß der Mann, der neben ihm eine wichtige Rolle in Éannas Leben gespielt hatte. Das war schon in Irland so gewesen und zu Brendans großem Missbehagen hatte es sich auch in New York nicht geändert.
Schon oft hatte sich Éanna anhören müssen, dass ihr Freund Patrick O’Brien für einen verdammten Dandy und süßholzraspelnden Möchtegernschriftsteller hielt, der nie Armut kennengelernt hatte und immer auf das Feinste herausgeputzt daherstolziert kam. Das allein war schon Grund genug für Brendan gewesen, ihn nicht zu mögen und zum Teufel zu wünschen. Doch erst der Umstand, dass Éanna ihm ehrlich zugeneigt war und ihn immer wieder gegen Brendans Lästereien verteidigt hatte, war der Auslöser ihrer Streitigkeiten gewesen.
Sie schüttelte den Kopf bei dem Gedanken daran, welche Vorhaltungen Brendan ihr gemacht hatte. Aber die Zeit, in der sie sich über Patrick O’Brien gestritten hatten, gehörte gottlob der Vergangenheit an. Sie waren nun auf dem Weg in ein neues Leben und Patrick gehörte nicht mehr dazu. Auch wenn Éanna ihren guten Freund vermisste, so war sie doch froh darüber, dass sie und Brendan nun von vorne beginnen konnten. Und auch Brendan schien mehr als beruhigt zu sein, keinen Nebenbuhler mehr um sich zu haben.
Im Moment jedoch war von dieser Erleichterung nichts zu spüren, denn Brendans Gesicht verfärbte sich gerade zornesrot.
»Das könnt Ihr nicht mit uns machen!«, rief er erregt aus, während er Éannas Hand wegstieß. »Ihr werdet uns gefälligst an Bord des Schiffes gehen lassen, Mann! Wir haben Tickets für die Lewis & Clark, das steht hier schwarz auf weiß!« Er streckte ihm die vier Fahrscheine für die Passage nach Independence entgegen.
Der Bootsmann stieß Brendans Hand grob mit seinem Prügel zur Seite. »Nimm das Maul bloß nicht so voll, sonst kriegst du was auf deine dicke Lippe, Paddy«, herrschte er ihn an. »Und mach gefälligst deine Augen auf und lies richtig, falls du überhaupt lesen kannst! Auf den Tickets steht ›Deckspassage nach Independence mit der Lewis & Clark …‹«, er machte eine kurze Pause, bevor er fortfuhr und das nächste Wort nachdrücklich betonte: »› … oder einem anderen Boot der Missouri Packet Steamboat Company‹! Und welches Boot euch nach Independence bringt, wird man euch schon noch früh genug mitteilen!« Damit spuckte er ihm einen dicken Strahl Kautabaksaft vor die Füße und wartete einen Moment, ob Brendan die Nerven verlieren und auf ihn losgehen würde. Als das nicht geschah, drehte er sich mit einem verächtlichen Schnauben um und ging über die Gangway an Bord zurück. Dabei rief er den Matrosen zu, die Leinen zum Ablegen loszuwerfen und die Gangway einzuziehen.
Sprachlos und hochrot im Gesicht stand Brendan im zunehmenden Regen und starrte auf die Tickets. Da stand es tatsächlich, klein gedruckt und unter der Umrisszeichnung eines Raddampfers, dieses ›oder einem anderen Boot der Missouri Packet Steamboat Company‹.
»So eine Gemeinheit!«, stieß er schließlich wütend hervor. »Davon hat keiner was gesagt, als wir die Tickets gekauft haben. Und so winzig, wie das hier gedruckt steht, fällt das doch keinem auf!«
Liam legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter. »Mach dir nichts draus, Brendan. Das konnte ja wirklich niemand ahnen, geschweige denn wissen. Keiner von uns hat es bemerkt«, besänftigte er ihn. »Gegen die raffinierten Tricks, die sich diese Geschäftsleute einfallen lassen, sind wir sowieso machtlos. Je eher du dich damit abfindest, desto besser. Und jetzt lass uns lieber zusehen, dass wir aus dem Regen kommen!«
Ungehalten schüttelte Brendan die Hand seines Freundes ab. »Du magst es hinnehmen, dass wir immer die Dummen sind. Aber ich nicht«, schimpfte er. »Heute nicht und morgen nicht! Dafür habe ich Irland nicht verlassen! Dafür habe ich nicht die Überfahrt auf diesem verfluchten Seelenverkäufer ertragen und mich in New York abgerackert! Das alles kann doch nicht umsonst gewesen sein. Niemals werde ich mich damit abfinden, das sage ich euch!« Damit wandte er sich abrupt ab und stapfte davon.
Liam sah ihm verdutzt nach. Er hatte sich daran gewöhnt, dass sein Freund schnell die Beherrschung verlor, doch noch nie hatten sich Brendans Wutausbrüche gegen ihn gewendet. Er schluckte und sagte dann mit einem schiefen Grinsen zu Éanna und Emily: »Na ja, wenigstens hat sich Brendan nicht vom Bootsmann provozieren lassen. Das hätte auch ein weit unerfreulicheres Ende nehmen können. Ich dachte schon, wir haben gleich die schönste Schlägerei!«
»Ja, viel hat wirklich nicht gefehlt«, sagte Emily. »Dieser Kerl hat es aber auch darauf angelegt. Man hatte fast den Eindruck, er will, dass Brendan auf ihn losgeht, damit er einen Grund hat, ihn ordentlich durchzuprügeln. Das wäre bestimmt böse für Brendan ausgegangen. Ganz zu schweigen davon, dass wir dann gewiss auf der schwarzen Liste dieser Raddampfergesellschaft stehen würden und uns woanders ein neues Ticket kaufen müssten.«
Éanna seufzte. Auch sie war erleichtert, dass der Wortwechsel zwischen Brendan und dem gehässigen Bootsmann nicht zu Handgreiflichkeiten geführt hatte. Aber der unbändige Zorn, der in Brendans Stimme gelegen hatte, bedrückte sie. Eigentlich war der Vorfall doch eine Lappalie gewesen. Schon oft hatten sie sich Beleidigungen dieser Art anhören müssen und es waren sicherlich nicht die letzten gewesen. Warum wurde Brendan darüber so ungehalten? Seine Unbeherrschtheit machte ihr Angst. Und sie riss alte Wunden in ihr auf, die lange genug gebraucht hatten, um zu heilen. Wieder drängte sich die bange Frage in ihr Bewusstsein, ob ihre Liebe füreinander stark genug war, um gemeinsam glücklich zu werden. Es gab nichts, wonach sie sich nach so vielen Jahren entsetzlicher Not und Quälerei mehr sehnte. Doch wann würden die Zweifel in ihr endlich zum Schweigen kommen und der Gewissheit Platz machen, dass Brendan und sie füreinander geschaffen waren und es nichts auf der Welt gab, das ihrem Glück im Weg stehen konnte?
2. Kapitel
Wie unnötig die hässliche Auseinandersetzung mit dem Bootsmann gewesen war, zeigte sich keine zwei Stunden später. Denn da tauchte ein kleiner Raddampfer namens Selkirk aus den Regenschleiern auf. Zwei Angestellte der Missouri Packet Steamboat Company eilten sogleich mit blechernen Sprechtrichtern über den Kai und forderten all jene Passagiere zum sofortigen Einschiffen auf, die eine Passage mit der Lewis & Clark gebucht hatten und nicht mehr an Bord gelassen worden waren.
Dem Dampfer mit seinen kurzen Kabinenaufbauten und dem langen freien Frachtdeck war auf den ersten Blick anzusehen, dass er nicht für die Beförderung von Passagieren gebaut war. Aber das kümmerte die Passagiere nicht. Hauptsache, er brachte sie nach Independence!
»Na also, viel Lärm um nichts«, konnte sich Emily nicht verkneifen, in Brendans Richtung zu sagen, als sie rasch ihre Bündel aufnahmen, um ebenfalls an Bord zu gehen.
Brendan schien sein unbeherrschtes Verhalten inzwischen zu bereuen und bemühte sich, wieder für gute Stimmung zu sorgen. »Es hat eben nicht jeder so ein lammfrommes Gemüt wie du«, scherzte er.
Liam zwinkerte ihm zu. »Wenn du dich da mal nicht gewaltig täuschst. Also, ich wüsste ein paar Geschichten, die so gar nichts Lammfrommes an sich haben!«
Emily machte ein empörtes Gesicht. »Vorsichtig, Liam Maguire! Pass bloß auf, was du herumerzählst, sonst bekommst du mein lammfrommes Gemüt erst richtig zu spüren!« Doch dann schmunzelte sie und ließ sich von Liam willig in den Arm nehmen und drücken. Wehmütig betrachtete Éanna ihre Freunde. Wie lange war es her, dass sie und Brendan so unbeschwert miteinander umgegangen waren?
Das heitere Lachen von Emily und Liam riss sie aus ihren Gedanken. Dass sie nun doch erheblich früher weiterreisen konnten, als sie nach der Abfahrt der Lewis & Clark befürchtet hatten, sorgte bei allen für eine fröhliche, fast ausgelassene Stimmung. Schon bald würden sie Independence erreichen! Auch das Wetter wurde wieder besser. Kaum hatte die Selkirk den Hafen hinter sich gelassen und mit laut ratternden Schaufelrädern Kurs auf die Mitte des Mississippi genommen, hörte es auf zu regnen und der Abendhimmel klarte auf. Das war für Éanna und ihre Freunde ein wahres Geschenk, denn sie reisten als einfache Deckspassagiere und würden wieder einmal ohne Dach über dem Kopf schlafen müssen.
Gut gelaunt suchten sie auf dem Deck nach einem annehmbaren Schlafplatz und entdeckten schließlich zwischen den vielen Tonnen, Kisten und Seilrollen ein Fleckchen, wo sie es sich so gemütlich machten, wie es die Umstände erlaubten. Éanna lehnte sich gegen einen fest verschnürten Ballen Leinwandplane, der später vermutlich zu den Dachbespannungen der schweren Präriewagen verarbeitet werden würde. »Nun ja, wir sind schon schlechter gereist«, meinte sie.
»Da hast du allerdings recht«, stimmte Emily ihr sofort zu.
»Ich schlafe zehnmal lieber hier auf den harten Planken und unter freiem Himmel als noch einmal in dem stinkenden Zwischendeck eines Auswandererschiffes. Wenn ich nur an die Metoka mit ihren Brettersärgen denke, die sie uns als Kojen verkauft haben!«
»Erinnere mich bloß nicht daran!«, kam es von Brendan und er schüttelte sich. Die Überfahrt nach Amerika auf dem entsetzlichen Schiff mit seiner skrupellosen Besatzung war ihnen schier endlos erschienen. »Mir reichen die Albträume, die ich manchmal noch davon habe. Ich werde nie vergessen, wie diese geldgierige Bande von Seeleuten die toten Passagiere einfach über Bord gekippt und den Haien …«
»Hör auf!«, fiel Liam ihm schnell ins Wort. »Lasst uns lieber von anderen Dingen reden. Was meint ihr, wird unser Geld auch wirklich reichen, um mit diesem Nathan Palmer und seinem Scout auf den Treck zu gehen? Wir müssen nicht nur die Gebühr bezahlen, sondern auch noch einen soliden Wagen, ein mindestens vierköpfiges Gespann, ausreichend Lebensmittel für gute viereinhalb Monate, Werkzeug, Ersatzteile …«
»Außerdem werden wir wohl ein, zwei Gewehre oder Revolver zur Verteidigung kaufen müssen, falls wir es auf dem langen Weg mit Rothäuten zu tun bekommen«, fügte Brendan hinzu.
Emily machte ein erschrockenes Gesicht. »Mal bloß nicht den Teufel an die Wand!«
»Ach was, so gefährlich wird es schon nicht werden«, erwiderte Éanna hastig, und diese Beteuerung galt ebenso der Beruhigung ihrer Freundin wie ihrer eigenen. »Es gehen doch so viele Trecks auf den Trail nach Westen! Und wir reisen bestimmt in einer größeren Gruppe.«
»Vorausgesetzt, unser Erspartes reicht«, kam Liam auf den Punkt zurück, der ihn mehr mit Sorge erfüllte als die Gefahr durch kriegerische Indianer.
»Mhm, ja, das ist schon eine verdammt lange Liste«, räumte Brendan besorgt ein, während sich die Dunkelheit über den breiten Strom legte und die zurückweichenden Wolken am Nachthimmel den Blick auf die ersten Sterne freigaben. »Ich wünschte, wir wüssten schon, was das ganze Zeug kosten wird. Jetzt mögen uns unsere siebenhundert Dollar wie eine Menge Geld erscheinen, aber wenn die Händler in Independence ihr Monopol nutzen und gesalzene Preise verlangen, kann es schnell knapp werden.«
Die Freunde redeten noch eine ganze Weile darüber, was sie wohl in Independence und später auf dem Treck erwarten würde. Angesichts des großen Abenteuers, auf das sie sich begeben wollten, waren alle vier aufgeregt und nervös. Doch die Hoffnung, die nötige Ausrüstung irgendwie zusammenzubekommen, Mitte April mit Nathan Palmers Wagenzug gen Westen aufzubrechen und irgendwo auf der anderen Seite des Kontinents ein Stück Land in Besitz nehmen und sich eine neue Existenz aufbauen zu können, überwog und stimmte sie zuversichtlich. Wie lange träumten sie nun schon davon! Seit sie von zu Hause aufgebrochen waren, waren sie ihrem Ziel nicht so nahe gewesen wie jetzt.
Die Selkirk dampfte mit monoton ratternden Schaufelrädern durch die Nacht und nach und nach verstummten die Gespräche an Deck. Auch Éanna und ihre Freunde gaben bald der Müdigkeit nach, die sich bleiern auf ihre Lider senkte. Als sie sich schlafen legten, breitete Brendan eine alte raue Decke über Éanna aus, schlüpfte ebenfalls darunter und schmiegte sich an sie. Von der anderen Seite des Ballens, wo Emily und Liam sich ihr Nachtlager bereitet hatten, kam leises Kichern und Flüstern.
»Möchte mal wissen, was die beiden da unter ihrer Decke so treiben«, raunte Brendan und zog Éanna näher zu sich heran. Seine Finger spielten vorwitzig mit den Knöpfen ihrer Bluse. »Hast du vielleicht eine Ahnung?«
»Brendan! Du bist unmöglich«, flüsterte sie zurück. »Das kann uns doch völlig egal sein! Außerdem bin ich hundemüde und kann mir Besseres vorstellen, als die ganze Nacht lang meine Freunde zu belauschen. Hast du nicht auch gerade andauernd gegähnt?«
»Ach Éanna«, seufzte Brendan. »Wie soll ich denn ans Schlafen denken, wenn du direkt neben mir liegst? Endlich sind wir mal wieder für uns – wenigstens ein bisschen. Soll ich mich da etwa einfach umdrehen und losschnarchen?« Er küsste sie zärtlich.
»Ehrlich gesagt, wäre mir das am liebsten«, entgegnete sie abweisend. »Es schickt sich nun einmal nicht, so in aller Öffentlichkeit …«
»Psst! Niemand kümmert sich um uns. Und die Sterne zählen nicht«, unterbrach er sie und erstickte ihren Protest mit seinen Lippen.
Mit einem leisen Seufzen gab Éanna ihren Widerstand auf und erwiderte seinen Kuss. Doch nach einer Weile schob sie ihn sanft von sich und wandte ihr Gesicht ab.
Brendan wusste inzwischen, dass es zwecklos war, sie zu bedrängen. »Wenn du nur wüsstest, wie grausam du bist, mich so von dir zu stoßen«, murmelte er. Obwohl er einen scherzenden Ton angeschlagen hatte, blieben seine Augen ernst. »Weißt du denn nicht, wie sehr ich dich liebe?«
Sie lächelte ihn an, sein Gesicht nur eine Handbreit von ihrem entfernt. »Doch, Brendan. Und genau deshalb weiß ich auch, dass du diese wunderschöne Grausamkeit gern erträgst und mir die Zeit lässt, die ich für …«, sie stockte kurz, »… für alles andere brauche. Und jetzt lass uns schlafen. Ich bin jedenfalls wirklich todmüde.«
»Dann schlaf gut«, antwortete er wehmütig. »Vielleicht darf ich dir ja wenigstens im Traum nahe sein.«
Sie lachte leise auf und strich ihm über die Wange. »Du hast vielleicht Einfälle, Brendan. Wir sind uns doch nahe. Und bald bestellen wir auf unserem kleinen Hof das Land, füttern das Vieh und freuen uns über das erste Kalb, das unsere Milchkuh geworfen hat!«
Brendan rückte ein wenig von ihr weg. »Und das ist alles, woran du denkst? Kommt in deinem Kopf gar nichts vor, was nicht mit mühsamer Plackerei zu tun hat?«
»Ist das denn nicht die schönste Vorstellung, die man haben kann?«, fragte sie zurück und nun war ihre Stimme frei von jeder Spur Leichtigkeit. »Ein eigenes Stück Land und Vieh zu besitzen, eine sichere Existenz zu haben und von keinem Großpächter abhängig zu sein, wie es unsere Eltern gewesen sind? Frei sein! Haben wir nicht deshalb Irland verlassen und all die Mühen auf uns genommen?«
»Ja, schon«, gab er zögerlich zu. »Aber es gibt auch noch andere Träume, Éanna.«
»Das mag ja sein. Aber ich möchte nie wieder Angst vor der nächsten Hungersnot haben müssen«, erwiderte sie entschlossen.
Für Éanna war das bitterer Ernst. All das, was sie durchgemacht hatte, hatte mit der Hungersnot angefangen, die Irland fest im Griff hatte. Éanna hatte dabei ihre ganze Familie verloren, und noch heute erinnerte sie sich, was sie ihrer sterbenden Mutter versprochen hatte.
Brendan jedoch schien nicht zu spüren, was in Éanna vor sich ging. Ärgerlich drehte er sich auf die Seite und einige Minuten später hörte Éanna seine gleichmäßigen Atemzüge.
Sie selbst jedoch lag noch lange wach und hörte auf das Rauschen des schäumenden Wassers in den Radkästen der Selkirk. Das Gespräch hatte sie stärker aufgewühlt, als sie vor Brendan zugegeben hatte. Denn sie musste sich eingestehen, dass es nicht ganz der Wahrheit entsprach, was sie eben über ihre Träume gesagt hatte. Es stimmte, dass sie sich nichts sehnlicher wünschte, als ihren eigenen Hof zu bewirtschaften, und daran würde sich auch niemals etwas ändern. Doch ob dieser Traum auch Brendan einschloss, dessen war sie sich nicht mehr sicher. Denn hin und wieder tauchte in ihren Träumen ein anderer Mann an ihrer Seite auf. Ein Mann, den sie nicht vergessen konnte, obwohl sie es mit allen Mitteln versuchte.
3. Kapitel
Weit entfernt von Éanna auf ihrem Weg in den Westen schnitt der Zweimaster Sarah Lee vor der amerikanischen Ostküste mit windgeblähten Segeln und singendem Rigg durch die nachtschwarzen Wogen. Die See war ruhig und der Wind blies beständig aus Nordnordost.
Captain Kenworth hatte fast alles verfügbare Tuch setzen lassen, denn schon kurz nach dem Auslaufen aus dem Hafen von New York waren sie in einen schweren Sturm geraten, der sie gezwungen hatte, mühselig vor dem Wind zu kreuzen. Die beträchtliche Verzögerung wollte er nun unbedingt wieder wettmachen, damit die Fracht, die der Zweimaster an Bord genommen hatte, möglichst schnell den Händler in Savanna erreichte. Dort wartete auch schon eine ganze Schiffsladung Baumwolle darauf, von der Sarah Lee über den Ozean nach England gebracht zu werden.
Patrick saß zu dieser nächtlichen Stunde mit Samuel, einem baumlangen Schwarzen, auf dem Vorschiff des Zweimasters. In der kurzen Pause, die ihnen zwischen zwei Wachen zur Verfügung stand, gönnten sie sich eine Maiskolbenpfeife voll Tabak. Niemand vom Rest der Mannschaft hielt sich in ihrer Nähe auf, sodass sie keine Mithörer fürchten mussten.
Samuel war der Einzige an Bord, mit dem Patrick offen reden konnte. Denn sie teilten dasselbe Schicksal. Sie waren beide in einer Taverne im Hafen von New York betäubt und im Schutz der Dunkelheit an Bord des Schiffes gebracht worden. Schanghaien nannte man diese Methode, die in allen großen Häfen angewandt wurde, wenn ein Captain knapp an Seeleuten und skrupellos genug war, seine Mannschaft auf diese Weise zu vervollständigen.
Samuel war schon vor gut zweieinhalb Jahren an Kenworth verkauft worden und hatte sich offensichtlich mit seinem Los abgefunden. Patrick hingegen befand sich erst seit gut einer Woche in der Gewalt des Captains. Anders als Samuel war er jedoch nicht zufällig ein Opfer des Schanghaiens geworden. Das Flittchen Caitlin war schuld daran, dass er nun in dieser Lage war.
Sie hatte Patrick unter einem Vorwand in eine üble Hafentaverne gelockt und ihn mit Opiumbier betäubt. Patrick hatte keine Ahnung, weshalb Caitlin das getan hatte. Er hatte nie Streit mit ihr gehabt, geschweige denn ihr etwas Böses getan.
Und auch darüber, was danach geschehen war, konnte Patrick nur spekulieren. Wohl noch im Hinterhof der Taverne oder auf dem Weg zur Sarah Lee hatten ihn die Schurken ausgeraubt und ihm alles abgenommen, was von Wert gewesen war: den hellbraunen Überrock, seine rehfarbene Seidenweste, die goldene Kette mit der Taschenuhr, seine Seidenkrawatte, die weichen Stiefel und sogar den abknöpfbaren Hemdkragen. Nur Hemd und Hose hatten sie ihm gelassen, und beiden Kleidungsstücken sah man nach dem tagelangen Sturm und dem vielen Seewasser, das sie immer wieder durchtränkt hatte, nicht mehr an, dass er sie erst vor Kurzem bei einem renommierten New Yorker Herrenausstatter erstanden hatte.
Als er mit dröhnendem Kopf aus seiner Betäubung erwacht war, hatte er sich jedenfalls an Bord der Sarah Lee wiedergefunden, die längst in New York abgelegt und sich bereits auf hoher See befunden hatte. Auf Patricks empörten Protest hin hatten die Seeleute nur dreckig gelacht. Als er allerdings darauf bestanden hatte, wieder an Land gebracht zu werden, hatte der Bootsmann nicht lange gezögert, ihn auf einen Gitterrost binden zu lassen und ihm eigenhändig mit der neunschwänzigen Peitsche ein Dutzend Hiebe zu verpassen. Damit hatte er klargestellt, dass Patrick von nun an zur Mannschaft gehörte und jedem Befehl von ihm und dem Captain unverzüglich Folge zu leisten hatte. Sogar jetzt, mehrere Tage nach der Auspeitschung, waren die Verletzungen kaum verheilt und schmerzten immer noch höllisch.
»Du hast also nicht nur studiert, sondern bist tatsächlich ein Schriftsteller und hast ein richtiges Buch geschrieben?«, fragte Samuel nun ungläubig. Patrick hatte ihm gerade ein wenig mehr von seinem bisherigen Leben erzählt.
Er nickte. »Ja, und endlich habe ich einen Verlag gefunden, der das Manuskript bald veröffentlichen wird«, bestätigte er stolz. »Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Schriftsteller bin. Noch kann ich nicht sagen, ob mehr als dieses eine Buch in mir steckt und mein Talent reicht, um darauf ein Leben aufzubauen.«
»Na ja, ein Leben auf See hat jedenfalls eine Menge Geschichten zu bieten, die du aufschreiben kannst!« Samuel grinste spöttisch.
»Ich habe aber nicht vor, so viel Zeit an Bord der Sarah Lee oder irgendeines anderen Schiffes zu verbringen, bis meine Erlebnisse ein zweites Buch ergeben«, wies Patrick den Vorschlag grimmig zurück.
Samuel lachte. »Wir werden sehen. Aber sag, wovon handelt dein Buch? Ist es eine spannende Abenteuergeschichte?«
»Nein, nicht wie das Seemannsgarn, das manche hier spinnen. Mein Buch erzählt eine wahre Geschichte, aber es ist deswegen nicht weniger aufregend. Es handelt von der entsetzlichen Hungersnot in meiner Heimat Irland, die schon über eine Million Tote gefordert hat. Es wird ›Der große Hunger‹ heißen und beschreibt die Leiden der Familie Sullivan«, erklärte Patrick. Tiefer Kummer schlich sich in seine Stimme, als er fortfuhr: »Die Sullivans gehörten zu den unzähligen armen Bauernfamilien, die bei der jahrelangen Kartoffelfäule alles verloren haben. Sie wurden gewaltsam von ihrem kargen Stück Land und aus ihrer kleinen Hütte vertrieben und bis auf eine Tochter, Éanna, sind alle elendig verhungert oder an Krankheit gestorben.«
»Und ausgerechnet in Éanna hast du dich verliebt«, sagte Samuel mitfühlend, der diesen Teil von Patricks Lebensgeschichte schon kannte.
Patrick nickte und dachte an den Tag zurück, als Éanna ihm zum ersten Mal begegnet war. In ihrer Not hatte sie versucht, ihm seinen Spazierstock mit dem silbernen Griffstück zu stehlen, um ihn bei einem Pfandleiher zu versetzen.
»Nie im Leben hätte ich mir das vorstellen können. Ich war damals ganz schön verwöhnt und habe blendend vom Geld meines reichen Onkels gelebt«, gestand er. »Und trotzdem habe ich schon bei unserer ersten Begegnung gespürt, dass Éanna etwas Besonderes ist. Und als wir uns dann jeden Sonntag getroffen haben und sie mir von ihrem Leben erzählt hat, ist sie mir immer mehr ans Herz gewachsen. Das waren die schönsten Stunden meines Lebens. Und jetzt hocke ich auf diesem verdammten Schiff, während sie mit diesem … mit ihren Freunden auf dem Weg nach Independence ist und schon bald mit einem Siedlertreck nach Westen zieht. Verflucht soll das Miststück Caitlin sein!«
»Besser, du gewöhnst dich langsam daran, dass du dem Seemannsleben so schnell nicht entkommen wirst«, sagte Samuel trocken und stopfte die Asche im Pfeifenkopf mit seinem schwieligen Daumen nach unten.
»Von wegen«, widersprach Patrick sofort. »Ich denke nicht daran! Bei der ersten Gelegenheit, die sich mir bietet, werde ich sehen, dass ich von Bord komme. Koste es, was es wolle!«
Samuel warf ihm einen mitleidigen Blick zu. »Da wirst du lange warten müssen, das kann ich dir sagen. Der Captain ist nicht auf den Kopf gefallen. Er weiß genau, dass du die ersten Monate den Gedanken an Flucht nicht aus dem Kopf kriegst. Deshalb wird er es mit dir genauso machen wie mit mir und allen anderen, die nicht freiwillig hier sind: Sobald wir einen Hafen anlaufen, wird er dich unten im Frachtraum einsperren und anketten und erst herauslassen, wenn wir wieder auf See sind. Finde dich lieber damit ab, dass du eine ganze Weile hierbleiben wirst. Das ist der beste Rat, den ich dir geben kann. Irgendwann gewöhnt man sich daran. So schlecht ist das Leben auf See gar nicht, wenn man erst seinen Platz gefunden und alle Handgriffe gelernt hat.«
Patrick schüttelte heftig den Kopf. »Nein! Es muss doch einen Weg geben zu flüchten!«
»Ja, in ein paar Jahren vielleicht, in irgendeinem Hafen, in dem der Captain keine Probleme hat, Seeleute anzuheuern.«
»Ein paar Jahre?« Patrick lachte bitter auf. »Unmöglich, Samuel, so lange kann ich nicht warten. Ich muss so bald wie möglich von Bord kommen! Ich muss, verstehst du? Es darf einfach nicht sein, dass Flucht unmöglich ist. Irgendeine Möglichkeit muss es doch geben!«
Samuel schwieg eine Weile und zog nachdenklich an seiner Pfeife, während Patrick verzweifelt über das Meer in die Nacht starrte. Niedergeschlagen fuhr er sich mit der Hand über das schwarze, leicht gewellte Haar und vergrub sein Gesicht in den Händen.
»Meinst du es wirklich ernst?«, holte Samuel ihn plötzlich aus seinen dunklen Gedanken. Er blickte ihn eindringlich an. »Was bist du bereit zu riskieren?«
Patrick fuhr hoch. »Mein Leben, wenn es sein muss! Ich würde alles tun, um von hier wegzukommen. Alles!«
»Du bist eine stattliche Erscheinung, Patrick, außerdem jung und kräftig. Aber kannst du auch schwimmen?«, fuhr sein Gegenüber fort.
»Ja, natürlich.«
»Ich meine nicht nur ein bisschen herumpaddeln und planschen. Kannst du dich länger als ein paar Minuten über Wasser halten?«, bohrte Samuel nach.
»Und ob«, versicherte Patrick. Erst letzten Sommer hatte er manchmal Stunden im Wasser verbracht und seine Ausdauer im Schwimmen trainiert. »Sag bloß, du hast eine Idee, wie ich dem Captain und seinem Schiff entkommen könnte?«
Samuel zuckte unschlüssig mit den Schultern. »Mag sein. Aber was mir da gerade durch den Kopf gegangen ist, kann dir den Tod bringen, wenn du nicht wirklich ein guter Schwimmer bist. Du wirst meilenweit schwimmen müssen.«
»Das kann ich«, bekräftigte Patrick aufgeregt. »Und nun erzähl schon, welche Idee dir gekommen ist!«
»Also, die Sache ist die«, begann Samuel zögerlich. »Normalerweise kann kaum ein Seemann schwimmen, weiß der Teufel, warum das so ist. Hier auf der Sarah Lee kenne ich jedenfalls nicht einen, der mehr kann als nur mühselig wie ein Hund im Wasser treten. Deshalb sperrt der Captain die Neuen auch erst immer dann weg, wenn wir schon in der Nähe des Hafens sind. Wenn du also so ein guter Schwimmer bist, wie du behauptest, ist das deine Chance. Du musst von Bord springen und ans Ufer schwimmen! Aber nicht kurz vorm Hafen, denn da wird dir der Captain sofort ein Beiboot nachschicken und dich im Handumdrehen wieder einfangen.«
»Wo dann?«, stieß Patrick aufgeregt hervor. Sein Herz raste nicht nur vor Hoffnung auf baldige Flucht, sondern auch vor Angst angesichts der Gefahr, in die er sich damit brachte. Wenn der Captain von seinem Vorhaben erfuhr, würde er sich sicherlich nicht wieder damit begnügen, ihm ein paar Peitschenhiebe zu verpassen. Ganz zu schweigen davon, was geschehen würde, wenn ihn im Meer die Kraft verließ!
Auch Samuel war sichtlich nervös. Vorsichtshalber blickte er sich noch einmal um, ob sich auch wirklich niemand in ihrer Nähe herumtrieb, der ihr Gespräch belauschen konnte. Erst dann begann er, Patrick leise zu erläutern, wann und wo seine Chancen auf Flucht am größten waren.
4. Kapitel
Zur selben Stunde, als Patrick mit neuer Hoffnung an den Lippen seines Schiffskameraden hing, tastete Éanna nach dem kleinen Anhänger, den sie an einem dünnen schwarzen Lederband um den Hals trug. Es war eine ovale Kamee, etwas größer als ein Silberdollar, die Patrick ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Aus dem cremeweißen Material trat in unglaublich feiner Schnitzarbeit das Bild eines vierblättrigen Kleeblattes, umrankt von winzigen Rosenknospen, hervor. Vorsichtig umfasste Éanna das Schmuckstück und drückte es an ihre Brust.
Gleichzeitig hatte sie ein schlechtes Gewissen, dass Patrick sich noch immer in ihre Gedanken schlich. Das durfte sie nicht zulassen, ihr Herz und ihre Zukunft gehörten Brendan!
»Du musst ihn endlich vergessen«, flüsterte sie tonlos und nahm ihre Hand von der Kamee. Es war doch nichts weiter als ein sentimentales Erinnerungsstück an ein endgültig abgeschlossenes Kapitel ihrer Vergangenheit.
Noch dazu ein Kapitel, das mit einer bitteren Enttäuschung geendet hatte.
Denn Patrick hatte es getan. Patrick hatte sie vergessen. Er hatte nicht auf ihren Brief reagiert. Und auch an der Pier war er nicht erschienen, um Abschied von ihr zu nehmen. Es war dumm von ihr gewesen, darüber enttäuscht zu sein. Patrick wusste, dass sie sich für Brendan entschieden hatte und dass sie von nun an getrennte Wege gehen würden.
Und doch, es war ein wundervolles Gefühl gewesen, seine Zuneigung gewonnen und eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt zu haben.
Nie in ihrem Leben würde sie vergessen, was sie ihm verdankten. Ohne seine Hilfe wären sie jetzt nicht mit mehr als siebenhundert Dollar in ihrer Reisekasse auf dem Weg nach Independence. Wahrscheinlich würden sie sich noch immer als Tagelöhner und Dienstmädchen in New York durchschlagen und sich Sorgen um ihr tägliches Brot machen.
Éanna drehte sich auf die Seite. Sie musste endlich aufhören, über ihn nachzugrübeln! Morgen wartete ein weiterer anstrengender Tag auf sie und sie würde völlig zerschlagen aufwachen, wenn sie nicht ein bisschen Schlaf fand.
Doch sie wälzte sich noch lange auf ihrem harten Lager hin und her, ehe ihre Augen zufielen. Sie hatte kaum geschlafen, als sie wieder aus wirren Träumen hochschreckte. Sie brauchte einen Moment, bis ihr einfiel, wo sie sich befand. Dann hörte sie das gleichmäßige Rattern der Schaufelräder und das leise Rauschen der Fluten entlang der Bordwand und wusste wieder, dass sie auf dem offenen Deck der Selkirk lag.
Éanna blickte in den weiten Himmel über sich. Die Sterne funkelten still herunter und nur noch wenige Wolkenfelder verdunkelten ihr Leuchten. An der hohen Position des Halbmondes sah sie, dass es kurz nach Mitternacht sein musste. Wahrscheinlich befand sich die Selkirk mittlerweile schon auf dem Missouri.
Erschöpft versuchte Éanna, zurück in den Schlaf zu finden, als sie ganz in ihrer Nähe ein merkwürdig schabendes, metallisches Geräusch wahrnahm. Es kam aus der Richtung, in der Emily und Liam lagen, und klang so ähnlich wie ihr Messer, wenn sie es aus seiner verbeulten und rostigen Blechscheide zog.
Éanna schüttelte den Kopf. Sie musste wirklich völlig übermüdet sein, wenn sie sich schon solchen Unsinn einbildete. Wer sollte denn noch zu dieser nächtlichen Stunde sein Messer ziehen! Vermutlich waren Emily oder Liam im Schlaf mit der Fußschnalle gegen eine der Truhen oder Kisten gestoßen.
Warum sie sich dennoch aufsetzte und zum Nachtlager ihrer beiden Freunde blickte, wusste sie später nicht mehr zu sagen. Doch hätte sie es nicht getan, hätte sie die schemenhafte Gestalt im dunklen Umhang und mit einem schwarzen Filzhut auf dem Kopf nicht gesehen, die nur zwei Schritte von ihr entfernt stand. Sie beugte sich gerade zu Emily hinunter und hielt tatsächlich ein Messer in der Hand!
Éanna war vor Schreck wie erstarrt und brauchte eine Sekunde, bis sie begriff, was vor sich ging. Mit der linken Hand hatte die Gestalt die Lederschnur des kleinen Brustbeutels ergriffen, den ihre Freundin unter der Kleidung trug, und mit der rechten setzte sie gerade die Messerklinge an, um die Schnur zu durchtrennen.
Jemand wollte Emily ausrauben!
»Nimm deine dreckigen Finger von dem Beutel«, stieß Éanna hervor und schleuderte die Decke von sich. Sie wollte aufspringen, um sich auf den Dieb zu stürzen und ihn festzuhalten, bis die anderen ihr zu Hilfe kamen. Ihre Füße verhedderten sich jedoch in der Decke und sie stürzte nach vorn auf einen Stoffballen. Zähneknirschend unterdrückte Éanna ein Fluchen, weil sie nicht laut genug gerufen hatte, um Brendan und Liam aufzuwecken. Noch im Stolpern sah sie, wie das Messer des Diebes durch die Lederschnur schnitt und er den Beutel an sich riss. Für einen flüchtigen Augenblick fiel Mondlicht auf das Gesicht des Schurken, doch mehr als eine krumme Nase, die unter dem tiefen Schatten der breiten Hutkrempe hervorschaute, enthüllte ihr der schwache Schein nicht. Und dann stürzte der Dieb auch schon mit wehendem Umhang davon.
»Verfluchter Halunke!«, schrie Éanna nun laut.
Überrascht fuhren Brendan, Emily und Liam aus dem Schlaf hoch.
»Was ist denn los?«, murmelte Brendan schläfrig.
Gleichzeitig erwachten auch die Passagiere in ihrer Umgebung. »Verdammt noch mal, was soll dieser Krawall mitten in der Nacht?«, grollte eine fremde Männerstimme verärgert hinter einer Reihe von Kisten.
»Jemand hat Emily den Brustbeutel geklaut«, rief Éanna. »Ich habe es genau gesehen! Da vorne läuft der Dreckskerl!«
Éanna achtete nicht auf die ärgerlichen Stimmen, die laut durcheinanderredeten und nun auch noch die tiefsten Schläfer weckten, sondern versuchte, den Dieb nicht aus den Augen zu verlieren. Indessen breitete sich das Stimmengewirr immer weiter auf der Selkirk aus.
Den Langfinger im Blick zu behalten, erwies sich als erheblich schwerer, als Éanna vermutet hatte. Das Gepäck der Passagiere sowie die vielen Frachtstücke, die sich überall auf dem Deck auftürmten, boten dem Täter im Dunkel der Nacht Schutz. Außerdem sprangen nun überall Menschen von ihren Lagern auf und blickten verwirrt um sich. In diesem Durcheinander von schläfrigen Männern, Frauen und Kindern tauchte der Dieb unter. Éanna sah noch, wie er sich in der Nähe einer Treppe in eine Menschengruppe mischte und so tat, als würde auch er sich verstört nach dem Grund für die nächtliche Störung umsehen. Dann wich er rückwärts zurück und verschwand in der Menge.
Éanna erfüllte jetzt eine ähnlich flammende Wut, wie sie Brendan am Nachmittag gepackt hatte. Wie konnte jemand etwas so Abscheuliches tun! Arme Einwanderer auszurauben, die sich jeden Cent bitter vom Mund abgespart hatten, um das nötige Geld für einen Siedlertreck nach Westen zusammenzubekommen! Wie abgebrüht musste dieser Kerl sein, dass er so etwas tat! Éanna wollte hinüber zur Treppe stürzen, doch eine Menschengruppe versperrte ihr den Weg. Die Männer und Frauen redeten in einer fremden Sprache aufgeregt durcheinander.
»Lasst mich doch durch«, schrie sie, als sie den Dieb auf dem Oberdeck zu erkennen glaubte. »Da versucht ein Gauner zu flüchten!«
Verständnislose Blicke trafen sie.
Éanna gab die Erklärungsversuche auf und bahnte sich einen Weg durch die Menge. Fast hatte sie den Aufgang zum Oberdeck erreicht, als ihr plötzlich ein erschrockenes Kleinkind in den Weg lief. Geistesgegenwärtig wich sie zur Seite aus, verlor dabei jedoch das Gleichgewicht und stürzte der Länge nach auf die Planken.
Bevor Éanna wusste, wie ihr geschah, spürte sie zwei kräftige Hände, die sich um ihre Taille legten und sie so mühelos hochhoben, als wäre sie leicht wie ein Sack Daunenfedern.
Aber es waren nicht Brendans Hände, die nach ihr gegriffen hatten. Sie blickte in das Gesicht eines jungen Manns, der nur wenig älter als Brendan und Liam sein konnte. Er hatte kräftige, markante Züge, eine strohblonde Haarmähne, einen kurz getrimmten Schnurrbart und strahlend himmelblaue Augen, die sie vergnügt anblitzten.
»Nur gemach, Miss! Decksplanken sind unsicherer Boden für uns Landratten.«
Verdattert blickte sie den Fremden an, der sie wie eine Puppe in der Luft hielt, sodass ihre Füße einige Handbreit über dem Boden schwebten. Dann stieß sie heftig atmend hervor: »Und während ich hier in der Luft zappele, entkommt der Dieb, der unseren Geldbeutel gestohlen hat!«, schnaubte sie.
»Aber Sie zappeln so zauberhaft«, gab der Mann unbeirrt zurück und blinzelte sie an.
Trotz ihrer Wut auf den Dieb musste Éanna sich zusammenreißen, um nicht mitzulachen. »Genauso zauberhaft sehe ich aus, wenn ich wieder sicheren Boden unter den Füßen habe«, konterte sie.
Der Blonde grinste anerkennend und setzte sie sanft ab. »Gewiss doch, fremde Schöne. Gestatten, Daniel Erickson, aus Schweden eingewandert und Euch stets gern zu Diensten, Miss«, sagte er schmunzelnd.
In diesem Moment bahnte sich Brendan hinter ihnen einen Weg durch die Menge, gefolgt von Emily und Liam.
»Was geht hier vor sich?«, stieß er aufgeregt hervor und starrte den Fremden, der Éanna gerade noch im Arm gehalten hatte, feindselig an. »Ist das der Dieb, Éanna? Hat er dir wehgetan?«