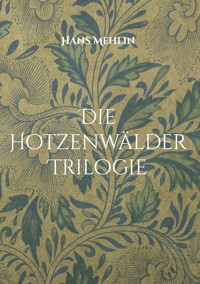
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alemannisches Intermezzo Mehlin erzählt in seiner Buchreihe "Alemannisches Intermezzo" vom Leben seiner Uroma Anna (Die Hotzenwälder Anna) und deren zwei Schwestern Pauline (Die Hotzenwälder Himmelsleiter) und von der Steffane, die 1901 nach Amerika ausgewandert ist. Diese Novelle beschreibt das Leben im Badischen Hotzenwald und am Hochrhein sowie in der Schweizer Grenzstadt Basel in den Jahren von 1890 bis 1927. Dieses Buch ist ein Sammelband der bisherigen drei Familien Bücher . Die Familiendialoge sind in alemannischer Sprache erzählt und werden in einem Glossar in Standardsprache erläutert. Ein echt alemannisches Hochgefühl! Günther Nufer, Ehrenbürger der Stadt Bad Säckingen schreibt: Hans Mehlin erzeugt mit seiner sympathischen Sprachmelodie ein uriges alemannisches Sprachgefühl in der Standardsprache.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alemannisches Intermezzo
Sprache ist ein Spiel und muss immer wieder neu ausgehandelt werden (Ludwig Wittgenstein).
Aus dem Leben meiner Urahnen
Uroma Anna (Logos und Ludus - Vernunft und Spiel)
Besonnenheit meint die nüchterne Betrachtung der Spielzüge, die man für den erfolgreichen Alltag braucht.
Urgroßtante Pauline (Caritas - die fürsorgende Liebe)
Ihre geistige Kraft steht für das Durchhaltevermögen, die heiligen Gipfel in der Ferne zu sehen und fromm zu sein.
Urgroßtante Steffane (Eros – die begehrende Liebe)
Ihr Wahnsinn meint, daß jeder Wunsch, sei er noch so verrückt, auch im fernen Land zugelassen werden muß.
Das Vorspiel
Uroma Anna liebte das Mühlespiel. Sie richtete ihren Willen im Leben nach dessen Spielregeln. Die junge Hotzenwälderin wollte aus der Armut und aus dem ländlichen Zwang heraus. Ihr Dorflehrer unterstützte seine Schülerin so gut er konnte.
Der Lehrer erklärte dem Schulmädchen Anna das Mühlespiel. Sie soll in der „Setzphase“ der Mühlesteine am Anfang auf die Beweglichkeit achten und offene Mühlen besonnen anlegen, bevor sie die erste Mühle schließen kann. Nach dem „Setzen“ sei die „Zugphase“ eine hohe Kunst des beliebten Brettspiels. Der Versuch, die Zwickmühlen zu bilden, um die Mühlesteine zwischen zwei Mühlen hin und her zu ziehen, bringe den Sieg. Man kann dem Gegner bei jedem Zug einen Stein abnehmen. Für die Beweglichkeit im Spiel sei es gut, Kreuzungen in der Spielmitte zu belegen. Dort eröffnen sich die guten Chancen. Es sei nicht sinnvoll, eine offene Mühle schnell zu schließen. Gerade im innersten Quadrat des Bretts schränke eine früh geschlossene Mühle die eigenen Zugmöglichkeiten stark ein.
Schließlich entscheide oft beim Spielende die „Sprungphase„, wenn ein Spieler letztlich nur noch über drei Steine verfüge. Er darf mit seinen Steinen zu einem beliebigen Punkt hüpfen. Normalerweise ist der Spieler mit guten Initiativen im Vorteil. Das gelte am Spielanfang für die weißen Steine auf dem Brett. Weiß bestimmt beim Spiel den ersten Spielzug und bedeutet die freie Gestaltung des Ablaufs. Schwarze Steine erforderten die ständige Reaktion des Spielers auf einen weißen Spielzug. Die Spielregeln und die guten Spielzüge bestimmen das Spiel. Zum Schluß bleiben dem Verlierer nur noch letzte „Sprünge“.
Hans Mehlin
Sammelausgabe der alemannischen Familien-Saga
über
Anna, Pauline und Steffane
zum 150. Geburtstag meiner Uroma Anna (1875 - 1963)
aus den drei Novellen
Die Hotzenwälder Anna
Die Hotzenwälder Anna in Lörrach
Die Hotzenwälder Himmelsleiter
Reihe Alemannisches Intermezzo
Inhaltsverzeichnis
Das Vorspiel
In Armut und Not
Auf dem Mettlenhof
Die Botschaft des Lehrers
Das Mettler Spiel beginnt
Der Baurevisor der Feuerversicherung
Das Mettler Dobe-Spiel
Drei Schicksalschläge
Die Feuerversicherung zahlt
Ankunft in Basel
Dienstmädchen in Basel
An der Schellenberger Chilbi
Im Basler Großbürgertum
D‘ Steffane isch abekeit
Die Hoferweiterung
Die Bräntz-Brenner
Der Stachel im Fleisch
Hotzenblitz und Totentanz
Annas Mühlen
Ihre Kleinbasler Jahre
Steffanes Neue Welt
Auf der Basler Schiffschaukel
Vier Buebe un e buschber Maidli
Die Ausgrenzung der Eidgenossenschaft
Hiobsbotschaften
Richards Testament
Schürgi-Wägeli und Kaltebach-Rolli
Das Lörracher Mühlespiel
Der Sattlerlehrling
Die Erneuerung der Brandversicherung
Zwischen dem Albtal und dem Murgtal
Der Laufenburger Rheinfall
Die Hotzenwälder Hoch-Zeit
Mit Musik und Tanz in Basel
Die Wirtschaftskrise nach dem Weltkrieg
Das Waldsanatorium
Trugbilder im Februar
Der Lindenplatz-Achtziger
Glossar Alemannisch
Das Leitmotiv der Hotzenwälder Himmelsleiter
Reihe Alemannisches Intermezzo
Der Autor
Wer die Spielregeln aufstellt, gewinnt auch.
Das ist der Sinn der Spielregeln.
In Armut und Not
Vater Richard Keller war mit seinen Töchtern Anna, Steffane und Pauline über den „Bühl“ zum Ostergottesdienst gestapft. Es lagen immer noch fünfzehn Zentimeter Schnee am Boden. Das kirchliche Hochamt der Osterkirche 1890 war nun vorbei. Anna nahm Abschied von den Dorfbewohnern in Herrischried. Die Mutter Marianne wartete mit der Tochter Marie im Haus, denn beide litten bei diesem „Sauwetter“ unter Brusthusten. Auf dem Strohdach des alten Hotzenhauses lag noch Schnee. Die langen Eiszapfen des harten Winters tauten in Tropfen ab. Kleine Rinnsale in den Feuchtwiesen schmolzen den Schnee.
„Mueder, hol mir mol d‘ Fläsche mit‘m Bräntz zum Ufwärme“ murrte der durstige Vater Richard, als sie unter dem „Schild“, dem strohgedeckten Vordach, ihre Zuflucht gefunden hatten. Dann legte er Teile seiner „Montur“ ab. Die dunkle, speckige Pelzkappe, „de abgewetzt Samttschobe ohni Krage un Knöpf“ sowie den mit „Samtstreife verbrämte, verblätzte Brustlatz“, während er das gefältelte Hemd mit dem breiten Kragen für den Mittagsbesuch von Lehrer und Kaplan Motsch anbehielt.
Dann nahm er einen kräftigen Schluck vom selbst destillierten „Bräntz us ere Schnaps-Guttere„. Seine gefältelte Pluderhose „un sini Bergschuh“ behielt er mit dem sonntäglichen Seufzer „jetz goht’s mer scho wieder e‘ wenig besser“ an den Beinen.
Die Töchter legten „fascht verfrore“ die schwarzen Pelzkäppli, die farbig bestickten Mieder und die gefältelten Halbröcke ab. Sie schlüpften aus den löchrigen Stiefeln und baten die kranke Mutter um heißes Wasser, um die eiskalten Füße zu wärmen.
Auf dem Herd hatte Annemarie „e Hafe“ Kartoffeln und Kraut, „g’schwellti Herdöpfel mit d‘Schlempe un Speck“ aufgewärmt, die den „sechs hungrige Müler e bizz Faißis z’ fudere geh hen“. Sie nahmen ihre Holzlöffel und aßen aus der großen Schüssel, die auf dem Tisch stand. Davor bekreuzigten sie sich stumm.
Der Kachelofen, „d‘ Chauscht“, beheizte die niedrige „Stube“. Über dem Ofen hing das hölzerne Wäschegestell, um feuchte Kleider zu trocknen. In der kalten Zeit saßen und lagen sie auf der warmen Bank. Im Winter war die Stube im schummrigen Tageslicht unter dem tief herabgezogenen Dach der einzige Ort, der mit einigen Klafter Brennholz immer befeuert wurde. Die Mutter erzählte gern alte Geschichten und sang dann mit ihren Töchtern: „In Mueders Stübeli, do goht e hm hm hm“. Das Spinnrad surrte und drehte die Schafwolle auf der Spindel zum Faden. Da war der fromme Herrgottswinkel und farbige Heiligenbilder sowie „e Holzchästli“ für die Briefe, Akten und für „sell ander Schriebzüg“. Wenn es dunkel wurde“ het me e Funzle a’zündet“. Dann wurde es Zeit, „d‘ Bettfläsche mit em heiße Wasser usem Schiff im Kochherd“ für das Bett zu füllen.
Die älteren Söhne waren schon 1870 zum Frankreichfeldzug eingezogen worden. Ob sie erst bei Dijon oder bei Straßburg gefallen waren, wußte der Vater Richard Keller nur ungefähr. Er haderte, daß er seine kräftigen Burschen nicht mehr hatte. So mußte er allein pflügen, mähen, dreschen oder Brennholz einschlagen, wobei die junge Pauline schon zupacken lernte. Der Vater brummte „ s‘ isch alles nüt, wenn me kei Bursch me zum Schaffe het“. Denn der Boden war karg, „d’ Matte“ nass, und zwei Ochsen, eine Milchkuh, zwei Schweine waren für die spärliche Selbstversorgung seiner Familie kaum ausreichend.
Es herrschte Hunger und Not, aber ebenso viel Vertrauen auf Gottes Hilfe. Jetzt, Anfang April, war nur „no e‘ wenig Surkrut und Schlempe do“, aber kaum geräucherter Speck, Blutwurst oder Leberwurst. Man erwartete „de Säutod“ zur Schlachtung erst im Mai auf dem Hof, um wieder Fleisch, Wurst und Speck in den Rauchfang zu hängen. Bis dahin gab es nur „Mehlsuppe un Brägel“, Haferschleim und auch süßes Mus oder gedörrtes Obst sowie vorjährige Waldbeeren. Kartoffeln, Mehl und Salz. Das wöchentliche „Buttern“ im Faß war in der eisigen, harten Winterzeit unverzichtbar „für’s eige Überlebe“. Denn Richards Hof verfügte kaum über Bareinnahmen, zumal das kleine Dorf Großherrischwand im „Hinteren Hotzenwald“ zu weit von den Textilfirmen im Rheintal entfernt war für die Haus-Webstühle.
Am Osternachmittag hatte Vater Richard sein „Tubakspfifli a‘ zündet“. Der qualmende Knastergeruch zog durch die Stube. Richards Töchter begrüßten ihren beliebten Lehrer freundlich, der zum Osterbesuch eine Kanne voll Bier mitgebracht hatte, das beide Männer und der später angesagte Kaplan tranken. Alle Kinder von Richard und Marianne Keller gingen bei ihm zum Schulunterricht und waren in einer gemeinsamen Klasse. Die fünfzehnjährige Anna war seine beste Schülerin gewesen. Im Rechnen, im Lesen und im Schreiben hatte sie gute Noten. Einmal gehört, lernte sie Texte, Gedichte oder die Liederverse ohne Mühe auswendig. Zur Begabung kam auch Fleiß hinzu. Sie durfte die jüngeren Schüler im Lehrstoff abhören und war dem Lehrer eine Hilfe, wenn er bei gemischten Altersstufen in der Klasse mit unterschiedlichen Lehraufgaben unterrichtete. Schon vor einem Jahr hatte sie die Volkschule abgeschlossen.
Das Bier war nun von der Kanne in die Steinkrüge gefüllt und der Vater, der Lehrer und der zwischenzeitlich angekommene Kaplan Motsch prosteten sich gegenseitig zu. „Selli Wieber“ saßen auf der „Chauscht“ und hörten die Gespräche still an. Richard, sagte der Lehrer, „die Anna“ hätte das Zeug für eine Lateinschule, wenn sie „e Bueb anstatt Maidli g‘ worde wär“. Der Lehrer, ein Freund Bismarckscher Sozialgesetze, hat Anna immer wieder mit aktuellen zeitkritischen Schriften versorgt.
„Für Frauen ist die Bibel wichtiger als die Sozialistenschriften, wenn sie ihre Kinder im katholischen Glauben erziehen sollen“, meldete sich der junge Kaplan, der den Schülern Katechismus lehrte und Kinder zur heiligen Kommunion vorbereitet hatte. Diese hatte Anna vor fünf Jahren beim alten Pfarrer Kaiser in Herrischried empfangen. Nun gingen Annas Schwester Marie und die schöne Steffane in die Glaubenslehre bei dem Kaplan. Pauline war noch zu jung. Sie blickte den glaubenseifernden Kaplan Motsch schwärmend an: Mädchenhaft verschossen.
Doch Vater Richard entgegnete, daß weder der Lehrer noch der Kaplan seine Probleme löse, da er es nicht mehr schaffe, ohne die gefallenen Söhne fünf Frauen im Haus zu ernähren. Die Mädchen seien zu jung, um unter die Haube zu kommen. Also müssen Anna und Steffane ihr Brot auswärts verdienen. Marie sei zu schwach. Die junge Pauline sei ihm eine wichtige Hilfe auf dem Feld, im Wald und bei allen anderen Arbeiten. Deswegen habe er am Lichtmeßtag mit dem Mettlenbauer vereinbart, daß Anna als Hausmagd „uf de Mettle“ arbeite. Für Kost und Logis. Jeweils zu Martini 10 Mark Lohn für die Bauernmagd. Am Ostermontag sei die Ankunft vereinbart.
Eine Last fiel von seinen Schultern, da er seine unerbittliche Notlage angesprochen hatte: „Armut, Hunger und den Krieg“. Er wäre ehemals lieber mit seiner Schwester ausgewandert! Der Lehrer und der Kaplan blickten stumm auf den Tisch, da beiden im Gegensatz zur Familie die Rede Richards neu war.
Kaplan Motsch bat die fünf Frauen an den Stubentisch und begann nun den Psalm 23 zu beten: „Der Herr ist mein Hirte“. Die Mädchen beteten laut mit. Vater und Lehrer schwiegen. Als der Psalm beendet war, holte Richard „nomol e Bräntz“ und bot beiden Gästen „e rechte Schluck uf de Schreck“ an.
Der Lehrer lehnte ab und wandte sich der reisefertigen Anna mit einem bekannten Buch zu und sagte „ich ha dr no emol“ Lesestoff mitgebracht. Nun zum Abschied einen Roman von Gustav Freytag. Hier ist der erste Band von „Soll und Haben“.
Mit Herzblut schrieb er eine Widmung zum Abschied für die bisher beste Schülerin in den Band. Dann übergab er das Buch mit einem lieben Wort an Anna. Dabei zog er sie an sich und umarmte das Mädchen. Von der baldigen Trennung gerührt. Anna blieb stumm, errötete wie eine Rose und ward gewahr, daß sie in ihrem Lehrer einen lieben Gönner gefunden hatte.
Dann stürzte sie mit dem geschenkten Roman aus der Stube, kam sofort wieder zurück und dankte ihm überschwänglich. Ohne ihn hätte sie außer der Bibel und Katechismus weder Bücher noch Hefte in ihrem abgelegenen Dorf bekommen. Umgekehrt wurde dem Lehrer bewußt, daß er seine beste Schülerin ganz besonders ins Lehrerherz geschlossen hatte.
Unterdessen widmete sich Kaplan Motsch im Laubengang der brusthustenden Mutter und der schwächlichen Marie, da sie am Vormittag nicht in die festliche Messe gekommen waren. Er sprach über Jesu Opfertod am Karfreitag und die christliche Auferstehung an Ostern. Danach beteten sie mehrmals innig den „Marianischen Rosenkranz“. Der Kaplan verabschiedete sich von ihnen mit dem Segen „der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft“. Für Anna bat er um Gottes Milde und Gnade.
Der Lehrer wollte im restlichen Nachmittag mit den Mädchen, wie oft nach dem Unterricht, Mühle „ d‘ Nüni-Schtei“, spielen. Zuerst war die junge Pauline an der Reihe: Er erklärte ruhig, daß sie in der „Setzphase“ der Steine auf Mühlen setzen soll. Am besten sei, gleich zwei offene Mühlen versuchen, bevor sie die erste Mühle schließen könne. In der „Zugphase“ dann immer wieder Zwickmühlen aufbauen, um ihre Mühlesteine zwischen zwei Mühlen „wie‘ne Zwicki“ hin und her zu ziehen.
Das Nesthäkchen war verdutzt über die ständige Ansage des Lehrers bei ihrem Mühlespiel, wobei sie alle Spielzüge richtig ausführte und den Sieg zum Greifen vermutete. Nun kam ihr Gegner in die „Sprungphase“ mit seinen letzten drei Steinen. Das könne die besten Spielzüge in Frage stellen, lehrte ihr der Lehrer, denn es gehe nur noch um „de Sieg oder Niederlage“. Der kluge Mann beendete das Mühlespiel mit Pauline durch einige Sprünge, die er sich im Spielplan gut ausgedacht hatte. So seien eben die Spielregeln erklärte er dem besiegten Kind.
Nun war die Reihe an Anna, mit ihrem ehemaligen Lehrer das Mühlespiel auszutragen. Anna loste die schwarzen Steine aus. Beide waren äußerst konzentriert. Anna vor Anspannung mit einem geröteten Gesicht. Der Lehrer fixiert auf das Spielfeld. Man hörte nur ein leises „Klacken“ beim Setzen der Steine. Rund um den Stubentisch war es still geworden. Dann hörte man das „leicht schleifende Geräusch“ der Zugbewegungen. Nun hatte auch der Lehrer ein gerötetes Gesicht, denn Anna konnte zwei Zwickmühlen bedienen und räumte die weißen Steine des Lehrers ab, bis er noch drei Steine im Spiel hatte.
Man hörte nun weitere „Klackgeräusche in der Sprungphase des Mühlespiels“. Es gelang Anna, die Sprünge des Lehrers zu blockieren. So hatte sie den Lehrer „mit de Schwarze“ besiegt. Die Schwestern gratulierten Anna zum Sieg beim Mühlespiel. Richard hatte ein lustiges Lächeln zwischen den Sorgenfalten.
Dann wollte der Lehrer heim. Das Wetter war am Nachmittag viel besser geworden. Der blaue Himmel und die Abendsonne verzauberten mit den Vogelstimmen die Abschiedsstimmung. Stille im weiten, ruhigen Hotzenwald, die den Frieden stiftete. Anna bat den Vater, ihren Lehrer bis zum Schulhaus begleiten zu dürfen. Diese Bitte nahm der Schulmeister auf und sagte: „Maidli, chumm mit uf de Heimweg. I mueß no öbbis sage“.
Anna trug die leere Bierkanne des Lehrers auf dem Heimweg mit besonderer Sorgfalt. Als ob sie das Siegen und die Freude, die ihr das Mühlespiel bereitete, in dieser Kanne halten wolle. Im hellen Gegenlicht der tief stehenden Abendsonne waren beide Gestalten nur noch als Schatten zu erkennen. Je weiter sich die beiden vom Haus zum entfernten „Bühl“ entfernten, desto enger verschmolzen beide Schatten zu einer Silhouette. Der gütige Gönner mit großen Gesten beim Gehen. Was beide erzählten, blieb ihr gut gehütetes Geheimnis beim Abschied.
Auf dem Mettlenhof
Da Richard und Anna weder Pferd noch Wagen für die Strecke von zu Hause zum Mettlenhof hatten, marschierten sie zügig. Richard kannte diese Pfade aus seiner Jugend, als er noch mit seinem Hausiergestell auf dem Rücken nach Wehr oder nach Säckingen zu den Wochenmärkten ging. Er hatte auch heute am Pfingstmontag seine „Wälder-Montur und den schwarzen Strohhut mit dem Samtband“ an. Auf dem Rücken trug er im Gestell das verknotete Leinentuch mit dem Krempel und dem Plunder seiner Tochter. Anna folgte ihm in knappem Abstand auf dem steinigen Weg. Bekleidet mit einem gefältelten Rock und einer groben Jacke. Auf dem Kopf den hellen „Schühhut“, den sie gern in der Sonne trug. Am langen Arm trug sie ihren „Ridikül“. Darin verwahrte sie die Habseligkeiten und ihr Gut. Die Bibel, ein Bild der jungen Großherzogin Luise, die neuen sozialistischen Schriften des Lehrers und dessen geschätztes Buchgeschenk, Gustav Freytags Erzählung „Soll und Haben“.
Mit der Morgensonne im Rücken waren sie bereits über Rütte bis zur Guffertsmatt gestapft. Der eisige Schnee knirschte laut unter den Schuhen. In der Kälte war er griffig. Richard hatte den kürzesten Weg in Richtung Mettlen ausgesucht. Am Ende des Herrischrieder Ödlands stiegen sie die Wiedenmatt hinab. Auf dem steilen Pfad am tosenden Sägebach bis zur Wehra, die dreihundertfünfzig Meter tiefer von Todtmoos aus zufloß. Für den Abstieg ins Tal der Wehra hatte Richard am Wegrand Haselstöcke geschnitten. Denn am Bach entlang war es sehr rutschig. Die ersten Weidenkätzchen blühten im Vorfrühling. Anna pflückte den ersten gelben Huflattich und die Veilchen.
Als sie ohne Sturz zur Wehratalbrücke herabgestiegen waren, erklärte Richard ihr den weiteren Wegverlauf: „Jetzt göh‘ mer uf de Wehratal-Strooß und stiege de Mettlegrabe uffe. In‘ ere halbe Stunde chöme mer zu dienere neue Heimet „Mettlehof“. Dann wirsch d‘ Mettler erlebe. Do isch e anderi Welt als unsi“.
Der Mettlenbauer saß am Tisch vor dem Bauernhof und hielt Ausschau nach den beiden „Hotzenwäldern“. Als er sie unten am Waldrand erkennen konnte, rief er seiner Frau Martha in der Küche freudig zu „sie chöme, d’ Richard un‘ s neu Maidli! Hol Most us em Cheller, hüt isch Fiertig.“ Den Ankömmlingen rief er gut gelaunt und freundlich zu „Gott‘s Willche Wälder. Bring‘sch uns e buschber jung Wälder-Maidli als Magd mit“? Die Bäuerin Martha erschien bald mit dem erbetenen Trank. Hinter ihr die Köchin Fanny mit einem Krug und vier Bechern, um die durstigen Wälder aus dem Hotzenwald zu erfrischen.
Die Mettlerin begrüßte nun Vater und Tochter und schenkte einen gehörigen Schluck „Moscht“ für die beiden Männer ein. Anna knickste und erhielt einen Becher lauwarme Kuhmilch, damit du „roti Backe kriegsch“, wie die Mettlerin meinte und zuerst den prüfenden Blick „uf‘s Maidli“ richtete. Martha trug ihre Sonntagskleider, als ob sie „grad neume ane goh wott“. Dabei schaute sie mit geringschätzender Miene auf Annas abgetragene wollene Jacke und murmelte „numme Plunder“!
Der alte Mettler prostete Richard mit dem Glas zu und sagte „s‘ Maidli kriegt z‘ esse, Chleider und Logis. Am Martini dezu zehn Mark Lohn, wenn’s lauft. Defür mues si schaffe und am Sunntig mit uns in d‘ Chille goh‘, ins Tal nach Wehr abefahre.
Darauf streckte er Anna seine fettige Pranke wie ein Patriarch entgegen und sagte „ab jetz gilt’s! Gib‘mr jetz die Hand druff“.
Der gefräßige Mettler freute sich schon auf das Mittagessen und klopfte dem hungrigen Freund Richard auf die Schulter, dem beim gierigen Blick über den gedeckten Mettler Esstisch seine eigene Situation als armer Hotzenwälder Hungerleider bewußt wurde. Es wurde ihm fast übel, als der Bauer redete. Und zu Anna im Brustton eines saturierten Sassen gefaselt hat „nochher mumpfle mer d‘ Fiertigs-Brotis. Dim Vater hets bi üs immer g’schmeckt“. Er hob seinen Becher: „Ne Trank in Ehre“.
„Dann isch au d‘ Franz vom Jage z’rueck. Hoffentlich bringt er no öbbis rechts vom Jage mit“. Denn sein Sohn Franz war ein passionierter Waidmann, der an der Herrschaftswald Grenze manchmal einen „Grenzbock“ oder einen „Überläufer“ schoß. Franz ging in der Dämmerung auch auf den „Schnepfenstrich“ und übte sich als Schürzenjäger, wenn er auf zum Markt fuhr.
Der Mettler wollte mit Richard über die alten gemeinsamen Zeiten plaudern. Deswegen deutete er zu Martha und sagte „zeig dere Anna unser Huus und Stall“. Beide Männer blickten über die frischen grünen Bergwiesen des Hofs in die Richtung Basel. Man konnte im Süden die Schweizer Juraberge sehen.
Schon als Ministranten kannten sie sich von den Wallfahrten zum Gnadenbild Mariens in Todtmoos. Der Mettler erinnerte: „Es isch jetzt fascht vierzig Johr her, daß du zum Gras maihje, zum Heue und zum Öhmde mit mir d‘ Sense gschwunge hesch. Ihr Wälderbuebe sin bim Maihje schneller gsi, als mir Bursche. Ihr hen euch immer uf langi fettigi Matte zum maihje g‘ freut.
Nit nur arg nassi un moorigi Matte, wie bi euch uf’ m Wälder. Vo was lebet ihr denn? Wohl immer no vo Herdöpfel und vo Mehlsuppe. Schlupfe dini Chinder im Winter immer no in die warme Chauscht, wenns chalt isch, und kei Mumpfel me git“. Dabei lachte der Mettler in gestopfter Zufriedenheit, während Richard trocken schluckte, und sein Gesicht arg bleich wurde. Sein ausgezehrter Körper schüttelte sich, als ob er schmerzte.
Darauf klagte Richard seine Sorgen: Seit seine zwei Buben im deutsch-französischen 70-ger Krieg gefallen seien, komme er mit der Ernährung seiner Familie nicht mehr zurecht. Er kann sich keine Knechte mehr leisten, er habe zu schlechte Böden, zu viele Hungrige am Tisch. Es habe wenig Futter für die Tiere. Er bringe bis in zwei Jahren seine zweite Tochter, d‘ Steffane, auch noch herüber auf die Mettlen. Dann sei Anna im Stande, um als Bäuerin zu heiraten. Denn sie sei fleißig und besonnen. Aber der Lehrer habe ihr das Lesen von seinen Schriften und von neuen Büchern in den Kopf gesetzt. Deswegen lese sie in jeder freien Minute und lerne alle Texte auswendig. Nicht nur die Bibel. So sei sie verständig und auch verlässlich geworden.
Der alte Mann hatte sich zum Most einen dunklen Schweizer Stumpen angezündet. Richard stopfte ruhig sein Knasterpfifli. Den Ausspruch vom baldigen heiratsfähigen Alter der Tochter von Richard kommentierte der Mettler ebenso wenig wie die Ansage zur zweiten Tochter Steffane, die Richard auch von der Essensliste streichen wollte. Ohne Martha sowieso nicht.
Er kannte die Hotzenwälder derart, daß er auch deren Ränke und Schlichen gut einschätzen konnte. Lange reden sie „gar nüt“; dann strömt alles aus ihnen heraus, dachte er stumm.
Dabei griff er an die Hosenträger und ließ sie „schnäppere“. Beide qualmten miteinander. Richard „het am Pfifli g’sugt“. Der behäbige Mettler zog mit Genuß an seinem glimmenden Burger-Stumpen. Diese bezog er aus dem Schweizer Aargau.
Der Mettler hatte Mitleid mit dem geplagten Vater Richard, dem seine Söhne fehlten. Denn auch den Mettlers war der ältere Sohn gestorben. Franz war ein spät geborenes Kind, schon fünfundzwanzig Jahre alt und ohne Bäuerin geblieben. Deswegen gab es bei den Mettlenbauern bisher weder Kinder noch gewünschte Enkel. Deshalb war eine Schwiegertochter auf der Mettlen willkommen, die „e weng öbbis hermacht“.
Nun nahte Franz mit geschulterter Flinte. Am Riemen seiner Jagdtasche hingen zwei Hasen und auch ein Fuchs, den er an der Grenze zum Herrschaftswald oben am Hang erlegt hatte. Er pirschte meist heimlich auf den verwilderten Hangpfaden, damit ihn der Hasler Förster nicht beim Wildern erwischt hat.
Seine Büchse, hohe Jagdstiefel, nasse lederne Beinlinge und seine lange Vogelfeder am Hut ließen ihn zünftig erscheinen. Der Hüne nahte mit wiegenden Schritten, zeigte freudig auf sein Waidmannsheil im frühen Morgen und rief dem Hotzen zu: „I ha euch scho e Rüngli bim Marschiere d‘ unte g‘ seh“! Dann wollte er vom Vater wissen „wo isch des Maidli ane“?
Der Jagdhund, ein Rauhaardackel, nahm die Spur der Frauen in die Küche auf, „wo’s Suppefleisch im Hafe g’sütterlet het“. Der Jungbauer war freudig überrascht, als er Anna erblickte. Sie lachte ihn an und streichelte seinen Dackel, der ihr gefiel. Franz lachte spitzbübisch und begann mit Anna zu schäkern.
Die Botschaft des Lehrers
An Fronleichnam, dem hohen Kirchenfeiertag, im Juni 1890, durfte Anna zum ersten Mal zurück nach Großherrischwand. Sie war schon in aller Herrgottsfrüh zum Fest aufgebrochen. Über Todtmoos-Au und Wehrhalden nach Großherrischwand. Als sie ankam, richteten sich die Schwestern zum Kirchgang. Aber es blieb dennoch genügend Zeit der Familie zu erzählen, was die Bauernmagd in den ersten zwei Monaten auf dem Mettlenhof im Haus, im Stall und auf dem Feld erlebt hatte.
„Am Morge melche, de Stall usmischte uns’ Vieh no fuedere. Dann in de Schtube mit em Bese wüsche un mit‘ em Lumpe d‘ Bode butze“, worauf die Mettlerin ausgesprochen Wert lege. Die Magd Fanny, mit der sie die Kammer und die Arbeit teile, „isch d‘ Chöchi in de Chuchi“. Sie sei in Gersbach zu Hause und gehe am Sonntag in ihre evangelische Kirche im Nachbardorf. Die Männer sind „bim Maihje un uf de Matte“. Sie bekämen oft weitere Verstärkung durch „kräftigi Buebe us Gersbach“ und Hasel. Es seien meistens die „evangelischi Burebursche“, mit denen man keinen näheren Kontakt am Hof haben wolle. Auf den Wiesen und im Wald arbeiten mehrere Holzknechte, die sich hauptsächlich außerhalb des Bauernhofs aufhielten. „Die Mettler Buurerei isch halt scho größer als unser Höfli“.
Dem Mettler Milchbetrieb sei eine „Chäserei“ angeschlossen, die von der Bäuerin besorgt werde. Butterballen würden in einem „Model“ ausgeformt, „wo Mettlen-Hof druff schtoht“. Butter und Käse fahre man auf den Wochenmarkt in Wehr. Da begleite Anna die Martha Mettler oder den Jungbauer Franz in einer Kutsche über den Höhenweg hinab nach Wehr.
Am Sonntag müßten alle Mettlenhöfler in die Kirche gehen. Zudem habe sie in Wehr die Familie Büche mit der Tochter Berta kennengelernt. Die Familie Büche lese gerne Bücher. Der Vater bringe Bücher vom Leseverein Wehr nach Hause.
Mit beginnendem Glockengeläut mahnte Pauline „looset au, d’ Glocke lütet! Mer muen gschwind laufe! S‘ isch glie Chille“. Pfarrer Kaiser zelebrierte die heilige Messe an Fronleichnam in St. Zeno. Ein buntes Blumenmeer zierte den voll besetzten Herrischrieder Kirchplatz wie ein farbenfrohes Blütenmosaik. Der Musikverein war in Uniformen vor der Kirche angetreten. Mit silberner Monstranz und mit klingender Blasmusik zog die Prozession auf den Wegen über die Flur in die Natur hinaus. Die Gläubigen in den Hotzenwälder Trachten sangen bei der Flurprozession. Anna hatte ihren Tschäpel auf dem Kopf, das bestickte Fürtuch und auch bunte Samtbänder. Sie strahlte.
Unter den Besuchern entdeckte Anna bald ihren Dorflehrer. Er gab ihr mit einer nickenden Kopfbewegung zu verstehen, daß er sie sprechen möchte. Wieder überzog eine kurze Röte das Gesicht seiner besten Schülerin und sie näherte sich ihm. „Hol dir in‘ ere Stund no ne mol e Buch bi mir ab. Dann chönne mir no miteinander schwätze wie‘s bie dir goh‘t in de Mettle“, flüsterte der Lehrer ihr leise zu. Sie wisperte ein freudiges Ja. Er hatte einen weiteren Band mit gutem Lesestoff gerichtet. Dann fragte er sie in gewohnter Herzlichkeit, ob sie mit ihm ein noch Mühlespiel vor ihrem Mettler Heimweg wagen will.
Anna willigte ein. „Jo, i ha‘ no Froge zum letschte Mühlispiel an de Oschtere. Isch es im Lebe au so a‘glegt, daß me Schtei wie Marke setzt und dann demit umgoh‘ muß wie mit dene Mühli Spielzüg? Daß me im Lebe au Zwickmühle uf‘ baue cha, und daß me si au schließe cha, wenn me si richtig gsetzt het“?
Der Lehrer war sprachlos, wie dieses junge Mädchen Anna die Spielregeln und die Spielzüge auf das Leben übertragen hatte. Er urteilte „Anna, du hast das Leben schon schnell begriffen“!
Dann plauderte er im Schulzimmer weiter mit der Schülerin, deren Gesichtszüge auf die gescheiten Lehrersätze reagierten.





























