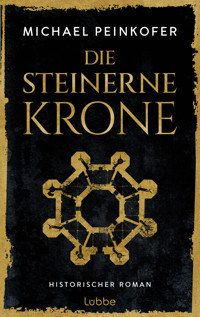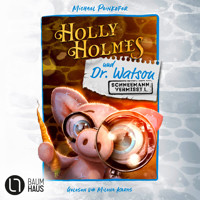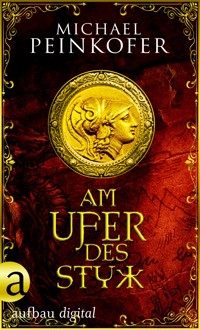3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Dunkle Geheimnisse in nebligen Gassen: „Die indische Verschwörung“ von Michael Peinkofer jetzt als eBook bei dotbooks. London, 1855: Kenny Jones muss täglich um sein Überleben kämpfen. Bei Ebbe durchwühlt er den dreckigen Schlamm der Themse nach verwertbaren Gegenständen. Die Arbeit ist mühsam und nicht sehr einträglich – bis Kenny vollkommen unerwartet einen berühmten, angeblich verfluchten Edelstein findet. Doch bevor der Junge seinen Geldgeber vor dem Fluch warnen kann, hat dieser den Stein schon verkauft. So beginnt eine abenteuerliche Reise auf der Suche nach dem Diamanten, quer durch London und bis tief unter die Stadt – wo Kenny in düsteren Tempelanlagen einer gefährlichen Sekte auf die Spur kommt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Die indische Verschwörung“ von Michael Peinkofer. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 427
Ähnliche
Über dieses Buch:
London, 1855: Kenny Jones muss täglich um sein Überleben kämpfen. Bei Ebbe durchwühlt er den dreckigen Schlamm der Themse nach verwertbaren Gegenständen. Die Arbeit ist mühsam und nicht sehr einträglich – bis Kenny vollkommen unerwartet einen berühmten, angeblich verfluchten Edelstein findet. Doch bevor der Junge seinen Geldgeber vor dem Fluch warnen kann, hat dieser den Stein schon verkauft. So beginnt eine abenteuerliche Reise auf der Suche nach dem Diamanten, quer durch London und bis tief unter die Stadt – wo Kenny in düsteren Tempelanlagen einer gefährlichen Sekte auf die Spur kommt …
Über den Autor:
Michael Peinkofer, 1969 geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft und veröffentlichte schon in dieser Zeit erste Werke. Heute gehört der Journalist und Übersetzer zu den erfolgreichsten Fantasyautoren Deutschlands. Michael Peinkofer schreibt neben seinen Bestsellern für erwachsene Leser erfolgreiche und spannende Jugendbücher.
Der Autor im Internet: www.michael-peinkofer.de
Bei dotbooks erscheint außerdem die Jugendbuchserie TEAM X-TREME, die folgende Bände umfasst:
Mission Zero: Der Alpha-Kreis
Mission 1: Alles oder nichts
Mission 2: Die Bestie aus der Tiefe
Mission 3: Projekt Tantalus
Mission 4: Das Borodin-Gambit
Mission 5: Sumpf des Schreckens
Mission 6: Codename Nautilus
***
Neuausgabe Februar 2014
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Verlag Carl Ueberreuter, Wien und Michael Peinkofer
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: © Tanja Winkler, Weichs
ISBN 978-3-95824-082-7
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die indische Verschwörung an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://gplus.to/dotbooks
http://instagram.com/dotbooks
Michael Peinkofer
Die indische Verschwörung
Roman
dotbooks.
Für Holly
Die Hauptfiguren
Kenny Jones ist dreizehn Jahre alt und ein »Schmutzfink« – so werden die Straßenjungen genannt, die bei Ebbe an den schlammigen Uferbänken der Themse nach Wertgegenständen suchen und sich auf diese Weise ihren Lebensunterhalt verdienen. Als Kenny eines Morgens eine besondere Entdeckung macht, beginnt für ihn das Abenteuer seines Lebens ...
Sepoy ist fünfzehn Jahre alt und gehört der indischen Glaubensgemeinschaft der Sikhs an, hat jedoch eine britische Ausbildung genossen. Als Diener von Colonel Kensington ist er diesem treu ergeben und scheut keine Gefahr, wenn es um das Leben seines Herrn geht.
Alice Kensington ist Colonel Kensingtons sechzehnjährige Tochter. Trotz ihrer Jugend zeichnet sie sich durch Selbstbewusstsein und Unerschrockenheit aus. Während ihr Vater im fernen Indien weilt, hütet sie den Familiensitz in London, unterstützt von ihrer Dienerschaft.
Colonel Clifford Kensington ist Oberst der königlich-britischen Kolonialarmee. In dieser Eigenschaft war er in den 1830er-Jahren als junger Captain an der Zerschlagung der blutrünstigen Thug-Sekte beteiligt. Knapp zwanzig Jahre später rächt sich dies ...
Inspector Desmond Lasallearbeitet für Scotland Yard und ist mit der Aufklärung der geheimnisvollen Mordserie betraut, die London in Atem hält. Lasalle ist ein typischer Vertreter der imperialistischen Zeit, konservativ und intolerant in seinen Ansichten und der Meinung, dass der aufgeklärte Mensch die heilige Pflicht habe, den Wilden dieser Welt die Zivilisation zu bringen.
Joseph Moody, genannt »Moody Joe«, ist das alte Oberhaupt der »Schmutzfinken«. Dafür, dass Kenny und die anderen Jungen alles abliefern, was sie im Schlamm finden, lässt er sie in seiner schäbigen Hütte übernachten und gewährt ihnen freie Kost (die oft genug nur aus Wasser und Brot besteht). Seine Gier wird ihm zum Verhängnis ...
Charles Dickens ist bis heute einer der meistgelesenen Autoren der Weltliteratur. In seinen Werken, von Oliver Twist
Die mit einem * gekennzeichneten Begriffe werden im Anhang erklärt.
Nächtliche Flucht
Es war im Herbst des Jahres 1856.
Die Nächte waren kalt und klamm; gelber Nebel hing in den Straßen Londons und gesellte sich zu dem Rauch, der aus unzähligen schmalen und breiten, niedrigen und hohen, geraden und schiefen, gemauerten und genieteten Schornsteinen drang. Wie ein riesiges schwarzes Ungeheuer ballte sich das Gemisch aus Dunst und Rauch über der Stadt. Es machte die Nacht noch finsterer und schien die Spitzen der Türme zu verschlingen, die sich aus dem Häusermeer erhoben. Nicht einmal vor der großen Kuppel der Kathedrale von St. Paul machte es Halt.
Im Westen, jenseits der verwinkelten Gassen der Stadtteile Holborn und Clerkenwell, war auch die Fassade des Britischen Museums hinter einer Nebelwand verschwunden, gegen die die Gaslaternen am Montague Place nichts ausrichten konnten. Matt verlor sich ihr Schein in den graugelben Schwaden. Das Britische Museum war das größte seiner Art. Unzählige Gegenstände waren hier ausgestellt, die aus den verschiedensten Ländern und Epochen stammten: ägyptische Mumien und griechische Inschriften, römische Münzen und chinesische Vasen; dazu Standbilder aus Assyrien, Schwerter aus Japan, hölzerne Schnitzereien aus Afrika und goldene Götzenbilder aus Mexiko – Überreste uralter, versunkener Kulturen, die die Zeit überdauert hatten. Auch eine asiatische Abteilung gab es; Wandteppiche reihten sich hier an steinerne Figuren und Tempelschätze aus purem Gold, die ihren Weg hierher aus dem fernen Indien gefunden hatten.
Bei Tag waren die Gänge der Ausstellungshallen bevölkert von wissbegierigen Menschen. Bei Nacht jedoch lagen sie still und verlassen da, und das wenige Licht, das durch die hohen Fenster hereindrang, ließ die Statuen fremdartiger Götter und Dämonen unheimliche Schatten werfen. Hier ragte ein Standbild Shivas auf, des Hindu-Gottes, der seinen Dreizack abwehrend erhoben hielt, dort starrte die steinerne Fratze des Schlangendämons Kaliya aus der Finsternis.
Und plötzlich wurden die Schatten der Nacht lebendig. Eine von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidete Gestalt, die Pluderhosen trug und eine weit geschnittene Tunika, kam barfüßig den Gang hinunter. Der Turban auf ihrem Kopf war so gewickelt, dass der Stoff auch das Gesicht bedeckte; nur ein dunkles Augenpaar, das wachsam um sich blickte, war zu sehen. Die Gestalt bewegte sich ebenso lautlos wie behände. Im Laufschritt huschte sie durch eine Reihe von Ausstellungsräumen zur Treppe.
Der Eindringling hatte gefunden, wonach er gesucht hatte. Den in Stoff gewickelten Gegenstand an sein heftig pochendes Herz pressend, setzte er die Stufen hinab. Bislang war alles glatt gegangen. Ungesehen in das Museum einzudringen und den Stein aus der indischen Abteilung zu stehlen war einfacher gewesen, als er erwartet hatte. Nun kam es darauf an, ebenso unbemerkt wieder zu verschwinden – was bei den vielen Wachen, die zu nächtlicher Stunde im Museum patrouillierten, alles andere als einfach war.
Atemlos erreichte der Dieb die Große Halle, in deren gläsernem Kuppeldach sich die Öffnung befand, durch die er eingestiegen war. Ein mit Knoten versehenes Seil hing von dort oben herab, freilich nicht bis zum Boden, wo es allzu auffällig gewesen wäre. Es baumelte etwa fünf Yards* über den Steinfliesen, was bedeutete, dass man es nur über den Balkon erreichen konnte, der vom ersten Stock aus in die Halle blickte. Vorsichtig pirschte sich der Dieb an die Balustrade heran und schaute über die Brüstung. Entsetzt schnappte er nach Luft, als er sah, dass er Gesellschaft hatte. Zwei Männer, die die grünen Uniformen der Museumswärter trugen und Laternen bei sich hatten, standen dort unten und unterhielten sich mit gedämpften Stimmen.
Der Dieb atmete auf, als er begriff, dass sie das Seil noch nicht bemerkt hatten und also auch nichts von seiner Anwesenheit ahnten – aber wenn er jetzt über die Balustrade kletterte, riskierte er, von ihnen entdeckt und gefasst zu werden. Was sollte er tun? Viel Zeit hatte er nicht, denn seine Tat würde nicht lange unbemerkt bleiben. Und dann würde es im Museum nicht nur von uniformierten Wächtern, sondern auch von Polizisten wimmeln ... Durch den Sehschlitz des Turbans irrten die dunklen Augen gehetzt umher. Während der Dieb noch überlegte, was er tun sollte, waren unten in der Halle weitere Stimmen zu vernehmen.
»Da sind Sie ja endlich, Quince«, sagte jemand streng. »Haben Sie Ihre Runde beendet?«
»Ja, Sir«, entgegnete der Angesprochene kleinlaut.
»Hat ja verdammt lange gedauert.«
»Entschuldigen Sie, Sir.«
»Gab es besondere Vorkommnisse?«
»Nein, Sir. In der indischen Abteilung dachte ich für einen Moment, ich hätte etwas gehört, aber ich habe mich wohl geirrt.«
»Na schön.« Die strenge Stimme räusperte sich geräuschvoll. »Dann nehmen wir uns jetzt die erste Etage vor. Und ich wäre Ihnen dankbar, Quince, wenn Sie sich diesmal weniger Zeit lassen würden.«
»Natürlich, Sir.«
Der Dieb zuckte in seinem Versteck zusammen – nun wusste er, dass er verschwinden musste, denn in wenigen Augenblicken würden die Wächter auf der Balustrade auftauchen. Schon konnte er hören, wie sich ihre Schritte über die Treppe näherten, und er verlor keine Zeit mehr. Mit katzenhafter Gewandtheit sprang er auf die Brüstung, visierte das Ende des Seiles an, das vor ihm in luftiger Höhe hing – und sprang.
Einen Moment lang schwebte er in banger Ungewissheit, wenn er daneben griff und in die Tiefe stürzte, würde er sich sämtliche Knochen brechen. Dann hatten seine Hände bereits das Tau umfasst und die Sohlen seiner nackten Füße schlossen sich um den untersten Knoten. Sich an das Seil klammernd wie ein Affe an eine Liane kletterte der Dieb nach oben, während die Wächter die erste Etage erreichten. Hell und hart hallten ihre Schritte unter der Kuppel wider. Der Dieb blickte sehnsüchtig am Seil empor – die Öffnung in der großen Glaskuppel, über der sich drohend der schwarze Nachthimmel wölbte, schien ihm unerreichbar fern. Mit zusammengebissenen Zähnen arbeitete er sich weiter voran. Die Wächter durften ihn nicht erwischen, sonst war alles vorbei ...
Er schaute nicht hinab, als tief unter ihm der Lichtschein der Laternen über dem Balkon auftauchte. Die Wächter waren jetzt dort, wo er sich eben noch versteckt hatte. Hätte er nicht die Flucht ergriffen, befände er sich jetzt schon in ihrer Gewalt. Er konnte hören, wie sich die Männer in der Tiefe unterhielten, verstand allerdings nicht, was sie sagten. Das Licht ihrer Laternen flackerte durch die Eingangshalle, glitt über Standbilder und Gemälde – und richtete sich im nächsten Moment auch auf ihn. Der Dieb verharrte in der Bewegung, verhielt sich völlig still, während er am Seil träge hin und her baumelte. Kurz sah es so aus, als hätte der Lichtschein ihn tatsächlich nur versehentlich gestreift. Plötzlich jedoch – er wollte bereits aufatmen – kehrte das Licht zurück, erfasste ihn und riss ihn aus der schützenden Dunkelheit.
»Was zum ...?«, hörte er den Wächter namens Quince von unten rufen – während er seine Reglosigkeit aufgab und unter Aufbietung all seiner verbliebenen Kräfte das restliche Seil hinaufkletterte.
»S-Sir!«, brüllte der Museumswächter mit heiserer Stimme. »Dort oben hängt jemand!«
»Was?«
Die übrigen Wächter stürzten zur Balustrade und sahen zur Kuppel – nur um den Dieb zu gewahren, der gerade das Einstiegsloch erreichte.
»Ein Eindringling!«, rief der Hauptmann der Wachmannschaft wenig geistreich und griff nach seiner Trillerpfeife. Den schrillen Ton vernahm der Dieb nur noch gedämpft, denn in diesem Augenblick schlüpfte er nach draußen und die feuchte Nachtluft hieß ihn willkommen. Er verzichtete darauf, das Seil einzuholen und das Dachfenster, dessen Schloss er geschickt aufgebrochen hatte, wieder zu schließen. Nun war er ohnehin entdeckt und es kam auf jede Sekunde an.
Das schwarze Tuch vor dem Gesicht und die Beute an die schmale Brust gepresst, fuhr er herum und begann zu laufen, über das Dach des Museumsgebäudes, das nach beiden Seiten steil abfiel. Aus den Straßenklüften jenseits des Daches drangen weitere Pfiffe wie ein unheimliches Echo. Das bedeutete, dass der Alarmruf des Wachmanns gehört worden war und die Polizisten, die in den Straßen auf Patrouille waren, jetzt aus allen Himmelsrichtungen zusammenströmten. Innerhalb von Minuten würde es auf der Straße von Constables* wimmeln.
Der Dieb beschleunigte seine Schritte. Leichtfüßig setzte er über das metallene Dach hinweg, dessen Beschläge unter seinen Tritten kaum knarrten. In seiner schwarzen Kleidung verschmolz er nahezu mit der Nacht, und der Rauch und der Nebel taten ein Übriges, um ihn neugierigen Blicken zu entziehen. Hektisches Gebrüll drang jetzt aus den umgebenden Straßen – die ersten Polizisten waren am Schauplatz eingetroffen und wurden von den Wächtern über die Geschehnisse informiert.
»Aufs Dach! Aufs Dach!«, rief jemand. »Dort hinauf ist er!«
»Wir brauchen Licht! Mehr Licht ...!«
Der Dieb lachte verwegen – bis die Uniformierten dazu kamen, ihm zu folgen, würde einige Zeit vergehen. Für einen Augenblick überlegte er, auf dem Dach des Museums zu bleiben und sich im Gewirr der Kamine zu verstecken, die sich wie ein dichter Wald aus dem Gebirge der Firste und Giebel erhoben. Gut möglich, dass er sich so die Nacht über verbergen konnte – spätestens bei Tagesanbruch würde man ihn jedoch aufspüren und dann wäre alles vergeblich gewesen. Er verwarf den Gedanken rasch wieder und konzentrierte sich auf seine Flucht.
Das Regenrohr, über das er das Gebäude erklommen hatte, befand sich auf der Vorderseite, beim Haupteingang. Von dort kam jedoch das lauteste Stimmengewirr. Wenn er der Polizei nicht geradewegs in die Arme laufen wollte, musste er also irgendwie auf der anderen Seite hinuntergelangen ... Abrupt änderte er die Laufrichtung und überquerte den First des Hauptflügels. Dass er nur einen Fehltritt zu tun brauchte, um über das schräg abfallende Dach in die Tiefe zu stürzen, daran versuchte der Dieb erst gar nicht zu denken. Als hätten sie nie etwas anderes getan, tänzelten seine nackten Füße über das eiskalte Blech, das an vielen Stellen schlüpfrig war von Nässe und Ruß.
Endlich hatte er die andere Seite des riesigen Gebäudes erreicht und spähte verstohlen in die Tiefe. Sein heftig pochendes Herz machte einen Freudensprung, als er auf der Straße weder einen Polizisten noch einen Wachmann entdecken konnte. Kurzerhand folgte er der Dachrinne zum nächsten Ablaufrohr und mit demselben katzenhaften Geschick, mit dem er auf das Dach geklettert war, glitt er nun am Rohr hinab. Die Dunkelheit umgab ihn wie ein schützender Mantel und er hoffte, dass seine schwarze Kleidung ihn auch weiterhin vor Entdeckung bewahren würde. Doch diese Hoffnung war trügerisch. Zwar erreichte der Dieb ungesehen den Bürgersteig – als er sich jedoch davonmachen wollte, hörte er plötzlich einen gellenden Schrei.
»Dort! Da läuft er!«
Er wusste nicht, woher der Ruf kam, und er hatte auch keine Zeit, darüber nachzudenken. Stattdessen nahm er die Beine in die Hand und lief, so schnell er konnte, während von beiden Seiten der Straße heller Laternenschein nach ihm tastete und hektische Stiefeltritte zu vernehmen waren.
»Da drüben!«, schrie jemand. »Das ist er!«
»Bleib stehen, Kerl!«
Trotz seiner Erschöpfung musste der Dieb grinsen. Dachten diese Dummköpfe wirklich, er würde stehen bleiben und sich ergeben, nachdem er schon so weit gekommen war? Niemals ... Mit fliegenden Schritten überquerte er die Straße und schlug sich in eine der angrenzenden Gassen. Die Stiefeltritte und das aufgebrachte Geschrei der Uniformierten folgten ihm, während er zwischen den dunklen Backsteinfassaden hindurchhastete, die zu beiden Seiten der Gasse aufragten. Unrat übersäte den Weg, hier und dort lungerten zusammengesunkene, in Lumpen gekleidete Gestalten in dunklen Nischen; aber sie waren zu beschäftigt mit ihrem eigenen Schicksal, als dass sie sich um ihn oder seine Verfolger gekümmert hätten.
Mit zu schmalen Schlitzen verengten Augen suchte sich der Dieb seinen Weg durch das Halbdunkel. Straßenbeleuchtung gab es hier nicht, nur der fahle Mond, der hinter Dunst und Wolken lag, spendete ein wenig Licht. Und die Laternen der Verfolger, die flackernde Schatten auf die schmutzigen Wände warfen.
»Dort ist er! Ich sehe ihn!«, gellte es durch die Gasse.
Im nächsten Moment gab es einen peitschenden Knall.
Einem jähen Drang gehorchend warf sich der Dieb zu Boden und merkte, wie etwas heiß und scharf über ihn hinwegsengte, um mit einem hässlichen Geräusch in die Backsteinwand zu schlagen – eine Pistolenkugel, die ihn nur um Haaresbreite verfehlt hatte! Er stieß eine Verwünschung aus, während er sich auf die Beine raffte und weiterrannte. Soweit er wusste, waren die Beamten der Stadtpolizei grundsätzlich unbewaffnet. Der Schütze war also ein rachsüchtiger Wachmann aus dem Museum, der keine Gnade kennen würde.
Dem Dieb wurde klar, dass aus seinem nächtlichen Abenteuer eine Flucht auf Leben und Tod geworden war. So schnell er konnte, rannte er durch die verwinkelten Gassen, die sich bald vor ihm teilten, dann wieder auf schmale Straßen mündeten, um sich auf der gegenüberliegenden Seite erneut fortzusetzen. Ein festes Ziel hatte er nicht, genau genommen wusste er nicht einmal, wo er sich befand. Er wollte nur die Verfolger loswerden, die sich als ausgesprochen zäh und hartnäckig erwiesen.
Kopflos hastete er durch das Häusergewirr von Holborn. Sein Glück war, dass sich viele der Constables, die aus benachbarten Stadtvierteln herbeigerufen worden waren, in den dunklen Gassen ebenso wenig auskannten wie er selbst. Mit jeder Straße, die er überquerte, und mit jeder Gasse, die sich teilte, verringerte sich die Zahl der Verfolger, sodass ihr empörtes Geschrei und der wütende Tritt ihrer Stiefel schließlich immer leiser wurden. Auch der Laternenschein fiel zurück und nach einer Weile verlangsamte der Dieb seine Schritte.
Keuchend blieb er stehen und lauschte. Als er von seinen Verfolgern nichts mehr hörte, glaubte er aufatmen zu können – aber einmal mehr freute er sich zu früh. Unvermittelt tauchte eine große, drohende Gestalt vor ihm auf, die nach Gin stank und deren Gesicht er in der Dunkelheit nicht erkennen konnte.
»Na, mein Junge?«, lallte eine vom Alkohol heisere Stimme, während eine grobe Pranke ihn packte. »Wohin soll’s denn gehen?«
Für einen Augenblick war der Dieb starr vor Schreck. Dann versuchte er dem Griff des Betrunkenen zu entkommen – vergeblich. Unnachgiebig hielt der dunkle Riese ihn fest, während aus der Ferne wieder die Schritte der Verfolger ertönten, die jetzt rasch aufholten.
Der Unbekannte lachte dröhnend. »Wirst du wohl hier bleiben, du verdammter Bengel? Hat ganz den Anschein, als wären die Wiesel* hinter dir her. Vielleicht ist ja ‘ne hübsche Belohnung für mich drin, wenn ich dich ihnen übergebe ...«
Verzweifelt wand sich der Dieb in der Umklammerung des Mannes. Jetzt konnte er auch die Stimmen seiner Verfolger wieder hören und vom Ende der Gasse kam flackernder Laternenschein. Jeden Moment würden die Constables hier sein ...
»Nein!«, rief der junge Dieb entschlossen – und mit aller Kraft, die er noch aufbringen konnte, trat er seinem unheimlichen Häscher gegen das Schienbein.
Der Betrunkene stieß eine wüste Verwünschung aus und ließ los. Jammernd ging er nieder, während der Dieb die Gelegenheit beim Schopf ergriff und davonrannte. Die derben Flüche des Betrunkenen verfolgten ihn bis ans Ende der Gasse. Ohne sich umzusehen stürzte er hinaus auf die Straße – und hätte um ein Haar ein grausames Ende unter den Rädern eines Fuhrwerks gefunden. Die Pferde scheuten und bäumten sich auf, als er unmittelbar vor ihnen vorbeihuschte. Der Kutscher ballte zornig die Fäuste. Atemlos und mit wild pochendem Herzen erreichte der Dieb die andere Straßenseite, die ungleich belebter war als die Gassen, die hinter ihm lagen. Zahlreiche Gaststätten und Pubs gab es hier, aus denen warmer Lichtschein und schräger Gesang drangen. Betrunkene grölten und Gläser klirrten und trotz der späten Stunde waren die Bürgersteige noch von Passanten bevölkert. Der Dieb nutzte die Gelegenheit, um in der Masse der Menschen unterzutauchen. Spätestens hier, sagte er sich, würden seine Verfolger ihn verlieren.
Abermals irrte er sich.
Zwar war es nur noch eine kleine Gruppe von Verfolgern, die an seinen Fersen hing. Aber ihr Anführer war der Hauptmann der Museumswache, der gute Gründe hatte, den Dieb einzufangen. Die Stelle im Museum war gut bezahlt und sicherte seiner Familie ein ordentliches Auskommen – mit dem es allerdings vorbei sein würde, wenn er einen Einbrecher entkommen ließ.
Seinen alten Armeerevolver im Anschlag war der Wachmann dem Dieb durch die Gassen von Holborn gefolgt und folgte ihm jetzt durch die belebten Straßen von Covent Garden. Mehrmals drohte er ihn in der Menschenmenge zu verlieren, aber er boxte sich rücksichtslos einen Weg durch die Passanten, die ihn laut beschimpften. Und je länger die Jagd dauerte, desto mehr war der Wächter überzeugt den Dieb zu fassen – denn dieser war dabei, in eine Sackgasse zu laufen.
Der Dieb ahnte davon freilich nichts. Auf der Flucht vor seinen Verfolgern rannte er immer weiter, überquerte belebte Plätze und Straßen, vorbei an Menschen, die ihn mit verständnislosen und empörten Blicken bedachten. Die kalte Luft brannte in seinen Lungen. Seine Beine taten weh, er war völlig erschöpft, aber er lief immer weiter – bis eine große dunkle Fläche, über der milchig weißer Nebel lag, seiner Flucht ein jähes Ende setzte.
Die Themse.
Wie ein Phantom war der breite Fluss, der London in weiten Schlangenlinien teilte, aus der Dunkelheit aufgetaucht und schnitt dem Dieb den Weg ab. Abrupt blieb er stehen, überlegte fieberhaft, was er tun sollte – als er bereits Gesellschaft erhielt.
»Da bist du ja! Bleib stehen, Kerl, oder ich erschieße dich wie einen räudigen Hund ...«
Der Dieb wirbelte herum – nur um den Museumswärter zu erblicken, der auf ihn zugelaufen kam, den geladenen Revolver in der Hand. Das Gesicht des Mannes war feuerrot und seine Augen aufgerissen, seine Backen blähten sich wie die einer bisswütigen Dogge. Der Dieb zweifelte nicht, dass der Mann ihn lieber erschießen würde als ihn laufen zu lassen. Nur zwei Möglichkeiten blieben ihm. Entweder er ergab sich oder ... In einem jähen Entschluss warf er die Arme über den Kopf und sprang vom Ufer ab, hinein in die dunklen Fluten des Flusses. Der Wachmann schrie erbost – und fast im selben Moment krachte der Schuss.
Der Dieb spürte, wie ihn etwas in die linke Schulter biss. Dann tauchte er kopfüber in das eisig kalte Wasser. Dunkelheit und Stille umfingen ihn. Mit kräftigen Schwimmzügen wollte er sich außer Reichweite des Revolvers seines schießwütigen Verfolgers oben an der Kaimauer begeben – aber sein linker Arm gehorchte ihm nicht mehr. Zu der Kälte, die von allen Seiten an ihm nagte, gesellte sich brennender Schmerz. Dem Dieb wurde bewusst, dass der Biss, den er gespürt hatte, eine Kugel gewesen war. Er war getroffen ... Sein Vorrat an Luft wurde knapp und er wollte zurück an die Oberfläche, aber auch das gelang ihm nicht. Die Strömung erfasste ihn und trug ihn davon, zog ihn hinab in die dunkle Tiefe.
Schmerz und Erschöpfung übermannten ihn, und während der Dieb langsam das Bewusstsein verlor, wurde ihm klar, dass seine Mission gescheitert war.
Das Monster aus dem Schlamm
Mudlarks* wurden sie genannt, Schmutzfinken und genau das waren sie auch. Denn wer seinen Lebensunterhalt damit verdiente, im Flussbett der Themse nach Kohlestücken, Eisenbeschlägen, Kupfernägeln und manchmal auch Knochen zu graben, der sah nach getaner Arbeit nicht nur ziemlich schmutzig aus, sondern verbreitete auch einen erbärmlichen Gestank.
Kenny Jones gehörte zu den Schmutzfinken, solange er zurückdenken konnte. Dass man bei der Arbeit schmutzig wurde und nach Fisch und Fäulnis stank, störte ihn nicht weiter. Schlimmer als der Geruch war die Kälte, die einen in die Sohlen biss, an den Waden emporkroch und dafür sorgte, dass die Füße blau anliefen. Und bei jedem Schritt bestand die Gefahr, in einen rostigen Nagel oder eine Glasscherbe zu treten, denn nicht ein einziger Mudlark besaß Stiefel, die er bei seiner Arbeit tragen konnte.
Fand man tatsächlich einmal etwas, das sich bei einem Händler verkaufen ließ, musste man auf der Hut sein, nicht von anderen Schmutzfinken überfallen und um seine Habe erleichtert zu werden. Die meisten Mudlarks waren deshalb in Banden organisiert so wie Kenny und seine Gefährten, die alle in Moody Joes Diensten standen. Es war harte Arbeit, die die Jungen für den alten Joe verrichteten, dafür gewährte er ihnen Unterschlupf, beschützte sie und gab ihnen zu essen. Und obwohl Joe sie mitunter schlug und zu Zornesausbrüchen neigte, war es immer noch besser, bei ihm zu leben als in einem der zahlreichen Waisenhäuser der Stadt. Zweimal war Kenny dort gewesen und zweimal war er wieder ausgerissen, denn verglichen mit den strengen Aufsehern im Waisenhaus war der alte Moody Joe ein durch und durch gütiger Mensch.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!




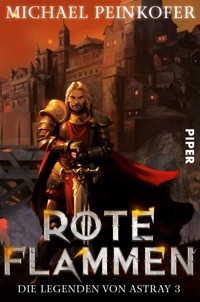


![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)
![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)