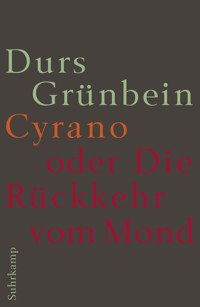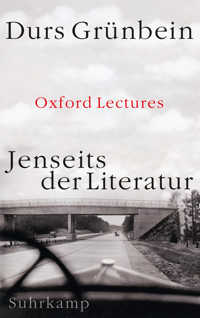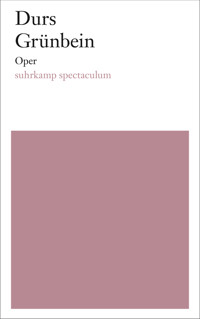11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Hellerau, die Gartenstadt am Rande Dresdens, zu Beginn des 20. Jahrhunderts Station für Kafka, Rilke, Benn und viele andere, wird für Durs Grünbein zu einer Stätte von prägender Kraft für den eigenen Lebensweg. Von hier aus geht es hinein in das Jahrhundert: Die Schicksale der Vorfahren väter- und mütterlicherseits ebenso wie das ihm überlieferte Trauma der Zerstörung Dresdens sind Erzählungen, die tief in den Kreis seiner eigenen Erfahrungen eindringen. Über das atmosphärisch dichte Erlebnis der heimatlichen Brachen und der russischen Besatzung öffnet sich in dieser äußersten Ecke des östlichen Deutschland ein konkreter Raum des Erinnerns. So entsteht das Bild seiner Kindheit – am Rand der Geschichte in den langen Sommern des Kalten Krieges.
Freundschaften und frühes Leid, schulische Erfahrungen und erste Lektüren, Lieblingsspielzeuge, Träume, Phantasien und Phantasmen entfalten sich in einem farbenreichen Kaleidoskop aus autobiographischer Prosa, Poemen, Reflexionen und, nicht zuletzt, vielen Funden aus der reichen Bildersammlung des Dichters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ein Kaleidoskop ist dieses autobiographische Buch voller Geschichten, Verse, Reflexionen und Bilder. Seinen Ausgangspunkt nimmt es in Hellerau, der Gartenstadt am Rande Dresdens, dem Geburtsort des Autors. Weit strahlte das Modell der berühmten Lebensreformsiedlung zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts über die Grenzen einer deutschen Vorstadt hinaus: Sie wurde Station für Kafka, Rilke, Benn und viele andere. Von hier aus zieht Durs Grünbein den Faden des Erinnerns immer weiter herein in die Epoche wachsenden Unheils. Lebenswege und Schicksale der Vorfahren väter- und mütterlicherseits, die Zerstörung Dresdens berühren den Kreis der eigenen, unmittelbaren Erfahrung und Erinnerung: an Elternhaus und Schule, an Lektüren und Lieblingsspielzeuge, an Freundschaften, erste Liebe und frühes Leid, an Berufswünsche, Träume, Phantasien und Phantasmen. An den unauflöslichen Widerspruch zwischen der Sehnsucht nach Weite und der bleiernen Erfahrung eines Lebens im Zoo. Entstanden ist ein erzählerisches Geflecht, in dem Geschichte und persönliches Erleben sich immer wieder kreuzen, nach Art eines objektiven Zufalls, wie es in der Sprache der Surrealisten heißt. Beschworen wird, in stilistischer Vielfalt und Brechung, das eindringliche Bild einer Kindheit und Jugend am Rand der Geschichte in den langen Sommern des Kalten Krieges.
Durs Grünbein, geboren 1962 in Dresden, lebt in Rom und Berlin. Neben anderen Auszeichnungen erhielt er den Georg-Büchner-Preis, den Friedrich-Nietzsche-Preis, den Friedrich-Hölderlin-Preis, den italienischen Pasolini-Preis und den schwedischen Tomas-Tranströmer-Preis.
Durs Grünbein
Die Jahre im Zoo
Ein Kaleidoskop
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015.
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015.
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Der Verlag weist darauf hin, daß dieses Buch farbige Abbildungen enthält, deren Lesbarkeit auf Geräten, die keine Farbwiedergabe erlauben, eingeschränkt ist.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagfoto: Familie Grünbein
eISBN 978-3-518-74229-7
Inhalt
Ouvertüre im nachhinein
Fischwaren
Das Große Gehege
Die Ohrfeige
Spielzeuge 1: Lokomotiven
Tag der Arbeit
Die Lehre der Photographie
Der Löffel
Die Schuluhr
Im Garten der Gartenstadt
Die Gründerhexe
Das Trafo-Häuschen
Kindertotenlieder
Spielzeuge 2: Das Luftgewehr
Der kluge Hans
Nämlich
Die Russen vor Dresden
Unheimliche Mutter
Ungetauft
Zoologische Internationale
Spielzeuge 3: Das Kaleidoskop
Der Rätselmeister
Meinen Eltern und wie immer …
Ouvertüre im nachhinein
Mit der Verläßlichkeit von Erinnerungen ist es, wie jeder aus Erfahrung weiß, nicht weit her. Dies zumindest haben Materie und Gedächtnis gemeinsam, daß sie ganze Welten verschlingen können, ohne daß die Oberfläche der Tage auch nur die leiseste Kräuselung zeigt. Tatsächlich können, so wie Gesichter, Stadtviertel, Straßenszenen im Klick einer Pupille verschwinden, ganze Lebensphasen und die zugehörigen Schauplätze und Gefühlslagen fortgewischt werden, als hätten sie nie existiert.
Ganz genau weiß ich aber noch meinen ersten Alptraum. Er hatte sich mir eingeprägt, weil er sich viele Nächte lang wiederholte. Bis dahin muß ich mit allem und allen verbunden gewesen sein, nach der Art der Naturvölker und Kleinkinder: Von diesem Moment an war ich nur noch das Einzelkind in seiner ganzen Verlorenheit und Verfehltheit. Der Ablauf war immer derselbe. Es geschah in unserem Haus in der Hellerau-Siedlung am Stadtrand von Dresden, das wir bezogen hatten, kurz bevor ich zur Schule kam, und es muß in der Zeit gewesen sein, da man das Lesen und Schreiben und die ersten primitiven Rechenformen erlernte.
Kaum war es dunkel und ich lag im Bett ausgestreckt, da begann sich der Raum nach oben zu weiten und um mich zu drehen. Aus großer Höhe sah ich mich selbst, winzig klein, da unten in meinem geblümten Schlafanzug liegen. Über der Kammer, die nur eine Schiebetür mit Milchglaseinsatz vom Schlafraum der Eltern trennte, der uns tags als Wohnzimmer diente, war das Haus aufgebrochen. Die Decke hatte sich wie die Himmelsluke eines Observatoriums zur Nacht hin geöffnet. Zwischen mir und dem Weltall gab es kein Dach mehr, und über den Kleiderschränken begann nun das Firmament. Ich war dem feuchtkalten, unfaßbar schwarzen Außenraum ausgesetzt und hatte das Gefühl, mit großer Kraft nach draußen gesogen zu werden. Mein Bett, mein geliebtes Bett bot keinen Halt mehr, der einzige Ort, an dem ich geschützt gewesen war vor den Attacken der Welt. Ich war jener unglückliche Kosmonaut (man gebrauchte damals den offiziellen sowjetischen Ausdruck, Astronauten waren nur Amerikaner), der versehentlich durch eine Klappe aus seiner Raumstation gefallen war und nun abgenabelt und abgekabelt umhertrieb. Was mir Angst machte, war, daß ich nicht nur äußerlich keinen Halt fand in dieser Dunkelheit, in der es kein Oben und kein Unten mehr gab, sondern daß es sich anfühlte, als sei auch mein Schädel geöffnet worden und das Gehirn freigelegt, einem gekappten Frühstücksei gleich – wozu mir deutlich das ringförmige Küchenwerkzeug mit dem Scherengriff vor Augen stand, mit dem ein Teil der Verwandtschaft die gekochten Eier bei Tisch köpfte. Ein kühler kosmischer Hauch wehte mir um die Stirn, ich fror am ganzen Körper und war verloren bis in den kleinen Zeh. Eine grenzenlose Angst hatte mich erfaßt, eine im urtümlichen Sinn panische Furcht, mich auflösen, mich ausströmen zu müssen ins All. Die Eltern vergruben sich währenddessen im Nebenzimmer in ihren Betten und konnten oder durften mich nicht retten, so erbärmlich ich auch wimmerte. Mir schien, sie waren kilometerweit von mir entfernt. Zu Anfang war Mutter noch aufgestanden und hatte mich zu beruhigen versucht. Im Grunde aber verstand auch sie wenig von meiner Not, und ihre freundliche Ignoranz schnitt mir ins Herz. Der Vater brummte immer nur aus dem Hintergrund, ich solle die Albernheiten doch lassen. Später hat auch Mutter es aufgegeben, mir noch Glauben zu schenken, wenn ich zitternd vor Kälte von meinen Irrfahrten durch den Weltraum erzählte. Untröstlich blieb meine Lage. So schlief ich dann leise greinend irgendwann ein unter den fühllos blinkenden Sternen.
Von da an veränderte sich alles, und nichts war mehr wie in den Jahrhunderten meiner Kindheit zuvor. Heute scheint mir, als hätten gewisse Dinge in meinem Leben seither einen etwas eigentümlichen Verlauf genommen, eine Ablenkung, wie schwach auch immer, aber mit jedem Tag deutlicher, vom normalmenschlichen Kurs. Ich weiß kein besseres Wort dafür als Aberration, ein Terminus, nach allen Seiten hin ausstrahlend, der sich mir später im Astronomieunterricht einprägte. Dabei sah man es überall: Kein Individuum, das nicht auf seine Weise von der Art abwich. Kein Blick zum Sternenhimmel, bei dem die Gestirne sich nicht scheinbar vom Beobachter wegbewegten, wenn ihn der Schwindel der Erdumdrehung erfaßte. Kein Bild, das nicht seine optischen Täuschungen mitbrachte. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Serie von Angstträumen gut war, aber sicher bin ich mir, daß sie damals einen Strich zog durch das noch kaum erwachte Bewußtsein. Ich war sieben, als die Gewißheit der Sterblichkeit mich streifte, das Gefühl des Ausgesetztseins im All.
Fischwaren
1
Aufgewachsen bin ich in einem alten Dresdner Mietshaus, das der Krieg begnadigt hatte; es gehörte jedenfalls nicht zu den zwanzig Prozent, die über Nacht wie vom Erdboden verschluckt wurden. Das graue Eckhaus, ein Gründerzeitkasten mit blatternarbigen Mauern, lag an einer der vielbefahrenen Straßen des Stadtteils, dessen Name mir später noch zwei Mal als Echo entgegensprang – aus der römischen Geschichte und aus der Literatur der Goethezeit – und also von weit her geholt schien: Cotta.
Das Haus stand als einziges seiner Art frei. An die Geräuschkulisse ringsum kann ich mich lebhaft erinnern, wenn ich die Augen schließe, in letzter Zeit kehrt sie manchmal im Halbschlaf zurück. Ein herzerfrischender Lärm lag in der Luft dieses Viertels. Es ging dort zu wie auf einer venezianischen Bühne in den Zeiten der Commedia dell'arte. Am liebsten wurde Goldoni gespielt, »Krach in Chiozza«. Jemand riß plötzlich ein Fenster auf und schrie hinaus in den Garten, in dem an langen Leinen zwischen Obstbäumen die Wäsche trocknete. Ein Preßlufthammer tanzte um den Bordstein. Oder ein Fußball knallte gegen die Brandmauer, die das Grundstück von der nächsten Parzelle trennte. Wenn die Straßenbahn um die Ecke rasselte, wurde das ganze Gebäude wach gerüttelt. Die Fensterscheiben klirrten jedesmal von den vorüberrumpelnden gelben Waggons der Linie 1, der ältesten, die schon damals eine Stadtlegende war. Nur in dem Fischladen im Erdgeschoß, an der stilleren Seitenstraße gelegen, blieb es auffällig ruhig. Vor den Mäulern der nach Luft ringenden Fische verstummte, wie unter Wasser, das Rauschen der kleinen Vorstadtwelt.
Unterm Dach lag die kleine Wohnung der Eltern, durch das Treppenhaus mit den ausgetretenen Sandsteinstufen über ein paar zusätzliche Holzstiegen erreichbar. Es war keine Wohnung, eher ein Taubenschlag. Ein langer, schlauchartiger Flur führte zu dem einzigen Zimmer, das ihnen gehörte. Küche und Bad teilten wir uns mit der Vermieterin, einer Märchengreisin, nahezu hundertjährig, mit schlohweißem Haar, seit langem Witwe: Sie hatte das Zeug zur Wahrsagerin. Das alte Weiblein hat meine Mutter einmal damit erschreckt (und nachher entzückt), daß sie im Flur vor dem Spülstein das Kind aus ihren Armen an sich heranzog und ihm aus der Hand las. Da fiel ihr das tief in den Babyspeck eingezeichnete M auf, und sie fing an, hexenhaft zu kichern, eine uralte Hexe des guten Willens.
Im Erdgeschoß wohnten die Großeltern. Sie hatten das junge Paar, das dankbar war für das Stück raren Wohnraums, in ihre Einflußsphäre gelotst, eine praktische Lösung für alle. Das klassische Trio Vater, Mutter, Kind hielt sich oft auf da unten, wo das Gemäuer und der Steinboden kälter waren, bei den Altvorderen, die weniger beengt hausten als die studentischen Turteltauben oben mit ihrer einzigen Brut.
Die Zimmer der Großeltern grenzten an die Verkaufs- und Lagerräume jenes Fischladens. Man brauchte nur dem Geruch zu folgen, einmal ums Haus herum, schon stand man vor einem Aquarium, las überm Eingang das verblichene Schild mit der Aufschrift »Fischwaren« und hatte den Hafen erreicht. Die Benennung war absichtlich so abstrakt gehalten, um die wilden Phantasien zu unterdrücken. Man fuhr nicht auf Meere hinaus bei dem Wort Waren, man war sofort eingestimmt auf die schütteren Reihen von Konservenbüchsen und Einmachgläsern voll trüber Tunke, die einen drinnen erwarteten. Daß Fisch nicht stinken darf, nicht, wenn er frisch ist, lernte ich erst in einem späteren Leben.
Der Geruch war auch der Grund für die niedrigen Mieten, die man in den davon heimgesuchten Häusern bezahlte – ein Vorteil, der den Großeltern seit den späten zwanziger Jahren, den Zeiten allgemeiner Arbeitslosigkeit, zugute kam. Damals kannten nur Zeitungsleser den Namen Hitler, aber jeder Dresdner wußte, was das Handelshaus »Paschky/Seefische« an Köstlichkeiten zu bieten hatte – das zweifache S-c-h las sich als eine Verheißung von Frische und Meeresrauschen. Noch im Jahr 1936, anläßlich der Reichsgartenschau Dresden, warb der Familienbetrieb damit, seit einem halben Jahrhundert Garant zu sein für beste Qualität. Er war der Vorläufer jenes Ladens mit dem Zeichen der Handelskette HO, denn selbstverständlich war ein Unternehmen wie dieses, geschäftstüchtig und weltmarktverbunden, beim Umsturz aller Verhältnisse, im Zuge der Landesteilung als Unternehmen vertrieben worden. Was den Geruch um kein Jodmolekül minderte.
Wahrscheinlich rührt daher die stille Phobie, die mich vor Fischgerichten bis heute erfaßt. Sie können so köstlich zubereitet sein, wie es der Chefkoch versteht, immer höre ich den Alarmton, wenn auf dem Teller ein Kabeljau auftaucht, eine filetierte Forelle oder ein Loup de mer mit lupenrein weißem Fleisch. Widerlich sind mir die fetten Karpfen mit ihren schartigen Moosbuckeln, die ich noch vor mir sehe, wie sie auf dem Küchenbrett aufgebahrt lagen, immer um die Weihnachtszeit, als fette Leichname, mit den vom Verröcheln weit geöffneten Mäulern.
An ihnen war nichts Segensreiches, es waren tote Fische, vor denen mir graute. Sie bringen mir die schmale Küche in Erinnerung, das Außenklo eine halbe Treppe tiefer und den grausigen Porzellanglanz der Badewanne im Waschabteil nebenan, in der die Karpfen die letzten Stunden lebend verbrachten, gegen die schadhafte Emaille klatschend – dieselbe, auf Vogelklauen stehende Badewanne, in der ich von Kopf bis Fuß abgeschrubbt wurde, wobei mir beim Haarewaschen der Seifenschaum in die Augen geriet. Wild strampelnd stand ich unter dem klobigen Wasserboiler, tobte und schrie, woraufhin der lärmempfindliche Großvater sich in die Küche verzog. Lange saß er dann dort, die Unterarme entblößt. Auf den linken war, knapp über den Pulsadern, ein Ochsenkopf tätowiert, sein Blau verblaßt wie das Dekor verwaschener Tischdecken. In seiner Lehrzeit als Metzgerjunge hatte er ihn sich stechen lassen, eine Jugendsünde, wie die Frauen der Familie gern lästerten. Hatte er erst einmal die Bierflasche geöffnet, konnte er sich regelrecht einrichten dort und stundenlang Audienz halten neben dem Herd mit dem gargantuesken, gurgelnden Kochtopf, in dem ein paar Fischköpfe glotzäugig schwammen. Bei einer solchen Gelegenheit muß es gewesen sein, daß er dem Fünfjährigen, die Zigarette auf dem Herdrand abgelegt, einen Schluck aus der Pilsnerflasche anbot – amüsiert, als das Kind nach der Kostprobe sich schüttelte. »Schmeckt nicht, ist bitter.«
Großvater war von Beruf Fleischhauer, ein Mensch, der den größeren Teil seiner Lebenszeit im Stehen verbracht hatte, mit dem Ausweiden geschlachteter Rinder und Schweine befaßt. Auf keine andere Tätigkeit, scheint mir, hat die Bezeichnung Schinderei jemals besser gepaßt. Wenn er nach einem schweren Arbeitstag im Schlachthof nach Hause kam, setzte er sich auf seinen müden Hintern und blieb so, in thronender Position, sitzen, bis es Zeit war, ins Schlafzimmer zu wechseln. Es war eine Angewohnheit, die er mit Erreichen des Rentenalters noch einmal ausbaute. Niemand aus der Familie hat je so ausdauernd dasitzen können wie er. In den letzten Lebensjahren hatte er es darin zur Vollendung gebracht: Aus dem Schlachtermeister war die Statue eines sitzenden Buddha geworden, freilich eines, der fast niemals lächelte.
Er konnte stundenlang ausharren auf seinem Stammplatz am unteren Ende des Wohnzimmertisches. Dieser blieb stets für ihn reserviert, mit einem Kissen im Rücken, das sein Revier markierte, dem Fernsehapparat gegenüber. Meistens lief irgendeine Tiersendung, wenn wir ihn am Nachmittag besuchten. Entweder war es der Fußball, der ihn alles ringsum vergessen ließ, oder es ging um Tiere, zumeist solche, die in Gefangenschaft lebten. Ein Zoodirektor stellte seine inhaftierten Menschenaffen vor wie entfernte Verwandte. Nicht jeder Orang-Utan war so geistesgegenwärtig, sein bekümmertes Bratpfannengesicht rechtzeitig abzuwenden. Mancher Gorilla, der es sich auf dem Autoreifen bequem eingerichtet hatte, winkte nur müde ab und vergrub die schlanken Hände im Fell. Dann schmückte sich der geschwätzige Tier-Impresario zur Abwechslung mit einem Totenkopfäffchen, das ihm auf der Schulter herumtanzte. Großvater sah sich das alles an, gab aber nie einen Kommentar dazu ab. Man konnte sagen, er hielt diesen Versuchen, sich bei den Tieren anzubiedern, eisern stand, wie einer, der ein Betriebsgeheimnis kannte, so furchtbar, daß er sich hütete, uns davon zu erzählen.
Es war jedesmal eine mittlere Sensation, wenn er überhaupt den Mund auftat. Alles, was über kurze Begrüßungen hinausging, lief schon Gefahr, als geschwätzig zu gelten. Er hatte einen festen Händedruck, und seine Hände erinnerten mich an die feuchtkalten, schweren Fleischpakete, mit denen er die Sippe versorgte. Seine Augen waren oft gerötet, man konnte sagen blutunterlaufen – vom Wasserdampf, dem er häufig ausgesetzt war, an den Brühanlagen im Schlachthof und von allem, was ihm entgegenspritzte, wenn er die Schutzbrille aufzusetzen vergaß. Er saß, wenn wir eintraten, auf seinem Stammplatz, wandte sich kurz um, gab uns die Hand, wobei der blaue Unterarm aufblitzte, dann starrte er wieder geradeaus, in seinem Nirwana mit dem Flimmern des Bildschirms eins. Während der Familienunterredungen, in Phasen des Klatsches, aber auch bei Anflügen echter Konversation mit meiner Mutter, behielt er immer den Fernseher im Blick.
Er sah das Elefantenjunge, noch wackelig auf den Beinen, in seinem engen Verschlag aus Bunkerbeton, beobachtete genau die Giraffe, wie sie sich umständlich herabbeugte, um dem Pfleger die Hand zu lecken. Aber die Feuchtigkeit hinter den Brillengläsern hatte nichts mit Tränen der Trauer zu tun, sie war eine Berufskrankheit. Dieser Stoiker des Sitzens verzog keine Miene, doch er schaute sich alles aufmerksam an: Flamingos bei der Morgentoilette, das Paarungsverhalten der Hyänen und die mühsame, fast halsbrecherische Art, mit der ein Kamel sich in die Liegeposition brachte, während die Kiefer ununterbrochen weitermahlten. Derweil brütete er seine eigene Theorie vom Sitzen aus, die anscheinend tief hinabreichte bis zu den Wurzeln unseres Stammbaums.
Denn keiner der lebenden Verwandten konnte sich mit seiner Beharrlichkeit messen. Verglichen mit ihm, waren wir alle, stets auf den Beinen und immerfort geschäftig, nur flüchtige Erscheinungen, sinnlos umherirrend wie jene Springböcke in den Savannen Afrikas, die über den Bildschirm huschten.
Ich kann mich nicht erinnern, den Tierparkchef, diesen armseligen Komiker, je vor der Kamera mit einem Krokodil gesehen zu haben. Dabei wäre ihm sicher das Scherzen vergangen. Auch wurden in seiner Sendung niemals Haie vorgeführt oder sonst eine Fischart, harmlos oder gefährlich. Grund dafür war wohl der niedrige Evolutionsrang dieser Lebewesen, Lurche und Kriechtiere inbegriffen. Mit Ausnahme der Schlangen, Boas und Pythons, die man sich fernsehtauglich um den Hals schlingen konnte, waren diese Kreaturen allesamt wenig präsentabel, als Bildschirmlieblinge ein Reinfall. Großvater beschwerte sich selten, aber manchmal zeigte er seinen Unmut über das immergleiche zoologische Repertoire. »Heute wieder Schimpansen«, knurrte er dann und sah mir verschwörerisch in die Augen.
2
Das Licht war anders – damals in den Vorstadtstraßen
Der ausgeglühten, leergeräumten Stadt. Die Morgenfrühe,
Auroras Mündungsfeuer, schmierte auf die Häuserkästen
Ein zähes Rot, das kämpfte mit den braunen Untergründen,
Und was sich zeigte, war das Grau, das Grau des Neuen.
Verwunschen war das meiste, eingeschläfert unterm Blick
Des Kindes, das dort umging, märchenstill, alleingelassen
Beim Spielen oder Kleingeldsammeln oder Zeittotschlagen.
Stunden vergingen so im Schatten der an Wäscheleinen
Erstarrten Hemden, Socken, nach der Größe aufgehängt.
Ein Nachmittag verrann vor einem morschen Bretterzaun,
An dem man jedes Astloch kannte, jeden krummen Nagel,
Den einer lange vor dem Krieg dort eingeschlagen hatte.
Einmal ein Wespenstich, das war schon großes Abenteuer,
So ungeheuerlich, daß sich die Welt im Aufruhr drehte
Draußen vorm Hoftor – und dann ruckhaft innehielt
Mit ihren Eisverkäufern, Hunden, gelben Straßenbahnen
Bis hin zum letzten Pflasterstein, den Fliegen an der Wand.
Einen Fischladen gab's da, umschwärmt von den Katzen
Des Viertels, zögernd, wenn sie den Bordstein beleckten,
Der vom Spülwasser feucht war, von Gräten und Köpfen.
Efeu krallte sich in den Mauerputz. Der lästige Friedhofsfilz
Säumte den Eingang zu einer Grotte aus falschem Marmor.
Ein Mann stand davor, in Gummischürze, sich lange kratzend.
Das Schaufenster war ein Aquarium, meistens leer.
Hier blieb er gern stehen, sah durch die trübgrünen Schleier
Ein Becken, in dem Forellen und Karpfen um Atem rangen.
Durch und durch gingen die schartigen Rücken ihm, Mäuler,
Röchelnd geöffnet, Kiemen, zum stummen Leiden bestimmt.
Am Grund blinkten Schuppen im Algensud. Durch die Scheiben
Sah er im Ladeninnern dem Schlachten zu, in stiller Hypnose.
Manchmal war Kundschaft da. Und wie konnte das sein,
Daß der Mann mit dem Einkaufsnetz ins Leere starrte und pfiff?
Daß die Kiemen noch lang auf dem Richtblock matt klappten?
Daß ein Lichtstrahl die Kasse zum Glühen brachte und keiner
Die Fliegen vertrieb, dreiste Bande? Wie konnte das sein?
Hinterm Ladentisch spielte ein Radio süßliche Schlager.
»Lauf nach Hause zu Muttern!« Aber ich wohnte doch hier …
Es war nicht traurig, das Kerlchen im Ringelhemd, nur,
Was sollte es bei den Mädchen auf der anderen Straßenseite,
Den kichernden Mädchen mit ihrem Himmel-und-Hölle-Spiel?
Sollte es Springseiltanzen, sich verstricken lassen in Bänder,
Geknüpft aus den Schlüpfergummis ihrer rüstigen Mütter?
Hügelab, hügelan fuhr mit klapprigen Wagen die Straßenbahn,
An blinden Fenstern vorbei, Häusern, geduldig wie Leguane.
Ungute Stadt – der nichts geblieben war als ihr Schatten.
In den Strombügeln spielte der Wind einen langsamen Satz.
Dabei dachte er oft, an der Elbe zu angeln – die lag so nah.
Nie was gefangen, doch die Fische im Laden taten ihm leid.
Die Büchse Erinnerung, ein altes Blech voller Regenwürmer:
Man öffnet sie, und Kindheit, das Erbärmliche, weht einen an.
3
»Dem Sozialismus kann keiner entfliehen.«Walter Ulbricht
Immer noch liegt er dort
In aller Unfrische auf dem Straßenpflaster
Der erste verdorbene Fisch den ich sah
Alles war Fisch damals nicht nur im Regen
Die Bänke Plakate die Zifferblätter es gab sie
Die schlierigen Himmel die schlechte Stimmung
Den Schriftzug Orwo Karma-Kosmetik Malimo
Das »HH« jeder Haltestelle beim Warten
Und die unmöglichen Blusen die Schuhe BHs
Die glänzenden Kniekehlen schwitzender Mütter
Die Kälte der Zäune den Sozialismus
Dem keiner entfliehen konnte
Fisch es schüttelt mich Fisch
Du bist mir noch eine Antwort schuldig
4
Daß dieses kleine, rundum verschlossene, neurotische Land eine eigene Hochseeflotte unterhielt, gehört zu den vielen Unbegreiflichkeiten jener Jahre. Man war von der Welt abgeschnitten, machte Front gegen die Nachbarn im Westen und später auch die im Osten – und leistete sich währenddessen eine stattliche Anzahl von Schiffen auf allen Meeren. Vor Westgrönland und bis in die Fanggründe vor der Küste Argentiniens wurden die Hochseefischer aus dem Schattendeutschland gesichtet. Fischerei und Handelsmarine waren ein beliebtes Thema in den Zeitungen. Hier ließ sich das überschüssige Fernweh in die vernünftigen Bahnen von Technikbegeisterung und das naturbeherrschende Pathos der Fünfjahrespläne lenken.
Ich erinnere mich, wie ich nachts am Radio unter der Bettdecke ergriffen den Schiffsmeldungen lauschte. Der Heimathafen hieß immer Rostock, es gab für den Überseeverkehr nur den einen. Mich aber interessierten die Positionen da draußen, tausende Seemeilen entfernt, Hafenstädte wie Paramaribo, Bombay oder Mombasa. In meiner Schlafhöhle, die nur der Leuchttropfen des Transistors erhellte, waren solch vokalreiche Ortsnamen die reine Wonne. Sicher förderte auch das Bett, mit dem der Lauscher allein in die Nacht hinausfuhr, die Bereitschaft zu Ozeanreisen.
In den Bilanzen spielte der Schiffsbau eine entsprechend große Rolle; er half, den Schein eines weltoffenen Landes zu wahren. Und er gab einfach die besseren Pressebilder her. Ein Schiff, das vom Stapel gelassen wird (mit oder ohne Champagnertaufe), die hochaufragenden Wanten an seinem Fertigungsplatz in der Ostsee-Werft, sind nun einmal photogener als die immergleichen versteinerten Mienen und das Händeschütteln sozialistischer Brüder. Mancher wußte von einem Bekannten, der das unwahrscheinliche Glück hatte, zur See zu fahren. Ein solcher Matrose, den die zurückgebliebenen Landratten so gut wie nie zu Gesicht bekamen, weil er wie der Fliegende Holländer natürlich immerfort unterwegs war, erzählte dann von der großen weiten Welt und von seinen Abenteuern in den Hafenstädten. Als wahres Eldorado galt etwa Kuba, dort konnte sich so ein armer Ostmatrose, der einen Teil seiner Heuer in Devisen empfing, sämtliche Männerträume erfüllen. Die Geschichten, die man darüber zu hören bekam, gipfelten in dem einen, höchst beeindruckenden Satz: »Für ein Stück Westseife tun die Hübschen in Havanna alles, was du willst.«
Was für Seemannsgarn da auch gesponnen wurde, ein Bewohner des Elbtals, tief ins Landesinnere verbannt, war dafür leicht empfänglich – noch dazu, wenn er gerade in seinen Büchern mit James Cook und Charles Darwin auf Weltumseglung war. Natürlich geriet er beim Anblick eines Matrosen, der verloren an einer Straßenbahnhaltestelle stand, ins Träumen. Gerade in Dresden hatte das Auftauchen der Männer in den blauen Schlaghosen und quergestreiften Pullis, den Seesack lässig über der Schulter, etwas Exotisches. Wie habe ich sie beneidet, diese Facharbeiter zur See, die genausowenig dorthin gehörten wie die vereinzelten Möwen, die am Altmarkt aus heiterem Himmel über eine Brotrinde herfielen. Sie waren die einzigen freien Vögel, so schien mir, in einer Voliere, die das ganze Land überspannte. So wie sie wollte ich sein, dieselbe Verächtlichkeit zur Schau tragen, den Landratten einen Blick entgegensenden, der glatt durch sie hindurchschnitt bis zum Horizont. So nahm ich mir vor, da man um den Militärdienst nun einmal nicht herumkam, zur Marine zu gehen. Es war eine von vielen Blasen, die schnell zerplatzten. Wer auf die Schiffe wollte, anstatt im Hinterland durch die Kiefernwälder zu kriechen, der konnte leicht auf einem Patrouillenboot enden, im gefürchteten Grenztruppendienst. Er hätte dann, die dänischen Inseln in Sichtweite, Jagd machen müssen auf Langstreckenschwimmer und tollkühne Schlauchbootflüchtlinge – eine etwas unsportliche Beschäftigung, wie ich fand. Und dafür mußte er noch erheblich mehr Zeit opfern als der gemeine motorisierte Schütze. Es war nicht der erste Handel von Lebenszeit, den ich ausschlug, und nicht der letzte.
Ich weiß noch, wie ich damals, nach überstandener Schule, mit der Aussicht auf öde achtzehn Monate in der Kaserne, mich einen letzten Sommer lang durch Dresden treiben ließ, vorzugsweise an den Ufern der Elbe hinauf und hinunter. Ich hatte es nicht sehr eilig, man kam ja doch nicht weit.
Aus irgendeinem Grund hielt ich mich immer besonders lange bei den Dampferanlegestellen auf. Die Fahrten, die sich mit den altmodischen, schornsteinbewehrten, schwimmenden Pendants unserer Bummelzüge machen ließen, hatte ich alle schon mitgemacht, und dies mehrmals. Flußabwärts ging es nach Meißen – und man wußte, daß in dieser Richtung irgendwann Hamburg erreicht wurde. Flußaufwärts kam man, am Lustschloß Pillnitz vorbei, in die Sächsische Schweiz mit ihren kleckerburgartigen Felsen. Einige der Elbdampfer waren noch echte Seitenrad-Oldtimer aus dem neunzehnten Jahrhundert, und man mußte sich nur in das feine rhythmische Stampfen versenken und die Kästen mit den hölzernen Schaufelrädern, um die das Wasser schäumte, beim An- und Ablegen nur lange genug betrachten, dann konnte der Strom sich hinterrücks unmerklich zum Mississippi weiten. Dann stand man mit einem Bein plötzlich in einer anderen Welt, an den Ufern Louisianas. Und erstaunlich auch, wie ein bloßer Name – die stillen Dampfer von der Eleganz großer Schwäne gehörten alle zur Weißen Flotte – immer noch einen Rest von Verheißung enthielt.
Und war nicht ein Fluß die beste Reklame für das nächste offene Meer? Auf den Gedanken konnte man leicht kommen – und ihn sogar in einer Verszeile festhalten –, wenn man die Elbwiesen entlangspazierte, landauswärts, in nordwestlicher Richtung. Aber dann machten schon ein paar tote Fische, bäuchlings im trüben Uferbereich dümpelnd, die ganze herrliche Werbeaktion zunichte.
5
»On the back of the fish truck that loadsWhile my conscience explodes«Bob Dylan, Visions of Joanna
»Zweimal in der Woche Fisch/bereichert jeden Mittagstisch!« Ich kann nicht sagen, daß mein Bewußtsein explodierte, wenn ich den Spruch auf dem Fischlaster sah, der vor der Tür ausgeladen wurde. Aber etwas muß in diesen Momenten mit mir geschehen sein. Vom Lesenkönnen war ich damals weit entfernt, doch der Schriftzug war mir vertraut, wenn ich ihn später im Straßenverkehr wiederfand. Es war, als hätte ich ihn schon früh, im süßen Stadium des Analphabetismus, unbewußt mitbuchstabiert, wobei der aufgeschnappte Reim sicher die gedächtniskitzelnde Rolle spielte – der Reim, der in meinem Leben noch manches auslösen sollte.
Der weiße Kühltransporter hielt in der Seitenstraße, und ich blieb jedesmal stehen und sah mir Schrift und Bild lange an, bemerkte auch die Rostflecken an der Verkleidung. Die streng riechende Ware wurde in schmuddeligen Plastikwannen und Paletten überbracht von Männern in weißen Kitteln, die an Krankenpfleger erinnerten. Doch den realistischen Teil blendete ich als Kind gern aus: Ich war das, was die Erwachsenen einen Träumer nannten.
Ich mochte den munteren blauen Fisch im Profil, mit seiner schwarzen Pupille und dem wie zum Sprechen geöffneten Maul, der meistens aufgerichtet auf seiner Schwanzflosse stand, als sei er auf dem Weg der Menschwerdung gestoppt worden. Einmal applaudierte er mit den Flossen wie die Seehunde bei der Zoovorführung, ein andermal hielt er einen Kochlöffel geschultert und hatte eine Kochmütze auf, oder er stützte sich auf den Tisch, auf dem schon die Schüssel mit der Fischsuppe dampfte. Er war wie ein guter Begleiter durch eine unfreundliche Welt, deren Härten man früh zu spüren bekam, wenn die Haut dünn genug war. Im Volksmund hatte er, soviel ich weiß, keinen eigenen Namen, wo doch sonst alles sogleich eingeheimst wurde mit Spitznamen und witzigen Etiketten.
Dieser Fisch war einfach der blaue sprachlose Fisch aus der Werbung, ein Maskottchen, das für die Produkte aus dem Kombinat Hochseefischerei Rostock salutierte. Man fing ihn hier und da im Straßenbild mit einem Seitenblick auf und ließ ihn dann wieder zurückgleiten in den Verkehrsstrom. Und eines Tages kam die Entdeckung der Abstraktion.
Kinder mögen das Abstrakte und im Abstrakten das Konkrete: die weiße Wurst aus der Zahnpastatube, das grüne Männchen, das in der Ampel wohnt, die Dampfwalze, die aus der schwarzen Streichmasse Asphalt einen glänzenden Teppich macht. Kinder fragen sich, ob man mit Tannennadeln nähen kann und wie es sich auf einer Wolkenbank sitzt. Im Kindergarten gab es mit schöner Regelmäßigkeit Fischstäbchen, es war das beliebteste Mittagessen. Diese kleinen braungelben Quader mit der köstlichen Kruste waren immer abgezählt: Man mußte die Köchin anbetteln oder mit anderen Kindern tauschen, wenn man mehr von ihnen wollte. Sie galten, ganz offiziell, als gesund, zeitsparend in der Zubereitung, waren grätenfrei und hielten sich lange als Tiefkühlkost frisch. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sich mit Fischstäbchen zu bewerfen, wie wir es später mit den Kartoffeln und den Königsberger Klopsen taten. Keiner hätte sie mit den phantastischen Wesen verwechselt, die mancher im Kinderzimmer hielt: den Goldfisch in seinem Kugelglas neben dem Globus, den Guppys im beleuchteten Aquarium, die sich gegenseitig die tropisch bunten Flossen zerfraßen: die Schleierschwänze, Speerschwänze und Triangelschwänze – diese ersten Verkörperungen der Geometrie, die einem später im Matheunterricht auf dem Kästchenpapier wiederbegegneten als Dreieck, Rhombus und Kreisform. Ich hatte niemals ein Kinderzimmer, bis ich achtzehn war und aus der Wohnung der Eltern auszog, und dann war es dafür zu spät. Man kann sich das eigene Zimmer um keinen Preis der Welt zurückträumen, wenn man keins hatte.
Habe ich schon gesagt, daß ich noch lange danach keinen Fisch essen mochte? Denn die Fischstäbchen waren etwas für die Kleinen, das Kapitel war bald beendet – und Konserven zählten nicht. Daß ich mich später manchmal auf eine Büchse Dorschleber stürzte, einen Miniatursarg voller Sardinen, seltenes Importgut, kommt mir heute unwahrscheinlich vor.
In einem der Sommer an der Ostsee, als ich wie Robinson mit einem riesigen ausgefransten Strohhut umherlief, lernten wir in Surendorf den alten Fischer Peplow kennen. Das war ein Mann, wie von Ernest Hemingway in die Welt gesetzt, der manchmal abends mit seinem Kahn hinausfuhr und eine Wanne voll Aale zurückbrachte. Die wurden dann gehäutet und, auf Spieße gesteckt, am offenen Feuer gebraten – das gefiel mir. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie wirklich probiert habe, aber ich erinnere mich an die blutige Lauge, in der sie nach dem Schlachten leblos zuhauf lagen. Man griff hinein und hielt eine dieser glitschigen Schlangen in den eiskalten Händen, sie glänzten im Fackelschein wie rohes Geschmeide. Der Fischer Peplow saß währenddessen auf einem dreibeinigen Schemel, schmauchte seine Pfeife und putzte die Schuppen von den Meeräschen, die ihm als Beifang in die Reusen gegangen waren. An den übrigen Tagen konnte man bei ihm geräucherte Flundern kaufen, auf die mein Vater besonders scharf war. Sie kamen nie auf den Teller: Man aß sie vom Wachspapier, das Fett schlug beim Häuten der flachen Räucherfische allmählich durch, und man pflückte das weiße Fleisch von den Gräten, mit den bloßen Fingern, man brauchte dazu kein Besteck. Für die Eltern war dies einer der kulinarischen Höhepunkte jedes Campingsommers. Ich weiß noch, daß ich mich lange nicht satt sehen konnte an den kleinen gezähnten Spitzmäulern der Flundern und Schollen. Besonders das eine, nach oben gewanderte Auge entfachte die Phantasie. Kein Fisch, von dem ich mich nicht beobachtet gefühlt hätte.
Wenn man zu lange in die starren, schießscheibenförmigen Augen schaute, konnte es geschehen, daß man sich festsah. Dann rauschte man plötzlich in einen Zeitschacht ab und fand sich, um Jahre versetzt, in einer anderen Szene wieder – etwa beim Baden in einem Baggersee, im aufgewühlten Uferschlamm der Waldteiche hinter der Autobahn im Norden Dresdens oder beim Angeln am Hellerauer Gondelteich. Dieses Angeln im trüben Wasser, dem wir uns an den schulfreien Nachmittagen hingaben, war eine perfide Sache. Es war mit einem Verbrechen verbunden, dessen Schande ich jahrelang still mit mir herumtrug.
Es begann damit, daß wir am Zulauf des Gondelteiches aus Stöcken und Pflastersteinen ein winziges Wehr errichtet hatten, in dessen Staubecken wir die geangelten Stichlinge, bald eine ganze Population, einsperrten. Die zentimeterlangen, grüngesprenkelten Süßwasserfische mit den gefürchteten Stacheln, die sich bei Gefahr aufrichten konnten und uns manchmal die Fingerkuppen ritzten, waren uns auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und wir Knaben, bebend vor Mordlust und Langeweile, spielten mit ihnen Herr über Leben und Tod. Ich werde nie vergessen, wie wir nach einem Tag voller Zwietracht und leerlaufender kleiner Gemeinheiten uns schließlich zusammenrauften zu einem Massaker, kurz vor Toresschluß. Es war im Herbst, die Tage wurden kürzer, vor Einbruch der Dunkelheit mußte jeder zu Hause sein: Grund genug, die Gereiztheit wegen der nassen Turnschuhe, durchweichten Strümpfe und der vom kalten Wasser schmerzenden Hände mit einem letzten Gewaltakt zu besiegeln. Wir waren uns wortlos einig: Unsere Stichlinge sollten die Nacht nicht überleben. So trat das kleine Sonderkommando zusammen, wir pumpten das Staubecken ab, griffen uns die Fische, einen nach dem anderen, heraus und klatschten sie gegen das Mauerwerk, bis der letzte aufgehört hatte zu zappeln. Danach ging jeder, die Angel lässig wie ein Maschinengewehr geschultert, seiner Wege.
6
Vor einigen Jahren trieb es mich in das alte Meereskundemuseum in Stralsund. Ich kannte das Gebäude, in dem das Skelett eines Finnwals an der Decke schwebte, seit den Sommern der Kindheit. Selten, daß wir den Besuch dort ausließen, wenn ich wie in jedem Jahr mit den Eltern an die Ostseeküste zog, zum Camping auf der Insel Rügen oder auf dem Darß. Damals beschäftigten mich vor allem die Trophäen und Relikte gefährlicher Meeresbewohner. Ich starrte lange auf die riesigen teleskopartigen Beine der Tiefseekrabbe und auf das Haifischgebiß mit den Reihen von Dreieckszähnen, die immer wieder nachgeladen wurden, wie Patronen im Magazin eines Trommelrevolvers. Das Technische von Natur und Mensch nahm die Aufmerksamkeit in Beschlag: der Stoßzahn des Narwals, der Panzer der Karettschildkröte, Schiffsschrauben und Fangwerkzeuge.
Ich erinnerte mich an den maßstabsgetreuen Nachbau eines Schleppnetzes mitsamt dem silberblitzenden Schwarm, der darin gefangen war – für alle Museumsewigkeit in der Falle. Jetzt erst ging mir das Sinnbild des Fangschiffes auf, in der Presse des Landes gern Trawler genannt. Ganze Populationen von Kiemenatmern wurden über die Stahlrampe am Heck an Bord gezogen, dort in einem Produktionsgang sortiert, zur bloßen Sache verwandelt und, mit Eisgranulat bedeckt, in Paletten verpackt, alles bei voller Fahrt. Mein Blick hing lange an diesem Schwarm, um den das Netz sich geschlossen hatte. Die armen Leute, dachte ich, dort im magischen Licht der Vitrine.
Und noch etwas interessierte mich, das ich damals übersehen hatte. Ich beugte mich über die Schaukästen mit den Fischkonserven aus sozialistischer Produktion. Jetzt wußte ich: Dies war die Vergangenheit. Sicher, der penetrante Geruch fehlte, die Exponate sahen armselig und grau aus, Zeit hatte die Etiketten entfärbt. Aber als hätte jemand an Aladins Wunderlampe gerieben, rollten sich vor meinen Augen die Blechdosen auf, und ich sah wieder den Hering in Tomatentunke. Es gab die Einmachgläser mit dem metallisch glänzenden Rollmops, die Büchsen voll der rotbraunen streichfähigen Masse, die man der Bevölkerung als Fischpaste verkaufte. Alles war wieder gegenwärtig, und die Kindheit erwischte mich mit einem Streiflicht, als gelinder Schrecken, der durch den Magen ging.
Ich sah die erbarmungswürdige Produktpalette planwirtschaftlicher Fischverarbeitung, dies karge Sortiment, das als Ersatz herhalten mußte für den Reichtum unerreichbaren Meereslebens. Ersatz – ein Wort, das in das Deutsche einzog, als die Weltmarktprodukte knapp wurden im Hitlerkrieg und das noch lange darüber hinaus in der abgeschotteten Hälfte des Landes Praxis blieb. Es gab Ersatzstoffe aller Art: Ersatz-Kaffee, Schokoladen-Ersatz, Ersatz-Fisch. In diesem Museum war die Substanz eines ganzen Landes und seiner untergegangenen Eßkultur aufbewahrt. Hätte ich ahnen können, daß solche unscheinbaren, fäkalienfarbenen Überreste mich einmal bestürzen und entzücken würden?
7
Wie lange hatte ich mir als Kind eine richtige Armbanduhr gewünscht. Als ich sie endlich geschenkt bekam und Vater sie mir um das schmale Ärmchen band, war ich enttäuscht. Immer wieder rutschte sie mir übers Handgelenk. Einige Zeit darauf wiederholte sich mehrmals ein Traum. Ich stehe an einer der seltenen Fischbuden an, die es damals in den Ostseeurlauberorten gab. Der Fischverkäufer preist seine ungewöhnlichen Matjesbrötchen an. Ich sehe ihm dabei zu, wie er die Brötchen aufschneidet und aus einem großen Bottich einzelne Armbanduhren herausfischt und zwischen die Hälften legt. Merkwürdig, die Enden der Armbänder zuckten und zappelten wie die Schwänze aufs Land geworfener Fische.
Das Große Gehege
Einmal in der Woche brach Großvater auf zu einem langen Spaziergang an seine alte Arbeitsstätte, den Schlachthof. Wenn ich Glück hatte, nahm er mich mit. Dabei war das Kind ihm, wegen seiner Langsamkeit, seiner Verträumtheit, und eben als Kind, unausgewachsenes Wesen, eigentlich lästig. Er war nicht gerade das, was man einen guten Betreuer nannte. Seine Einwirkung auf diesen Enkel bestand in der Nichteinwirkung; er ließ die Dinge laufen.
Wir gingen, da bin ich mir sicher, an vielen Gartenzäunen und Brandmauern vorbei, und das Ganze machte den Eindruck, als wäre der Krieg eben erst zu Ende gegangen. Wir gingen die Warthaer Straße hinunter entlang der Gleise, der untersetzte Großvater im Anzug Hand in Hand mit dem Vierjährigen in Lederhosen, zwei trödelnde kleine Gestalten – jede auf ihre Weise klein –, die hin und wieder von einer Straßenbahn überholt wurden, selten von einem Auto. Und wenn es ein Auto war, dann eines mit strenger Pontonkarosserie, ein buckliger alter Wolga oder Popeda, ein tantenhafter Wartburg, und nur ganz ausnahmsweise eine der eben frisch vom Fließband gerollten Plastikschachteln Marke Trabant, die so leichtgewichtig über das Kopfsteinpflaster hüpften. Aber an Autos war nur einer von uns beiden interessiert, der andere hielt es mit den Immobilien am Wegrand, die seinem Naturell besser entsprachen – wobei das Wort Immobilie aus dem Sprachgebrauch gestrichen war und etwa so exotisch herüberklang wie Hypothek oder Rendite, Ausdrücke, die gleichfalls ausgestorben waren. Er musterte, während ich nach dem Brummgeräusch am Himmel Ausschau hielt, die Schaufenster, prüfte ihre spärlichen Auslagen, in denen jede kleine Veränderung einer Offensive gleichkam, hier ein neues Bügeleisenmodell, da ein fescher Rasierpinsel. Lange hielt er sich vor den Fassaden auf, deren Gestern er kannte, vor deren schäbigem Heute ihn aber eine tiefe Verwunderung ergriff. Sie waren tatsächlich oft nur mehr Ziegel und Eisenprothesen.
Das Caféhaus, in dem ein paar dicke Damen vor ihren Tortenstücken saßen, ließ er links liegen, machte aber jedesmal hinter der großen Kreuzung an der Meißner Landstraße vor einem Kiosk halt, um dort ein Bier zu kaufen und für das Enkelkind eine Limonade. Dann ging es weiter an einer braunen Feldsteinmauer entlang, die sich später mit der Vorstellung von einem Felsenkeller verband; es gab davon etliche in der Umgebung, wenn auch vielleicht nicht dort. Kann sein, das Gedächtnis erfuhr an dieser Stelle eine Irritation durch den Gestank, der gleich darauf die empfindliche Nase des Kindes traf. Wir waren dann an dem dunklen Pissoir vor der Eisenbahnbrücke angekommen, das uns mit seinen Ammoniakdünsten noch lange verfolgte. Ich hätte gern die Straßenseite gewechselt, aber das war erst möglich, nachdem Großvater diese unheimliche Männerhöhle aufgesucht hatte, vor der ich zu meinem Unglück auch noch warten mußte. Selbst hineinzugehen kam nicht in Frage. Einmal hatte ich dort neben ihm gestanden und mit schreckgeweiteten Augen die glitschigen Wände einer Tropfsteinhöhle, eines Salzstollens betrachtet, von denen unablässig etwas Weißliches, Salpeterartiges herabrann. Kann auch sein, daß ich damals die ersten rübenhaften schweren Gehänge sah, fleischerne Karotten, die im Halbdunkel glänzten, und den goldenen Harnstrahl, der an der Pißwand in tausend Tröpfchen zersprühte, die an den bloßen Beinen brannten. Der Schauder und die Bedrängnis waren so groß, daß ich zu zittern und hemmungslos zu weinen anfing. Die Affäre wurde stillschweigend übergangen, aber der beißende Geruch, das spürte auch mein abgehärteter Großvater in seiner Gutmütigkeit, war doch so wenig zumutbar, daß er das Kind fortan lieber draußen ließ, allein mit seiner Bestürzung vor der abstoßenden Erwachsenenwelt.
Wenn er fertig war, ging es mit einem gewissen Schwung der Erleichterung auf beiden Seiten weiter in Richtung Elbe, indem wir linker Hand das letzte Haus nach der Brücke passierten, einen Gasthof, vor dem unter Lindenbäumen ein paar Gartenstühle auf Kundschaft warteten. Erst auf dem Heimweg machten wir dort Station. Dann gab es den unvermeidlichen Eisbecher zur Belohnung, wenn das Kind die Expedition wie stets ohne Murren überstanden hatte. Vorher jedoch zeigte er mir den Strom.
Das Wort kam aus seinem Mund, ich weiß es noch, und es hat sich mir eingeprägt in all seiner Erhabenheit, weil es mich bis heute in ein Wechselbad der Gefühle stürzt. Strom, das war etwas, das normalerweise aus der Steckdose kam, Elektrizität, die es brauchte, um den Fernsehapparat zum Flimmern, den Wassertopf mit dem Tauchsieder zum Blubbern zu bringen. Nun aber standen wir an den Elbwiesen und sahen auf einen Fluß, der ein ganzes Landschaftsbild prägte und einen eigenen, sonderbaren Namen trug, der immer wiederkehrte in den Gesprächen der Einheimischen. Elbe sagten sie, das ist die Elbe, und sie fließt durch Dresden, die wunderschöne, aber leider restlos zerstörte Stadt. Sie kommt aus dem böhmischen Riesengebirge, da ging einst Rübezahl um, der ein bärtiger Riese war, und sie mündet hinter Hamburg in die Nordsee – ein Meer, das wir so schnell nicht sehen würden, denn es lag fern im Westen. Nicht gerade hinter den sieben Hügeln wie im Märchen, aber doch durch eine Grenze von uns getrennt, eine Staatsgrenze, wie ich bald hörte. Wir standen dann lange und schauten auf diesen Strom. Meist waren ein paar Lastenkähne unterwegs, sie hielten Kurs in der Flußmitte oder passierten einander in gemessenem Abstand wie Eisenbahnzüge, unbeirrbar die graubraunen Wasser durchpflügend, mit einer kleinen Bugwelle und einigen Wirbeln am Heck. Von der Stadt her kommend, unterquerten sie in Sichtweite die Kaditzer Brücke und bogen vor unseren Augen in eine scharfe Rechtskurve. Gegenüber lagen die Wiesen von Übigau, unbebautes Gelände, auch Kühe weideten dort. Fehlten nur noch die Windmühlen für ein richtiges Holländerbild. Das Kind wäre am liebsten auf eines der Schiffe hinübergesprungen und auf dem flachen Oberdeck hin und her gestürmt. Bis auf den einen Mann am Steuerrad, der so gar nichts von einem Kapitän hatte in seiner Hausmeisterkluft, waren die meisten Kähne unbelebt, und wir wunderten uns über das einzelne Fahrrad an der Bordwand und die Antenne hinter dem Stummel von einem Schornstein. Einige Wimpel in verwaschenen Farben flappten träge im Wind, einmal die tschechische Flagge, ein andermal Schwarzrotgold oder ein Fetzen mit einem unbegreiflichen Symbol, das von fern wie ein Anker aussah, ein Glücksrad oder ein Flickenteppich aus Tapetenproben. Manchmal waren die Luken in ganzer Länge geöffnet, und man sah Kohlehaufen, Berge von Altmetall, verschachtelten Schrott, aus dem ein paar Ofenrohre aufragten, Kühlschrankgehäuse, schmiedeeiserne Gitter. Da begann ich zu träumen: Ich stellte mir den Alltag der Binnenschiffer vor in all seiner Herrlichkeit, ein Zigeunerleben (was wußte ich damals von dem vergifteten Wort, ich hatte es oft gehört und nichts von den Stämmen der Sinti und Roma), versuchte die Zeichen an Bord zu deuten, den festlandsfernen Tagesablauf, Hemden auf einer Leine, eine frisch gestrichene Werkbank, den Pudel, der auf einen Container geklettert war und von dort aus wie irre zu uns herüberkläffte. Was hätte ich darum gegeben, bei ihnen zu sein. Auf ein vorüberfahrendes Schiff aufzuspringen, einfach so, ohne Vorwarnung, unter den Augen der fassungslosen Eltern, war eine fixe Idee, die mir lange im Kopf spukte. Überhaupt fiel es mir niemals schwer, mich in das Leben der anderen hineinzuträumen. Auch in Großvaters Rolle konnte ich jederzeit schlüpfen, mir genügten dazu die paar Hauptepisoden aus seinem überschaubaren Leben, von denen ich später erfuhr. So sah ich mich beispielsweise einmal neben ihm in das von Wehrmachtstruppen besetzte Paris einmarschieren, hoch zu Pferd auf einer Platanenallee, an deren Ende Napoleons Triumphbogen in der von Blütenstaub getrübten Sommerluft stand. Und natürlich waren die Ketten um den Triumphbogen abmontiert, auf denen Gertrude Stein als Kind noch geschaukelt hatte, und natürlich ging er unter dem Bogen durch, was sich nicht gehörte, und das Unglück erfüllte sich, weil der Sieger zuletzt immer verliert.
Das Motiv vom Reiter war dem Familienalbum zu entnehmen, allerdings stammte die Aufnahme bereits aus dem anschließenden Rußlandfeldzug, wie er das nannte. Das wichtigtuerische Unternehmen Barbarossa, Codewort der Militärs, habe ich nie aus seinem Munde gehört. So sprachen Memoirenschreiber und die Bürohengste vom Oberkommando der Wehrmacht. Er war als Koch seiner Kompanie immer nur weitergezogen und saß da auf einem in den russischen Dörfern requirierten Pferd, woraus ich im Überschwang später die Vorstellung von einer Kavallerietruppe entwickelte, wie sie mir aus Isaak Babels roter Reiterarmee lebhaft vor Augen stand. Nie zuvor hatte ich ein so rauschhaft aus wilden Erinnerungsfetzen zusammengestückeltes Buch gelesen, das mir den Krieg, jeden Krieg, in brennenden Farben malte. Budjonnys reitende Soldateska, Pferdeköpfe auf den Ärmelaufschlägen der Uniformen, wie sie im galizischen Regen durchs Schtetl fegt und auf der uralten Straße von Brest nach Warschau die Kirchen plündert. So war auch mein Großvater unterwegs gewesen, nur in umgekehrter Richtung, gut zwanzig Jahre später, den Bolschewisten entgegen, und so sah ich ihn, den kleinen, gedrungenen Metzger, Hüter der Gulaschkanone, als verwegenen Feldkoch in Eilmärschen zu Pferde zwischen den vorrückenden Truppen. Nach meiner eigenen Militärzeit erst der Verdacht: War er das typische fleißige Lieschen gewesen, der Schatten hinterm Spieß, zuerst Liebling der Kompanie, dann ihr einziger Anwärter aufs Überleben? Sein Dienstrang? Ich habe vergessen, ihn danach zu fragen. Nach seinem Tod waren da nur noch Frauen übrig, die solcher Kriegskram nie interessierte.
Ob auch er Dörfer angezündet hatte, irgendwo hinter Kursk, vor Orel und Woronesh, wenn auf dem Rückzug Verödung befohlen war? War er dabeigewesen, wenn es darum ging, steifgefrorenen Kosakenleichen das Fußzeug abzunehmen, indem man ihnen mit der Axt die Unterschenkel abschlug und die blutigen Filzstiefel zum Auftauen ans Feuer stellte? Im Winterkrieg war es schnell vorbei mit den guten Sitten, der fröhliche Landser verrohte. Aus motorisierten Romantikern wurden Mordbrennerbanden. Und bald ging den grimmigen Gotlandfahrern auch der Treibstoff aus, wie sie damals sagten, heute heißt es Benzin. Der übermächtige Raum durchtränkte alles mit dem Gefühl der Verlorenheit. Nur Müdigkeit, grenzenlose Apathie machte das sinnlose Pendeln zwischen der Front und den Auffangstellungen erträglich. Sah er die Partisanen am schnell gezimmerten Galgen baumeln? Hatte auch er zwischendurch seine Panjenki, junge Russenmädel, zum Vergnügen gehabt? Ich sehe ihn an den Geschützzügen vorbeiziehen, Verpflegung austeilend an die Kolonnen, die mit Munitionswagen und Panzerabwehrkanonen in die östlichen Steppen zogen. Es paßte alles nicht wirklich zusammen oder nur ungefähr, aber wen störte das schon? Als Kind hatte ich mir eine gewisse Art des Tagträumens angewöhnt, ein wildes Imaginieren über Zeiträume hinweg, und das begann auf unseren Spaziergängen durch die Dresdner Vorstadt.
Damals werde ich ihn wohl manchmal mit einem scheuen Seitenblick betrachtet haben. Er stand an der Elbe, rauchte und starrte ins Leere. In unser Schweigen eingesponnen, jeder auf seine Weise, waren wir mehr als nur ein Zeitalter voneinander entfernt. Gehörten wir überhaupt noch demselben Jahrhundert an? Wenn ich jetzt an diese friedvollen Nachmittagsrundgänge zurückdenke, fällt mir eine Seltsamkeit ein, die alles über unser Verhältnis sagt. Es wurde auf diesen wenig peripatetischen Exkursionen nie viel gesprochen, und mein Großvater war ja auch alles andere als ein Aristoteles. Er gehörte nicht zu der Kategorie Lehrer aus den altdeutschen Bilderbüchern, die mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt schritten und ausgedehnte Vorträge hielten. Zwar zeigte er mir unterwegs mancherlei, vom Porzellankopf am Strommast und der toten Maus, die auf dem Gullydeckel verendet war, bis zu den Löwenzahninseln im wilden Grün der Elbwiesen, diesem breitzüngigen Unkraut, erkennbar an den grauverschleierten Kugeln, die sich bei kräftigem Pusten in ein Kommando von Fallschirmjägern auflösten. Er benannte das alles mit der Sachlichkeit eines Lexikons, die Gegenstände, die Pflanzen und Tiere, und auf Nachfragen ließ er sich auch zu Erklärungen herbei, aber auch sie blieben immer nur ganz lakonisch. Er ging mit den Worten so sparsam um wie mit dem Geld, das er umständlich aus dem zerdrückten Lederportemonnaie fischte, das ihm in der Gesäßtasche steckte neben dem schwarzen Stielkamm. Er machte sich rar, wie es bei uns hieß, und seine Wortkargheit bewirkte, daß ich ihn beim kleinsten Räuspern aufmerksam ansah. Die eigentliche Sensation war denn auch etwas anderes: Es war die Anrede, jedesmal gut für einen Überraschungseffekt, den er für mich parat hatte. Er sprach mich, den erstgeborenen Enkelsohn, immer nur mit »Mein Freund« an.
Eine dunkle Anziehungskraft schien da zu wirken – als wäre ihm in diesem Kind der ersehnte, ein Leben lang ausgebliebene Vertraute erschienen, ihm, der nie eine Freundschaft erlebt hatte, sondern immer nur Konkurrenten, Kameraden und Kollegen. In jedem zweiten Satz, so kommt es mir heute vor, flocht er dieses »Mein Freund« ein. Es ersetzte die körperliche Berührung und stand für alle Liebe und alles Wohlwollen, das er diesem kleinen, klaglos dahintrippelnden Spaziergänger an seiner Seite entgegenbrachte. Manchmal schob ich verstohlen meine Hand in die seine, die als kaltes Fleischpaket an ihm herabhing – nicht immer nahm er sie an. Lange nach seinem Tod kam mir ein Vers in den Sinn, der alles Unausgesprochene, das wie die schlechte Luft von damals zwischen uns war und doch genetisch längst durch uns hindurchging, auffangen sollte:
Glück ist, wenn gräsergleich dich Erinnerung
Streift an den Schläfen. Wenn diese erste Welt
Der Blicke und der Benennungen wiederkehrt
Diese Wiesen entlang der Elbe, mit ihren Unkrautstreifen ein fades, menschenverlassenes Arme-Leute-Grün, wie vom Kurvenlineal in den Talgrund gezeichnet, waren so etwas wie ein früher, prägender Eindruck. Unter allen Stadtansichten von D. sind sie es, die als erste wiederkehren, wenn ich die Augen schließe. Stand da nicht manchmal ein Angler, mit der langen Rute weithin sichtbar als Silhouette? Einzelne Unbeirrbare gab es immer, aber es hatte sich doch herumgesprochen, daß aus diesem Fluß nichts mehr zu holen war, seitdem die Abwasser der neuen Chemiefabriken ihn schwer vergifteten. Mutter erzählte gern, wie sie als Kind in der frühen Nachkriegszeit mit ihren Freundinnen sich an der Elbe zum Schwimmen verabredet hatte. Zwanzig Jahre danach hatte die Szenerie sich gründlich verändert. Man wußte, daß man hier nicht mehr zum Baden und Angeln herkommen durfte. Die Elbwiesen waren nun ausgestorben. Nur noch Einzelgänger wie dieser alte Mann und das Kind gingen auf den einstmals ausgetretenen Pfaden, die wieder von Unkraut überwuchert waren. Wegwarte und Skabiose wuchsen da, und der wilde Schnittlauch war schon verblüht. Ein starker Modergeruch kam vom Fluß her, der sich träge dahinschob, ein lehmgelber Brei aus den böhmischen Märchentöpfen. Ich mochte sie, diese verwahrlosten Wiesen, in denen man sich verlieren konnte, und vorn am Wasser die steinernen Einfassungen der alten Dampferstationen mit ihren rostigen Ringen.
Wir gingen am Ufer weiter stadteinwärts, bis wir an einen schmalen, kanalartigen Flußlauf kamen, der dort, unterhalb der Kaditzer Brücke, in die Elbe mündete. Es war die Weißeritz, ein Bächlein, das von den südlichen Höhen der Stadt herabgestolpert kam und regelmäßig, so ausgehungert es auch wirkte, zu Überschwemmungen neigte und die umliegenden Keller unter Wasser setzte, wenn im Frühjahr die Schneeschmelze einsetzte. Seinen Ursprung hatte es im Erzgebirge, bei den im Mittelalter schon ausgeschlachteten Zinn-und Silberbergwerken, dort, wo aus gelben Nebeln die von den tschechischen Industrieanlagen entstellten Fichten aufragten, hoch oben auf dem Bergkamm von Zinnwald. Ich wunderte mich über das dünne Rinnsal in der tiefen Mulde aus Quadersteinen, als wir den Steg überquerten. Nicht ausgeschlossen, daß ich spätestens hier auch zu klagen anfing über den weiten Weg und dies und jenes, und mich ans Geländer klammerte, ein bockiger Esel. Ich stampfte mit den kleinen Lederschuhen auf, daß die Schnürsenkel flogen, erklärte, daß mir die Füße weh taten – irgend etwas tat immer weh. Aber Großvater, der Jammern nicht ausstehen konnte, blieb eisern und lockte mich mit dem Elbhafen, der Aussicht auf das Beladen der Frachtkähne. Wenn nichts mehr half, verfiel er als letztes Druckmittel auf das lapidare »Mein Freund …«, halb Mahnung und halb Liebkosung, ein fein dosierter Rippenstoß, vor dem jeder kindliche Widerstand dahinschmolz.
Großvater war selbst nicht der Schnellste, aber einmal aufgestachelt, konnte es vorkommen, daß ich auf den letzten Kilometern mit neuer Begeisterung losstürmte, und er, der sich nicht lumpen ließ, hielt mit mir Schritt. Er sah dabei immer aus wie ein Mann, der zu ebener Erde einer Rolltreppe zu entkommen suchte, die in Gegenrichtung unter seinen Füßen dahinlief. Auf diese Weise trippelten wir dann auch um das große, rechteckige Hafenbecken, vorbei an den Kaianlagen und Silos, kreuzten Gleise, sprangen behende durch die Lücken zwischen abgekoppelten Güterzügen, nahmen im Slalom Container, gefüllt mit Ziegelschutt oder Buntglasscherben, die in der Herbstsonne glitzerten und die Elstern anlockten. Mag sein, daß der schläfrige Kranführer in seiner Kabine aufschrak und uns verwundert nachschaute. Ein Monteur im Blaumann brüllte uns etwas hinterher. Die dunklen Gestalten, die schweigsam Briketts auf ein Förderband schaufelten, alle rußverschmiert wie die Schornsteinfeger, drohten uns mit ihren schwarzen Fäusten. Man konnte uns, wie wir da vorbeitrabten, leicht für ein Stummfilmpaar halten – Pat und Patachon, das dänische Komikerduo, bei einem seiner Streiche, die wir manchmal im Vorabendprogramm sahen, wobei ich der einzige war, der sich vor Lachen bog, Großvater runzelte nur die Stirn bei derlei Albernheiten. Ob es ihn langweilte, mit mir zusammenzusein? Immerhin, ich kann sagen, wir hatten beide unseren Spaß an diesen Inspektionsgängen in die Umgebung. Ich bilde mir ein, daß er die Nachmittage, die er mit mir verbrachte, im stillen genoß als ein seltenes Generationsspiel. Daß sie mehr waren als nur eine Unterbrechung im Trott seines einförmigen Werktagslebens, wer weiß – ein Moment der Schwebe, der Schwerelosigkeit in der unaufhaltsam nach unten, grabwärts ziehenden Zeit.
So erreichten wir endlich das Große Gehege, auch Ostra-Gehege genannt. Erst viele Jahre später begriff ich, wo ich da hingeraten war. Von dem milden Oktobertag hat sich mir nur das Licht eingeprägt, das über die Flußniederung Wellen von dunstigem Gold verströmte, hier, wo die Elbe eine Umarmung wagte. Das schöne rätselvolle Wort Aue, eine Kostbarkeit aus dem Sprachschatz, kommt mir in den Sinn, wenn ich an diesen Fleck auf der Weltkarte denke, Fluchtort vieler Erinnerungen und der Sehnsucht nach einer weniger bauwütigen Zeit. Auenlandschaften waren die begehrtesten Siedlungsplätze, auch für jene Völkerschaften, die es nicht wie die Römer verstanden, feste Brücken zu schlagen zwischen den Ufern. Die fruchtbaren Schwemmböden gaben die besten Weidegründe ab, schon früh wurden darum die Auenwälder abgeholzt, bis sie etwas so Seltenes, ja geradezu Märchenhaftes wurden wie unter den Tieren das Einhorn und der Auerochse. Seltsamerweise träume ich hin und wieder von bewaldeten Flußauen, von denen ich doch, wenigstens an der Elbe, niemals etwas gesehen haben konnte. Es sind dies die intensivsten Träume. In ihnen regt sich der tiefe Eindruck, den die alten Lindenbäume am Ostra-Gehege hinterließen. So hoffnungslos trockengelegt und zersiedelt dieser Teil des Flußbogens auch war: Vieles deutete noch auf die Lichtung, an der die slawischen Gründerhorden, wandernde Wenden aus den Tiefen des Ostens, sich zuerst eingefunden hatten. Ostra hieß in ihrer Sprache »die Insel«, während das weiter flußaufwärts gelegene Droschdin soviel bedeutete wie »die Stadt am Wege«.
Wie groß aber war meine Verwunderung, als ich eines Tages in einem der Bildersäle der Zwinger-Galerie diesem Ziel unserer Spaziergänge als Romantikermotiv wiederbegegnete. Und es brauchte einige Zeit, bis ich in Friedrichs Gemälde der überfluteten, von kleinen Prielen durchzogenen Wiesen im Sonnenuntergang unser Gelände von damals wiedererkannte. Bei flüchtiger Betrachtung konnte man es für eine dieser chromatischen Träumereien halten, wie die Romantiker sie liebten, eine Übertreibung der Empfindung, so daß sie ein nahezu abstraktes Bild ergab. Die Landschaft glich einer gefleckten Kuhhaut, auf den Wiesen im Vordergrund ausgespannt, wie zum Zeichen einer unsichtbaren Schlachterei, die vielleicht hinter den Bäumen vor sich ging, reflektiert von den Abendstreifen am Himmel. Der Fluß hätte ebensogut ein Blutstrom sein können. Was hier Naturmotiv, was Schlachtengemälde war, ging auf eine verstörende Weise durcheinander. Große quecksilbrige Wasserlachen – unheimlich ihr Schillern in der kühlen Dämmerung – betonten das Amphibische des Geländes. Es war ein Akkord in den Farben Dunkelgrün, Silber, Violett und Orange, und wie so oft bei den Romantikern waren Himmel und Erde hier in ein böses Ungleichgewicht geraten. Ein einsames Segel war alles, was von der Nähe des Menschen zeugte. Allerdings betonte es wie zur Beruhigung den Kurvenverlauf, den der Fluß nahm, ein Fluß, dem man ansah, daß er die Ufer jederzeit überspringen konnte. Erst später dämmerte mir, daß dies die Elbe war, unterwegs zur unerreichbaren Nordsee. Lange Zeit hatte mich der Titel geblendet mit seiner bedeutungsschweren Symbolik. Das Große Gehege: Das schien mir auf ein landschaftliches Verhängnis anzuspielen, einen Fluch, der da über den Wassern hing und seinen Abglanz in dem unerreichbaren Himmel fand. Später fühlte ich mich, wann immer ich eine Reproduktion des Friedrich-Gemäldes sah, so heimisch wie beim Anblick einer zufälligen Wandertagsphotographie aus dem Familienalbum, und einmal kam es mir in den Sinn: Ja, dort bist du aufgewachsen. Dies war dein Heimatrevier.
War es nicht so, daß wir gewissermaßen eingepfercht lebten in dieses Stück Kulturlandschaft, das uns von Geburt an zugeteilt