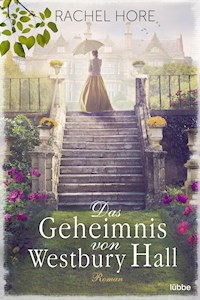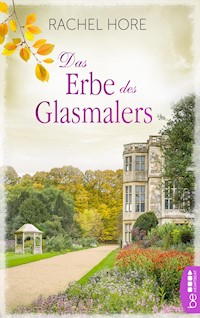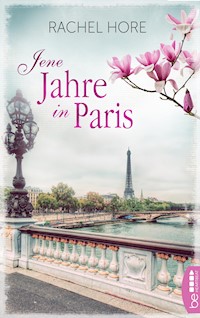5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die bewegenden Familienromane der britischen Erfolgsautorin
- Sprache: Deutsch
Von der Passion für Bücher und der Liebe zu den Sternen
Sich mit kostbaren Büchern zu beschäftigen ist für Jude mehr als ein Beruf - es ist Leidenschaft. Daher ist sie begeistert, als sie in Norfolk eine Sammlung astronomischer Gerätschaften und Bücher bewerten soll. Sie gehörte einst dem Astronomen Anthony Wickham. Durch sein Beobachtungsjournal öffnet sich für Jude eine neue Welt. Doch wer war die junge Esther, die Wickhams Aufzeichnungen fortführte, über die aber niemand etwas zu wissen scheint? Jude forscht nach - und stößt auf eine Geschichte, die auch ihre eigene Familie betrifft ...
"Die Karte des Himmels" ist eine bezaubernde Verbindung zweier Familiengeschichten - ein fesselnder Roman über Liebe und Freundschaft.
Weitere Romane von Rachel Hore bei beHEARTBEAT:
Das Haus der Träume.
Der Garten der Erinnerung.
Das Erbe des Glasmalers.
Jene Jahre in Paris.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitate
Prolog
TEIL I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
TEIL II
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
TEIL III
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Anmerkung der Autorin
Weitere Titel der Autorin
Das Erbe des Glasmalers (alter Titel: Der Zauber des Engels)
Das Haus der Träume
Der Garten der Erinnerung
Jene Jahre in Paris
Das Bienenmädchen
Wo das Glück zuhause ist
Das Geheimnis von Westbury Hall (November 2019)
Über dieses Buch
Von der Passion für Bücher und der Liebe zu den Sternen
Sich mit kostbaren Büchern zu beschäftigen ist für Jude mehr als ein Beruf – es ist Leidenschaft. Daher ist sie begeistert, als sie in Norfolk eine Sammlung astronomischer Gerätschaften und Bücher bewerten soll. Sie gehörte einst dem Astronomen Anthony Wickham. Durch sein Beobachtungsjournal öffnet sich für Jude eine neue Welt. Doch wer war die junge Esther, die Wickhams Aufzeichnungen fortführte, über die aber niemand etwas zu wissen scheint? Jude forscht nach – und stößt auf eine Geschichte, die auch ihre eigene Familie betrifft …
Über die Autorin
Rachel Hore, geboren in Epsom, Surrey, hat lange Zeit in der Londoner Verlagsbranche gearbeitet, zuletzt als Lektorin. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen in Norwich. Sie arbeitet als freiberufliche Lektorin und schreibt Rezensionen für den renommierten Guardian.
Mehr über die Autorin und ihre Bücher erfahren Sie unter www.rachelhore.co.uk.
RACHEL HORE
DIE KARTEDES HIMMELS
Familiengeheimnis-Roman
Aus dem britischen Englisch vonBarbara Ritterbach
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2010 by Rachel Hore
Titel der englischen Originalausgabe: »A Place of Secrets«
Originalverlag: Pocket Books UK, an imprint of Simon & Schuster UK Ltd
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: Scott A. Burns | Helen Hotson | Pozdeyev Vitaly | jakkapan
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-7721-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Jenny, meine Schwester
Sieh zu den Sternen! Sieh, sieh hinauf zum Himmel!O, sieh nur das feurige Volk in den Lüften!Die strahlenden Schlösser dort, den Kreis der Zitadellen!
Gerald Manley HopkinsThe Starlight Night
Wenn Sie frohen Sinnes sind und es zu bleiben wünschen, dann kümmern Sie sich besser nicht um die Astronomie. Unter allen Wissenschaften verdient allein sie den Ruf des Schrecklichen … Sind Sie jedoch unruhig und blicken ängstlich in die Zukunft, dann sollten Sie sich umgehend dem Studium der Astronomie widmen. Das wird Ihre Leiden erstaunlich mindern. Allerdings mindert es sie auf besondere Weise, nämlich indem es die Bedeutung aller Dinge mindert. Deshalb ist diese Wissenschaft immer noch schrecklich, selbst als Wundermittel … Es ist besser – weitaus besser – für den Menschen, das Universum zu vergessen, als es deutlich im Gedächtnis zu tragen.
Thomas HardyTwo on a Tower
In der Nacht, bevor alles anfängt, kehrt der Traum zurück.
Sie hat sich verirrt, stolpert durch einen dunklen Wald und ruft nach ihrer Mutter. Immer wacht sie mittendrin auf, sodass sie nie erfährt, ob sie sie am Ende wiederfindet. Alles fühlt sich sehr real an. Sie spürt die lehmige Erde unter ihren Füßen, hört die Zweige knacken, auf die sie tritt, und riecht die satten Düfte des Waldes, die nachts immer am stärksten sind, wenn die Bäume atmen. Es ist kühl. Dorniges Gestrüpp verfängt sich in ihrem Haar. Voller Panik und Verzweiflung versucht sie sich zu ihrem Bewusstsein durchzukämpfen und tastet nach dem Lichtschalter. Dann liegt sie da und wartet darauf, dass ihr Schluchzen aufhört und sich ihr rasendes Herz beruhigt.
Es ist der Albtraum, den sie als Kind hatte. Was ihn jetzt ausgelöst hat, kann sie nicht sagen. Seit sie Mark verloren hat, gab es viele schreckliche Nächte, aber nie hat dieser besondere Traum sie heimgesucht. Und jetzt, gerade als sie glaubt, dass sie ihr Leben wieder in den Griff bekommt, verhöhnt er ihre kläglichen Versuche und reißt sie in die Hilflosigkeit ihrer Kinderzeit zurück.
Einmal hat sie eine Schulfreundin, die sich für Träume interessierte, gefragt, was ihr Traum bedeuten könnte.
»Ein dichter Wald, sagst du? Hm.« Sophie zog ein Buch aus dem Regal und blätterte durch die Seiten, bis sie auf das stieß, was sie suchte. »›Geschäftliche Verluste, unglückliche Einflüsse im Haus und Familienstreitereien.‹ Klingelt da was bei dir?«, fragte sie und sah Jude hoffnungsvoll an.
»Klingt wie ein Zeitschriftenhoroskop«, sagte Jude. »So was passt doch irgendwie immer. Erstens hab ich heute in der Drogerie zu wenig Wechselgeld rausbekommen, und zweitens kriselt es in meiner Familie ständig. Wie in jeder anderen auch.«
»Obwohl deine Familie schon ziemlich merkwürdig ist«, meinte Sophie und klappte das Buch zu.
»Nicht merkwürdiger als deine«, gab Jude zurück.
Und doch – in den Wochen, nachdem ihr Traum zurückgekehrt ist, wird ihr mehr und mehr bewusst, dass Sophie nicht ganz unrecht hatte.
TEIL I
1. Kapitel
Juni 2008
Wie unscheinbar und zufällig die Ereignisse doch sind, die unser Schicksal bestimmen!
Am nächsten Morgen auf dem Weg ins Büro hatte Jude ihren Traum fast vergessen. Als sie an der Greenwich Station auf die Bahn wartete, heulte plötzlich ein kleines Kind los, und sofort kehrte die Verzweiflung schemenhaft zurück, aber in der Bond Street war auch das schon wieder von anderen, alltäglichen Sorgen überdeckt. Jude ahnte nicht, dass bald etwas Wichtiges passieren würde, etwas, das an der Oberfläche ziemlich bedeutungslos war.
Es war Freitag um die Mittagszeit in der Abteilung für Bücher und Manuskripte des Auktionshauses »Beecham’s« in Mayfair. Jude hatte den ganzen Vormittag am Bildschirm gesessen und seltene Erstausgaben von Dichtern aus dem achtzehnten Jahrhundert für einen bevorstehenden Verkauf katalogisiert. Das war eine mühsame Angelegenheit, denn es hieß, den Inhalt eines jeden schmalen Bändchens zu beschreiben, seinen Zustand und sämtliche Besonderheiten zu erfassen – eine handschriftliche Widmung zum Beispiel oder gekritzelte Randnotizen –, die das Interesse eines potenziellen Käufers wecken könnten. Ärgerlich, wenn dann jemand kam und sie in ihrer Konzentration störte.
»Jude.« Inigo, dessen Schreibtisch in dem offenen Büro neben ihrem stand, kam herüber, einen unordentlichen Stapel Papier, der mit selbstklebenden Notizzetteln in allen Farben geschmückt war, in den Händen. »Die Korrekturfahnen vom Septemberkatalog. Wo soll ich sie hinlegen?«
»Oh, danke«, murmelte sie, »gib her.« Sie ließ den Stapel auf den überquellenden Ablagekorb neben ihrem Computer fallen und fing an, den nächsten Satz zu tippen. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, den Inigo allerdings ignorierte.
»Ich denke wirklich, dass du dir die Bloomsbury-Seiten noch mal anschauen solltest«, sagte er in aufgeblasenem Ton. »Ich hab ein paar Punkte notiert, wenn du vielleicht …?«
»Inigo«, sagte sie und versuchte vergeblich, ihm auf höfliche Weise zu verstehen zu geben, dass er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern solle. Die Erstausgaben der Bloomsbury Group gehörten zu ihrem Verantwortungsbereich, und sie musste ihm weder darüber noch über irgendetwas anderes Bericht erstatten. Nur dass ihn das keineswegs daran hinderte, sich einzumischen. »Können wir uns heute Nachmittag darüber unterhalten? Ich muss das hier fertigmachen«, sagte sie.
Inigo nickte, ging wieder zu seinem Schreibtisch und zog sich an, um nach draußen zu gehen. Jude konnte nicht anders, als fasziniert zu beobachten, wie er seine Tweedjacke über die passende Weste gleiten ließ, den Füllfederhalter in die Brusttasche steckte, die Seidenkrawatte zurechtrückte und sich mit den Fingern das Haar glatt strich, das noch immer so blond war wie bei einem Schuljungen. Es war eine Art Ritual.
»Was Wichtiges vor, Inigo?«
Er quittierte ihre Frage mit einem zufriedenen Lächeln. »Ich bin mit Lord Madingsfield im Chez Gerard verabredet«, flüsterte er und tippte sich an den Nasenflügel, um anzudeuten, dass es sich um vertrauliche Geschäfte handelte.
»Schon wieder Lord Madingsfield?«, fragte sie überrascht. »Na dann, viel Spaß.« Jude wandte sich wieder ihrer Tastatur zu. Seit Monaten bereits kroch Inigo vor dem reichen Sammler auf den Knien herum. Insgeheim war Jude überzeugt, dass der gerissene alte Aristokrat ihn an der Nase herumführte.
»Wir befinden uns gerade in einer ziemlich heiklen Verhandlungsphase«, sagte Inigo und schürzte seine engelsgleichen Lippen, als wäre es unter seiner Würde, an Spaß auch nur zu denken.
Jude wechselte einen ironisch-beeindruckten Blick mit Suri, die ihr am selben Schreibtisch gegenübersaß und als Volontärin in der Katalogerstellung arbeitete. Suri sah rasch wieder auf ihre Arbeit hinunter, aber Jude konnte sehen, wie ihre Schultern vor unterdrücktem Lachen zitterten. Inigo nahm alles im Leben zu ernst, am meisten aber sich selbst. Er schloss die Schubladen seines Schreibtisches ab, griff nach seiner handgefertigten ledernen Aktentasche und machte sich auf den Weg. Die Freigabetaste an der Tür zur Eingangshalle betätigte er mit der üblichen umständlichen Geste. Durch das Glas beobachteten die Frauen, wie er mehrmals heftig auf den Fahrstuhlknopf drückte. Die elegante Erscheinung wirkte so zappelig wie ein Hund mit einem Floh. Erst als der Fahrstuhl ankam und ihn verschluckte, ließen die beiden Frauen ihrem Gelächter freien Lauf.
»Was er wohl sagen würde, wenn er sich in einem Video sehen könnte?«, brachte Suri zwischen ihrem Gekicher hervor. Sie stand auf, rückte die Spange in ihrem glänzenden schwarzen Haar zurecht und schwang sich die Handtasche über die Schulter.
»Der arme Kerl, bestimmt würde er sich verlieben«, sagte Jude, während sie tippte. »Lass es dir schmecken.«
»Soll ich dir was mitbringen?«, fragte Suri. »Ich komme bei ›Clooney’s‹ vorbei, falls du ein Sandwich willst.«
»Danke, ich komm schon klar«, erwiderte Jude und lächelte Suri an. »Ich bring den schlimmsten Teil von diesem Manuskript hinter mich, dann schlüpf ich vielleicht selbst noch raus.«
Als Suri weg war, trank Jude einen Schluck Mineralwasser aus der Flasche, die sie unter dem Schreibtisch versteckt hatte. Das Mittagessen musste ausfallen. Es gab zu viel zu tun. Außerdem war ihre neue Hose am Bund zu eng, und sie konnte nicht riskieren, dass die Knöpfe heute beim Abendessen absprangen.
Sie nahm einen muffigen Band vom ersten Stapel, untersuchte ihn schnell und legte ihn auf dem zweiten ab. Kalbslederband, schrieb sie, rebacked mit echten Bünden. Buchdeckel mit Blindprägung. Gutes, sauberes Exemplar eines bedeutenden zeitgenössischen Werkes.
In diesem Moment schlug die Hand des Schicksals zu.
Das Telefon auf Inigos Schreibtisch schrillte, und das Geräusch bohrte sich in ihre Konzentration, hartnäckig, wichtigtuerisch wie sein Besitzer. Sie starrte auf den Apparat, wollte ihn zum Schweigen bringen. Bestimmt rief eine zittrige liebenswürdige alte Dame an, die darauf hoffte, mit ihrer Agatha-Christie-Sammlung voller Eselsohren ein Vermögen zu machen. Oder ein rechthaberischer Antiquariatsbuchhändler, der eine Privataudienz verlangte. Reine Zeitverschwendung. Es klingelte acht Mal, wechselte dann auf Suris Apparat und klingelte wieder acht Mal, bevor der Anrufbeantworter ansprang. Jude riss den Hörer ihres eigenen Telefons hoch und drückte auf den Knopf.
»Bücher und Manuskripte, guten Tag.«
»Inigo Selbourne, bitte«, erwiderte eine vornehme männliche Stimme.
»Er ist leider gerade zu Tisch«, sagte Jude, und für den Fall, dass der Anrufer sie für Inigos Sekretärin hielt, was entmutigend oft passierte, fügte sie hinzu: »Ich bin Jude Gower, ebenfalls Taxatorin. Kann ich ihm etwas ausrichten?«
»Wenn Sie so freundlich wären. Mein Name ist Wickham. Ich rufe aus Starbrough Hall in Norfolk an.«
Jude verspürte ein leichtes Interesse. Norfolk war vertrautes Terrain. Aber wo um alles in der Welt lag Starbrough Hall? Sie hielt den Hörer dichter ans Ohr.
»Ich besitze eine Sammlung Bücher aus dem achtzehnten Jahrhundert und möchte, dass er einen Blick darauf wirft«, fuhr Mr. Wickham fort. »Ein Freund hat mir versichert, dass die Bücher wahrscheinlich von beachtlichem Wert sind.«
Jude schlug ein neues Blatt ihres Notizblocks auf und schrieb »Starbrough Hall« in sauberen Großbuchstaben oben auf die Seite. Dann starrte sie auf die Worte und versuchte zu verstehen, warum sie an ihrer Erinnerung zerrten. Sie glaubte nicht, dass sie jemals in Starbrough Hall gewesen war, doch aus irgendeinem Grund tauchte das Bild von Gran, ihrer Großmutter, vor ihrem geistigen Auge auf.
»Hat Inigo Ihre Rufnummer, Mr. Wickham?«
»Nein.« Die Vorwahl war ihr vertraut, als er die Nummer nannte. Genau dieselbe wie bei ihrer Schwester. Ja, das war es: Starbrough Hall gehörte zu dem großen Anwesen, auf dem Gran als Kind gelebt hatte. Jude notierte die Telefonnummer und kritzelte einen gezackten Stern rundherum.
Hätte sie es dabei belassen und die Nachricht an Inigo weitergeleitet, wäre die Sache für sie erledigt gewesen. Aber der Name Starbrough bedeutete ihr etwas, und ihre Neugier war geweckt. Andererseits konnte es ja auch sein, dass das Material, das der Anrufer verkaufen wollte, für »Beecham’s« nicht interessant war.
»Mr. Wickham«, hakte sie nach, »um welche Art Bücher handelt es sich denn? Es ist so, dass das achtzehnte Jahrhundert eigentlich zu meinem Spezialgebiet gehört.«
»Ach, wirklich?«, sagte Wickham. »Nun, dann sollte ich mich vielleicht lieber an Sie halten als an Mr. Selbourne.«
Sie öffnete den Mund, um zu sagen, dass Inigo sehr wohl in der Lage sei, die Sammlung zu beurteilen, merkte aber, dass sie das gar nicht sagen wollte. Es war ihr ein Rätsel. Robert Wickham hatte ausdrücklich nach Inigo gefragt. Sie jedenfalls würde vor Wut kochen, wenn Inigo ihr Arbeit wegnähme – und von Suri wusste sie, dass er das schon einmal getan hatte, obwohl Jude dem Kunden namentlich empfohlen worden war. Trotzdem wollte sie sich nicht auf sein Niveau herablassen. Es war wirklich lächerlich, dass sie beide immerzu versuchten, sich gegenseitig eins auszuwischen. Der Abteilungsleiter Klaus Vanderbilt redete dauernd davon, dass sie zusammenarbeiten sollten, um den anderen großen Auktionshäusern Aufträge abzujagen. Eigentlich hatte Jude eine Menge Respekt vor Inigos beruflichen Fähigkeiten, aber sie ärgerte sich darüber, dass er ständig die Ellbogentaktik einsetzte. Wenn er im Büro war, stand sie immer unter Spannung.
»Kennen Sie Inigo Selbourne?«, fragte sie Robert Wickham. »Ich meine, ist er Ihnen empfohlen worden?«
»Nein, den Namen habe ich gerade erst gehört. Ihre Zentrale hat mir den Mann vorgeschlagen.«
Das hieß, sie mischte sich gar nicht in Inigos Angelegenheiten ein.
»Nun, wenn das so ist«, erklärte sie Wickham und schämte sich ein bisschen, weil sie innerlich triumphierte, »dann nehme ich die Sache in die Hand, wenn es Ihnen recht ist.«
»Das würde mich freuen. Die Sammlung gehörte einem meiner Vorfahren, Anthony Wickham. Er war so etwas wie ein Freizeit-Sterngucker, und die meisten Bücher beziehen sich auf seine Liebhaberei. Ich möchte, dass Sie den Wert der Sammlung schätzen, und zwar im Hinblick auf einen möglichen Verkauf.«
»Er war ein Astronom? Das ist interessant.« Jude notierte sich die Einzelheiten. Nach naturwissenschaftlichen Werken, besonders aus dem achtzehnten Jahrhundert – dem Jahrhundert der Entdeckungen – herrschte im Moment eine lebhafte Nachfrage. Ihr fielen auf Anhieb zwei oder drei Händler ein, die vermutlich mehr erfahren wollten.
»Mir wurde gesagt, dass sich mehrere Erstausgaben darunter befinden. Und ich sollte die Manuskripte erwähnen«, fuhr Wickham fort, »seine Karten und Observationsberichte. Ich selbst werde aus dem Material nicht schlau. Meine Mutter kennt sich besser damit aus. Wie auch immer, ich nehme an, dass Sie in der Lage sind, sich sofort zu äußern, wenn Sie erst einmal hier sind.«
»Um wie viele Bücher geht es eigentlich? Ich darf vermutlich nicht davon ausgehen, dass Sie sie zu uns ins Büro bringen können?«, fragte Jude.
»Um Himmels willen, nein. Es sind ein paar hundert oder noch mehr. Und die Papiere, die sind ziemlich empfindlich. Hören Sie, wenn Sie unser Gespräch für Zeitverschwendung halten, kann ich immer noch bei ›Sotheby’s‹ anrufen. Das hatte ich ursprünglich ohnehin vor. Es war nur so, dass mein Freund mir geraten hat, es zuerst bei Ihnen zu versuchen.«
»Selbstverständlich komme ich zu Ihnen, seien Sie unbesorgt«, sagte Jude rasch. »Ich dachte nur, es wäre sinnvoll, danach zu fragen. Das ist alles.«
»Außerdem haben wir noch ein paar Instrumente, die Anthony Wickham gehört haben. Teile eines Teleskops. Und so ein Dings … eins von diesen Kugelmodellen des Sonnensystems.«
»Meinen Sie ein Orrery?«, fragte Jude, »eine Planetenmaschine?« Langsam klang die Sache danach, als wäre sie eine Reise wert. Mit der freien Hand schob sie Bücher und Papiere beiseite und suchte nach ihrem Schreibtischkalender.
»Ein Orrery, genau«, fuhr Robert Wickham fort. »Zeigt, wie die Planeten um die Sonne kreisen. Dann wären Sie also bereit, uns einen Besuch abzustatten?«
»Natürlich«, erwiderte sie und entdeckte ihren Kalender in ihrem Ablagekorb, unter dem Stapel von Korrekturfahnen, die Inigo hinterlassen hatte. »Wann würde es Ihnen denn passen?« Sie blätterte durch die Seiten. Konnte sie sich nächste Woche loseisen? Wenn Wickham damit drohte, die Sammlung noch anderen Auktionshäusern zu präsentieren, dann musste sie schneller sein als die Konkurrenz.
»In den nächsten Tagen bin ich unterwegs«, sagte er, »also geht es erst danach.« Sie kamen überein, dass Jude am Freitag in der folgenden Woche nach Starbrough Hall fahren sollte. »Sie kommen doch mit dem Wagen, oder? Ich schicke Ihnen die Wegbeschreibung per E-Mail, das wäre zu kompliziert am Telefon. Der nächste größere Ort ist Holt. Und Sie können über Nacht bleiben, wenn Sie wollen. Wir haben Platz genug, und meine Mutter und mich würde es freuen, wenn Sie unser Gast sind. Meine Frau ist dann mit den Kindern verreist, sodass Sie in Ruhe arbeiten können.«
»Das ist sehr freundlich. Aber es ist wahrscheinlich nicht notwendig, dass ich bei Ihnen übernachte«, sagte Jude. »Ich habe Verwandtschaft in der Gegend, wissen Sie.« Seit Ewigkeiten war sie nicht mehr zu Hause in Norfolk gewesen. Und jetzt bot sich eine großartige Gelegenheit. Vielleicht würde sogar Caspar mitkommen, ihr Freund.
Als sie aufgelegt hatten, lief Jude unruhig in der Abteilung hin und her. Sie war sich absolut sicher, dass die Sammlung in Starbrough Hall bedeutend war, obwohl sie nicht wusste, woher sie diese Überzeugung nahm. Aber es würde einen guten Eindruck machen, wenn es eine bedeutende Sammlung war und sie diese für »Beecham’s« sichern konnte. Und gerade jetzt kam es darauf an, einen guten Eindruck zu machen, weil Klaus Vanderbilt sich dem Ruhestand näherte und »Beecham’s« einen neuen Abteilungsleiter brauchen würde.
Wie so oft grübelte sie darüber nach, wie ihre eigenen Chancen auf eine Beförderung im Vergleich zu Inigos standen, als ihr Blick auf den Notizblock fiel und sie die Worte »Starbrough Hall« las.
Jude konnte sich den Ort immer noch nicht vorstellen. Sie ging zum Regal mit den Nachschlagewerken und zog einen voluminösen Band mit dem Titel Great Houses in East Anglia heraus, den sie auf Inigos Tisch legte. Als sie bis zum »S« geblättert hatte, entdeckte sie eine körnige Schwarz-Weiß-Fotografie. Starbrough Hall war ein würdiges, vielleicht ein bisschen kahl wirkendes Herrenhaus, erbaut im palladianischen Stil, mit kiesbedecktem Vorplatz und einer großen strukturlosen Rasenfläche vor dem Gebäude. Zwei Meilen von Starbrough Village entfernt, hieß es in der kurzen Erläuterung, 1720 erbaut von Edward Wickham Esq. auf den Ruinen des abgebrannten alten Gutshauses von Starbrough. Starbrough. Das lag ganz in der Nähe von Claire. Irgendwann war sie schon mal durch Starbrough Village gefahren. Sie erinnerte sich an die ungewöhnlich große Kirche, an die Grünfläche mit einem hübschen Ortsschild und einer Bank, die um eine gewaltige Eiche herumgezimmert war. Jude glaubte, dass Grans Vater als Jagdaufseher auf den Ländereien in Starbrough gewesen war, aber wo die Familie gewohnt hatte, wusste sie nicht.
Eine Weile saß sie grübelnd im leeren Büro, bis sie schließlich zum Telefon griff, um Gran anzurufen.
Die alte Dame hatte es sich angewöhnt, nachmittags zu dösen, besonders dann, wenn die Sonne über den Fußboden spielte und das Wohnzimmer mit Wärme und flackerndem Licht erfüllte. Wie immer am letzten Wochenende im Juni tummelten sich zahllose Feriengäste in dem Küstendorf Blakeney. Aber wenn Gran ihr Hörgerät abnahm, verebbten die Geräusche der Leute und der Autos mit Bootsanhängern vor dem Fenster, das auf den kleinen Hafen von Norfolk hinausging, zu einem sanften Gemurmel im Hintergrund. In ihrem schläfrigen Zustand kam es ihr vor, als tanzten Bilder der Vergangenheit über ihre Lider. Auch wenn sie inzwischen fast taub war – in ihrer Erinnerung sprudelten die Stimmen aus längst vergangenen Zeiten und lautes glückliches Gelächter frisch wie Quellwasser.
Sie stellte sich vor, wieder ein Kind zu sein, die kleine Jessie, die am Waldrand Verstecken spielte. Darin war sie gut gewesen, konnte in Windeseile einen Baum hochklettern und sich in der Krümmung eines Astes zusammenkauern, so schmal und reglos wie ein brauner Vogel, dass die anderen Kinder sie nie fanden. Einmal aber hatte sie sich zu weit vorgewagt, bis tief in den Wald hinein, noch an Starbrough Folly vorbei. Dabei hatte ihr Vater ihr verboten, in die Nähe des Turmes zu kommen, weil kleine Mädchen sich verlaufen konnten oder vielleicht noch etwas Schlimmeres passierte. Das war der Tag gewesen, an dem sie es zum ersten Mal gesehen hatte – das wilde Mädchen. Sie hatte es gespürt, bevor sie es sah. Ein prickelndes Gefühl sagte ihr, dass sie beobachtet wurde. Sie hielt erstarrt inne und lauschte, während ihr Geist aus den Schatten der großen Bäume und den Bewegungen der Blätter und Zweige über ihrem Kopf bedrohliche Gestalten formte. Und auf einmal blitzte es zwischen den am niedrigsten hängenden Zweigen einer ausladenden Eiche silbrig auf. »Ich kann dich sehen«, stieß Jessie atemlos hervor. Und einen Augenblick später rutschte das Waldgeschöpf aus seinem Versteck herunter. Es war ein Mädchen etwa in ihrem Alter, acht, und zuerst fühlte Jessie sich an ein Bild aus dem Schulbuch mit den Geschichten erinnert. In dem fadenscheinigen braunen Kittelkleid und den Blättern, die sich in seinem Haar verfangen hatten, sah das Kind aus wie eine märchenhafte Blumenelfe. »Hallo«, sagte Jessie, »warum beobachtest du mich?« Aber das Mädchen zuckte nur mit den Schultern. »Kannst du nicht sprechen? Warum kannst du nicht sprechen?«, wisperte Jessie. Das Kind legte die Finger auf die Lippen und sagte: »Pst! Das ist ein Geheimnis.« Dann riss es die Augen belustigt auf und winkte Jessie heran. »Wohin gehen wir?«, fragte Jessie, als das Mädchen noch tiefer in den Wald eintauchte. »Ich muss zurück. Ich darf nicht …« Die Elfe schüttelte den Kopf und duckte sich unter einem abgestorbenen Ast hinweg. Jessie folgte ihr und entdeckte ein paar kleine rosafarbene Blumen. »Eine Orchidee!«, rief sie. Sie hatte sie sofort erkannt, denn ihr Vater hatte einmal eine wilde Orchidee mit nach Hause gebracht, die er unterwegs gefunden hatte, als er die Fallen überprüfte. Die Elfe bückte sich, pflückte die Blume und reichte sie Jessie. »Wie schön!«, sagte Jessie, und die Mädchen lächelten einander verschwörerisch an …
Langsam kehrte Gran in den Wachzustand zurück, nahm entfernt das Klingeln wahr und fummelte auf dem Weg zum Telefon an ihrem Hörgerät herum.
»Judith!« Sie würde nicht zugeben, dass Jude ihr liebstes Enkelkind war, obwohl sie ihr gegenüber eine Nähe empfand, die sie bei Claire nie so recht gefühlt hatte, bei der lieben kleinen, widerspenstigen Claire.
»Gran, ich fahre nächsten Freitag nach Starbrough Hall. Kann ich am Donnerstagabend zu dir kommen?«, fragte Jude. »Ich würde dich gern ein bisschen über den Ort ausfragen.«
»Starbrough?« Jude konnte Jessies Überraschung an ihrer Stimme erkennen, aber die alte Lady erwiderte nur: »Es wäre wundervoll, dich zu sehen, Liebes. Kommst du zum Tee?«
Als sie den Hörer aufgelegt hatte, lehnte sich Jessie, überschwemmt von einer Flut von Erinnerungen, an die Anrichte. Starbrough Hall. In letzter Zeit hatte sie sehr oft an das wilde Mädchen gedacht. Eigentlich war ihr Geist nichts anderes mehr als eine alte Filmspule, die nach dem Zufallsprinzip Szenen aus der Vergangenheit darbot. Und nun würde ihre Enkeltochter dorthin gehen. Aus welchem Grund? Das hatte sie nicht gesagt. Starbrough … vielleicht bekam sie jetzt die Gelegenheit, alles wieder in Ordnung zu bringen.
Später am Nachmittag, nach mehreren ärgerlichen Stunden, in denen die Telefone fast nicht stillgestanden hatten, und einem kleinlichen Streit mit Inigo über die Erstausgaben von Bloomsbury beendete Jude ihre Arbeit an dem Katalog und flüchtete sich nach nebenan in den Lagerraum, um Bücher für die Auktion in Gruppen zu sortieren. Das hatte sie schon immer als beruhigend empfunden, als Aufgabe, in die sie eintauchen konnte und die ihr den Kopf freimachte. Als sie über die Sammlung von Starbrough Hall nachdachte, fiel ihr plötzlich ihre alte Freundin Cecelia ein. Sie hatten sich an der Universität kennengelernt; aber während Jude sich irgendwann ins echte Arbeitsleben gestürzt hatte, vergrub Cecelia sich immer noch in Universitätsbibliotheken und forschte über die naturwissenschaftliche Umwälzung im späten achtzehnten Jahrhundert. Als sie sich das letzte Mal auf einen Drink getroffen hatten, vor einem Jahr oder so, hatte Cecelia erwähnt, dass sie an einem Buch über die Astronomie in jener Zeit schrieb. Ja, Jude erinnerte sich genau und nahm sich vor, sich wieder bei ihrer Freundin zu melden.
Es schien nicht viel Zeit vergangen zu sein, als Suri den Kopf durch die Tür steckte. »Ich bin dann mal weg, Jude. Wir fahren direkt zu meinen Eltern nach Chichester. Ist bestimmt schrecklich viel Verkehr. Schönes Wochenende!«
»Verdammt, es ist ja schon fast sechs. Ich darf auch nicht mehr so lange bleiben!« Das Lager hatte keine Fenster, was verwirrend sein konnte.
»Heute Abend gehen wir mit ein paar Freunden von Caspar essen«, sagte sie, als sie mit Suri ins Hauptbüro zurückging. »Hab ich dir schon erzählt, dass wir in ein paar Wochen alle zusammen nach Frankreich in Urlaub fahren? Dabei habe ich seine Freunde erst zwei Mal gesehen. Ich bin verrückt, findest du nicht?«
»Eher mutig, wenn du die Leute nicht kennst«, erwiderte Suri, unschlüssig, ob Jude Zustimmung von ihr erwartete oder nicht. »Und was ist, wenn ihr euch nicht versteht?«
»Wir kommen bestimmt gut miteinander aus«, sagte Jude und versuchte, zuversichtlich zu klingen. »Sieht so aus, als könnte man mit den Leuten Spaß haben. Und mit genügend Wein lässt sich das Getriebe immer ölen.«
Als Suri gegangen war, räumte Jude ihren Schreibtisch auf, stellte die Bücher mit raschen, geübten Bewegungen ins Regal zurück und rückte die Papierstapel gerade. Sie konnte nicht entscheiden, ob ihr gefiel, was sie in Suris Blick gelesen hatte – eine Art Mitleid. Suri mit ihren sechsundzwanzig Jahren, die neuerdings mit einem jungen Mann verlobt war, den sie an der Uni kennengelernt hatte, betrachtete das Leben noch voller Unschuld. In ihrer Welt war alles wunderbar, voller Farbe und Hoffnung und Glück, und Jude liebte sie dafür. Selbst Inigo mit seinen herablassenden Äußerungen schaffte es nur selten, Wolken über Suris zauberhaft schimmernder Aura aufziehen zu lassen. So war ich auch mal, dachte Jude in einem Anflug von Selbstmitleid.
Um halb sieben drängte sie sich durch die Menschenmengen, die ziellos durch den Sommer schlenderten und die schmale Straße neben der Charing Cross Railway Station verstopften, die zur U-Bahn-Station Embankment hinunterführte.
Selbst wenn sie ihn nicht gekannt hätte, wäre ihr die Gestalt, die am Pfeiler lehnte und irgendetwas in ein Blackberry tippte, aufgefallen. Caspar war ein kräftig gebauter Mann in dunkelblauem Designeranzug und gestärktem weißem Hemd. Das dunkle, wellige Haar hatte er nach hinten gekämmt und eine Fingerspitze Gel hineingerieben. Er war fünf Jahre älter als Jude mit ihren vierunddreißig, attraktiv und quicklebendig. Vor ein paar Monaten hatte sie ihn bei einer Freundin kennengelernt, die sie zu einer Party eingeladen hatte. Mit ihren knapp einsfünfundsiebzig und der üppigen Figur passte sie äußerlich ganz ausgezeichnet zu ihm. Er fühlte sich von ihren sanften braunen Augen angezogen und von der rotblonden Haarwolke auf ihrem Kopf, die sie im Nacken mit einer Spange zusammengeklammert hatte. »Schön wie eine Madonna bist du. Du hast traurig ausgesehen«, hatte er geantwortet, als sie ihn spaßeshalber einmal gefragt hatte, warum er sich an jenem Abend zu ihr hingezogen gefühlt hatte, »aber dann hast du gelächelt. Es gibt so viele Leute, die nur mit den Lippen lächeln. Aber du hast mit den Augen gelächelt, so als ob es dir etwas bedeutet. Das hat mir gefallen.«
Ihr hingegen hatte es gefallen, wie mühelos er sich unter diesen schicken Großstädtern bewegen konnte, wie er es ganz offensichtlich genoss und mit Haut und Haaren in ihre Welt gehörte. Er war nie verheiratet gewesen, und nur wenige Freunde aus seinem weitverzweigten Netzwerk hatten sich irgendwo häuslich niedergelassen. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, hart an ihren Karrieren zu arbeiten, die sie liebten – Caspar und sein Freund Jack hatten eine Werbeagentur für Neue Medien –, und sie feierten auch viel. Im Großen und Ganzen hatten noch nicht einmal seine verheirateten Freunde Kinder. Sie lebten für den Moment, und Jude wusste, dass das ein weiterer Punkt war, der ihn für sie so anziehend machte. Sie sprachen nie über die Zukunft – sie hatte auch immer noch genug damit zu tun, mit der Gegenwart zurechtzukommen. Als er sie gefragt hatte, ob sie Lust hätte, mit ein paar Freunden in den Urlaub zu fahren, hatte sie erst gezögert, dann aber gedacht, warum nicht? »Es wird lustig«, hatte er gesagt, »bestimmt werden wir unseren Spaß haben.« Sie hatte allen Grund, ihm zu glauben, dennoch fühlte sie sich bei dem Gedanken daran immer noch nicht wohl.
Dauernd wurde sie von ihren Freunden – allen, die bei ihrer Hochzeit mit Mark vor sechs Jahren dabei gewesen waren – zu deren Hochzeiten eingeladen oder bekam Geburtsanzeigen ihrer Kinder. Sie selbst hatte nicht nur eine Nichte, die sechsjährige Summer, sondern auch schon ein Patenkind und nahm bald an der Taufe eines dritten Kindes teil, Milo. Vor ein paar Wochen hatte sie den kleinen Milo, gerade acht Monate alt und mit seinen großen Augen zum Anbeißen süß, mit seiner Mutter, einer ehemaligen Kollegin, in den Londoner Zoo begleitet. Die dreijährige Jennifer sah sie nur selten, denn deren Eltern – Sophie war in der Schule Judes beste Freundin gewesen – waren letztes Jahr in die Staaten gezogen. Aber die Fotos, die Sophie ihr per E-Mail schickte, zerrten unerträglich an ihrem Herz.
»Hi. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin«, sagte sie und legte die Hand kurz auf den Ärmel von Caspars maßgeschneidertem Anzug.
»Bist du nicht«, erwiderte Caspar und zog sie für einen seiner kurzen, aber gekonnten Küsse an sich. Seine dunklen Augen glänzten, der Blick flog anerkennend über sie. Jude war froh, dass sie sich den Hosenanzug gekauft und auf das Mittagessen verzichtet hatte, damit er auch passte. »Hübsche Ohrringe«, sagte er, als er den Schmuck erkannte. Sie berührte einen der eleganten silbernen Stecker, die er ihr an Ostern zum Geburtstag geschenkt hatte, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten. Sie war sicher, dass sie damals angedeutet hatte, normalerweise Gold zu tragen, aber die Ohrringe gefielen ihr trotzdem, weil er sie ausgesucht hatte.
»Luke und Marney erwarten uns erst um acht«, sagte er, »lass uns was trinken gehen.« In der Nähe fanden sie ein Weinlokal, wo Caspar wundersamerweise den letzten Tisch ergatterte. Nach den ersten Schlucken des sirupartigen Burgunders auf leeren Magen fühlte Jude sich schwindlig.
»Wie ist deine Präsentation gelaufen?«, fragte sie Caspar. Jack und er versuchten gerade, einen Werbeauftrag für junge Mode an Land zu ziehen.
»Gut!«, erwiderte er. Er hatte sein Glas schon geleert und schenkte sich das nächste ein. »Die Leute sind ganz verrückt nach diesem Videoclip. Wenn wir die richtigen Kids für das Shooting finden, könnte es ein voller Erfolg werden. Jack kontaktiert schon die Agenturen. Und was macht die staubige Welt der Totholz-Technologie?« Er spottete gern darüber, dass sie es in ihrem Job mit alten Büchern zu tun hatte, wo die Zukunft der modernen Medien sich doch online abspielte. Obwohl es ihn beeindruckte, welche Preise im Antiquariatsbuchhandel zu erzielen waren.
»Da ist etwas aufgetaucht, was ziemlich verführerisch klingt«, erzählte Jude. »Die Sammlung eines Astronomen aus dem achtzehnten Jahrhundert. Freitag fahre ich nach Norfolk. Wirklich komisch, das ist genau da, wo Gran aufgewachsen ist. Caspar, ich dachte, dass wir vielleicht …« Der Alkohol ermutigte sie zu fragen. »Am nächsten Wochenende haben wir doch noch nichts vor, oder? Wir beide zusammen, meine ich. Am Donnerstag bleibe ich bei Gran, und am Freitag arbeite ich. Das heißt also Freitag und Samstagabend. Am Sonntag muss ich zu Milos Taufe, aber das ist machbar. Du könntest hochfahren, und wir würden uns am Freitagabend in Norfolk treffen. Oder früher, wenn du magst. Und zur Taufe mitkommen. Ich bin mir sicher, dass Shirley und Martin dich gern kennenlernen würden.«
»Freitag ist der vierte, oder? Ich glaube, da ist Tates und Yasmins Einweihungsparty. Nein, die ist am Samstag.« Er tippte auf seinem Blackberry herum. »Da müssen wir nicht hin.«
»Wirklich? Wir könnten auch nur meine Schwester Claire besuchen und ihr kleines Mädchen. Du kennst sie doch noch gar nicht, und ich dachte … bei ihnen ist es zu eng für uns, aber im Dorf gibt es eine Frühstückspension. Oder wir könnten irgendwo an der Küste bleiben. Die Landschaft ist wunderschön. Wir könnten spazieren gehen …« Sie brach ab, als sie merkte, dass er gar nicht zuhörte.
Caspars Augen wurden schmal, als er auf sein Blackberry starrte. Das blaue Licht des Displays flackerte unheimlich über sein Gesicht. Er sah angespannt und besorgt aus.
»Ah!«, sagte er, plötzlich erfreut über etwas, was er gefunden hatte. »Tut mir wirklich leid, Jude, aber ich muss Sonntag nach Paris. Wegen einer Präsentation am Montag. Jack und ich brauchen den Samstag zur Vorbereitung.«
»Oh, das ist aber schade. Du hast meine Familie noch nicht kennengelernt. Vor allem dachte ich, dass du Claire wahrscheinlich mögen wirst.«
»Ist das die … die Behinderte?«
»Sie hinkt ganz leicht, mehr nicht.« Jude würde ihre Schwester nie als behindert bezeichnen. Hübsch und kratzbürstig, offen und direkt, eine scharfsinnige Geschäftsfrau, ja, aber niemals behindert. Ein Bein war von Geburt an ein kleines Stück kürzer als das andere, was zu einer Kindheit mit ständigen Operationen und Krankenhausaufenthalten geführt hatte. »Ihre kleine Tochter heißt Summer. Ich habe sie bestimmt schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen.«
»Ich dachte, ihr hättet euch letzte Woche alle am Flughafen getroffen.« Jude und Claire hatten ihre Mutter nach Spanien verabschiedet, wo ihr neuer Mann Douglas eine Villa in den Bergen hinter Malaga einrichtete.
»Der Flughafen in Stansted ist wohl kaum ein Ort, wo man entspannt plaudern kann.«
»Nun, ich werde Claire und Summer … süßer Name … wohl ein anderes Mal kennenlernen müssen.«
Inzwischen sah er sogar so aus, als würde er es aufrichtig bedauern. Aber Jude war trotzdem enttäuscht. Denn es war nicht das erste Mal, dass er die Gelegenheit ausgeschlagen hatte, ihre Familie kennenzulernen, was nicht spurlos an ihr vorüberging. Wenn sie es genau bedachte, kannte sie auch noch niemanden aus seiner Verwandtschaft. Er war das einzige Kind polnischer Eltern, die in Sheffield lebten, so viel hatte er ihr erzählt. In all der Zeit, die sie ihn nun schon kannte, war er nie nach Hause gefahren, um seine Eltern zu besuchen. Und falls sie irgendwann in London gewesen sein sollten, hatte er es ihr verschwiegen. Bisher war ihr das nicht merkwürdig vorgekommen. Jetzt aber schon.
Einer der kleinen Ohrstecker tat weh. Sie tastete mit den Fingern nach dem Verschluss und lockerte ihn vorsichtig. Er fiel heraus. In letzter Sekunde fing sie die Teile auf.
2. Kapitel
Jude freute sich immer, nach Hause zu kommen in das weiße Reihenhaus in Greenwich, in dem sie wohnte. Mit dem Ellbogen stieß sie die Tür hinter sich zu und ließ die Tüten aus dem Supermarkt auf den Küchentisch fallen. Die vergangene Nacht war sie bei Caspar in Islington geblieben. Am Morgen hatte er – obwohl Samstag war – ein paar Dinge im Büro zu erledigen, und so war sie mit ihm zusammen per U-Bahn in die Stadt gefahren, wo sich ihre Wege am King’s Cross getrennt hatten. Sie hatten kaum miteinander geredet. Caspar sah ziemlich angeschlagen aus, weil er am Abend zuvor viel zu viel getrunken und die Dinnerparty bis in die frühen Morgenstunden gedauert hatte. Wenn Jude ehrlich war, hatte ihr der Abend noch weniger gefallen, als sie befürchtet hatte. Außer ihr und Caspar waren sechs andere Leute da gewesen, alle freundlich und amüsant, wenn man einzeln mit ihnen ins Gespräch kam, aber auf einem Haufen hatten sie sich als langweilig und öde erwiesen. Beim Abendessen hatten sie über Restaurants geredet, wo Jude noch nie gewesen war, über Designer, für die sie sich nicht interessierte, über alte Freunde von der Universität, die sie nicht kannte. Schweigend hatte sie in ihrem Essen herumgestochert. Sie hatte sich ausgeschlossen gefühlt und innerlich gewehrt. Allein der Gedanke, mit diesen Leuten zwei Wochen in der Dordogne zu verbringen, war deprimierend! Als Jude sich in einer Gesprächspause nach Sehenswürdigkeiten in der Nähe von Brantôme erkundigte, hatte ihre Gastgeberin, die coole Marney, die Nase krausgezogen und gesagt, dass sie die Tage eigentlich immer am Pool der Villa verbringen und nur abends irgendwohin zum Dinner gehen würden. »Normalerweise ist es da sowieso zu heiß, um rumzulaufen«, sagte sie gedehnt.
»Mal ehrlich«, mischte sich die mollige, alberne Paula ein, »hast du eins von diesen châteaux gesehen, kennst du doch alle diese blöden alten Kästen.« Alle lachten, und Jude zwang sich zu einem höflichen Lächeln.
Jude, deren blasse englische Haut in der Sonne knallrot wurde, hasste es, an Pools herumzuliegen. Der ideale Urlaub hieß für sie, in beschaulichen Städtchen und Dörfern herumzuspazieren und etwas über ihre Geschichte zu erfahren, die oft erstaunlich bewegt und stürmisch gewesen war. Es sah so aus, als müsste sie diesmal allein auf Entdeckungstour gehen, denn nach dem Gespräch in dem Weinlokal konnte sie sich nicht vorstellen, dass Caspar Lust hatte, herumzustreifen und die Gegend zu erkunden.
Nun war sie glücklich wieder zu Hause, schleuderte ihre Schuhe in die Ecke und ging in die Küche, um Wasser aufzusetzen. Entspannt genoss sie ihre eigene Gesellschaft – in diesem hübschen Haus fühlte sie sich nie vollkommen allein. Es war das Zuhause, das Mark und sie bei ihrer Verlobung gemeinsam für sich ausgesucht und in dem sie während der kurzen drei Jahre ihrer Ehe gewohnt hatten. Sie spürte ihn immer noch sehr stark, so als ob er jeden Moment durch die Tür spazieren könnte. In den letzten Jahren hatten verschiedene Leute – ihre Mutter, ihre Schwester, Marks Schwester und Sophie – sich allmählich Sorgen darüber gemacht. Sie hatten ihr vorgeschlagen, das Haus zu verkaufen, und damit stillschweigend angedeutet, dass es nicht gesund sei, sich mit all diesen Erinnerungsstücken zu umgeben. Aber davon abgesehen, dass Jude ihnen erlaubte, Marks Kleidung auszusortieren, hatte sie nichts unternommen. Es gab ihr Sicherheit, mitten in seinen Sachen zu leben; es war ein Teil ihrer Überlebenstechnik. An den weiß gestrichenen Wänden des Wohnzimmers hingen immer noch seine atemberaubend schönen Fotos. Entstanden waren sie bei Kletterexpeditionen in die patagonische Wildnis, zum Kilimandscharo und in die Cairngorms, Reisen, die er dank seines Lehrerberufes in den großen Ferien unternehmen konnte. Einige der modernen Möbel wie das schmiedeeiserne Bett und das hell gemusterte Sofa hatten sie gemeinsam ausgesucht, aber der ovale viktorianische Spiegel und die Fliesen von William de Morgan vor dem Kamin waren Judes Wahl. Mark mochte das Neue, Jude das Alte. Sie hatten sich einen Spaß daraus gemacht. Immer wenn sie irgendwo hingefahren waren, nach Norfolk zum Beispiel oder auf einen Tagesausflug an die Südküste, hatte Jude gesagt: »Ich schau hier nur mal kurz rein«, und war in irgendeinem geheimnisvollen Laden verschwunden, der voller faszinierender Schätze steckte. Mark blieb es überlassen, sich die modernen Spielereien im Camping Shop oder bei Chandler’s anzusehen. Über manche ihrer Kuriositäten hatte er gelacht, besonders über das kleine Trio indischer Elefanten, deren Knopfaugen sie vom Fenster eines Trödelladens aus angefleht hatten.
Jude trank ihren Kaffee, ging langsam im Wohnzimmer herum und blieb stehen, um den kleinen antiken Globus auf der Anrichte zu drehen. Sie nahm einen Ebenholzelefanten in die Hand und genoss die Wärme des Holzes auf ihrer Haut. »Elefanten sollten immer zur Tür schauen, sonst bringt es Unglück«, hatte sie Mark erklärt.
»Warum zur Tür?«, hatte er gefragt und die Arme verschränkt, was immer ein Zeichen dafür war, dass er jetzt den skeptischen Wissenschaftler gab. Das war ein weiterer Unterschied zwischen ihnen gewesen. Sie liebte alte Legenden und den Aberglauben; er war daran interessiert, solche Geschichten zu entzaubern. Aber beide hatten es genossen, lebhaft darüber zu diskutieren.
»Das hat Dad immer gesagt. Vielleicht weil sie schnell ins Freie gelangen wollen, falls ein Feuer ausbricht oder so.«
»So was Verrücktes habe ich noch nie gehört«, hatte Mark sie geneckt, und beide hatten gelacht.
Sie waren in sehr vieler Hinsicht grundverschieden voneinander gewesen. Aber das Schicksal hatte sie füreinander bestimmt. Jude hatte das immer gespürt. Schon als sie sich das erste Mal begegnet waren. Warum nur war sie so um das Glück betrogen worden?
Jude staubte den kleinen Elefanten ab und stellte ihn sorgfältig an seinen Platz zurück.
Bei dem Gedanken, dass der ganze Samstag leer vor ihr lag, überkam sie ein wunderbares Gefühl. Während sie ihre Einkäufe auspackte, überlegte sie, was sie mit ihrer Zeit anstellen sollte. Vielleicht den Hügel zum Royal Observatory hinaufsteigen, um sich ein bisschen in die Stimmung für Astronomie zu bringen?
Als sie die Milch in den Kühlschrank stellen wollte, fiel ihr Blick auf ein Foto ihrer Nichte, das an der Tür befestigt war. Summer. Der Name passte zu dem schönen honigfarbenen Haar des Kindes und seinen blauen Augen, zu seiner versponnenen Leichtigkeit. Kaum zu glauben, dass Summer im August schon sieben Jahre alt wurde. Es wäre wunderbar, wenn sie sie am nächsten Wochenende sehen könnte. Jude schnappte sich das Telefon und drückte die Kurzwahl von Claires Arbeitsplatz.
»›Star Bureau‹«, meldete sich ihre Schwester mit forscher Stimme. Zusammen mit einer Freundin führte Claire einen kleinen Laden in Holt, einem Marktflecken in Norfolk. Sie verkauften allerlei Geschenke, die mit Sternen und Astrologie zu tun hatten. Als hübschen Nebenerwerb boten sie einen Service an, der es den Leuten möglich machte, einem Stern einen Namen zu geben, zum Beispiel den eines geliebten Menschen. Für einen bescheidenen Betrag erhielten sie eine Urkunde, auf der der Ort und die amtliche Seriennummer des Sterns angegeben waren. Dazu gab es ein gerahmtes Gedicht, das Claire selbst verfasst und »Stardust« genannt hatte, Sternenstaub. Jude fand, dass das Versmaß in der dritten Zeile etwas holprig war, wusste aber, dass ihre Meinung hier wie bei vielen anderen Dingen nicht willkommen war.
»Ich bin’s, Jude. Steckst du gerade mitten in der Arbeit?«
»Oh, du bist es! Warte mal kurz … Linda, das nehme ich mit ins Büro … es ist meine Schwester«, hörte Jude, als Claire mit ihrer Geschäftspartnerin sprach, und dann: »Ich sollte mich lieber beeilen, Jude. Der ganze Ort ist voller Touristen. Komm schon, Katze, beweg dich.« Jude stellte sich die gertenschlanke Claire vor, ihr elfenhaftes Gesicht, wie sie Pandora fortscheute, die schwarz-weiße Katze, die sie manchmal zur Arbeit mitnahm. »Ich wollte dich auch gerade anrufen, Jude. Hast du Lust, uns zu besuchen und ein paar Tage zu bleiben? Summer hat nach dir gefragt.« Summer, nicht Claire, bemerkte Jude, schob den Gedanken aber als kleinlich beiseite.
»Ehrlich gesagt hatte ich vor, am nächsten Wochenende zu kommen. Bist du dann zu Hause?«
»Lass mich mal sehen. Am Samstag bin ich mit Piers in Dubai und am Sonntag mit Rupert auf den Salomon-Inseln. Ach, sei nicht albern, natürlich bin ich zu Hause. Wann fahre ich schon mal irgendwohin? Ich kann mir das auch gar nicht leisten.«
Jude nahm die altbekannte Schärfe in der Stimme ihrer Schwester wahr, und ihr Lachen klang auch nicht besonders überzeugend. Das »Star Bureau« musste sich mächtig anstrengen, um einen bescheidenen Gewinn zu erwirtschaften, und mit einem nicht unerheblichen Teil dieser Einkünfte zahlte Claire die Hypothek ihres kleinen Hauses ab. Claire hatte zwar nie offen gezeigt, dass sie auf die finanzielle Sicherheit ihrer Schwester eifersüchtig war, aber nach diesem unübersehbaren Wink mit dem Zaunpfahl bekam Jude trotzdem wieder ein schlechtes Gewissen. Was immer dazu führte, dass sie Claire ab und zu einen Scheck anwies. Um den Stolz ihrer Schwester nicht zu verletzen, erklärte sie, Claire solle davon etwas für Summer kaufen.
»Also könnte ich mich dann am Freitag und Samstag bei dir einmieten? Sonntag muss ich früh wieder los.«
»Klar, es wäre toll, dich zu sehen. Wenn du nichts dagegen hast, dir mit Summer das Zimmer zu teilen.«
»Ich genieße es, in Summers Zimmer zu schlafen. Sie schnarcht nicht so wie du. Übrigens, wie geht es meiner lieben Nichte?«
»Es geht ihr gut.« Jude bemerkte die leichte Unsicherheit in der Stimme ihrer Schwester. »Letzte Woche hat sie beim Lesen einen Zauberstern gewonnen.«
»Einen Zauberstern?«
»Den bekommt man, wenn man vorher schon fünfundzwanzig normale Sterne geholt hat.«
»Die wunderbare Summer.«
»Und sonst, ach, ich mach mir ein bisschen Sorgen um sie.«
»Oh nein, warum denn?«
»Sie schläft schlecht. Hat nach wie vor Albträume. Vielleicht ist es doch nicht so gut, wenn du mit ihr in einem Zimmer schläfst. Denk mal drüber nach.«
»Was sind denn das für Träume?«
»Weiß ich auch nicht so genau. Sie erzählt mir immer nur, ›Mummy, ich konnte dich gar nicht sehen.‹ Das ist alles.«
Erinnerungen aus Judes Kindheit blitzten auf. Wo bist du, Maman? Ich kann dich nicht sehen. Aufwachen in einem kleinen Schlafzimmer in London, das Licht der Straßenlaterne scheint durch blasse Gardinen, und drinnen fliegt ein Insekt brummend gegen die Scheibe.
Jude zwang ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Gespräch. »… der Arzt wusste auch nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun soll.«
»Bitte entschuldige, was hat der Arzt gesagt?«
»Nichts«, sagte Claire gereizt. »Soweit er es beurteilen kann, ist alles in Ordnung.«
»Du machst dir wirklich Sorgen, stimmt’s?«
»Würdest du das nicht auch tun?«
»Hm, ja, natürlich.« Jude war Claires scharfen Tonfall gewohnt. Kein Grund, beleidigt zu sein. Claire erzog Summer allein, und manchmal merkte man ihr eben an, wie anstrengend das war.
»Ist sie denn sonst so wie immer? Nicht krank oder schmachtend vor Sehnsucht oder so?«
»Nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Eigentlich scheint sie sogar sehr glücklich zu sein.«
»Dann hat sie vielleicht Stress in der Schule«, sagte Jude, obwohl sie sich mit solchen Dingen überhaupt nicht auskannte. Aber Claire schien den Gedanken gut zu finden.
»Kann sein, dass du recht hast«, sagte sie. »Sie schreiben ständig Tests und haben furchtbar viele Hausaufgaben auf. Außerdem ist sie in ihrem Jahrgang die Jüngste.«
»Sie stehen wirklich sehr unter Druck«, fügte Jude hinzu. »Ich habe gerade einen Artikel über das schwedische System gelesen. Da kommen sie erst in die Schule, wenn …«
»Jude, hast du was von Mum gehört?«
»Nicht, seit sie letzte Woche angerufen und uns mitgeteilt hat, dass sie sicher in Malaga gelandet ist. Und du?«
»Nein«, sagte Claire verbittert, »aber sie würde ja auch nie meine Nummer wählen. Ich muss sie immer anrufen.«
»Sei nicht albern«, sagte Jude resigniert. Innerhalb der Familie war es schon immer ihre Aufgabe gewesen, Claire zu versichern, dass sie geliebt wurde.
»Aber es stimmt doch! Ich sollte jetzt lieber Schluss machen, an der Kasse stehen die Kunden Schlange.«
»Halt, ganz schnell noch, was glaubst du, wie es Gran geht? Ich bleibe Donnerstagabend bei ihr.«
»Oh, da wird sie sich freuen.« Claires Stimme klang weicher. »Es geht ihr ganz gut, obwohl sie ein bisschen gebrechlich ist. Am Samstag sind Summer und ich mit ihr nach Sheringham gefahren, um Schuhe zu kaufen. Es war eine ziemliche Tortur, weil es im Laden nicht das gab, was sie normalerweise trägt, aber schließlich haben wir doch noch ein Paar gefunden. Aber sag mal, was hast du mitten in der Woche eigentlich hier zu tun?«
»Ich weiß, es ist bloß ein schöner Zufall, aber ich fahre nach Starbrough Hall, um ein paar Bücher zu schätzen.«
»Nach Starbrough Hall? Wirklich? Darüber kann dir Gran ja jede Menge erzählen. Aber jetzt muss ich wirklich aufhören.«
Als Jude auflegte, war sie tief beunruhigt. Irgendetwas war aus dem Lot geraten. Zum Teil waren es die üblichen Spannungen in der Familie. Claire irrte sich, wenn sie annahm, dass ihre Mutter sie nicht gern hatte, sie irrte sich sogar sehr. Mum liebte ihre ältere Tochter genau so, wie sie Jude liebte. Jude hingegen hatte nie an der Liebe ihrer Eltern gezweifelt. Sie hatte einfach gewusst, dass diese Liebe existierte, und sie angenommen.
Ich glaube, dass Mum mich öfter anruft, weil sie mir vertraut, dachte Jude, während sie die Wäsche in die Maschine stopfte. Obwohl sie Douglas hat, vermisst sie Dad sehr, und ich bin ein bisschen wie Dad. Bodenständig und zuverlässig … o Gott, das klingt stinklangweilig. Mums Beziehung zu Claire ist viel komplizierter. Wenn die beiden aufeinandertreffen, sprühen die Funken. Aber das heißt nicht, dass Mum Claire nicht liebt … und, meine Güte, wie sie in die kleine Summer vernarrt ist!
Und um Summer musste man sich Sorgen machen. Jude konnte es noch nicht ganz glauben, aber sie hatte den Verdacht, dass ihre Nichte den gleichen schrecklichen Traum hatte wie sie als Kind.
3. Kapitel
»Gran! Gran!« Jemand klopfte. Jessie schlug die Augen auf, war ein paar Sekunden lang verwirrt. Am Fenster zeigte sich ein Gesicht. Nicht das wilde Mädchen. Die kleine Judith. Jude, ihre Enkelin. Sie hatte nicht mit ihr gerechnet. »Doch, Jessie, das hast du, du dummes altes Ding«, murmelte sie und stemmte sich aus dem Sessel hoch. Jude hatte angerufen und gesagt, dass sie donnerstags kommen und über Nacht bleiben wolle. Es war Donnerstag, und Mr. Lewis hatte ihr ein schönes Stück Fisch vorbeigebracht.
»Hallo, tut mir leid, dass ich dich geweckt habe«, sagte Jude, als ihre Großmutter die Tür öffnete. Einen Augenblick lang war sie besorgt gewesen, als sie durch das Fenster des Steinhäuschens gespäht und Gran zusammengesunken im Sessel erblickt hatte. Der Mund in ihrem faltigen Gesicht stand weit offen, ihr dünnes Haar hing nach allen Seiten herunter. Jude war dankbar, als die alte Dame sich auf ihr Klopfen hin endlich rührte.
Drinnen stellte sie ihre Taschen ab und drückte ihrer Großmutter einen Kuss auf die vertrocknete Wange. Einen Moment lang stand Jessie verlegen da und schaute ihre Enkelin entzückt und verwundert zugleich von oben bis unten an.
»Du siehst wirklich toll aus, Liebes. Sehr elegant.«
»Danke«, sagte Jude, die immer noch in dem schicken Leinenrock und dem Jackett steckte, das sie zu einem Geschäftsessen getragen hatte.
Sie folgte ihrer Großmutter in die Küche und stellte mit Bestürzung fest, wie krumm der Rücken der alten Frau geworden war. Jessie war inzwischen fünfundachtzig. Das letzte Mal hatte Jude sie an ihrem Geburtstag im Mai gesehen, als die Frauen aus vier Generationen – Gran, Judes Mutter Valerie, Jude, Claire und die kleine Summer – sich alle bei Sandwiches und einem schiefen Geburtstagskuchen ins Wohnzimmer gezwängt hatten. Summer hatte beim Kuchenbacken geholfen und das Ergebnis selbst mit Geleebonbons verziert. Später hatte Jessie es fertiggebracht, an Judes Arm am Hafen entlangzuhumpeln. Und jetzt, als sie zuschaute, wie ihre Großmutter sich an die Arbeitsplatte lehnte und sich mit der schäbigen Teedose abmühte, fragte sie sich, wie viel Zeit der alten Frau wohl noch blieb. Gran war zwar in der Lage, das Haus ohne Hilfe zu verlassen, aber würde sie bis zum Dorfladen kommen oder bis zur Arztpraxis? In Judes Kopf wirbelte alles durcheinander. Vielleicht sollten sie eine passendere Wohnung für Gran suchen. Gran würde sich allerdings heftig gegen einen Umzug sträuben.
»Lass mich dir doch helfen, Gran.«
Nach Jessies Anweisung goss sie kochendes Wasser in die vertraute metallene Teekanne, holte das Porzellanservice aus dem Schrank, das noch von ihrer Urgroßmutter stammte, und trug das Tablett ins Wohnzimmer. Jude liebte es, diesem kleinen Cottage am Meer einen Besuch abzustatten, das ihre Großeltern nach der Pensionierung ihres Großvaters bezogen hatten. Sie erinnerte sich daran, wie sie als Heranwachsende herkam, als ihr Vater herzkrank geworden war und nicht mehr Vollzeit arbeiten konnte. Damals waren sie alle von London nach Norwich gezogen.
Mit einem leichten Stöhnen ließ Jessie sich in den Polstersessel sinken. »Manchmal kann ich gar nicht mehr richtig durchatmen«, erklärte sie, als sie die Sorge in Judes Gesicht bemerkte. »Aber wenigstens ist mir heute nicht so schwindlig.«
»Schwindlig? Das klingt nicht gut.«
»Dr. Gable sagt, es liegt an diesen Viren. Gib mir das Kissen, bitte. Er hat mir ein paar Pillen verschrieben, aber die nehm ich nicht.«
»Oh, Gran«, schimpfte Jude, während sie ihrer Großmutter half, es sich bequem zu machen.
»Ich fühle mich dann immer so komisch. Rohes Ei mit einem Schuss Brandy drin – das wär ein richtig gutes Stärkungsmittel. Mach dir keine Sorgen, Jude, ich bin einfach nur eine verknöcherte alte Schachtel, und dagegen ist kein Kraut gewachsen. Aber jetzt erzähl, wie es dir ergangen ist. Ist doch viel interessanter. Willst du dir nicht eins von den fondant fancies nehmen? Ich weiß doch, wie gern du die isst.«
»Danke«, sagte Jude und beobachtete ängstlich, wie Gran mit der Teekanne hantierte. Sie nippte an ihrem Tee und streifte brav das Papier von einem der knallbunten Törtchen, die sie in jungen Jahren geliebt hatte, aber als Erwachsene nur noch schrecklich süß fand. »Tut mir leid, dass ich nicht so oft herkommen kann. Ich habe furchtbar viel Arbeit, und die Wochenenden vergehen auch immer wie im Flug. Mit Freunden und so weiter«, schloss sie mit schlechtem Gewissen.
»Mit jemand Besonderem?« Jessie schaute sie gespannt über den Rand ihrer Teetasse an.
Jude zögerte und lächelte dann. »Ja, es ist ein Mann im Spiel, falls du danach fragst, Gran. Nichts Ernstes, also mach dir keine Hoffnungen. Ich weiß doch, wie ihr seid, du und Mum.«
»Oh, kümmere dich nicht um uns. Macht er dich glücklich, Liebes?«
»Ich genieße seine Gesellschaft.«
»Das ist nicht dasselbe«, sagte Jessie ernst. »Ich mache mir Sorgen um dich, Jude.«
»Das weiß ich, Gran. Aber das solltest du nicht. Über das Schlimmste bin ich inzwischen hinweg.«
Gran musterte sie nachdenklich. »Solche Dinge vergisst man nicht so leicht. Und doch müssen wir sie hinter uns lassen und das Beste aus unserem Leben machen. Das habe ich auch lernen müssen, auf sehr schmerzhafte Weise.«
Judes Großmutter schien in weite Ferne zu blicken, so als ob irgendetwas außerhalb der Mauern des Zimmers ihre Aufmerksamkeit auf sich zog.
»Gran?«
»Bitte entschuldige, meine Liebe. Ich war mit den Gedanken woanders.«
»In der Vergangenheit?«
»Ja. Weit, weit in der Vergangenheit. Als ich noch klein war. Wahrscheinlich kannst du dir gar nicht vorstellen, dass deine alte Gran auch mal klein war, wenn du sie so anschaust, stimmt’s?«
Jude beobachtete, wie ein verschmitztes Lächeln das faltige Gesicht ihrer Großmutter verwandelte. »Doch, natürlich«, sagte sie liebevoll.
Gran sah glücklich aus.
»War es traurig oder schön, woran du gedacht hast?«, hakte Jude nach.
»Es war beides. Nun, wenn du schon fragst, ich habe an jemanden gedacht, den ich früher kannte. Oh, das ist alles schon lange her, sehr lange. Nimm noch einen von den kleinen Kuchen, Liebes. Ich esse die nicht.«
»Später vielleicht, Gran. Aber sag doch, an wen hast du gedacht?« Ihre Großmutter sprach nur selten über ihre Kindheit, und so genoss Jude es umso mehr.
»Du kennst sie doch nicht, Jude. Es würde dir nichts bedeuten.«
»Doch, und das weißt du auch. Gran, du bist gemein, du weißt doch genau, dass es mich fesselt, zu hören, wie es war, als du aufgewachsen bist. War es, als du in Starbrough gelebt hast?«
»Ja, zu der Zeit. Einmal, als ich sieben oder acht Jahre alt war, bin ich in einem Wald einem Mädchen begegnet. In der Nähe von dem Cottage, wo ich gewohnt habe. Wir sind Freundinnen geworden.«
»Erzähl mir davon«, bettelte Jude.
»Wenn du noch einen von diesen kleinen Kuchen isst«, versprach ihre Großmutter. Ohne Widerspruch nahm Jude ein fondant fancy und biss hinein.
»Damals ahnte ich es noch nicht, aber das Mädchen gehörte zu diesem fahrenden Volk. Es war eine echte Roma. Deshalb habe ich sie manchmal über Wochen und Monate gesehen, dann aber lange Zeit gar nicht. Manchmal ein ganzes Jahr nicht mehr. Sie hieß Tamsin.«
Gran hielt inne, um Luft zu holen, und Jude fragte zwischen zwei Bissen: »Was ist aus ihr geworden?«
»Das wollte ich dir gerade erzählen. Eines Tages, als ich neun oder zehn war, tauchte sie in der Schule auf. Du musst wissen, dass ich in Starbrough Village zur Schule gegangen bin. Wir haben alle in unseren Bänken gesessen und gerechnet oder was auch immer, und mich hat fast der Schlag getroffen, als die Tür aufging und der Direktor sie reinbrachte. Sagte, sie wäre die neue Schülerin, und, also, das war wie ein rotes Tuch, als er sagte, sie wäre eine Zigeunerin und wir sollten nett zu ihr sein.«
»Aber das wart ihr wahrscheinlich nicht.« Jude bemerkte, dass der ländliche Akzent ihrer Großmutter breiter geworden war, als sie über die Vergangenheit sprach.
»Ein paar von den Jungs waren am schlimmsten. Kein Wunder, dass Tamsin nicht besonders glücklich in der Schule war. Erst mal sah sie mit ihren Kleidern vom Ramschverkauf, mit ihrer bräunlichen Haut und den goldenen Ohrringen anders aus als wir. Außerdem war sie mit dem Lernstoff hintendran, was einen Teil des Problems ausmachte. Manche Kinder glaubten, sie wäre dumm. Beschimpften sie, behaupteten, dass Zigeuner Diebe seien und so was. Hatten sie bestimmt von ihren Eltern, obwohl ich so einen Unsinn zu Hause nie gehört habe. Mein Dad hat manchmal ein paar Worte über Wilddiebe verloren, aber er hat die Zigeuner nie schlimmer beschuldigt als irgendwen anders. Egal, ich schäme mich, aber ich war zu ängstlich, um in der Schule ihre Freundin zu sein. Ich dachte, dann würden sie auch auf mir herumhacken, du weißt ja, wie Kinder sein können. Aber manchmal in den Ferien, wenn dein Großonkel Charlie und deine Großtante Sarah und ich zum Turm gegangen sind, habe ich sie gesehen. Dann haben wir oft zusammen gespielt und waren quietschvergnügt. Es war, als hätte jede von uns noch eine Schwester. Und es schien ihr nichts auszumachen, dass wir in der Schule nichts mit ihr zu tun haben wollten. Ich hab oft darüber nachgedacht, wie unglücklich wir sie gemacht haben müssen.«
»Vielleicht hat sie verstanden, dass du Angst hattest«, sagte Jude und fragte sich, wohin diese weitschweifige Geschichte noch führen würde. Sie war ein bisschen bestürzt darüber, wie sehr diese längst vergangene Episode ihre Großmutter heute noch beschäftigte.
»Das hoffe ich«, sagte Gran, »zumindest habe ich mich nie beteiligt, wenn sie in der Pause über sie hergefallen sind. Noch einen Tee, Liebes?«
»Danke. Und was ist nun aus Tamsin geworden?«, fragte Jude.
Aber Gran presste nur die Lippen aufeinander. Dann schüttelte sie traurig den Kopf. »Wir … ihre Familie ist fortgezogen. Ich hab sie nie wieder gesehen. Ich hab mich allerdings immer schlecht gefühlt. Ich hab ihr nicht geholfen, als es nötig war, konnte nicht … und dann hab ich ihr was weggenommen, weißt du.«
»Was?« Aber Jessie schien sie nicht zu verstehen. Schockiert bemerkte Jude die Qual im Blick ihrer Großmutter.
»Es ist schrecklich, wenn du niemals verzeihst oder dir niemals verziehen wird«, sagte die alte Dame. »Es ist immer da – begraben, ja, aber du weißt, es ist da.«
Später am Abend, nachdem sie zu Bett gegangen waren, konnte Jude hören, wie ihre Großmutter im Zimmer nebenan unruhig auf und ab ging, wie Schubladen rumpelnd aufgezogen und wieder zugeschoben wurden und wie Gran mit sich selbst sprach. Just in dem Moment, als sie beschloss, nachzusehen, ob es irgendeinen besonderen Grund für die Unruhe gab, hörte sie die Bettfedern quietschen, ein bisschen Gehuste, und dann trat Stille ein. Jude musste früh aufstehen und versuchte einzuschlafen. Wenn Gran mich braucht, dachte sie, wird sie mich bestimmt rufen.
Aber der Schlaf kam nicht. Eine Weile kreisten ihre Gedanken um die Geschichte, die Gran ihr erzählt hatte, um das Zigeunermädchen im Wald von Starbrough. Da gab es einen Turm, Starbrough Folly. Follys, so wusste Jude, waren Bauwerke, die zur Ausschmückung der Gärten errichtet worden waren. Sie kannte das aus anderen Parks. Da gab es Türme, künstliche Ruinen, antike Torbögen und prächtige Schmuckpavillons. Gran hatte gesagt, dass sie bei diesem Turm gespielt hatten. Jude beschloss, ihn sich am nächsten Morgen auf jeden Fall anzusehen.
Ihre Gedanken schweiften zurück in ihre eigene Jugend. Wenn sie damals zu Besuch gekommen waren, war Grandad mit Claire und ihr bei schönem Wetter in seinem kleinen Fischerboot hinausgefahren, um die Seehunde zu beobachten, die sich am Blakeney Point sonnten. Grandad war ein ruhiger, stiller Mann gewesen, der immer in der Nähe der Küste gelebt hatte und sich wohlfühlte, wenn man einfach nur zusammensaß und nicht viele Worte machte. Er hörte zu, wenn man ihm etwas erzählte, aber er stellte nicht die ganze Zeit über dumme Fragen, über die Schule und irgendwelche Lieblingsfächer und was man werden wollte, wenn man groß war – wie manche Erwachsene mit Kindern eben so redeten.