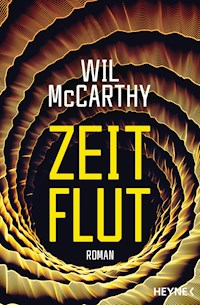6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eine neue Welt – ein neues Paradies?
Die Revolution der Jungen gegen die Alten ist gescheitert. Zusammen mit den restlichen Aufständischen wird Prinz Bascal Edward de Towaji Lutui mittels hypermoderner Teleportationstechnik auf den fernen Planeten Kummer verbannt, wo er eine neue Zivilisation erschaffen will. Voller Zuversicht erkunden die Siedler ihre neue Heimat – bis sich herausstellt, dass die Voraussagen der Astronomen zu optimistisch waren. Die Siedler sehen sich einer Natur gegenüber, die rau und abweisend ist. Trotz aller Vertuschungsmaßnahmen erkennen sie schnell, dass das notwendige Niveau der mitgebrachten Technik auf Dauer nicht zu halten ist und das Projekt der Landnahme scheitern muss. Doch Bascal Edward de Towaji, der sich zum König der neuen Welt proklamiert hat, unterdrückt gnadenlos alle Bestrebungen, das Kolonisierungsprojekt abzubrechen – und auch die Rückkehr zur fernen Erde ist unmöglich …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Ähnliche
Das Buch
Die achte Dekade der Regentschaft des galaktischen Königreichs SOL: Eine Gruppe von Aufständischen hat gegen die Herrscher aufbegehrt, aber ihre Revolution ist gescheitert und zur Strafe werden sie ins Exil geschickt. Mittels hypermoderner Teleportationstechnik erreichen Prinz Bascal Edward de Towaji Lutui und Tausende von Auswanderern den entfernten Planeten »Kummer«, wo sie sich eine eigene, unabhängige Zukunft schaffen wollen.
Voller Zuversicht erkunden die Siedler ihre neue Heimat – bis sich herausstellt, dass die Voraussagen der Astronomen zu optimistisch waren: Die Siedler sehen sich einer Natur gegenüber, die rau und abweisend ist. Trotz aller Vertuschungsmaßnahmen erkennen sie schnell, dass das notwendige Niveau der mitgebrachten Technik auf Dauer nicht zu halten ist und das Projekt der Landnahme scheitern muss. Doch Bascal Edward de Towaji, der sich zum König der neuen Welt proklamiert hat, unterdrückt gnadenlos alle Bestrebungen, das Kolonisierungsprojekt abzubrechen – und auch die Rückkehr zur fernen Erde ist unmöglich …
Der Autor
Wil McCarthy lebt mit seiner Familie in Denver, USA, und arbeitet als Ingenieur. Als Science-Fiction-Autor wurde er durch zahlreiche brillante Kurzgeschichten populär, denen mittlerweile mehrere Romane folgten. Darin befasst er sich immer wieder mit der Frage nach den zukünftigen Perspektiven der Menschheit, wobei er es meisterhaft versteht, die literarischen und wissenschaftlichen Aspekte seiner Themen zu verknüpfen.
Mehr zu Autor und Werk unter: www.wilmccarthy.com
Titel der amerikanischen Originalausgabe
LOST IN TRANSMISSION
Deutsche Übersetzung von Norbert Stöbe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Deutsche Erstausgabe 8/07 Redaktion: Wolfgang Jeschke Copyright © 2004 by Wil McCarthy Copyright © 2007 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagillustration: Dirk Schulz Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
eISBN: 978-3-641-19229-7V001
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
DANKSAGUNG
Ich danke Kathee Jones und Laurel Bollinger, die der Ansicht waren, dieser Teil der Geschichte dürfe nicht ausgelassen werden, sowie Anne Groell, Rich Powers und Gary Snyder, die dazu beigetragen haben, dass sie Gestalt annahm, und Cathy, deren Einfluss erheblicher ist, als sie bisweilen glaubt. Des Weiteren danke ich Paul F. Dietz und Malcolm Longair für ihre Hilfe hinsichtlich der Astrophysik verdichteter Materie, John H. Maudlin für sein maßgebliches Buch über Raumschiffe und Chris McCarthy für die Daten zu Barnards Stern.
Diese Geschichte gründet auf einem Fundament von Ideen, die sich im Laufe von Jahren entwickelt haben. Geholfen haben mir Dutzende von Personen, die an anderer Stelle ausführlich gewürdigt werden. Gleichwohl schulde ich besonderen Dank Shawna McCarthy, Mike McCarthy, Vernor Vinge, Scott Edelmann, Chris Schluep, Anne Groell, Bernard Haisch, Richard Turton und Sir Arthur C. Clarke.
Ich versichere Ihnen, dass sämtliche Irrtümer in diesem Buch bloße Druckfehler sind.
0. KAPITEL
Die gestörte Idylle
»Halten Sie sich fest«, sagt Radmer zu spät, als dass es noch etwas genutzt hätte. Die erste Lufttasche ist wie ein Tritt in den Bauch. Womm!
Radmer ist alt genug – mehr als alt genug –, um sich zu erinnern, wie es sich anfühlt, aus dem Orbit kommend inmitten eines Feuerballs in eine Planetenatmosphäre einzutreten. Das Heulen des Plasmas, die glühenden Wärmeschilde … Im Vergleich dazu ist es ein Klacks, die Atmosphäre von Lune zu durchstoßen. Zum einen beträgt seine Geschwindigkeit nicht mal 4 km/s, deshalb entsteht Hitze, aber keine Glut. Zum anderen handelt es sich bei diesem Raumfahrzeug nicht um ein elegantes Shuttle mit Möwenschwingen, sondern um eine primitive Messingkugel, die mithilfe eines Sextanten sowie mittels Dynitsprengladungen auf Sicht gesteuert wird. Für die Inertialstabilität sorgt theoretisch ein Gyroskop, das im Wesentlichen aus einer Töpferscheibe besteht, doch Radmer war zu sehr vom Steuern in Anspruch genommen, um das Rad in Schwung zu halten. Durch das untere Bullauge sieht er den wie verrückt trudelnden Mond.
Lune, der Gequetschte Mond: eine komprimierte, begrünte und sich selbst überlassene Welt, die noch immer um den stecknadelkopfgroßen Kollapsar der Gemordeten Erde kreist. Lune ist wesentlich kleiner als ein gewöhnlicher Planet. Zarter, preziöser und dennoch die größte – bei weitem die größte – bewohnbare Welt, die sich noch im Lichte von Sol badet.
Die Luft säuselt nicht mehr, sondern ist inzwischen so stark verdichtet, dass sie an der Hülle singt und kreischt. Selbst aus dieser geringen Höhe – sie sind bereits tief in die Atmosphäre eingedrungen – wirkt die Welt noch immer klein und sehr rund. Und das trifft es auch: Der Durchmesser von Lune beträgt lediglich rund 1400 Kilometer. Diese Welt hat die Größe einer Provinz, eines Binnenmeers, eines großen Hurrikans. Nicht ganz menschlichen Maßstäben gerecht werdend, aber fast. Fast.
In der zweihundertundersten Dekade nach dem Tod des Königinreiches Sol, in einer von Waffenschmieden, Uhrmachern und Artilleristen gefertigten Raumkapsel, schickt General Emeritus Radmer – der ehemalige Architekt Conrad Ethel Mursk – sich an, auf dieser kleinen Welt mit Namen Lune in der Provinz Appenin in der Nation Imbria zu landen. Jedenfalls hofft er, dass es ihm gelingen wird. Die exakte Lage des Landepunkts entscheidet darüber, ob man ihn mit einer warmen Mahlzeit begrüßen wird oder mit …
Knallend und kreischend trifft die Messingkugel auf eine weitere Lufttasche, einen Wirbel in den Stürmen der oberen Atmosphäre, und Radmers Nutzlast – die wertvollste aller denkbaren Frachten – wird heftig gegen die Gurte geschleudert. Die Kapsel rotiert. Dann ein weiterer Schlag und noch einer, noch heftiger als der erste. Das Kreischen der Luft wird ohrenbetäubend, und Radmer begreift, dass sie noch gar nicht in die oberen Atmosphäreschichten eingedrungen sind. Sie haben gerade erst die Troposphäre durchstoßen. Die Schicht, in der das Wetter entsteht.
An dieser Stelle gibt es heute nur wenige Wolken, doch sie bilden eine abgegrenzte Schicht, eine Atmosphärenschicht, die ihnen mit merklicher Geschwindigkeit näher kommt. Während die Messingkugel darauf zutrudelt, macht Radmer sich Sorgen, die Nutzlast könnte bei dem unruhigen Flug Schaden nehmen. Das hätte schlimme – sehr schlimme – Auswirkungen auf den weiteren Verlauf des Krieges, denn es wurden Menschenleben und große Vermögen geopfert, um diese spezielle Fracht aus dem menschenleeren tropischen Paradies des Planetchens Varna abzuholen.
»Kann man nicht den Fallschirm auslösen?«, fragt die Nutzlast.
»Leider nein«, antwortet Radmer.
Die Fracht ist ein Mensch – ein Mann mit uralten Kenntnissen von entscheidender Bedeutung. Er ist mehrere hundert Jahre älter als Radmer, und das sieht man ihm an. Es erscheint unglaublich – geradezu kriminell! –, diesen verhutzelten Mann einem solch turbulenten, dröhnenden Sturz durch die Atmosphäre auszusetzen, doch Lune kann sich nicht aus eigener Kraft retten. Dies zu bewerkstelligen, obliegt solch alten Männern, den Älteren.
Radmer kann den Fallschirm nicht auslösen, weil sie noch zu hoch sind und die Luft noch zu dünn ist. Selbst wenn der Fallschirm sich vollständig öffnen sollte, was keineswegs sicher ist, könnte die Kapsel mit den Passatwinden hunderte Meilen weit abtreiben. Und wenn sie außerhalb der Grenzen von Imbria niedergingen, würden Radmer und seine Fracht ganz schön tief in der Scheiße stecken. Radmer muss jedoch etwas gegen das Trudeln unternehmen, sonst wird der Fallschirm, wenn er ihn denn irgendwann auslöst, sich verheddern, und das würde aller Wahrscheinlichkeit auch ihrer beider Tod bedeuten. Er ist schon häufiger mit flatternden Fetzen gelandet, doch das war in der wohlbehüteten Umgebung eines kleinen Planetchens. Lune kommt seiner Vorstellung von einer Welt viel näher, und es verzeiht keinen Fehler.
»Zünden Sie noch eine Sauerstoffkerze«, rät er seiner Fracht, bloß um den Mann zu beschäftigen. Dann beugt er sich im Sitz vor und bringt endlich mit den Füßen die Töpferscheibe in Schwung. Die Schwungscheibe ist völlig zum Stillstand gekommen. Er muss fünfzigmal treten, bis die Federn überhaupt einrasten. Und dann, während sich die Scheibe stetig dreht, muss er noch minutenlang stetig weitertreten, um die Muskelenergie auf die Schwungscheibe zu übertragen, die von Highrock-Töpfern hergestellt und von Orange Mayhew, dem Uhrmachermeister, in die Kapsel eingebaut wurde.
Wenn Radmer den Fallschirm auslöst, wird die Trägheit der rotierenden Scheibe die Kapsel hoffentlich ein wenig stabilisiert haben. Andernfalls kann er noch einen weiteren Trick ausprobieren: Er kann die Hülle gegen die fixierte Innenplattform der Kugel rotieren lassen oder gar – Gott steh ihm bei – die geöffnete Luke als Schwert oder Steuerruder benutzen.
Gehorsam löst die Fracht den Gurt, beugt sich nach hinten, streckt die Arme hinter dem Kopf aus und öffnet das Staufach. Sie ertastet den Stahlmantel einer Sauerstoffkerze und klemmt sie sich zwischen die Beine, dann schließt sie das Fach, setzt sich wieder gerade hin und legt erneut den Gurt an.
»Das ist die Letzte«, sagt die Fracht.
»Das macht nichts«, erwidert Radmer zerstreut. Das ist nicht entscheidend. Entweder sie werden wohlbehalten landen oder sterben, und ob die Luft in der Kapsel frisch oder verbraucht ist, macht da nicht den geringsten Unterschied. Die Fracht aber zieht dennoch die Reißleine des Kanisters und hält ihn noch eine Minute lang fest, während die Eisen/Natriumchlorat-Mischung reagiert und sich dabei erwärmt. Dann zieht sie den verbrauchten Kanister aus der Nische hervor, schiebt den neuen hinein und fixiert ihn. Anschließend beugt sie sich zurück und verstaut den verbrauchten Kanister in dem Fach, aus dem sie den vollen genommen hat.
All das erfordert kein großes Geschick, doch Radmer empfindet gleichwohl Erleichterung. Die Fracht kann immer noch dazulernen, kann immer noch vernünftige Überlegungen anstellen, kann eine ihr fremde Handlungsabfolge bewältigen. Das ist wirklich eine gute Neuigkeit: Dies ist keiner der Untoten, jener Älteren, deren Gehirnnerven sich einfach abgenutzt haben. Während des siebenundfünfzigstündigen Fluges und der wochenlangen Vorbereitungszeit sind Radmer in dieser Beziehung einige Bedenken gekommen. Der Gesprächsstoff ist ihnen rasch ausgegangen, und daraufhin verfiel der alte Mann in eine Art Starre und wartete nur noch darauf, dass irgendetwas passierte.
Aber vielleicht war das auch nur Ausdruck von Geduld. Niemand lebt so lange, ohne Geduld zu entwickeln.
»Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben«, verkündet die Fracht. »Ich bin diese Rotation nicht gewöhnt. Ich glaube, ich bin überhaupt keine Bewegung mehr gewöhnt.«
»Tun Sie sich keinen Zwang an«, meint Radmer. »Aber mir wär’s lieber, Sie würden nach dem Bodenfunkeln Ausschau halten.«
»Funkeln?«
»Nach Lichtern. Das Sonnenlicht wird von unseren Gegnern reflektiert, wenn sie sich über Land bewegen. Wenn Sie einverstanden sind, Sire, möchte ich lieber nicht in ihrer Mitte landen, sofern die Kapsel sich überhaupt steuern lässt.«
»Hmm. Ich verstehe.«
Und das tut die Fracht vielleicht wirklich. Die Einzelheiten des Krieges scheinen wirkungslos an ihr abzuprallen, doch das Wesentliche kann ja nicht so schwer zu begreifen sein. Sie beugt sich vor und späht durch die Luke.
Während die Fracht beschäftigt ist, bringt Radmer die Schwungscheibe noch etwas mehr in Schwung. Und tatsächlich, das Torkeln der Kapsel verlangsamt sich, das Drehmoment wird von der Scheibe absorbiert. Um die Kapsel vollkommen zu stabilisieren, bräuchte er eigentlich drei rechtwinklig zueinander angeordnete Schwungscheiben. Und wenn er genügend Zeit hätte, könnte er das ganze Schiff drehen und den Drehimpuls jeder einzelnen Richtungsachse aufheben. Aber auch so funktioniert der primitive Mechanismus erstaunlich gut. Vielleicht wird sich der Fallschirm doch nicht verheddern.
»Da ist ein Berg«, sagt die Fracht.
Radmer blickt nach unten, in die gleiche Richtung wie der alte Mann. Ja, er kann in der sich drehenden Landschaft die grüne Fläche des Aden-Plateaus ausmachen. Im nächsten Moment wird es draußen vor der Luke kurz weiß, denn sie durchstoßen eine Wolkenschicht. Die Kapsel befindet sich schon lange im freien Fall, ist bestimmt schon zehntausende Kilometer tief gestürzt. Jetzt befindet sie sich kaum einen Kilometer über dem Plateau, und es wird allmählich Zeit, den Fallschirm auszulösen. Radmer nimmt die Steuerketten in die Hand, blickt einen Moment aus der Luke, dann ruckt er fest daran.
Die Fallschirmtüren öffnen sich mit einem lauten Klirren, und der Luftsack knallt im Fahrtwind, dann zieht er hinter sich den orange-weißen Seidenschirm heraus. Radmer kann es nicht sehen, doch er spürt, wie der Schirm sich öffnet, und die Kapsel ruckt, als hätte sie sich an etwas Elastischem verfangen. Die Leinen aus gezwirntem, vakuumgeschwächtem Hanf knarren unter der plötzlichen Belastung, entscheiden sich aber standzuhalten.
So. Auf dem Aden-Plateau, einem unbewohnten Gebiet, hatte Radmer nicht landen wollen. Doch es hätte schlimmer kommen können; die Stadt Timoch liegt nur zweiundzwanzig Kilometer entfernt hinter dem Ostrand des Plateaus, also steht es um seine Navigationskünste – oder um sein Glück – weniger hoffnungslos als befürchtet. Unglücklicherweise trägt der Ostwind die Kapsel auf diesen Rand zu. Es sieht sogar ganz danach aus, als werde die Kapsel auf den Hängen dieses Randes landen anstatt auf dem flachen Mittelteil. Das ist extrem gefährlich, denn nichts würde die Kapsel daran hindern, auf dem sechzig Grad steilen Hang zwei Kilometer tief zu rollen. Dabei bestünde die Gefahr, dass die Fracht ums Leben kommt, von Radmer – ein seltsamer Gedanke – ganz zu schweigen.
Die Möglichkeiten der Einflussnahme sind praktisch gleich null, doch da ihm nichts Besseres einfällt, zieht er mithilfe der Ketten einen Teil des Fallschirms ein, um eine Kurve nach Westen zu beschreiben und den Fall etwas zu beschleunigen. Genauer gesagt: um gegen den widrigen Wind anzustürzen. Die Wirkung ist subtil, aber eindeutig. Mit dem östlichen Wachturm auf dem Plateau als Orientierungspunkt kann er die Kursveränderung einschätzen. Zu seiner Erleichterung stellt er fest, dass das Manöver Wirkung zeigt. Die Kapsel wird dem Rand fernbleiben und auf dem flachen Plateau aufsetzen.
Unglücklicherweise wächst auf Aden nur Gras; es gibt dort keine Bäume und auch keine andere nennenswerte Vegetation, die den Aufprall hätte abfedern können. Sie gehen gerade mal dreißig Meter westlich des Turms nieder, und beim Aufprall scheppert es ohrenbetäubend laut und dumpf, und sie beginnen sogleich zu rollen. Der Ausblick durch die Luken ist eher verwirrend als informativ; man sieht den rotierenden Rand des Abgrunds aufblitzen, während die Kugel sich in Seide und Fallschirmleinen verheddert. Aber auch diesmal wieder ist das Glück ihnen wohlgesonnen: Die Innenplattform bleibt stabil und damit auch die Lage der beiden Männer, denen nicht einmal schwindlig wird, als die Kapsel gegen die Metallumzäunung des alten Wachturms rollt. Obwohl der Zaun mit einem protestierenden Ächzen nachgibt, kommt die Kapsel ganze zehn Meter vor dem Abgrund zur Ruhe.
Sie sind angekommen. Radmer hat seine interplanetarische Mission erfüllt. Jedenfalls eine Interplanetchen-Mission – erst haben die Handwerker von Highrock diese Kapsel mithilfe einer Brücke und einiger Flaschenzüge in den Himmel geschleudert, dann hat er mithilfe von Dynit von der Oberfläche von Varna abgehoben, von der winzigen Welt, auf der seine Fracht dahinvegetierte. Und irgendwie hat alles funktioniert. Nicht alles ist nach Plan verlaufen, doch es hat gereicht.
»Tut mir leid«, sagt Radmer, von jäher Erschöpfung überkommen. »Willkommen auf Lune, Sir.«
»Hmm«, macht die Fracht und späht unsicher umher. Der alte Mann spürt wieder die Gravitation, die beharrlich an Gliedmaßen, Eingeweiden und Augenwimpern zerrt. Er beugt versuchsweise den Arm. »Es fühlt sich … anders an.«
»Was meinen Sie?«, fragt Radmer. »Den Gradienten?«
Wie Varna wurde auch Lune so weit zusammengequetscht, bis erdähnliche Gravitation entstand, jedoch nicht weiter. Der Radius von Varna ist jedoch um den Faktor dreitausend kleiner; die Gravitation nimmt mit zunehmender Höhe viel rascher ab als auf Lune. Gleichwohl hat Radmer den Unterschied nicht gespürt und sich auch nicht eingebildet, ihn spüren zu können.
Die Fracht aber nickt. »Ja, der Gradient. Das ist eine … große Welt.« Und da ihr Name – Bruno de Towaji – praktisch ein Synonym für profunde Kenntnis der Gravitation und deren Wechselbeziehung mit Elektrizität und Informationstechnik, Biologie und sogar Politik ist, neigt Radmer dazu, ihm zu glauben.
»Es ist lange her«, sagt die Fracht, »dass ich die Gravitationswirkung einer flachen Oberfläche gespürt habe. Aber irgendwie kommt mir das richtig und angemessen vor, finden Sie nicht auch? Also, ich möchte nicht undankbar klingen, aber Sie müssen mich nach draußen bringen. Ich möchte mich aufrichten; ich möchte atmen.«
»Ich auch«, versichert ihm Radmer. Als er den Gurt löst, fällt er neben dem Sitz der Fracht auf die geschwungene Außenhülle, packt den glänzenden Messinggriff der Luke und dreht daran. Mit einem Geräusch, das einem Überraschungslaut ähnelt, mischen sich Innen- und Außenluft. Und dann zieht die Schwerkraft den Lukendeckel nach innen und unten, und das Innere der Kugel füllt sich mit einem Muster aus Licht und Schatten.
In der Kapsel ist es kalt, und die Winterluft des Appenins, die vom an der Sphärenhülle singenden Wind hereingedrückt wird, ist noch kälter, aber auch wundervoll frisch.
»Ich gehe vor«, sagt Radmer zu de Towaji. »Eine übliche Vorsichtsmaßnahme in Kriegszeiten; Ihr Leben ist wichtiger als das meine.«
Der alte Mann schnaubt belustigt. Radmer tritt in den kalten Wind hinaus, reckt sich und gähnt, dann stöhnt er auf. Der Wachturm wurde geplündert. Die feindlichen Streitkräfte legen nicht systematisch Feuer und richten keine willkürlichen Zerstörungen an, doch bei ihrer Suche nach allem Metallischen haben sie den Turm auseinandergenommen, die Böden herausgerissen und alles, was nicht niet- und nagelfest war, zerfleddert und pulverisiert. Außer dem Fundament der Außenhülle, die aus behauenem Fels und Gussbeton besteht, ist kaum etwas übrig geblieben.
»Sie waren hier«, sagt er. »Erst kürzlich.«
»Ihre Feinde?«, fragt die Fracht, tritt an seine Seite und besieht sich die Bescherung.
»Das sind jetzt auch Ihre Feinde«, verbessert ihn Radmer. »Ich bedaure, das sagen zu müssen, Sir, aber wenn die Sie sehen, werden sie Sie wahrscheinlich töten.«
»Kann sein«, meint nachdenklich die Fracht. »Muss aber nicht.«
Im Osten liegt die Stadt Timoch in all ihrer Pracht, eine Zusammenballung von Türmen am Ufer des Central Lake. Im Umkreis sind entlang eines Sterns pfeilgerader Straßen viele Kilometer weit kleinere Gebäude verteilt. Wäre der Krieg nicht dazwischengekommen, hätte sich die Stadt mittlerweile bis zu den Hängen des Aden-Plateaus ausgebreitet.
Hier leben fast zehn Millionen Menschen. Für die hiesigen Verhältnisse ist das eine große Stadt. »Das ist die Stadt Timoch«, sagt Radmer.
De Towaji aber sieht gar nicht hin. Er blickt nach Süden. »Da funkelt was«, sagt er.
Radmer wendet den Kopf. Verdammt. Die Reflexe sind in der Mittagssonne deutlich zu erkennen. Wahrscheinlich ein Zwanzigertrupp. Nachdem das Glück ihm bisher bemerkenswert treu war, hat es ihn nun doch endlich verlassen. Er bemerkt, dass de Towaji jetzt den Himmel mit dem gleichen lustlosen Interesse mustert wie zuvor die feindlichen Kämpfer.
»Haben Sie dort oben etwas verloren?«, fragt Radmer ungeduldig.
Die Fracht schweigt einen Moment, dann murmelt sie: »Ein wirklich schöner Tag. Man vergisst leicht, wie ein richtiger Himmel aussieht. Der Horizont ist ja fast so weiß wie die Wolken! Und stellen Sie sich vor, der Erdhimmel war noch blasser und noch heller. Furchtbar, das mit der Erde, nicht wahr? Wie ich diesen Ort, diese gewaltige Ansammlung von Orten, doch vermisse. Diesen von Gott erschaffenen Planeten.«
»Lunes Atmosphäre ist fast achtzig Kilometer dick und dynamisch stabil«, sagt Radmer. »Die thermische Bewegung unterschreitet die Fluchtgeschwindigkeit. Die Wolken, das Wetter – die sind kein Fake.«
»Ja, ich erinnere mich. Ich habe bei der Konstruktion mitgeholfen.«
»Ah. Also doch. Ich bitte um Verzeihung, Sir.«
»Das ist lange her. Ist auch egal. Wir sind an einer ungünstigen Stelle gelandet, nicht wahr?«
Radmer schirmt die Augen gegen die Sonne ab und zählt die Reflexe. Ja, es sind zwanzig. Aus unerfindlichen Gründen bewegt sich der Gegner in Zuggröße, obwohl er weder über herausgehobene Offiziere noch eine Befehlshierarchie verfügt. Zwanzigertrupps lassen sich rasch zusammenstellen und neu formieren, falls es Verluste geben sollte. Der Gegner ist höchstens fünf, sechs Kilometer entfernt. Radmer beobachtet ihn minutenlang.
»Eigentlich dürften sie sich nicht so weit im Norden aufhalten. Die imbrischen Streitkräfte hätten sie an der Grenze aufhalten sollen. Und wie Sie richtig bemerkten, ist dies ein ungewöhnlich schöner Tag. Das ist schlecht, denn sie haben bestimmt gesehen, wie wir gelandet sind. Den Fallschirm, die Sphäre. Das ist vermutlich der Trupp, der den Wachturm geplündert hat. Jetzt kehren sie mit den erbeuteten Nägeln, Radnaben und so weiter nach Hause zurück. Aber zwei Tonnen Messing kämen ihnen gerade recht. Sie haben wieder kehrtgemacht.«
»Warum funkeln die so?«, will die Fracht wissen. »Womit sind sie bekleidet?«
»Das sind keine Menschen«, ruft Radmer ihm in Erinnerung, schon wieder ungeduldig werdend. Das Wort ›Sire‹ hängt unausgesprochen in der Luft.
Radmer reicht dem alten Mann das Fernglas, und der mustert die Reflexe erneut und atmet scharf ein. Dann lacht er. »Das ist euer Gegner? Die Armee des Verhängnisses? Diese Dinger, die auf zierlichen Füßen durch die Gegend trippeln?«
Radmer entreißt ihm aufgebracht das Fernglas. »Stellen Sie sich vor, Sie würden einem unmittelbar gegenüberstehen. Oder vielmehr zwanzig oder hundert oder tausend. Ihnen mag das irreal erscheinen, Bruno – als hätten Sie geträumt und wären im Albtraum eines anderen Menschen aufgewacht –, doch es ist wahr, das ist ein winziger Teil der Armee, die diese Welt verwüstet hat. Das sollten Sie nicht auf die leichte Schulter nehmen.«
»Aber das sind Haushaltsrobots!«, protestiert der alte Mann. »Sie sollten euch den Fußboden wischen und die Schuhe wienern. Das sind keine Soldaten. Sie sind nicht einmal in guter Verfassung; was haben die eigentlich für Kästen an den Köpfen?«
»Sie haben sich zu Soldaten umgemodelt«, sagt Radmer. »Sie haben sich modifiziert und endlos vervielfältigt. Die letzte Schätzung beläuft sich auf vier Millionen. Sie töten jeden, der sich ihnen in den Weg stellt, und zwar ziemlich effizient, nein danke. In Nubien hat die Senatoria Plurum bedingungslos kapituliert – es wurde keinerlei Widerstand geleistet –, aber bedauerlicherweise feststellen müssen, dass der Gegner auch dann, wenn man ihm freie Hand lässt, alle Formen von Autorität, Regierungsgewalt und Rechtsstaatlichkeit beseitigt.
Was anschließend passiert, kann sich jeder ausmalen; den letzten Berichten aus Nubien zufolge zertrampeln diese ›Haushaltsrobots‹ ganze Städte und schleppen jedes Metallfitzelchen weg, das sie finden können. Um weitere Ebenbilder ihrer selbst zu erschaffen? Um etwas anderes zu bauen? Vielleicht eine Belagerungsmaschine, die unsere stärksten Festungen schleifen könnte? Sie lachen, Sire, aber meine Kinder sind tot. Viele Kinder sind tot, und über das Schicksal derer, die hinter den feindlichen Reihen zurückgeblieben sind, wissen wir nichts. Die wenigen Berichte, die uns noch erreichen, sind, zurückhaltend formuliert, wenig ermutigend.«
In Anbetracht des Gehörten überdenkt die Fracht ihre Haltung und Stellung auf Lune. Radmer wird von einer Woge des Mitgefühls erfasst; in Wahrheit hat er dem Mann nur sehr wenig erklärt, und es mag gut sein, dass Radmers Stimme im Laufe der Zeitalter an Eindringlichkeit verloren hat und von den ständigen Kriegen, den Friedensschlüssen und den darauf folgenden Neuanfängen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vielleicht hat er die Gefahren nicht genügend herausgestrichen.
»Ich möchte Sie nicht kritisieren«, sagte die Fracht förmlich, als antworte sie auf den unausgesprochenen Gedanken, »aber ich konnte das nicht wissen, denn Sie haben es mir nicht gesagt. Wir haben kaum miteinander gesprochen. Es gab einmal eine Zeit, Architekt, da haben Sie mir Vertrauen und Respekt entgegengebracht.«
»Also, daran hat sich auch nichts geändert«, erwidert Radmer. »Aber wir sind hier nicht auf einer einsamen Insel oder Ihrem kleinen Planetchen, und hier kennt man mich auch nicht als Architekten. Ich bin eher eine Art … Schlachtross im Ruhestand, könnte man wohl sagen. Ich habe mich von meiner Armee getrennt, und meine Aufgabe – meine absurde Mission – besteht darin, Sie in diese Stadt zu schaffen. Sie sind ein Stellungsvorteil, Sire, Sie sind Feuerkraft. Ich weiß nicht, ob Sie uns werden helfen können, aber einstweilen habe ich die Aufgabe, Sie wohlbehalten abzuliefern.«
In weiter Ferne, jenseits der Stadt, sieht er die gewaltigen weißen Zelte und Kuppeln, die den Meeresstrand säumen, wenngleich das Meer unsichtbar hinter dem Horizont liegt. Dies ist das Lager der größten verbliebenen Menschenarmee von Lune, die letzte Hoffnung der Welt.
Jetzt ist die Fracht verärgert. »Vielleicht würde Ihre Mission glatter verlaufen, wenn ich über die relevanten Details Bescheid wüsste. Sie sagen, dieser Ort kommt mir unwirklich vor. Ich gestehe, Sie haben recht. Wie sollte es auch anders sein? Ich kenne diese Welt in bewohntem Zustand nicht. Ich kenne die Menschen nicht, und irgendwie habe ich das Gefühl, Sie ebenfalls nicht zu kennen. Sie haben sich … vollkommen verändert. Außerdem sollten Sie bedenken, dass ich bis vor zwölf Tagen davon ausgegangen bin, meine Zeit auf der Bühne der Geschichte sei abgelaufen.«
Während de Towaji weiterredet, dreht Radmer sich um und wühlt in den Staufächern im Rumpf der Kugel. »Ich habe nur leichte Waffen dabei«, sagt er und fischt eine Pistole und einen kurzen Blizzerstab heraus. »Und nur wenig Munition. Halten Sie sich dicht an meiner Seite, Sire, und tun Sie, was ich Ihnen sage. Ihr Leben hängt davon ab, und das Schicksal der Welt ruht auf Ihren Schultern. Haben Sie mich verstanden? Habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Vollkommen klar. Ich danke Ihnen.«
»Gut. Ich bedaure meine Schroffheit, aber es wird hier bald heiß hergehen. Wenn sich später eine Gelegenheit ergibt, können wir uns ausführlicher unterhalten.« Radmer ergreift einen Metallhaken von der Größe einer Essgabel, allerdings könnte es sich auch um einen besonders großen Schleusenschlüssel handeln. Er lässt sich auf einen großen Stein niederplumpsen. Dann beginnt er mit dem Haken an den Schnürsenkeln zu ziehen. »Passen Sie gut auf, was ich mache. Sie müssen das gleich nachmachen. Ihre Stiefel sollen schließlich fest sitzen.«
»Äh … ich glaube, sie sitzen schon fest genug.«
»Das sagen Sie. Aber wenn Sie den Erstkontakt überleben sollten, werden Sie bald rennen, springen und Haken schlagen, und der Untergrund könnte morastig sein oder mit Blut oder Schmiermittel getränkt. Glauben Sie mir, ich habe schon gesehen, wie Männer ihre Stiefel verloren haben. Die hätten ein Königreich für einen fest sitzenden Knoten gegeben. Die Stiefel können gar nicht fest genug sitzen. Sie können an den Schnürbändern ziehen, bis Ihre Zehen blau anlaufen, bis Sie kein Gefühl mehr in den Füßen haben, und wenn es so weit ist, werden Sie trotzdem feststellen, dass Sie in den Stiefeln herumwobbeln, weil sie nämlich zu locker sitzen.«
Die Fracht hält ihn offenbar für verrückt und glaubt, in den Jahren der Entbehrung habe er den Verstand verloren. Menschen in Panik konzentrieren sich häufig auf völlig unwichtige Details, wohl wahr, doch Radmer kann sich schon gar nicht mehr erinnern, wann er zum letzten Mal in Panik geraten ist.
Jetzt, da er darauf achtet, fällt ihm auf, wie großartig die Aussicht ist. In dieser Höhe, in der klaren Winterluft, überblickt er nicht nur Timoch, sondern ein ganzes Drittel des Landes Imbria – seine Seen, Wälder und Prärien, die kleineren Städte im Norden und im Süden, und im Westen das schroffe Sägezahngebirge, welches das Aden-Plateau um Kilometer überragt.
Dennoch ist das alles ein wahr gewordener Albtraum: der Feind innerhalb der imbrischen Grenzen, gerade mal einen Tagesmarsch von der Hauptstadt entfernt. Er hält in der wundervollen Landschaft nach weiteren Reflexen Ausschau und findet auch ein paar, doch die stammen anscheinend nicht von superreflektierenden Robothüllen. Das ist das ganz normale Gefunkel von Glas und Metall, von Wasser und vielleicht sogar Eis, dort unten im Getriebe der winterlichen Stadt und ihrer Vororte. Doch es lässt sich nicht leugnen: Ein Ausläufer der Invasionsstreitkräfte hat das Herz Imbrias erreicht. Bevor Radmer seine Fracht in Timoch abliefern kann, werden die feindlichen Soldaten ihn erreicht haben. O weh!
Heute gibt es keine Ruhe, keinen Frieden, kein prasselndes Lagerfeuer nach überstandener Reise, es sei denn, die Stadt würde in Brand gesteckt. Radmer fürchtet sich nicht vor dem Tod – jedenfalls nicht besonders –, doch der Gestank der Vergeblichkeit breitet sich aus, und den fürchtet er seit dem Exil im Barnardsystem. Seit er zum ersten Mal die Last der Verantwortung gespürt und vor Problemen gestanden hat, die so groß waren, dass er sich seines Scheiterns nicht einmal bewusst war.
Und deshalb zerrt Radmer mit aller Kraft an den Schnürsenkeln und bemächtigt sich der einen Variablen, die er noch unter Kontrolle hat. Im Bewusstsein, dass es nicht reichen wird.
ERSTES BUCH
PIONIERE
1. KAPITEL
Unterwegs zu einer namenlosen Welt
Radmer erinnert sich noch deutlich, wie er zum letzten Mal den alten Mond sah, bevor König Bruno ihn im Zuge seines Terraformungprojekts zusammenquetschte …
Damals hieß er noch Conrad Mursk, stand auf der Brücke des KRS Neue Hoffnung und stürzte auf einer sonnenwärts gerichteten Flugbahn an Erde und Mond vorbei. Begonnen hatten sie den Sturz am Mars und beabsichtigten, diesen Kurs bis zu einem Abstand von einer Million Kilometern zur Sonne beizubehalten. Wenn die Sonnenhitze sogar ihre Superreflektoren durchdringen würde, wollten sie das Schiff drehen und erneut aufsteigen.
Ihre Flugbahn ähnelte dem Orbit eines Kometen: Sie war elliptisch und einsam, senkte sich kurz Mutter Sol entgegen und führte dann wieder in die Dunkelheit, wo sie eine weitere lange Umkreisung hätten beginnen können. Allerdings gedachten sie, am tiefsten Punkt das Fusionstriebwerk zu zünden, die Photosegel zu setzen, das Licht der Sonne sowie den Laserschub eines Dutzends Ministerne aufzufangen und sich in den Weltraum schleudern zu lassen. Vorbei an Mars und Neptun, vorbei am Kuipergürtel und der Oortwolke, wo die wahren Kometen herkamen, den Sternen entgegen.
Die Fenster auf der Brücke bestanden nicht aus Glas und waren gar keine richtigen Fenster. Sie waren nichts weiter als Videobilder auf W-Stein-Wänden. Holographische Bilder – da es in der unmittelbaren Umgebung des Raumschiffes jedoch nur Leere gab, war das schwer festzustellen. Natürlich konnte man die Bilder nach Herzenslust einstellen, vergrößern und filtern, doch was Conrad in diesem Moment sah, war vermutlich ein unverfälschter Ausblick: die blau-weiße Erde, kaum größer als eine Traubenbeere, und im Vordergrund der faustgroße Mond.
Es gab keinen Mann im Mond. Da der Mond eine an den Mutterplaneten gebundene Rotation aufwies, erblickte Conrad im Moment die erdabgewandte Seite, auf der er keine vertrauten Orientierungspunkte ausmachen konnte. Eigentlich seltsam: Da lebte er jetzt seit acht Jahren im Weltraum und war sich trotzdem nicht sicher, ob er die erdabgewandte Seite überhaupt schon einmal gesehen hatte. Sie wirkte flach und grau, ohne besondere Merkmale, und auf der sonnenerhellten Hälfte waren keine superreflektierenden Wohnkuppeln auszumachen. Diese Seite wirkte völlig unbewohnt.
Dieser fremdartige, präzivilisierte Mond schwebte im Fenster mit deutlich erkennbarer Geschwindigkeit von oben nach unten und von vorn nach achtern, wie eine Seifenblase, die sich auf der Erde absetzen wollte. Eine Seifenblase aber war klein und nah, während Luna eine Viertelmillion Kilometer entfernt und sehr groß war. Die KRS Neue Hoffnung war schnell und legte siebenundzwanzig Kilometer in der Sekunde zurück. Sie war so schnell wie ein Komet. Sie waren noch hundertfünfzig Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, würden aber das Perihel – den Punkt der größten Annäherung an den Schmelzofen Sonne – in nur dreißig Tagen erreicht haben.
Es gab durchaus Menschen, die schon schneller gereist waren. Genau genommen mehrere hundert Menschen. Die Neue Hoffnung aber war was größte Objekt, das die Zehn-Sekundenkilometer-Barriere durchbrochen hatte. Freilich nicht das massereichste, denn sie war am Bug und am Heck mit Kollapsium abgeschirmt, mit einem Schaum oder Kristall aus winzigen Schwarzen Löchern, und die Masse zwischen diesen ›Ertialschilden‹ … verschwand bildlich gesprochen einfach aus dem Raum-Zeit-Gefüge. Das Schiff und die Besatzung besaßen Masse und Trägheit, jedoch nicht genug. Nicht so viel, wie das Universum von ihnen erwartete. Derartige Raumschiffe konnte man mühelos umherbewegen und mit geringstem Kraftaufwand enorm beschleunigen, ohne dass die Besatzung etwas davon mitbekam.
Doch bislang waren noch nicht viele ertialabgeschirmte Raumfahrzeuge so schnell geflogen. Im Allgemeinen galt das als unsicher – und zwar in dem gleichen Sinn, wie ein Kugelhagel als riskant betrachtet wurde. Interplanetarisches Vakuum hin oder her, es gab hier draußen eine Menge Müll, mit dem man zusammenstoßen konnte.
Conrad Mursk saß rechts hinter dem weiblichen Captain im Sessel des Ersten Schiffsoffiziers. Bei ihnen waren noch drei weitere Brückenoffiziere, zuständig für Astrogation und Steuerung, Sensoren, Kommunikation und Information sowie das Systembewusstsein. Zufällig drehte sich der Captain in diesem Moment zu Conrad um. Ihr Gesicht wurde wundervoll vom Fenster eingerahmt, Teil eines planetarischen Tableaus. Conrads Blick wanderte von ihrem Gesicht zum Mond und wieder zurück, da er meinte, sie wolle vielleicht ein paar passende Worte sagen. Stattdessen musterte sie ihn wortlos, ohne den Ausblick zu würdigen.
»Alles in Ordnung, Cap’n?«
Den Titel gebrauchte er halb im Scherz. Sie hieß Xiomara Li Weng, Xmary für ihre Freunde, und war niemandem enger verbunden als Conrad Mursk. Im Grunde stellte das einen Verstoß gegen alle möglichen Bordregeln und Traditionen dar, andererseits gehörten sie beide weder der Navy noch der Handelsflotte der Weltraumhändler an. Und das hatten sie auch nie getan, es sei denn, Raumpiraterie in kleinem Maßstab zählte neuerdings zu den Dienstleistungsbranchen. Vielmehr waren sie wie alle anderen Besatzungsmitglieder Strafgefangene. Verurteilte, Verbannte, fakahe’i. Dieses lange Abenteuer, diese hundertjährige Reise zu Barnards Stern, war die Strafe für jahrelanges antisoziales Verhalten im Allgemeinen und den Kinderaufstand im Besonderen.
»Hast du Lust, einen Spaziergang mit mir zu machen?«, fragte der Captain, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, wie fasziniert er von der Aussicht war.
»Ja, klar«, antwortete Conrad. ›Spaziergang‹ war ein Euphemismus, da jedes kreisförmige Schiffsdeck einen Durchmesser von exakt dreißig Metern hatte. Da kam man nicht weit. Doch es gab eine Observationslounge, und dorthin wollte Xmary.
»Robert«, wandte sie sich an den Astrogationsoffizier. »Sie übernehmen die Brücke.«
»Jawohl, Miss«, erwiderte Robert. Schon vor längerer Zeit hatte er seine Haut passend zu seinen Haaren und Augen im Fax blau getönt, und deshalb wirkte alles, was er sagte und tat, irgendwie aufsässig, selbst wenn sein Tonfall ganz harmlos war.
Xmary zögerte. »Möchten Sie die Brücke für die ganze Nacht übernehmen? Wir sind jetzt schon dreiundneunzig Tage mit diesem Pott unterwegs, und Sie hatten die Brücke höchstens mal eine halbe Arbeitsschicht für sich. Was meinen Sie?«
»Sehr gern, Miss. Ich habe schon größere Schiffe geführt als das hier, wenn Sie sich erinnern.«
»Ich kenne Ihre Akte«, sagte sie missmutig. Tatsächlich war sie selbst schon auf einem dieser Raumschiffe mitgeflogen, um in der Weite des Außensystems Navy-Schiffen zu entwischen. »Aber würden Sie bitte Xmary zu mir sagen?«
Robert lächelte nur. Diese Unterhaltung hatten sie schon öfter geführt, und Robert schien aus irgendeinem Grund entschlossen, die Förmlichkeit beizubehalten. Robert war selbst eine Art Pirat und hatte fast fünf Jahre lang an Bord eines Neutroniumfrachters von Mass Industries eine Gruppe von Siedlern angeführt. Mann, er hatte das Ding praktisch allein gemanagt – umsichtiger Heimwerker und Amateur-Massecowboy in einer Person. Außerdem war er ein erklärter Anarchist und hatte jahrelang mit dem angeborenen Bedürfnis der Menschen gehadert, Hierarchien zu bilden und Führer zu wählen. Doch davon abgesehen steckte noch immer eine Menge Navy in ihm.
»Weiter so, Nummer Drei«, meinte Conrad forsch, um dem Affen noch ein wenig Zucker zu geben.
»Aye, Sir. Weiter so, zu Befehl.«
Conrad kniff die Augen zusammen, was eine Art Navy-Zorn ausdrücken sollte. »Versuchen Sie etwa geistreich zu sein, Offizier?«
»Gewiss nicht, Sir«, erwiderte Robert trocken. »Aber wenn ich den Eindruck habe, dass ich entsprechende Symptome zeige, werde ich auf der Stelle Meldung erstatten.«
»Ja, tun Sie das«, sagte Conrad, dann brach er in Gelächter aus.
Aus verschiedenen logistischen, historischen und wahrscheinlich auch sentimentalen Gründen lag die Brücke in der Mitte des zweitvordersten Decks, nur fünf Meter hinter dem Ertialschild. Auf diesem Deck war dies der einzige Raum, der für die Besatzung zugänglich war. Um sie herum, über und unter ihnen und rings an den Seiten befanden sich die Tanks für die acht Tonnen Wasser, die das Schiff als Massepuffer und Ballast benötigte. Außerdem diente es dem Schutz vor Strahlung, auftreffenden Partikeln und weiß der Himmel was noch alles.
Conrad hatte das Schiff nicht entworfen und war nicht mit allen Einzelheiten der Konstruktion vertraut. Er war erst fünfundzwanzig Jahre alt – nach den Maßstäben des Königinreiches Sol noch ein Jugendlicher – und hatte bis vor drei Monaten, als er von den Passagieren der Neuen Hoffnung zum Ersten Schiffsoffizier der Expedition gewählt worden war, noch nie eine Job gehabt. Er suchte noch immer seinen Weg. Xmary war soeben siebenundzwanzig geworden und besaß noch weniger Segelerfahrung als Conrad. Der Systemoffizier war der zweiundzwanzigjährige Zavery Biko, die Information war bemannt (oder beweibt?) mit der neunundzwanzigjährigen Agnes Moloi. Der Blaue Robert M’chunu, der alte Mann der Astrogation, war dreißig.
Es war kein Zufall, dass Conrad das Alter aller Besatzungsmitglieder kannte. Das war nämlich sein Zuständigkeitsbereich: die Crew. Wenn er auch sonst nur wenig wusste – und zwar in jeder Beziehung –, so kannte er doch immerhin die Geburtstage, Hobbys, Interessen und speziellen Fähigkeiten der Besatzungsmitglieder. Er war sich nicht sicher, was das mit Wissen zu tun hatte, bemühte sich aber nach Kräften, sich alles einzuprägen. Die Mitglieder der Startcrew begannen einander auf die Nerven zu gehen, kaum dass die Passagiere untergebracht waren, und hatten unter den ersten Anwandlungen von Bordkoller zu leiden, noch ehe das Diemos-Katapult die Arme weggeklappt und sie sonnenwärts geschleudert hatte. Conrads Leidenschaft galt der Architektur, dem subtilen Zusammenspiel von Formen und Materialien, doch er wusste nur wenig – so wenig! – darüber, wie man eine Crew unter schwierigen Bedingungen zusammenhielt. Diese Verantwortung nahm er so ernst wie nichts anderes zuvor. Das wollte nicht viel heißen, aber so war es nun mal.
»Wünsche einen angenehmen Spaziergang!«, rief Robert ihnen in einem harmlosen Tonfall nach, der eines anzüglichen Untertons gleichwohl nicht entbehrte.
Um die Brücke zu verlassen, mussten man mit dem Hintern voran eine schräge Leiter hinuntersteigen – oder auf dem Geländer hinunterrutschen, wenn einem danach war, was Conrad meistens auch tat. Die Lounge lag drei Decks weiter unten und nahm fast die Hälfte dieser Ebene ein – eine der wenigen Annehmlichkeiten, welche die Schiffskonstrukteure Besatzung und Passagieren zugestanden hatten. Gegenwärtig waren zwanzig Personen wach: die Startcrew. Die übrigen viertausendachthundert Personen waren als Datenmuster im W-Stein-Gedächtnis der Neuen Hoffnung gespeichert. Und achtzehn von diesen zwanzig Personen schliefen entweder, arbeiteten oder trieben sich auf der Kombüsenebene herum. Im Moment jedenfalls hatten er und Xmary die Lounge für sich. Erde und Mond waren durch die Fenster nicht mehr zu sehen, was sich freilich durch eine etwas höhere Vergrößerungsstufe hätte beheben lassen.
Stattdessen verriegelte er die Schleuse und stellte das Elektronikschloss auf Stimmerkennung, dann drehte er sich um und riss seinem Captain die Hose herunter. Das war seine zweite Leidenschaft und Freude und die einzige andere Verantwortung, die er überhaupt ernst nahm. Kurz darauf fifften sie auf den kühlen W-Stahl-Platten des Decks, umarmten und küssten sich und gingen voll zur Sache. Dass sie das bei der erstbesten Gelegenheit taten, sollte einen nicht wundern; sie waren seit Jahren intim miteinander befreundet. Und da in dieser dreißigsten Dekade des Königinreiches Sol jeder über den immorbiden, praktisch unsterblichen Körper eines Zwanzigjährigen verfügte, galten ein bis zwei leidenschaftliche Fiffs pro Tag als völlig normal. Jedenfalls sahen das die Männer so, und die Frauen hatten nichts dagegen.
Als Conrad und Xmary fertig waren, hielten sie sich umarmt und ruhten sich aus. Noch immer auf dem Boden liegend, ohne die Sofas und Trampoline auch nur eines Blickes zu würdigen, denn sie waren im Kopf ebenso jung wie vom Körper her und mochten das Gefühl von Unmittelbarkeit, das ihnen der kühle Stahlboden vermittelte.
»Also, das nenne ich einen Spaziergang«, meinte Conrad.
»Hmm«, machte Xmary unverbindlich. Sie hatte gegen einen leidenschaftlichen Fiff ebenfalls nichts einzuwenden, doch war das nicht der Grund, weshalb sie Conrad gebeten hatte, mit ihr hierherzukommen.
»Möchtest du reden?«, nahm er den Hinweis auf.
»Ach, jetzt willst du auf einmal.«
»Ich bin klar im Kopf«, sagte er. »Ich kann dir meine ganze Aufmerksamkeit widmen. Hast du ein Problem? Gibt es in irgendeinem Winkel deines Gehirns eine kleine Sorge?«
»Nur das Übliche.« Sie seufzte. »Ich hasse meinen Job. Jedenfalls wenn ich ihn ausüben muss. Captain eines verfifften Raumschiffes? Was weiß ich schon darüber? Robert ist weltraumerfahren; er sollte der Captain sein. Ich hingegen sollte bei den Passagieren gespeichert sein.«
Conrad zuckte die Achseln. »Die Leute mögen es, wenn eine Frau das Kommando führt; seit dreihundert Jahren lassen sie sich von einer Königin regieren. Also, ich schätze, die älteste Person im Speicher kennt die Königin erst seit fünfundvierzig Jahren, aber trotzdem sind wir alle Produkte der Gesellschaft, oder? Du glaubst, wir wollten den Blauen Robert M’Chunu als Captain haben, der nicht an Führer und Gefolgsleute glaubt? Der fünf Jahre lang aus Prinzip nackt herumgelaufen ist? Ich glaube das nicht, Schatz. Ich bestimmt nicht.«
»Es kämen auch noch andere Frauen infrage«, meinte Xmary missmutig. »Ich war immer ein Partygirl. Ich bin versucht zu sagen, nur ein Partygirl. Der Rest meines Lebens war … eine Laune des Schicksals.«
»Aye«, sagte er und hauchte ihr einen Kuss aufs Haar. »Es gibt noch andere Frauen. Und ein paar von denen waren an den August-Unruhen beteiligt, andere waren Weltraumpiraten und wiederum andere Vertraute des Prinzen von Sol. Du warst alles zugleich. Du hast die Königin von Angesicht zu Angesicht zum Narren gehalten und dir einen Palastrobot gefügig gemacht. Obwohl du hättest Prinzessin werden können, hast du in den Straßen von Denver Verwirrung und Chaos gesät. Soll ich weitermachen?«
»Schon gut«, grummelte sie. »Du warst jedenfalls schon vorher Erster Offizier. Sozusagen.«
»Sozusagen«, meinte er lachend. Eigentlich hatte er den Titel nie geführt und sich an Bord des selbstgebauten fetu’ula, das unter dem Kommando eines depressiven Prinzen mit Selbstmordabsichten gestanden hatte, nur mittels Drohungen und Erpressung in der Position halten können. Außerdem – und das war nun wirklich nicht komisch – waren acht Menschen bei dem Flug ums Leben gekommen. Das war überwiegend schrecklich gewesen. Später waren sie anhand der Backups wiederhergestellt worden, doch das Erlebnis hatte bei Conrad einen üblen Nachgeschmack hinterlassen, den er noch immer nicht losgeworden war, obwohl seitdem schon acht Jahre vergangen waren.
»Tut mir leid«, sagte sie, als sie seinen Stimmungsumschwung bemerkte. »Wahrscheinlich magst du deinen Job auch nicht.«
»Nicht besonders. Der Flug wird hundert Jahre dauern, und selbst wenn wir die meiste Zeit im Speicher verbringen, müssen wir doch viele Jahre … in diesem Ding zubringen.« Er breitete die Arme aus, um die Enge der Lounge zu verdeutlichen. »Und ich soll alles zusammenhalten? Ausgerechnet ich? Der Straßenpflasterer aus Cork County?«
»Das ist unsere Strafe«, rief sie ihm in Erinnerung.
»Aye.« Auf einmal klang er bitter. »Wir werden bestraft, weil wir uns eine Zukunft wünschen. Also, davon haben wir jetzt genug.«
»Und zwar eine ziemlich gute«, sprang sie auf das Thema an. »Ein ganzes Sternsystem nur für uns. Ein neuer König, eine neue Gesellschaft. Das ist doch gar nicht so schlecht.«
»Mag sein. Übrigens, bin ich dir zu schwer?«
»Ein bisschen schon. Ich wünschte, wir könnten hier drinnen die Schwerkraft abstellen.«
Er schnaubte. »Also, das geht nun wirklich nicht.«
Hatte man eine Weile im Weltraum zugebracht, gewöhnte man sich daran, dass man ständig sämtliche Sterne sehen konnte. Stand man dann wieder auf einem Planeten, der die Hälfte des Sternenhimmels verdeckte und mit seiner Atmosphäre tagsüber das verbliebene Sternenlicht wegfilterte, kam man sich irgendwie betrogen vor. Mit dem Fiffen in der Schwerelosigkeit verhielt es sich ähnlich: Es machte Spaß, und man gewöhnte sich an die totale Freiheit, die man dabei genoss. Unter Schwerkraftbedingungen brauchte man eine Oberfläche, an der man sich abstützen konnte, und man verspürte den Wunsch, hindurchfassen zu können, um in die richtige Position zu kommen. Allerdings gab es für Raumfahrer und ehemalige Raumfahrer Spezialbetten, die ihren Wünschen entgegenkamen, und Conrad spielte hin und wieder mit dem Gedanken, ein solches Bett in seiner Kabine aufzustellen.
Die Schwerkraft abzuschalten aber war strikt verboten. Sie wurde im vordersten Teil des Mannschaftssegments des Schiffes erzeugt, etwa in der Mitte der lang gestreckten Nadel der KRS Neue Hoffnung. Conrad kannte sogar die entsprechenden Fachausdrücke: Ein Zetahertz-Laser – das entspricht einer Trillion Gigahertz –, der mit vier Watt betrieben, mittels zweier Fresnelkondensate zu einem isotropen Strahl von exakt dreißig Metern Durchmesser gebündelt wird und an der Kollapsiumbarriere des vorderen Ertialschilds endet. Das Photon verwandelt sich dabei in ein hochenergetisches spin-positives Graviton, das selbst eine ein Lichtjahr dicke Bleischicht durchdringen würde. Man konnte es nicht ablenken und auch nicht raumweise nutzen. Es war einfach pure Gravitation, und entweder man hatte sie im Schiff oder nicht. Obwohl Xmary über die nötige Autorität verfügte, um die Schubkraft für die Dauer eines Nachmittagsfiffs abzustellen, hätte dies für den Rest der Crew höchst unangenehme Folgen gehabt. Außerdem hätten sie zweideutige Blicke und spöttische Bemerkungen über sich ergehen lassen müssen.
Außerdem hätte auch ohne den Grav-Laser keine Schwerelosigkeit geherrscht, da die Ertialschilde alle möglichen verrückten Drehmomente und Trägheitseffekte bewirkten. Wenn die Gravitation abgestellt wurde, begannen die Leute zu rotieren, mussten sich übergeben, bekamen Zustände und das große Zittern. Man hätte sich mit dem Fiff ganz schön beeilen müssen, um ernsthaften Problemen aus dem Weg zu gehen.
»Bitte ein Bodenhologramm«, sagte Xmary. Ein paar Meter weiter erschien ein verschwommener Kubus. Jedenfalls eine Art von Kubus – holographische Darstellungen wirkten gut, wenn man aufrecht stand, aber richtig mies, wenn man auf dem Boden lag. Dass sie das Hologramm aufgerufen hatte, signalisierte ihm, dass es Zeit zum Aufstehen war. Und da löste sie sich auch schon von ihm und langte nach den Kleidern, die sich ihr sogleich an den Körper schmiegten, als wären sie lebendig.
Conrad langte nach seiner Uniformhose, steckte die Füße hinein und ließ sie hochrutschen. Im Königinreich gab es alle möglichen Arten von Kleidern, darunter Spray-ons, Wrap-ons und Sachen, die so lange, bis man darauf trat oder mit der Faust darauf schlug, aussahen wie ein Klumpen Kitt. Dann aber erwachten sie zum Leben, strafften sich um einen und nahmen einen modischen Schnitt und Farbe an. Conrad und Xmary waren für ihre Generation ein wenig altmodisch. Sie sahen gern den Schnitt der Kleider, bevor sie sie anzogen. Sie mochten es, sie aus dem Fax zu holen, sie zu inspizieren, Änderungen vornehmen zu lassen und sie dann erst anzuziehen.
Dieser ›klassische‹ Stil war im Königinreich auch tatsächlich am weitesten verbreitet, wenngleich die Bestandteile der Kleidung nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Leder, den Textilien alter Zeiten oder den Synthetikfasern der alten Neuzeit hatten. Die Stoffe des Königinreiches waren überwiegend aus Silizium gewebt, und die Fasern waren um den Faktor tausend dünner als ein menschliches Haar. Wie der W-Stein des Rumpfes bewegten diese W-Stoff-Fasern Elektronen auf kreative Weise umher und bildeten Strukturen aus, welche die Eigenschaften von Atomen und Molekülen nachahmten, wodurch sich die scheinbare Zusammensetzung der Kleidung radikal änderte.
Außerdem zogen sie sich einem selbstständig an, jawohl. Warum auch nicht? Conrad hatte hin und wieder natürliche Kleidung getragen – im Freundschaftslager hatte man sie ihm sogar aufgezwungen –, doch das Zeug hielt einen nicht warm und trocken, es atmete nicht und so weiter. Es hielt keine Projektile ab und verhärtete sich bei einem Sturz auch nicht zu Diamantschwamm. Es sah nicht einmal gut aus.
Er und Xmary waren also weder Ludditen noch Flachraumphantasten oder etwas in der Art, außerdem waren die Uniformen der Neuen Hoffnung ziemlich roh – grün und schwarz, mit subliminalem Sternenlicht gesprenkelt. Xmarys Uniform hatte zwei Imperviumspangen am Kragen, während die von Conrad nur eine hatte. Außerdem war ihre anders geschnitten, doch ansonsten waren sie gleich. Beiden sahen einfach toll aus. Jeder konnte jung und schön sein, aber eine modische Erscheinung wurde im Königinreich hoch geschätzt. Vielleicht war dies das einzige Gebiet, auf dem die Meinung der Jugendlichen noch etwas galt.
Als sie beide standen, wirkte das Hologramm viel besser als zuvor, mit Ausnahme eines Streifens, der links von der Mitte darüber hinweglief. Dieser Defekt blieb stationär, während der holographische Kubus durch ihn hindurchrotierte. Seltsam. Auf dem Boden machte Conrad einen ganz ähnlichen Streifen aus verfärbtem Material aus. Er ließ sich auf die Knie nieder und kratzte mit dem Fingernagel daran. Der Streifen fühlte sich anders an als das Pseudometall des Bodens.
»Hmm. Irgendwas stimmt mit dem W-Stein nicht«, murmelte er.
»Gebrochene Fäden?«, schlug Xmary vor.
»Scheint mir eher eine Kontamination zu sein.« Es gab noch etwas, womit er sich leidlich auskannte: Materieprogrammierung und die Risiken und Fallstricke des W-Steins. Irgendwann wollte er einmal Architekt werden. »Die Zusammensetzung der Fäden hat sich verändert. Sie funktionieren noch, schieben immer noch Elektronen umher und bilden Pseudoatome aus, aber nicht die richtigen.«
»Das ist eine vollkommen gerade Linie«, sagte der Captain, »aber sie verläuft nicht entlang der Schiffsachse. Sie schneidet sie. Ich wette, das ist eine Spur kosmischer Strahlung.«
»Hmm. Ja, kann sein. Am Schott ist auch ein Fleck. Ein schweres Partikel hat das Schiff mit Lichtgeschwindigkeit durchschlagen.« Er zeichnete den Flugweg mit dem Finger nach und gab dabei ein zischendes Geräusch von sich. »Ich werde das im Wartungslogbuch vermerken, und wenn die Nanobs das in ein paar Tagen nicht repariert haben, müssen wir die Instandsetzungsmannschaft aufwecken.«
»Klingt gut«, meinte sie und erschauerte plötzlich. »Wir erleiden die gleichen Schäden. Unser Körper, meine ich.«
»Das war auch schon auf der Erde so. Vielleicht in geringerem Maße und mit weniger Energie.« Er deutete mit einem Nicken auf den Streifen. »Aber auch dort sind ständig geladene Partikel durch uns hindurchgeflogen. Haben Löcher in die Zellen gepiekst, DNA-Schnipsel rausgeschlagen … Schließlich ist das einer der Gründe, weshalb die Menschen früher gealtert sind, stimmt’s? Damals, als es noch keine Faxgeräte gab, die selbst den kleinsten Kratzer reparieren?«
»Igitt, Conrad! Ich brauche keine Biologienachhilfe, zumal nicht von einem, der auf der Schule versagt hat. Zeig uns bitte mal eine Ansicht von Planet Nummer Zwei.«
Der Boden brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass sie mit ihm geredet hatte. Dann wurde der durchscheinende holographische Kubus durch eine durchscheinende holographische Kugel ersetzt. Allerdings war sie in der Mitte heller und an der Ober- und Unterseite dunkler und blauer, und sie war umhüllt von einer dünnen Dunstschicht, welche die Atmosphäre darstellen sollte.
Der Captain räusperte sich. »Der zweite Planet, mein Lieber.«
»Jedenfalls angenähert«, erwiderte Conrad. »Das hätte auch ein Fünfjähriger zeichnen können.«
»Also, man hat dort tatsächlich Meere und so etwas wie eine kleine Polkappe gefunden.«
»Wer soll das gewesen sein? Ich habe keine Ahnung, woher man das wissen will!«, protestierte Conrad. Er hatte sich auch ein wenig mit Astronomie beschäftigt – im Weltraum, als es um Leben und Tod gegangen war – und wusste, wie schwer es war, ein verschwommenes, fernes, stecknadelkopfgroßes Objekt zu vergrößern. »Alle Aussagen beruhen auf der Analyse des von der Planetenatmosphäre reflektierten Lichts, hab ich recht?«
»Also, die Luft ist jedenfalls atembar.«
»Vielleicht«, sagte Conrad. »So gerade eben. Ich habe gehört, man würde dort an Kohlendioxidvergiftung sterben.«
»Atembar für irgendwelche Wesen, meine ich. Es gibt dort Leben.«
»Hmm. Ja.« Das jedenfalls ließ sich nicht abstreiten. Ohne biochemischen Stoffwechsel hätte es in der Atmosphäre keinen ungebundenen Sauerstoff gegeben und wahrscheinlich auch keinen ungebundenen Stickstoff.
»Präg dir das gut ein«, sagte Xmary. »Damit du es nie wieder vergisst. Wir werden uns nicht immer mit solchem Kleinkram beschäftigten müssen. Ehe wir uns versehen, werden wir eine eigene Welt aufbauen.«
Conrads Lächeln war ein wenig bitter. »Wenn man diesen Knalltüten Glauben schenken will, was man vielleicht besser lassen sollte, dann besitzt Planet Nummer Zwei die vierfache Erdmasse. Wie lang ist dort gleich noch ein Tag, neunzehn Erdtage? Das solltest du dir einprägen, meine Liebe: Ungeschützt würdest du auf der Planetenoberfläche in wenigen Stunden sterben. Der Planet dient nur dazu, das Gewissen des Königinreiches zu beschwichtigen; Barnard ist so lebensfeindlich wie die Venus oder die Trümmer des Kuipergürtels.«
»Auf der Venus leben Menschen. Und im Kuipergürtel auch.«
»Stimmt. Wir haben dort gelebt. Aber wir hätten uns notfalls jederzeit zur Erde faxen können. Frische Luft, Sonnenschein … Auf Barnard gibt es das nicht. Jedenfalls wird es lange dauern, bis es das gibt.«
An der Tür ertönte ein Scharren, dann ein dumpfer Laut, als hätte jemand den Ellbogen dagegengerammt. Und dann waren ganz leise Stimmen zu vernehmen. Ein saugendes Geräusch, als wollte jemand ausspucken, dann schwenkte die Luke ein Stück nach innen.
»Hallo?«
»Hallo?«, erwiderte Xmary.
»Alle schön brav da drinnen?« Es war die Stimme von Bascal Edward de Towaji, dem ehmaligen Pilinisi Sola und Pilinisi Tonga, dem Prinzen von Tonga und des Königinreiches Sol. Jetzt war er der frisch gewählte König von Barnards Stern.
Die Luke war stimmverriegelt gewesen, doch das bedeutete nur wenig in einer programmierbaren Welt, wo königliche Order den Gehorsam nicht nur der Maschinen, sondern auch der Materialien erzwingen konnten, aus denen sie bestanden. Immerhin hatte der König die Höflichkeit besessen, vorher anzuklopfen.
»Hallo, Bascal«, sagte Xmary. »Komm rein.«
Die Luke öffnete sich vollständig, und Bascal betrat die Lounge. Er trug die gleiche Uniform wie Conrad und Xmary, seine aber war purpurrot und hatte keine Abzeichen. Anders als seine Mutter, die Königin von Sol, die für jeden bewohnten Planeten ihres Reiches einen Ring trug und sich bisweilen auch mit dem Erdszepter schmückte, trug er weder eine Krone noch irgendwelche anderen Insignien seines Amtes. Barnards Bewohner – insgesamt zwanzig Personen – hatten noch keine Zeit gehabt, so etwas zu entwerfen. Vielleicht würden sie auch ganz darauf verzichten.
Bascal besaß die braune Haut oder ›Mischlingskraft‹, wie er gern sagte, seiner Eltern: eine dunkelhäutige tonganische Mutter und ein katalanischer Vater mit olivfarbener Haut und braunem Haar. Bascal war ein Sohn der Inseln, jetzt aber ins lebensfeindliche Vakuum verbannt und zu einem beschwerlichen Leben im Weltraum verurteilt.
»Hi«, sagte er ein wenig dümmlich. »Stören wir?«
»Nicht mehr«, erwiderte Xmary. »Vor ein paar Minuten hättet ihr allerdings tatsächlich gestört.«
»Na schön.« Bascal entfernte sich von der Luke, worauf eine Frau eintrat. Ihre Uniform – die grün-schwarz war wie die der übrigen Besatzungsmitglieder, auch wenn sich die Farben mit ihrer hellblauen Haut bissen – trug das Maschinistenabzeichen.
»Ihr kennt Brenda Bohobe«, sagte Bascal.
Xmary reagierte verärgert. »Sie ist meine Speicherverwalterin, Dritte Maschinistin und Faxspezialistin, Majestät.«
Und noch mehr. Brenda hatte zusammen mit Robert, Agnes und den anderen zu den Blauen Schiffsbesetzern gehört. Conrad und Xmary hatten sie gleichzeitig mit Bascal inmitten der Wirren des Kinderaufstands kennengelernt. Der König nahm es mal wieder allzu genau, eine Schwäche, die er kurz nach seiner Ernennung angenommen hatte.
»Hi, Brenda«, sagte Conrad.
Brenda musterte ihn verärgert und selbstgefällig. »Du bist nicht zufällig für die Unordnung verantwortlich, oder?«
»Nicht dass ich wüsste, Dritte Maschinistin.« Conrad bemühte sich, herablassend und distanziert zu klingen. Schließlich war er praktisch ihr Vorgesetzter. Allerdings ärgerte er sich auch diesmal wieder über ihre spitze Art.
»Ah«, sagte Bascal, als er das Hologramm bemerkte. »Planet Nummer Zwei. Also, das ist mal ein Anblick für naive Augen, die noch nie etwas nicht Machbares geschaut haben. Wir planen die Übernahme, nicht wahr? Seine Unterwerfung unter Menschenjoch? Oder wollen wir dort Freunde finden und uns selbst dieser Welt zum Geschenk zu machen? Aber vielleicht sollten wir eher von Frauenjoch sprechen: etwas bis zur Unterwerfung lieben. Wie auch immer, Freunde, es ermutigt mich, dass ihr im Licht dieser Welt gefifft habt. Ich wollte ihr bereits einen Namen geben – man hat mir gesagt, das sei mein Vorrecht, doch ich finde, wir sollten damit besser warten, bis wir uns förmlich miteinander bekannt machen. Bis wir wissen, wie sie ist, wie sie uns behandelt.«
»Du solltest dich mal wieder rasieren«, bemerkte Conrad. Das war nichts weiter als eine Redewendung; er meinte damit, Bascal solle seine Gesichtszellen so umprogrammieren, dass kein hässlicher Haarwuchs mehr entstand. Oder aber in ein Fax treten und sich einen richtigen Bart zulegen.
»Ach, wirklich? Wer sagt das?«
»Oder willst du dir etwa einen Bart wachsen lassen? Wachsen?«
»Auf die altmodische Art«, meinte Bascal. »Das kommt mir passender vor, als einfach einen auszudrucken oder vielmehr mich mit Bart auszudrucken. Ich kostümiere mich nicht, Conrad – ich wachse in eine Rolle hinein.«
»Zum Glück sind wir alle gespeichert«, stichelte Conrad. »Du siehst aus, als wolltest du wieder Pirat werden. Oder Landstreicher.«
»Ha, ha. Ich lach mich tot. Ein König braucht einen Bart, findest du nicht? Der drückt eine gewisse Würde aus.«
Conrad lächelte höhnisch. »Auch bei einem verbannten König?«
»Ganz besonders bei einem verbannten König, Boyo. Ich habe hier keine richtigen Aufgaben. Ich leite die Expedition, aber unsere liebe Xmary befehligt das Schiff. Meine Untertanen befinden sich im Zustand des Quantenschlummers, und wenn sie aufwachen, werden sie so beschäftigt sein, dass sie mich nur dann angucken werden, wenn sie emotionaler Unterstützung bedürfen. Im Unterschied zu meinen Eltern nehme ich meine Rolle als Galionsfigur ernst. Ich herrsche selbst, Punkt.«
Xmary lächelte ohne viel Wärme. »Dazu braucht es mehr als einen Bart, Majestät.«
Bascals Lächeln war nicht minder höflich als das ihre. »Ich habe nie etwas anderes behauptet, Captain. Es stellt eine große Verantwortung dar, beim Nichtstun einen guten Eindruck zu machen. Und zwar in alle Ewigkeit, denn wir werden niemals sterben! Aber lasst mir nur ein wenig Zeit, und ich werde nichts besser machen als je ein anderer zuvor. Ich werde der König des Nichts sein, und das Nichts wird sich in Bewunderung vor mir verneigen.«
Xmary musste unwillkürlich lachen. Sie und Bascal hatten mal eine Beziehung gehabt, die ein bitteres Ende genommen hatte, und soweit Conrad das erkennen konnte, waren die Wunden nie richtig verheilt.
»Musst du dich nicht um das Schiff kümmern?«, mahnte der König behutsam. »Ich habe die Erde vor meinem Fenster gesehen. Das sind tückische Regionen, in denen es von Farbsplittern und W-Stein-Brocken wimmelt. Die Rückstände der Zivilisation: tödliche Geschosse, alle miteinander.«
»Robert hat das Kommando übernommen, Sire. Er besitzt mein volles Vertrauen.«
»Ah, schön für ihn. Wenngleich ihm dieser Rammbock von einem Schiff allzu leicht und dünnhäutig erscheinen mag.«
»Jedenfalls«, sagte Brenda, »fühle ich mich sicher, wenn ich weiß, dass er auf der Brücke ist.«
Klar, wenn Xmary steuerte, sah es natürlich ganz anders aus. Conrad öffnete den Mund, um Brenda zurechtzuweisen.
Aber wenn sich der König von Barnard auf eines verstand, dann darauf, einer Unterhaltung eine neue Wendung zu geben, bevor sie unangenehm zu werden drohte. Er wandte sich dem Fenster zu und breitete die Arme aus. »Wo sind sie? Die Erde? Der Mond? Wir sind hierhergekommen, um uns in ihrem Glanz zu baden.«
»Da kommt ihr leider zu spät«, sagte Conrad. »Wenn ihr möchtet, kann ich noch mal zurückspulen lassen. Oder die Vergrößerung ändern oder so was in der Art.«
Bascal aber tat den Vorschlag mit einem Stirnrunzeln ab, das teilweise durchaus ernst gemeint war. »Nein, nein. Das wäre nicht das Gleiche. Als Playback kann ich die Erde schließlich jederzeit sehen, nicht wahr?«
»Aber in Echtzeit vielleicht nie wieder«, bemerkte Brenda säuerlich. Vielleicht aber war das ja auch ihr normaler Tonfall; bei ihr hatte man Mühe, den Unterschied zu erkennen.
»Tja«, sagte Conrad im dienstlichen Tonfall des Ersten Offiziers, »vielleicht sollten wir jetzt gehen.« Er wandte sich Xmary zu. »Sollen wir den Spaziergang fortsetzen?«
»Klar.«
Als sie draußen waren und die Luke hinter sich schlossen, flüsterte Conrad ihr zu: »Die beiden sind in letzter Zeit häufig zusammen. Eigentlich trifft man ihn gar nicht mehr alleine an. Läuft da was? Haben die was miteinander?«
»Schon seit einer ganzen Weile«, antwortete Xmary. »Weißt du, für einen Ersten Offizier, der für die Besatzung zuständig ist, bekommst du nicht besonders viel mit. Daran solltest du noch arbeiten.«
»Also, ich bin vielleicht etwas langsam von Begriff, aber irgendwann macht’s auch bei mir Klick.« Nach kurzem Überlegen setzte er hinzu: »Sollten wir uns vielleicht einen Titel für Brenda ausdenken? So was wie Philander oder Bettgenosse, nur für Frauen? Um ihren Status als Geliebte des Königs deutlich zu machen?«
»Wie wär’s mit Xanthippe?«, schlug Xmary liebenswürdig vor, setzte sich aufs Geländer und rutschte in die Tiefe.