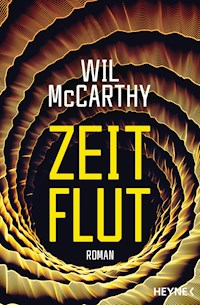6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Grenzenloser Machthunger
Im Königreich SOL gibt es keinen Hunger, keine Kriege, keine Krankheiten und keinen Tod. Alle relevanten Daten sind gespeichert und können wieder in Materie übersetzt werden. Geschieht ein Unfall, kann man jederzeit auf ein Backup der betroffenen Person zurückgreifen und sie wiederherstellen. Niemand braucht mehr zu altern, das ewige Leben ist garantiert. Aber ist das wirklich eine glückliche Zukunft? Was geschieht mit der nächsten Generation, die nie die Gelegenheit haben wird, an die Stelle der älteren zu treten? Was tut ein ehrgeiziger Prinz, der keine Möglichkeit sieht, in den nächsten Jahrtausenden den Thron zu besteigen? In Ferienlager auf künstlichen Planeten verbannt, schlagen die gelangweilten Jugendlichen die Zeit tot. Kein Wunder, dass unter solchen Umständen verzweifelte Fluchtfantasien entstehen. Und so schmiedet eine Gruppe unter der Führung des Prinzen von SOL einen unglaublichen Plan, um sich ihre eigene Zukunft zu schaffen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Ähnliche
Das Buch
Eine traumhafte Zukunft: Im Königreich Sol gibt es keinen Hunger, keine Kriege, keine Krankheiten und keinen Tod. Alle relevanten Daten sind gespeichert und können wieder in Materiestrukturen übersetzt werden. Geschieht ein Unfall, kann man jederzeit auf ein Backup der betreffenden Person zurückgreifen und sie wiederherstellen. Niemand braucht mehr zu altern, das ewige Leben ist garantiert. Aber ist das auch eine glückliche Zukunft? Was geschieht in der nächsten Generation, die nie Gelegenheit haben wird, an die Stelle der älteren zu treten? Was tut ein ehrgeiziger Prinz, der keine Möglichkeit sieht, in den nächsten Jahrtausenden den Thron zu erben? In Ferienlager auf künstlichen Planeten verbannt, schlagen die Jugendlichen die Zeit tot – eine endlose und quälend langweilige Zeit. Kein Wunder, dass unter solchen Umständen verzweifelte Fluchtphantasien entstehen. Und so schmiedet eine Gruppe Jugendlicher unter der Führung des Prinzen von Sol einen unglaublichen Plan, um sich ihre eigene Zukunft zu schaffen …
Nach »Der Schöpfer der Ewigkeit« setzt Wil McCarthy mit »Die Rebellion des Prinzen« seine atemberaubende Science-Fiction-Bestsellerserie SOL fort.
Der Autor
Wil McCarthy lebt mit seiner Familie in Denver, USA, und arbeitet als Ingenieur. Als Science-Fiction-Autor wurde er durch zahlreiche brillante Kurzgeschichten populär, denen mittlerweile mehrere Romane folgten. Darin befasst er sich immer wieder mit der Frage nach den zukünftigen Perspektiven der Menschheit, wobei er es meisterhaft versteht, die literarischen und wissenschaftlichen Aspekte seiner Themen zu verknüpfen.
Mehr zu Autor und Werk unter: www.wilmccarthy.com
Titel der amerikanischen Originalausgabe
THE WELLSTONE
Deutsche Übersetzung von Norbert Stöbe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Deutsche Erstausgabe 1/2007 Redaktion: Wolfgang Jeschke Copyright © 2003 by Wil McCarthy Copyright © 2007 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagillustration: Dirk Schulz Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
eISBN: 978-3-641-19228-0V001
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Für Rich,der niemals erwachsen werden wird
1. KAPITEL
Die Himmelssphären
Ein Mensch in einer Messingkugel.
Ein Mensch, einsam und allein im Vakuum des Weltraums.
Ein Mensch, der mit einer Geschwindigkeit von vierzig Metern pro Sekunde auf einen massiven Fels zurast – schnell genug, um zu zerschellen, was der törichte Abschluss eines langen und unbestreitbar törichten Lebens wäre und zur Folge hätte, dass seine Kinder schutzlos zurückblieben.
In der Sichtluke steht das Planetchen Varna, sein Ziel, gehüllt in weiße Wolken und bedeckt mit funkelnden Meeren, Grasland und Wäldern, deren vertikale Ausdehnung gegenüber dem tellerförmig gebogenen Horizont bereits hervortritt. Kein Planet: ein Planetchen. Es sieht klein aus, weil es klein ist, kaum zwölfhundert Meter im Durchmesser. Ein Kern aus hochverdichteter Materie, insgesamt fünfzehn Neubel – sehr hübsch. Die Oberfläche ist exquisit gearbeitet; er sieht Kontinente, Inseln, majestätische kleine Gebirgszüge, die über die Baumwipfel aufragen. Teleskope, wird ihm bewusst, werden dem fernsten von Lunes Trabanten nicht gerecht.
Er heißt Radmer oder Conrad Mursk, falls Sie alt genug sind. Nur wenige Menschen sind alt genug. Radmers Alter lässt sich nur schwer schätzen – sein Haar ist noch immer teilweise blond, seine welke Haut nicht sonderlich faltig. Er besitzt noch seine eigenen Zähne, wenngleich sie stark abgenutzt sind. Einige sind abgebrochen. Doch während er die Schwungscheibe in Bewegung hält, welche die Gyroskope dreht, die verhindern, dass die Sphäre ins Trudeln gerät, wirken seine Bewegungen trotz der Schwerelosigkeit irgendwie schwerfällig. Ist er vielleicht älter, als er aussieht? Diese Frage drängt sich einem auf.
Um ehrlich zu sein, ist die Luft in der Dreimetersphäre nicht sonderlich gut. Es ist kühl und feucht und riecht nach Kohlendioxid, feuchtem Messing und dem Chloridgestank der verbrauchten Sauerstoffkerzen. Verbrauchte Atemluft – die einzige Möglichkeit, sie aufzufrischen, besteht darin, sie abzulassen, doch nach anderthalb Tagen sind ihm die Kerzen und die Zeit ausgegangen, und als der Moment der Wahrheit näher rückt, beschleicht ihn eine gesunde Angst. Das Ablassventil zu öffnen, wäre im Moment zu riskant.
Er versetzt dem Drehmechanismus einen letzten Tritt, schiebt den Sessel ein paar Kerben in der Verankerung zurück und klappt den Sextanten auseinander. Das dauert mehrere Sekunden – es ist ein kompliziertes Instrument mit zahlreichen Anhängseln. Als er es in den Aussparungen der Armlehnen verankert und richtig eingestellt hat, nimmt er kurz hintereinander mehrere Messungen vor, bis der kleine Messingpfeil zur Ruhe kommt. Dann klappt er das Gerät seufzend und voller Sorge wieder zusammen, verstaut es sorgfältig im Regal und schiebt den Sessel erneut vor, worauf er die Schwungscheibe wieder in schnellere Drehung versetzt. Eine Kurskorrektur erfordert nun einmal ein gewisses Maß an Stabilität.
Als er sich vergewissert hat, dass die Gyros mit voller Leistung laufen, nimmt er die Kurskorrekturketten in die Hand und führt mit einer Reihe von Ruckbewegungen die mit dem Sextanten bestimmte Manöverfolge aus. Womm! Womm! Die Explosivladungen an der Außenhülle schütteln die Sphäre durch. Zündung, Zündung – oben, vorne, steuerbord, steuerbord … Er hat das Gefühl, unter die Hufe einer Pferdeherde geraten zu sein, doch noch ehe das Dröhnen in seinen Ohren verhallt ist, hat er den Sextanten bereits wieder in Position gebracht und nimmt die entscheidenden Messungen vor.
Die Planetchenatmosphäre ist ebenso winzig wie der Rest, und genau das ist das Problem: Bei senkrechtem Landeanflug würde er die Strecke von der dünnen Stratosphäre bis zur Lithosphäre in weniger als einer halben Sekunde zurücklegen. Selbst bei perfektem Timing ist diese Zeitspanne zu kurz, als dass der Bremsschirm sich entfalten könnte. Um den Aufprall zu überleben, muss er dicht über den Planetenrand hinwegfliegen und horizontal in die Atmosphäre eintauchen. Einen Apfel zu treffen ist leicht; ihm die Schale säuberlich abzurasieren ist wesentlich schwieriger, zumal wenn man selbst das Projektil ist.
Hätte er vielleicht eine Flaschenpost absetzen sollen? Oder gleich ein ganzes Dutzend Flaschen, um alle Planetchen von hier bis zur verwüsteten Erde abzudecken? Das allerdings wäre nun tatsächlich eine leere Geste gewesen, freilich leichter zu bewerkstelligen. Dabei wird er anderswo gebraucht und an mindestens einem Dutzend verschiedenen Orten dringend erwartet, während es auf Lune immer schlimmer wird. Doch aus irgendeinem Grund hat dieser dubiose Auftrag sein Interesse geweckt. Nein, mehr als das: seine Hoffnung. Kann ein Mensch ohne Hoffnung existieren? Und gilt das nicht erst recht für eine ganze Welt?
Die mit dem Sextanten ermittelten Daten sind jedoch alles andere als ideal: Er hat auf zwei von drei Bewegungsachsen überkorrigiert. Mit einem noch schwereren Seufzer als zuvor verstaut er das Gerät, bereitet die nächste Kurskorrektur vor und löst die Ketten aus den Arretierungen. Als er an der ersten Kette zieht, wird er diesmal nicht von einer Pferdeherde überrannt. Es passiert gar nichts.
Mit jähem Schreck wird ihm bewusst, dass er Korrekturladungen vergeudet. Er hat ganz vergessen, ein paar auf jeder Achse für den letzten Abschnitt des Landeanflugs aufzusparen. Lässt sich der Fehler wieder gutmachen? Durch eine Neuorientierung des Raumschiffes, die er vor der Landung sowieso ausführen muss? Ja, gewiss, es sei denn, er hat wirklich Pech gehabt, und die Ladungen an allen sechs Orientierungsachsen der Sphäre gehen ihm gleichzeitig aus.
In der vorderen Luke ist nichts als Varna zu sehen: unter einem Wolkenwirbel sind bereits einzelne Bäume zu erkennen. Vorsichtig ausgedrückt, pressiert es allmählich.
Die Höhenkontrolle lässt sich nur manuell bedienen; Radmer wirft den Sicherheitsgurt ab und katapultiert sich zu einer Reihe von Griffen, die an der Innenwand der Sphäre montiert sind. Sie sind kalt, ihre Temperatur liegt nur knapp über dem Gefrierpunkt, und sie sind so feucht, dass er fest zupacken muss, um nicht abzurutschen.
Als die Außenhülle sich in der Halterung bewegt, die sie an der Stelle, wo seine Füße stehen, mit dem Innenkäfig verbindet, ertönt ein metallisches Kreischen und Ächzen, Messing gegen Messing. Die Schwungscheibe und die Gyros haben eine fixe Orientierung im Raum, während die Dreimetersphäre mitsamt dem Sessel und den Staufächern um sie herum rotiert. In der einen Luke blitzt kurz die Sonne auf; in der anderen die grün-weiße Oberfläche von Lune. Dort kommt er her.
Wie die meisten Männer seines Alters ist Radmer erheblich kräftiger, als es auf den ersten Blick scheint. Gleichwohl ist es ebenso mühevoll, die Rotation der Hülle zu beenden, wie sie in Gang zu setzen. Er kämpft gegen seine eigene Kraft, gegen den Schwung, den er selbst erzeugt hat. Trotz der Kälte gerät er unter dem Mantel und den Ledersachen ins Schwitzen.
Er würde die Hülle gern so ausrichten, dass der Sessel nach hinten weist, damit er beim Aufprall besser geschützt ist. Denn schließlich kann sogar die beste Landung ganz schön unsanft sein. Da die Steuerbordladungen jedoch aufgebraucht sind, bliebe immer noch eine unkorrigierbare Achse übrig. Und so richtet er den Stuhl zu den Sprengladungen hin aus, um neunzig Grad gegenüber seiner Wunschrichtung versetzt, feuert zwei rechtwinklig zueinander angebrachte Ladungen ab, richtet den Sessel dann wieder nach vorn und schnallt sich eilig an, um eine weitere Sextantenmessung vorzunehmen.
Perfekt? Nah genug? Nein, er liegt schon wieder daneben und kommt von der idealen ballistischen Flugbahn ab. Er nimmt die Voreinstellungen für eine weitere Kurskorrektur vor, erkennt, dass ihm nicht mehr genug Zeit bleibt, und verstaut stattdessen eilig den Sextanten, damit der sich nicht seinerseits in ein verselbstständigtes Projektil verwandelt.
Er macht Anstalten, sich erneut loszuschnallen und den Sessel nach hinten zu drehen, um den Aufprall abzudämpfen, aber dazu ist nun wirklich keine Zeit mehr, die Hülle singt bereits von der Luftreibung. Deshalb krallt er die eine Hand um die Armlehne und die andere um die Reißleine des Bremsfallschirms und bereitet sich darauf vor, gegen die Gurte nach vorn geschleudert zu werden.
Er könnte jetzt beten oder Schlachtgesänge grölen, aber vielleicht reicht es schon, daran zu denken. Jedenfalls geht es schneller: In einem Augenblick spult er im Geiste gleich eine ganze Reihe Lieder ab. Und dann prallt die Sphäre gegen die dichteren Luftschichten – sanfter als erwartet. Was bedeuten könnte, dass er zu hoch gezielt hat und mit zu flachem Winkel auftrifft. Wird er von der Planetchenatmosphäre abgleiten und zu seiner Beschämung wieder lunewärts geschleudert werden?
Die Luft kreischt, und einen Moment lang erblickt er Varna gleich durch drei verschiedene Luken. In der vierten ist der dunstige, schwarz-blaue Himmel zu sehen. Er kann tatsächlich einzelne Grashalme erkennen, und dann weicht der Boden wieder zurück und es wird höchste Zeit, den Bremsfallschirm auszulösen. Das plötzlich spürbare Gewicht seiner Arme kommt ihm zu Hilfe, als er die Reißleine zieht. Während er stark abbremst, blickt er quer durch die Sphäre nach ›unten‹. Er hört, wie sich der Fallschirm begleitet vom Klirren der Messingklappen entfaltet, und dann drückt die Luft den Bremsfallschirm hinter das Raumfahrzeug und strafft die Leinen, und Radmer blickt auf einmal tatsächlich in die richtige Richtung.
Dann schlägt das Unheil zu, in Form eines Baumwipfels mit ausladenden Ästen. Er trifft ihn nicht fest, die Akazienblätter ratschen lediglich über die Lukenverglasung, doch der kurze Kontakt bewirkt, dass sich die Sphäre um den Innenkäfig dreht. Was schlecht ist, denn der Bremsfallschirm, der sich noch nicht vollständig entfaltet hat, wird verzogen – Radmer kann ihn sehen, ein orange-weißer Wimpel, dessen Saum sich unentwirrbar verheddert.
Und dann macht die blaue Atmosphäre wieder der Schwärze des Weltraums Platz, und nach drei langen Sekunden des Abbremsens herrscht abermals Schwerelosigkeit. Er hat das Planetchen verfehlt. Er hat das verfluchte Planetchen tatsächlich verfehlt. Der Anblick, der sich ihm in den langsam rotierenden Luken bietet, ist eindeutig: Varna schrumpft hinter ihm.
Oder bewegt Varna sich seitlich?
Kommt Varna etwa wieder näher? Ja, langsamer als zuvor, aber es kommt eindeutig näher. Weil er die dichte Atmosphärenschicht durchstoßen, einen Baum gestreift und den Bremsfallschirm ausgelöst hat, der ihn zwar nicht ausreichend abbremsen konnte, ihn aber zumindest unter die Fluchtgeschwindigkeit des Planetchens verlangsamt hat.
Diesmal pfeifen keine verdrängten Luftmassen, sondern es ist lediglich ein leises Rauschen zu vernehmen. Lauter freilich ist das Geräusch des Wassers, in das er hineinklatscht, worauf die Sphäre sich sogleich dreht; durch die Luken sieht er Gischt, blaues Wasser, blauen Himmel und braunen Sand oder Schlick, der vom Grund aufgewirbelt wird.
Die Sphäre rotiert noch eine Weile um die quietschende Gyroplattform, dann gibt die sich geschlagen und beginnt sich ebenfalls zu drehen. Die Lager, die sie mit der Außenhülle verbinden, bewegen sich nicht mehr. Der Sessel macht die Drehbewegung mit, und im nächsten Moment weiß Radmer schon nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Plötzlich kommt ruckartig alle Bewegung zum Erliegen. Er schaut nach oben: Da ist nur der Himmel.
Er ist auf dem Planetchen gelandet. Sein verrückter Plan hat sich im Nachhinein als ausgesprochen vernünftig erwiesen.
An den Seiten sieht er Fische, wogendes Gras und Sonnenschein, der durch flaches Wasser fällt. Die eine Seite der Sphäre liegt höher, sodass die Luke zur Hälfte aus dem Wasser ragt. Das Ufer ist hinter der Wasserkante verborgen, doch in der Ferne sind Baumwipfel zu sehen, vielleicht sogar der, den er getroffen hat. Durch die Luke zwischen seinen Beinen sieht er den sandigen Meeresboden und niedergedrückten Tang.
Er nimmt sich einen Moment Zeit, um sich zu sammeln – die Landung war tatsächlich etwas unsanft –, doch die Zeit drängt, und sein Anliegen duldet keinen Aufschub. Er tastet nach dem Gurtverschluss: feuchtes, körperwarmes Messing. Zum hundertsten Mal an diesem Tag schnallt er sich los; der Vorgang ist ihm inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen.
Aufgrund seiner Kugelform war damit zu rechnen, dass sein Raumschiff bei der Landung ein Stück weit rollen und in einer Zufallsorientierung zur Ruhe kommen würde. Aus diesem Grund hat die Sphäre zwei Ausgänge. Der eine befindet sich derzeit unter Wasser, der andere weist in schiefem Winkel himmelwärts. Er benutzt das Schwungrad und den Gyro als Trittleiter.
Er bewegt sich behutsam; zwar ist es eine kleine Welt, doch aufgrund des superdichten Neutroniumkerns herrscht hier ein Ge, etwa so viel wie auf der Oberfläche von Lune. Oder wie damals auf der Erde, wenn man so weit in den Nebel der Geschichte zurückgreifen will. Mit einer Hand hält er sich an einem rutschigen Griff fest, der an der Hülle befestigt ist; mit der anderen öffnet er den Lukenverschluss. Das Rad lässt sich mühelos drehen – kein Quietschen, keine Reibung –, was er nicht ohne Erleichterung beiläufig registriert.
Wie viele weise Männer macht auch Radmer sich viele Sorgen, und dieser Auftrag hat seine Vorstellungskraft ungewöhnlich stark in Anspruch genommen. Doch obwohl die Sphäre in aller Eile gebaut wurde, muss er den Werkzeug- und Waffenschmieden und den Uhrmachern von Highrock zugestehen, dass sie ihr Handwerk verstehen.
Jetzt, da er heil gelandet ist, besteht gute Aussicht, dass ihn sein Raumfahrzeug auch wieder nach Hause bringen wird. Verglichen mit diesem Planetchen ist Lune ein ausgesprochen großes Ziel, das praktisch nicht zu verfehlen ist; solange die Motoren anspringen und der Bremsschirm sich ordentlich öffnet, sollte er spätestens kommenden Freitag wieder mitten im Getümmel sein.
Im allgegenwärtigen Tod, im Elend, inmitten zusammenbrechender Nationen. Die Bewohner von Lune sind nicht Radmers leibliche Kinder, doch viele sind auf die eine oder andere Weise seine Nachfahren. Und die Welt ist sein Werk oder war es zumindest vor langer Zeit. Wie gern würde er sein Leben dafür lassen, sie zu bewahren!
Die Luke klappt nach innen und prallt mit einem lauten Klonk gegen die Hülle, dann pendelt sie hin und her, während Radmer auf der Außenhülle nach einem Halt sucht und sich schließlich durch die Öffnung schiebt.
Es ist, als betrete er einen angenehmen Traum. Es ist warm, und der wolkenlose Himmel und die strahlende Sonne erzeugen funkelnde Reflexe auf dem Meer, das an der breitesten Stelle gerade mal eine Ausdehnung von achtzig Metern hat und sich fast von Horizont zu Horizont erstreckt. Hinter dem wenige Meter breiten jungfräulichen Strand wachsen Palmen und Elefantengras. Die Luft riecht würzig, irgendwie nach Eiscreme und Salz. Wie frisches Bier und Blumen.
Weiter hinten, jenseits des gekrümmten Planetchenrands, ragen zwei flache, mit grünen Pinien und Akazien bestandene Hügel auf, und auf einem der beiden Hügel steht das, was Radmer zu dieser Reise veranlasst hat und was der Astronom Rigby in einer besonders klaren Nacht von seinem Bergobservatorium aus zu beobachten meinte: ein kleines weißes Landhaus aus W-Stein-Marmor.
Auf einer großen, universalen Punkteliste wechselt die Bewertung für Radmers Obsession von ›vernünftig‹ zu ›hochgradig vernünftig‹. Und so legt er wie ein pflichtbewusster Soldat den Mantel und die lederne Reisekluft ab, springt ins Wasser und schwimmt auf den Hügel zu.
Weit ist es nicht. Bald darauf betritt er tropfend den weißen Strand und schreitet in seinem Filzanzug im Palmenschatten auf die gar nicht so fernen Hügel zu. Es ist ein wenig dunstig, was Absicht sein mag; der Dunst verstärkt die Illusion von Weite. Als er durch eine brusthohe Graswand stapft, verliert er das Haus vorübergehend aus dem Blick und ist überrascht, als es unvermittelt vor ihm wieder auftaucht.
Ja, es ist überwachsen und überschattet. Doch was da auf der kleinen Hanglichtung steht, ist alles andere als eine Ruine. Und unbewohnt ist es auch nicht. Davor kniet ein nackter Mann am Boden, dem das weiße, ungekämmte Haar bis zur Hüfte reicht.
Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie etwas erblicken, das Ihnen auf Anhieb vertraut vorkommt? Wenn sich Ihnen die Nackenhaare sträuben, es im Bauch kribbelt und Sie am ganzen Körper eine Gänsehaut bekommen? Genauso fühlt sich Radmer, als er sich dem Landhaus nähert und den davor knienden Mann beäugt.
Er erwägt, seinerseits niederzuknien, nimmt jedoch davon Abstand.
»Bruno«, sagt er stattdessen aus zehn Metern Abstand. »Bruno de Towaji.« Er könnte dem Namen eine ganze Latte von Ehrentiteln voranstellen, beziehungsweise daran anhängen, doch das erscheint ihm unangemessen in Anbetracht dieser kläglichen Gestalt. Gleichwohl liegt kein Zaudern in seiner Stimme, er ist sich seiner Sache sicher. Dieses Gesicht lässt keinen Irrtum zu. Wohl wahr, die Zeit hat darin ihre Spuren hinterlassen: Die Älteren altern langsam, aber auf ihre ganz spezielle Art. Bart und Haar des Mannes sind gelblich weiß und so lang, dass die Spitzen gespalten und abgebrochen sind. Die Haut ist glatt, aber mit Altersflecken übersät und zeigt das matte Braun akkumulierten Melanins, das sich an einigen Stellen verstärkt angesammelt hat. Die Zähne in dem schlaffen, offenen Mund sind bis auf kleine Stummel abgenutzt.
Radmer hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Mann, doch da seine Haare und Zähne länger sind und weil er bekleidet ist, fällt das nicht ganz so auf. Obwohl die Armeen, denen er einstmals angehört hat, längst Staub und Geschichte sind, hält er sich noch immer wie ein Soldat, während der Mann im Staub – der, wie Radmer jetzt erkennt, mit bloßen Händen Yamswurzeln ausgräbt – die geistesabwesende Ausstrahlung eines Schlafwandlers hat.
Und noch etwas fällt ihm auf: Der Blick des Mannes wandert langsam hin und her, richtet sich aufs Haus, den Wald, den weichen Boden, das Meer. Ein wenig länger verweilt er auf der fernen Messingkugel und auf Radmer selbst – Störenfriede in der gewohnten Umgebung. Aber eigentlich nimmt er sie gar nicht richtig wahr. Er sieht sie nicht. Oder vielmehr, er sieht sie schon, verarbeitet das Gesehene aber nicht. Er zeigt nicht die geringste Reaktion.
In jeder Hand zwei kleine Yamswurzeln, richtet der alte Mann sich auf und geht – ohne zu humpeln oder zu schlurfen – auf das kleine Haus zu. Radmer folgt ihm.
»De Towaji, Sir. Sire. Ich muss mit Ihnen sprechen.«
Der alte Mann bleibt stehen, wirft einen umwölkten, besorgten Blick über die Schulter und geht dann weiter.
Von diesem Zustand hat Radmer bereits gehört: neurosensorische Dystrophie. Aufgrund sich ständig wiederholender Stimulation werden im Gehirn bestimmte Pfade ausgetreten. Wenn das Nervensystem alt ist und die tägliche Routine über Jahre oder Jahrzehnte hinweg gleich bleibt, kann sich der Betreffende darin verfangen. Radmer hat schon von Ehepaaren oder ganzen Dörfern gehört, die davon befallen waren, doch zumeist trifft es allein lebende Personen – zumal solche in abgelegenen Gegenden.
Er stellt sich vor, wie Bruno de Towaji Tag für Tag die gleichen Tätigkeiten verrichtet, mit wenigen oder gar keinen Variationen. Wie ein wiederbelebtes Fossil. Wie ein Gespenst, das hier umgeht und nicht weiß, dass es längst dem Totenreich angehört.
Die gute Nachricht ist, dass diese Symptome nur vorübergehender Natur sind und allmählich vergehen, sobald die Routine unterbrochen wird. Das Erscheinen eines Besuchers reicht normalerweise schon aus. Da er die Wundererscheinungen jedoch partout nicht wahrhaben will, muss de Towaji schon sehr lange auf dem Planetchen wohnen – viel länger, als Radmer sich vorstellen mag. Ganze Geschichtsepochen haben unterdessen begonnen und geendet, eine unvorstellbare Zeitspanne ist verstrichen.
Radmer schreitet durch den Schatten überhängender Äste, und dann betritt der alte Mann das Haus durch einen offenen Durchgang, der so aussieht, als hätte sich noch nie eine Tür oder auch nur ein Vorhang darin befunden. Wahrscheinlich gibt es hier keinen Winter, vielleicht sogar überhaupt keine nennenswerten Wetteränderungen. Rigby könnte das bestätigen. Gleichwohl strahlt das nach allen Seiten offene Haus etwas verstörend Primitives aus.
Im Innern gibt es einen einzigen überraschend sauberen Raum, der von einem Springbrunnen beherrscht wird, der wie die Wände und der Boden aus W-Stein-Marmor besteht. An dem Brunnen kniet de Towaji wieder nieder und wäscht geduldig die vier Yamswurzeln.
Radmer versucht es erneut. »Ich nehme an, Sie können mich hören, Sire. Vielleicht erinnern Sie sich noch an einen Architekten mit Namen Mursk? Conrad Mursk? Vor langer Zeit haben wir einmal zusammengearbeitet. Zuvor war ich mit Ihrem Sohn befreundet.«
Als die Wurzeln sauber sind, legt de Towaji sie auf den Boden und tritt dann in eine Ecke des Zimmers, wo auf einem kleinen Bord ein Haufen kleiner Steine liegt. Feuersteine? Um ein Kochfeuer zu entzünden? Mit dem Verzehr von ungekochten Yamswurzeln hätte sich der arme Kerl bestimmt schon längst den letzten Rest Verstand ruiniert. Nach einer Weile dreht er sich zum Ausgang um und setzt sich zielstrebig in Bewegung. Als Radmer ihm den Weg verstellt, prallt de Towaji gegen ihn.
Er blinzelt und mustert den Besucher von oben bis unten.
»Sire«, sagt Radmer.
Der alte Mann nickt bedächtig. »Ah. Ah. Ich … kenne Sie.«
»Ja, Sire.«
»Mursk.«
»Ja, Sire. Ausgezeichnet.«
»Der Architekt. Sie … haben den Mond zerbrochen. Ihn zusammengequetscht.«
Radmer blickt sich zu der halbkreisförmigen Mondscheibe am Himmel um. Die Wolken, die Kontinente, die blauen Tupfen der Meere … Aber das ist keine Landkarte. Das ist die Welt, betrachtet aus einer Höhe von fünfzigtausend Kilometern. »Wir haben ihn gemeinsam zerbrochen. Vor langer Zeit.«
Knurrig: »Sie … Sie stehen mir im Weg.«
Radmer bringt es nicht fertig, den Ausgang noch länger zu versperren. Mit einer Verneigung tritt er beiseite und lässt de Towaji durch. Sogleich bessert sich die Stimmung des alten Mannes.
»Verzeihen Sie, Sire. Ich weiß nicht, ob ich Sie rette oder entweihe … Verzeihen Sie! Sire!«
Ungeduld ist selten bei den Älteren, doch als ihm klar wird, dass de Towaji ihn erneut ignorieren will, wird Radmer von eben dieser Regung erfasst und wagt es, seinen früheren Auftraggeber beim Arm zu fassen.
»Bruno! Ich habe nur wenig Zeit. Nehmen Sie sich zusammen und hören Sie mir zu: Ihrem zerbrochenen Mond droht Unheil. Seine Zukunft ist in großer Gefahr.«
Der alte Mann runzelt die Stirn; kein königliches Stirnrunzeln, das offizielles Missfallen kundtun soll, sondern Ausdruck ganz privaten und unbewussten Unbehagens.
»Zukunft«, sagt der alte Mann versonnen, vielleicht wiederholt er auch nur das Gehörte. »Ich erinnere mich an dieses Wort. Wo ist die Zukunft? Wann wird sie eintreten?«
»Ich fürchte, gar nicht mehr, Sire.«
De Towajis Blick wird etwas klarer, und ein Schatten schmerzlicher Belustigung legt sich auf sein Gesicht. Er spricht ganz langsam. »Mann, ich garantiere Ihnen, Sie irren sich. Alle diese … Zukünfte, die wir zu gestalten glaubten. Wo sind sie geblieben? Das hier ist Vergangenheit, sobald ich es ausgesprochen habe.« Er hält kurz inne, dann fügt er hinzu: »Es gibt keine Zukunft, nur Vergangenheit.«
Radmer ist jetzt richtig erbost. »Ich bin nicht hergekommen, um mich mit Ihnen über Semantik zu streiten, Sire. Während wir hier miteinander reden, sterben Menschen, und andere werden versklavt. Millionen Menschenleben stehen auf dem Spiel, und es wäre in höchstem Maße schändlich, wenn wir zuließen, dass dies Vergangenheit wird, obwohl es in unserer Macht steht, es zu verhindern.«
Radmer ist jetzt richtig erbost. »Ich bin nicht hergekommen, um mich mit Ihnen über Semantik zu streiten, Sire. Während wir hier miteinander reden, sterben Menschen, und andere werden versklavt. Millionen Menschenleben stehen auf dem Spiel, und es wäre in höchstem Maße schändlich, wenn wir zuließen, dass dies Vergangenheit wird, obwohl es in unserer Macht steht, es zu verhindern.«
Bruno versucht, sich von ihm zu lösen. »Ich bin auch schon Vergangenheit, Mann. Lassen Sie mich in Ruhe.« Und noch einmal, in herrischerem Ton: »Lassen Sie mich in Ruhe.«
»Nein«, sagt Radmer. »Noch nicht – erst wenn Sie mich angehört haben.«
Brunos Widerstand lässt nach; de Towaji wird von einer Art verbitterter Ruhe erfasst. Ja, er wacht auf, und es gefällt ihm nicht. Der Ausdruck seiner Augen ist leicht zu deuten: Angst davor, wieder gebraucht zu werden, das Joch der Verantwortung auf sich zu laden, nachdem er so lange davon frei gewesen ist. Auf einmal wird Radmer klar, dass hinter der Isolation und der Senilität des alten Mannes Absicht steht.
Sein Griff wird fester, und seine Stimme klingt beinahe grausam: »Selbst wenn Sie schon tot wären, würde ich Sie zwingen, mich anzuhören, Sire. Denn ich glaube, Sie können uns helfen, und es ist mir gleichgültig, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Sie uns freiwillig helfen werden, wenn Sie erst einmal wissen, welche Gefahr uns droht.«
»Das ist höchst unwahrscheinlich. Sie haben ja keine Ahnung, wie müde ich war, als ich an diesen Strand gespült wurde, Mann. Nicht die geringste Ahnung.«
Gepresst: »Ich glaube doch, Sire. Auch ich wurde zu Zeiten stark in Anspruch genommen. Und trotzdem leben wir beide noch, nicht wahr? Man ist nie zu alt, um behelligt und um Blut und Schweiß angegangen, entstaubt und auf die eine oder andere Art wieder in Gebrauch genommen zu werden. Für solche wie uns gibt es keine Grabesruhe. Die Alternative – ohne Sinn und Zweck weiterzuleben – ist abstoßend und obszön.«
Bruno de Towajis Zorn entspricht nun Radmers Empörung, und er erwidert dessen Blick. »Ach, glauben Sie? Sie selbstgefälliges Arschloch. Also, sagen Sie mir, welche Gefahr droht, und dann gehen Sie mir gefälligst aus den Augen.«
Radmer tut wie geheißen und genießt die grimmige Genugtuung, zu beobachten, wie sich das Gesicht des alten Mannes jäh belebt. Verblüffung, rechtschaffener Zorn und sogar Angst spiegeln sich darin.
De Towaji ist jetzt hellwach. Blinzelnd mustert er Radmer von oben bis unten. »Lune, sagten Sie? Das Kollapsitergitter gibt es nicht mehr. Träume ich etwa? Wir betreiben keine Raumfahrt mehr. Wie sind Sie dann hierher gekommen, Mann? Und … wie wollen Sie zurückfliegen?«
Radmer verspürt ein Zucken in den Mundwinkeln. Das Wiedersehen mit Bruno hat zahlreiche Erinnerungen und viel alten Kummer geweckt. Im Nachhinein meint er, seine Beziehung zu dem Mann andeutungsweise zu verstehen, doch die ist vor langer Zeit entstanden und längst wieder zerbrochen, im Laufe von Ereignissen, die so gewaltig waren, dass sie von innen heraus betrachtet wie ein Klacks erschienen. Spritztouren und groteske Auseinandersetzungen, das vitale Feuer der Jugend.
Diese Frage aber ist allzu praktischer Natur für einen Mann, der in Ruhe gelassen werden will. Radmer spürt, dass eine Hürde genommen und eine neue Abfolge von Ereignissen in Gang gesetzt wurde. Er wird diesen Mann mitsamt seinem Intellekt und seinem Erfahrungsschatz an selbst erlebter Geschichte mitnehmen. Auf einmal verspürt er zum ersten Mal seit Monaten wieder Hoffnung.
Das ist eine Insel mit Vögeln und Bäumen. Die Insel ist ein Berg mitten im Meer. Ein anderer Mensch lebt dort, jedoch nicht ich. Ich will da nicht leben, mitten im Meer.1
›Die Insel‹
Bascal Edward de Towaji Lutui, im Alter von 4 Jahren
2. KAPITEL
Freundschaftslager
Conrad hatte eine so aufgebrachte Meute noch nie gesehen, geschweige denn von einer angehört. Wie eine Meereswoge bot sie anscheinend nur zwei Alternativen: Entweder man ließ sich fortspülen, oder man wurde zerschmettert. Und um ehrlich zu sein, machte es Spaß, sich fortspülen zu lassen. Seit ihnen beim Sturm aufs Bootshaus Kanupaddel in die Hände gefallen waren, hatten die Berater richtig Angst.
Vor einem Haufen sechzehn- bis siebzehnjähriger Halbstarker! Kaum den Windeln entwachsen, könnte man sagen, doch selbst Dengle, der Fels, war im Rückzug begriffen, und die tief stehende künstliche Miniatursonne warf einen besorgniserregend breiten Schatten auf die Lehm-und-Holzwand des Hauses für Handwerkliche Fertigkeiten und Scheiße.
»Was, zum Teufel, habt ihr Jungs eigentlich vor?«, wollte Dengle wissen.
»Wir randalieren«, antwortete Bascal leichthin. Seine Bemerkung brachte ihm schallendes Gelächter ein, und Conrad lachte nicht minder laut als die anderen. »Prinz Bascal! Heil Prinz Bascal, dem Befreier!«
»Das ist ein Sommerlager«, erklärte der Fels. »Es dient der Erholung. Ihr seid hier, um Spaß zu haben, nicht wahr?«
»Davon haben wir genug«, erwiderte Bascal. Bascal Edward de Towaji Lutui, Kronprinz des Königinreiches Sol.
Die schlimmeren Jungs – Steve Grush und dieser Ho, dessen Nachname ›Ng‹ geschrieben, aber eher wie ›Eh‹ ausgesprochen wurde – standen zur Linken des Felsens, schnippten Zigarettenstummel weg und johlten, und das konnte er nun wirklich nicht mehr ignorieren.
»Habe ich jemanden verletzt?«, wollte der Fels wissen. Dazu fähig war er gewiss – kräftig und angesäuert, aber beherrscht. Sich um die ›Problemjungs‹ zu kümmern war sein Job.
»Haben wir Sie verletzt?«, entgegnete Ho Ng und versetzte ihm mit dem Paddel eins auf den Schädel. Jedenfalls versuchte er es; der Fels wehrte den Hieb mit dem Arm ab. Da er Steve damit Gelegenheit gab, ihm auf die Eier zu hauen, war ihm damit nicht unbedingt geholfen. Mit einer Art Quaklaut krümmte sich der Fels zusammen, blieb aber auf den Beinen. Sich um fünfzehn Problemjungs auf einmal zu kümmern, überforderte ihn offenbar.
Es war toll, einen Großen so erniedrigt zu sehen, aber es war nicht auszuschließen, dass Ho oder Steve ihn abermals schlagen wollten, noch fester als zuvor, und das machte Conrad Angst, denn er fürchtete die Folgen. Außerdem schämte er sich, zu der Meute zu gehören, denn Dengle der Fels war eigentlich gar nicht so übel, jedenfalls was Gefängniswärter betraf. Er hielt sich an die Regeln, ohne einen als Kind zu behandeln, und das konnte man von den wenigsten sagen.
Doch da trat zum Glück Prinz Bascal in die Feuerlinie. »Ruhig, Männer. Wir wollen doch nicht, dass hier jemand verletzt wird. Wir wollen lediglich Zugang zum Faxgate haben.«
»Ohne die Begleitung eurer Eltern oder eines Aufpassers dürft ihr hier nicht weg«, sagte der Fels und versuchte, sich aufzurichten. »So sind die Bestimmungen. Ausnahmen gibt es keine.«
»Heute schon«, sagte Bascal, und Conrad wunderte sich über den lässigen, liebenswürdigen Ton des Jungen, der von Geburt an in der Kunst der Überredung trainiert worden war. Damit würde er den Fels wohl kaum überzeugen – nicht nachdem man ihm mit einem Kanupaddel auf die Eier geschlagen hatte –, doch es gab dem Ganzen einen gewissen Anschein von Legitimität. Als hätte ihre Sichtweise eine gewisse Berechtigung.
Und genau diese Wirkung trat auch ein; schließlich war das hier genau genommen kein Gefängnis, wenngleich die Jungs weder Freizügigkeit genossen, noch für die Dauer ihres Aufenthalts tun und lassen konnten, was sie wollten. Mit zwölf wäre es hier toll gewesen, doch wenn man alt genug war, um sich nach weiblicher Gesellschaft und anderen verbotenen Genüssen zu sehnen, war es ganz schön ätzend. Allerdings gab es niemanden, bei dem sie sich hätten beschweren können, weder Polizisten noch Sozialarbeiter. Hier gab es nur die Beschäftigten des Freundschaftslagers, die das Regiment der Eltern fortsetzten, die sie hierher verbannt hatten.
Und so waren hier in der neunundzwanzigsten Dekade des Königinreiches Sol, auf diesem Miniaturplaneten, der in der Tiefe des Kuipergürtels seinen Orbit beschrieb, junge Männer gezwungen – buchstäblich gezwungen –, die Entbehrungen einer weniger zivilisierten Ära erneut zu durchleben. Deshalb lag es für sie nahe, ebenso unzivilisiert darauf zu reagieren.
»Ihr Jungs steckt in Schwierigkeiten«, mahnte der Fels. Seinem Tonfall nach zu schließen, hatte er ebenso viel Sorge um ihr Wohlergehen wie um sein eigenes. Er würde keinen weiteren Widerstand leisten, denn er konnte unmöglich gewinnen.
Am zwanzig Meter entfernten Horizont materialisierten drei weitere Berater. Den einen hatte Conrad schon mal gesehen, kannte ihn aber nicht näher; er betreute die Jüngeren auf der anderen Seite der Welt. Die anderen beiden waren D’rektor Jed: zwei Faxkopien ein und desselben Individuums, die jeweils den elektrischen Viehtreiber in der Hand hielten, vor dem er häufig warnte.
»Was geht hier vor?«, fragte der eine der beiden scharf. Der andere blickte einfach nur streng. Dass er immer nur zu zweit auftauchte, sagte eine Menge über D’rektor Jed aus, fand Conrad. Fühlte er sich so wohl in seiner eigenen Gesellschaft, oder hatte er lediglich Sorge, das Universum könnte ihm zahlenmäßig überlegen sein?
»Wir fordern ein Ende der Freiheitsberaubung!«, rief Bascal. »Dieser Mann will uns unrechtmäßig in Gewahrsam halten.«
Der D’rektor war so nah, dass Conrad den Schleier der Vorsicht wahrnehmen konnte, der sich auf sein Gesicht legte, als er Bascals Stimme vernahm. Allerdings hatte er offenbar Mühe, den Prinzen in der Gruppe ausfindig zu machen. Vor Beginn des Aufstands hatten sich die Jungs das Gesicht mit Dreck beschmiert und ihr Haar in Unordnung gebracht, einerseits, um sich aufzuputschen, andererseits, um nicht so leicht erkannt zu werden.
»Hoheit«, sagte einer der beiden Jeds, und man meinte sehen zu können, wie er innerlich einen Rückzieher machte und sich eine andere Vorgehensweise zurechtlegte. ›Prinz‹ war ein komisches Wort, ein komischer Begriff; das Kind, das irgendwann regieren würde.
Falls seine Eltern nicht ewig lebten.
Wie behandelte man ein Kind, wie erzog, bestrafte oder belohnte man eine Person, die eines Tages eine viel höhere Stellung als der Erzieher einnehmen würde? Ein kniffliges Unterfangen, aus dessen Schwierigkeit Bascal ständig – und vielleicht sogar mit Absicht – Kapital schlug, jedenfalls hatte Conrad diesen Eindruck.
»Hoheit«, versuchte es der andere Jed, »Sie und Ihre Freunde wurden meiner Obhut anvertraut. Ich werde nicht zögern …«
»Doch, Sie werden zögern!«, schrie Bascal und trat einen großen, symbolischen Schritt auf Jed zu. »Sie werden sogar das Feld räumen, sonst werden meine Gefolgsleute Sie beide bewusstlos schlagen. Das ist kein Witz; sie eskortieren mich, weil ich mich an den Kinderwohlfahrtsdienst wenden will, denn das ist mein gutes Recht.«
Das war Conrad völlig neu; vor drei Minuten hatte es noch geheißen: »Auf, Männer! Zeigen wir’s den Schuften!« Dieses neue Argument aber klang besser, kultivierter. Nahezu legitim.
»Ich habe bereits Alarm ausgelöst«, erklärte Jed. »Ihr habt es nicht nur mit mir zu tun, denn von jedem Berater auf diesem Planetchen gibt es mehrere Kopien. Außerdem noch den Geheimdienst und die Königliche Polizei.«
»Ja«, sagte Bascal, »zehn Flugstunden von hier entfernt.« Das entsprach einer Reise mit Lichtgeschwindigkeit von hier ins eigentliche Königinreich.
»Das Faxgate wird von Ihrer eigenen Palastwache geschützt. Man wird Sie nicht durchlassen.«
»Das wird auch gar nicht nötig sein«, erwiderte Bascal. Er warf einen Blick auf Dengle, den Fels, der sich noch immer heldenhaft bemühte, aufrecht zu stehen. »Es ist bereits zu einem bedauerlichen Zwischenfall gekommen, und wir sind auf weitere Vorkommnisse gefasst, sollten Sie uns in die Quere kommen. Meine Leibwächter beobachten uns, das können Sie mir glauben, und Ihre Sicherheit bedeutet ihnen nur wenig.«
»Blasen Sie den Alarm ab«, empfahl der Fels, sich auf Bascals Seite stellend. »Lassen Sie sie ins Büro. Wir haben nicht genug Leute, und wenn sie die Wohlfahrt anrufen wollen, sollen sie das meinetwegen tun. Wir haben nichts zu verbergen. Die Eltern sollten davon erfahren.«
D’rektor Jed schwieg, doch als die Jungs sich geschlossen Richtung Büro in Bewegung setzten, versuchte er nicht, sie aufzuhalten. Sie gingen schnurstracks an ihm vorbei und verschwanden am Horizont, hinter dem gerade die Sonne unterging. So war das eben auf kleinen Planeten; die Tageszeiten waren Orte, die zu Fuß erreichbar waren. Hier funkelten die Sterne, als wollte Gott persönlich ihnen seine Entlastung aussprechen.
Das Büro ähnelte besonders im Dunkeln eher einem Blockhaus. Doch es war größer, und der aus den Fenstern strömende Lichtschein stammte von einer richtigen W-Stein-Decke. Hier gab es keine einzige beschissene Glühbirne. Und als sie die Tür geöffnet und sich hineingedrängt hatten, zerstob die Illusion endgültig. Dieser Raum hätte sich überall im Königinreich befinden können – die Toilette hatte doch tatsächlich Wasserspülung, ein weiterer Beleg für die hier herrschende himmelschreiende Ungerechtigkeit.
Das Fax stand im Hinterzimmer, in einer Art Foyer, nur mit dem Fax anstelle der Tür. Im Lager gab es noch weitere Faxgeräte, deren Aktivierung sie vielleicht hätten verlangen können, doch das hier war das einzige, von dem sie wussten, dass es ständig lief, ständig mit dem Neuen Systemweiten Kollapsiternetz, dem N-Syskon, verbunden und somit imstande war, ihre Nachricht – oder womöglich sie selbst – im Bruchteil einer Sekunde von hier fortzuschaffen.
Bedauerlicherweise wurde das Gate wie angekündigt von zwei funkelnden Robots der Palastwache bewacht. Die geschlechtslosen Metallgestalten rührten sich nicht, und die undurchdringlichen Metallaugen blickten ihnen ausdruckslos entgegen. Offenbar hatten sie die Aufgabe, unbefugte Personen daran zu hindern, das Freundschaftslager zu betreten und dem einzigen Prinzen des Königinreiches ein Leid zu tun.
Obwohl, überlegte Conrad, die Faxsoftware eigentlich auch allein hätte in der Lage sein müssen, unerwünschte Übertragungen herauszufiltern. Waren die Wachrobots eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass jemand das System beschädigte? Waren sie Spione der Eltern, die Bascal beaufsichtigen sollten? Jed war offenbar dieser Ansicht, auch wenn der Prinz das anders sah.
Als Leibwächter waren sie jedenfalls ausgesprochen einschüchternd; Conrad hatte nicht den geringsten Zweifel, dass sie in der Lage wären, jederzeit aus dem Raum zu stürzen und in Minutenschnelle jeden beliebigen Ort auf diesem Planetchen zu erreichen. Die Jungs hielten auf Abstand, drängten sich im Vorraum, und nur einige der tapfersten beäugten diese Ungeheuer aus dem ›sicheren‹ Abstand von drei oder vier Metern.
Einzig Bascal schritt völlig unbeeindruckt auf die beiden Robots zu. »Ihr beiden kommt mit. Wir müssen von hier verschwinden – das Planetchen brennt. Beeilung.«
Er trat unmittelbar vors Fax und sagte: »Zum nächsten Notfallzentrum.« Die Robots zögerten kaum merklich; dann drehte sich der eine mit furchteinflößender Geschmeidigkeit und Anmut um, sprang durchs Gate und verschwand in einer Quantenverpuffung.
Der zweite Robot wollte offenbar Bascal den Vortritt lassen. Plötzlich aber hielt Bascal eine kleine, spielzeughaft anmutende Pistole aus blauem Plastik in der Hand und brachte damit den metallisch funkelnden Kopf des Robots zum Verschwinden. Der Robot brach zuckend zusammen. Das Ganze ging völlig sauber und fast geräuschlos vonstatten. Eine Teleportationswaffe?
»Schließ das Gate für ankommende Sendungen«, sagte Bascal zum Fax, dann drehte er sich mit einem zufriedenen Grinsen zu seinen Gefolgsleuten um. »Es gibt nichts, was unsere Eltern an uns weitergeben oder mit uns teilen könnten. Das Einzige, was sie uns beibringen können, ist still zu sitzen, den Mund zu halten und auf ewig in ihrem Schatten zu leben. Es ist ihr Königinreich, nicht wahr? Und das wird es auch bleiben.«
Die Jungs gaben ein zustimmendes Gemurmel von sich. Ihre Eltern waren ebenfalls unsterblich. Vielleicht hatten sie auch schon selbst über dieses Thema nachgedacht: Es gab für sie nichts zu erben, keine Familienhinterlassenschaft, keine Fußstapfen, in die sie hätten treten können. Conrads Vater war der Straßenpflasterer von Cork County und würde es immer sein. Conrad würde sich auf ewig mit dem Titel des Straßenpflastererjungen begnügen müssen.
Und das war ätzend.
Die Coolness des Prinzen war einfach bewundernswert. Als wäre dies alles nur ein Spiel, als könnte er völlig unbehelligt überall hingehen, durch Kugelhagel und ungezähmte Schwarze Löcher hindurch. Man wollte hinter ihm stehen, ja wirklich.
»So«, fuhr Bascal fort, »was haltet ihr davon, wenn wir ein bisschen Randale machen würden? Eine Nacht auf der Erde, wie wär das? Ihr braucht nur einzuschlagen; ich mach’s möglich.«
Conrad war ein sehr impulsiver Mensch – das war auch der Grund, weshalb er hierher verbannt worden war. Zwar wusste er, dass sie irgendwann die Zeche würden zahlen müssen, aber die Vorstellung, Unordnung zu stiften, gefiel ihm sehr. Welchem Siebzehnjährigen hätte sie nicht gefallen?
»Herrgott, Bascal«, sagte er begeistert, »dir würde ich überallhin folgen.«
3. KAPITEL
Die Kuppeln des Popcornmonds
Sie flitzten durch einen Repeater in der Umlaufbahn des Pluto und wurden in ein Ringkollapsitersegment – einen aus kleinen Schwarzen Löchern bestehenden Leiter – eingespeist, in dem das Signal eine Zeitlang mit Überlichtgeschwindigkeit reiste. Planeten, Planetchen und Planetoide rasten unbemerkt vorbei. Damit ging keine subjektive Empfindung einher; die Körper und das Bewusstsein der Jungs – und wenn man so wollte, auch ihre Seelen – waren für die Dauer der Reise auf Quantenwellenpakete reduziert. Dies war das N-Syskon, das Neue Systemweite Kollapsiternetz, das Geistesprodukt von Bascals Vater. Die Reise vom Freundschaftslager im Kuipergürtel bis zur im Innensystem gelegenen Erde nahm für äußere Beobachter je nach Verkehrsdichte und Einstellung der Knoten und Leiter zwischen acht und zehn Stunden in Anspruch. Für die Jungs hingegen – und dieser Betrachtungsweise gab man tunlichst den Vorzug – vollzog sie sich in einem Augenblick, ein Vorgang, der so wenig staunenswert und so trivial war, als trete man durch einen Vorhang hindurch.
Sie hätten auch mehrere Kopien ihrer selbst übertragen und eine ganze Armee ans Ziel befördern können. Sie hätten bestimmte Farben verändern und etwa mit hellblauer oder pinker Haut aus dem Faxgate am Zielort treten können. Sie hätten ihre Köpfe nach hinten ausrichten können. Doch sie taten nichts von alledem und blieben, wie sie waren. In dem Augenblick, den sie im Netz gefangen gewesen waren, hatten keine Veränderungen stattgefunden, außerdem wären sie mit irgendwelchen Mätzchen lediglich an den Filtern hängen geblieben, was Nachforschungen nach sich gezogen hätte.
Auf der anderen Seite des Vorhangs lag Athen. Die Sonne ging gerade auf, und es war heiß. Mit einem weiteren Schritt gelangten sie nach Kalkutta, wo es noch heißer und prachtvoller war und wo gerade ein Monsunregen niederging. Schließlich landeten sie in Denver, wo soeben die Nacht über die sommerlich warme Stadt hereingebrochen war. Die Luft war frisch und angenehm. Plappernd, kichernd und sich gegenseitig knuffend strömten sie in die Market Street Station hinaus. Endlich waren sie frei, und die Nachricht von ihrer Flucht konnte sich nicht schneller verbreitet haben, als sie gereist waren. Es würde eine Weile dauern, bis man nach ihnen suchen würde.
»Ich habe keinen Leibwächter mehr«, sagte der Prinz verwundert. Er drehte sich um und umarmte Conrad, dann tat er das Gleiche mit dem sich windenden Ho Ng. »Ich habe keinen Leibwächter mehr!«
Lachend drehte er sich im Kreis, ohne sich an den erstaunten Blicken der Passanten zu stören.
Eine Reklametafel aus animiertem W-Stein verkündete stolz, dieser Bahnhof sei eins von fünf öffentlichen Faxdepots im Stadtzentrum. Auf einem kleinen Stadtplan waren die Standorte vermerkt, verstreut über einen nierenförmigen Distrikt von ein paar Kilometern Durchmesser. Im Begleittext wurden die Jungs darüber informiert, dass Besitz und Betrieb privater Faxgates in dieser Sperrzone streng verboten sei. Je nach Ziel boten sich ihnen verschiedene Beförderungsoptionen: Sie konnten mit dem Bus fahren (kostenlos), mit dem vollautomatischen Taxi ($), mit der Pferdekutsche oder mit der Hansom ($$), und natürlich konnten sie auch zu Fuß gehen, was in einer kommerziellen Sperrzone von diesem Kaliber das Naheliegendste war.
»Uii«, tat einer der Jungs beeindruckt und unterstrich den Ausruf mit erhobenen, schlaff herabhängenden Händen, was auf die verweichlichte Aristokratie verweisen sollte. Yinebeb Fecre bewies damit einen Sinn für Ironie, dessen er sich wahrscheinlich gar nicht bewusst war: Nach den Maßstäben des Freundschaftslagers war er nämlich selbst ein verweichlichter Aristokrat, der hyperaktive Sohn zweier bekannter TV-Kritiker. Feck die Schwuchtel.
»Halt den Mund«, tadelte ihn Bascal milde. »Denver ist roh. Eine gute Stadt. Du solltest froh sein.«
Conrad kannte die Stadt lediglich vom TV her, doch er war geneigt, Bascal zuzustimmen. Als seine Eltern noch jung gewesen waren, war die fortgeschrittene Technologie wie ein Flächenbombardement über die urbanen Gebiete hereingebrochen und hatte die Landkarten und Landschaften über Nacht umgeschrieben. Viele Städte verwandelten sich in Bienenstöcke adressierbaren Raums, dessen Lokalisierung im Raum nahezu bedeutungslos war. In einigen Fällen verschwanden die Städte ganz oder verwandelten sich in hypothetische Gebilde mit im ganzen Sonnensystem verteilten Außenposten. Denvers Stadtplaner aber hatten die Entwicklung vorausgesehen und diesen Schutzwall ums Zentrum gezogen, um die Stadt vor der Tyrannei der Bequemlichkeit zu schützen. Die Stadt führte nicht nur den Titel Kinderstadt, sondern war auch eine urbane Schutzzone und gehörte zudem dem Netzwerk Lebender Museen an. Ebenso klassisch und ursprünglich wie der Fuck-You-Song und zweimal so hübsch.
Das Terminal lag unterirdisch, ein schummrig erhellter urbaner Raum mit zahlreichen Säulen, Informationskiosken, Snackbars und altmodischen Telefonen, die wahrscheinlich reine Zierde waren. Eine weitere Infotafel – die Buchstaben waren aus irgendeinem Grund aus kleinen roten Leuchtpunkten zusammengesetzt – zeigte die planmäßigen Ausfallzeiten der hier befindlichen Faxgates sowie die Zeitfenster von Breitbandverbindungen zu bestimmten Zielen an: HONOLULU 21:15–21:17 HEUTE. An der Decke waren Zahlenreihen eingraviert, doch zu welchem Zweck, war nicht ersichtlich.
Einige Leute hatten Gepäck dabei – eine Kuriosität in einer Welt, in der Faxgeräte jeden beliebigen Gegenstand in abrufbaren Speichern aufbewahren und nach Bedarf Kopien ausdrucken konnten. In der Menge waren auch noch andere Absonderlichkeiten festzustellen: Einige Menschen wirkten älter oder jünger, als es dem ›alterslosen‹ Schönheitsideal des Königinreiches entsprach. Andere waren seltsam gekleidet oder hatten komische Frisuren. Und natürlich gab es Kinder aller Altersstufen – sie stellten etwa ein Zehntel der Passanten. Die Mischung war interessant, kosmopolitisch und ja, hochgradig roh. Frisch und originell. Was auch immer. Alle aber – und das galt sogar für die Kinder – betrachteten das Erscheinen von fünfzehn Halbwüchsigen mit dreckverschmierten Gesichtern und ohne Begleitung als Vorboten von Ärger. Eine Mutter fasste ihr Kleinkind bei der Hand und zog es schützend an sich heran. Die Reaktionen der anderen fielen weniger deutlich aus, doch auch sie vermochten ihr Misstrauen nur schwer zu verhehlen.
Willkommen in Denver. Halten Sie die Hände so, dass sie gut sichtbar sind.
Conrad warf wilde Blicke um sich und schnappte sogar in die Richtung einer Frau, die ihn anstarrte. Ach Gott, die Zeiten, da Verbrechen sich hin und wieder ausgezahlt hatten, waren jetzt, da die ganze Erde ein einziger gigantischer Sensor war, endgültig vorbei. Selbst dort, wo die Ereignisse nicht explizit in einer W-Stein-Matrix aufgezeichnet wurden, hinterließen sie in den Steinen Quantenspuren oder etwas in der Art – Gespensterbilder. Mit ausreichend Geduld und Rechenkraft ließ sich nahezu jedes Ereignis rekonstruieren.
Ohne die Böswilligkeit ringsumher zu beachten, musterte Bascal den Raum und grinste. »Ich glaube, wir sind am Ziel, Männer.«
Eine Rolltreppe führte zur Straße hoch, und Ho Ng und Steve Grush sprangen auf und ließen sich nach oben tragen, ohne sich nach Bascal und den anderen überhaupt umzusehen. Vielleicht spürte der Prinz, dass seine Führungsrolle bedroht war, denn auch er stürzte zur Rolltreppe und rief: »Vorwärts! Vorwärts!«
Es war nicht schwer, gegen die Fahrtrichtung nach oben zu laufen, doch irgendwie war es ärgerlich, da sich die Gesetze der Schwerkraft gleich doppelt bemerkbar machten. Und die nach unten fahrenden Menschen waren natürlich nicht erfreut über die sich an ihnen vorbeidrängenden Rüpel; trotzdem sagte niemand ein Wort, und es stolperte auch niemand, deshalb kam Bascal kurz nach Ho und Steve oben an. Und neben ihm stand auf einmal wieder Conrad, seine rechte Hand, erfüllt vom Bewusstsein seiner Bedeutung. O ja, hin und wieder im Laufe dieses Sommers, den er im selben Sommerlager wie der Prinz des Solsystems verbracht hatte, war er sich richtig wichtig vorgekommen. Das hier aber war etwas anderes. Es war kein bloßer Zufall. Sie waren tatsächlich Freunde.
»Das ist roh«, sagte er mit vertraulich gesenkter Stimme, und der Prinz schüttelte herausfordernd die Faust. Dabei hielt er sie so, dass nur Conrad sie sehen konnte.
»Bis jemand den pilinisi erkennt. Dann wird’s kompliziert.«
»Hmm.« Conrad konnte nur vielsagend nicken. ›Pilinisi‹ war das tonganische Wort für ›Prinz‹, und er wusste – oder meinte zu wissen –, welche Bedeutung der Titel für Bascals Leben hatte. Einerseits hatte er sich bestimmt nicht über Frauenmangel zu beklagen, andererseits gab es für ihn wohl auch kein Privatleben. Alle meinten, ihn zu kennen, obwohl das auf fast niemanden zutraf. Andererseits hatte der zerzauste Junge aus dem Sommerlager, der in Hemd und Kniehosen rumlief, nicht viel Ähnlichkeit mit dem Bascal Edward, den man aus dem TV kannte.
Auf der Straßenebene öffnete sich in der Glaswand des Terminals eine kreisförmige, irisblendenartige Tür. Die Luft im Freien war perfekt: sommerlich warm, aber erfrischend und kein bisschen schwül. Es roch nach Essbarem: nach Knoblauch und frisch gebackenem Brot. Vielleicht wurde irgendwo in der Nähe auch Popcorn zubereitet. Die betoneingefassten Gehsteige hatten eine Oberfläche aus echtem Stein – das merkte man an der rauen Oberfläche, die ganz anders war als eine W-Stein-Emulation.
Und da waren sie nun: an der Sixteenth Street Mall der Mile High City, der Meilenhohen Stadt, wie Denver auch genannt wurde, eine nahezu mythische Adresse. Das Zentrum des Ursprünglichen. Ein paar Blocks im Osten lag die Self Similar Street, wo noch immer allwöchentlich die Puppet Show aufgezeichnet wurde. Irgendwo im Süden lag der Cola Dome, in dem noch immer die Broncos, Avalanche und die Nuggets spielten, wo Konzerte stattfanden und Paintball-Schlachten tobten. Auf den Straßen war, wie angekündigt, tatsächlich Verkehr: weiße Busse und gelb-schwarze Taxis, Lieferwagen und Pferdekutschen. Es gab auch ziemlich viele Fahrräder, auf denen allerdings keine Kinder saßen, sondern ernsthaft wirkende Erwachsene, bekleidet mit stoßfestem W-Stein-Stoff. Auch Rikschas waren zu sehen, die von Liliputanern gezogen wurden, was Conrad ausgesprochen merkwürdig vorkam: Woher kamen die Liliputaner in diesem Zeitalter der perfekten Gesundheit?
Die belebten Gehsteige waren voller Hindernisse, denen die Fußgänger geschickt auswichen. Dies war eine Stadt der Pfosten und Podeste, der Säulen und Obelisken. Ein Springbrunnen plätscherte munter vor sich hin. Überall standen kleine Bäume – Ahornbäume, Pappeln und sogar Akazien, alle nicht mehr als vier oder fünf Meter hoch. Die ringsumher aufragenden Wolkenkratzer hingegen, welche die Sicht begrenzten, waren alles andere als klein. Erst als Bascal um eine Ecke auf die Sixteenth Street einbog, sahen sie die Berge, die dunkel über dem Sonnenuntergang dräuten, von Wolken verschleiert, die Hänge mit Häusern bedeckt. Allerdings waren die Berge entweder kleiner, als Conrad erwartet hatte, oder sie waren weiter entfernt. Im rotgoldenen Widerschein der Wolken war das schwer zu sagen. In diese Richtung aber führte Bascal die Gruppe: weg von den Wolkenkratzern, dem Sonnenuntergang entgegen.
Johlend stürmten die Jungs durch die Stadt, Blätter abreißend, um sich tretend, über Bänke hinwegsetzend und Passanten anrempelnd. Dagegen gab es kein Gesetz, und es war ein wirklich tolles Gefühl. Gleichwohl vermochte Conrad die eindrucksvollen Gebäude nicht ganz zu ignorieren. Das war eines der wenigen Gebiete, die ihn interessierten und auf denen er gut war: die Geschichte des Bauens und die Geschichte der Bauwerke an sich. Hier war diese Geschichte auf die Wände geschrieben, abgelagert wie in geologischen Gesteinsformationen.
»Sieh dir mal den Gehsteig an«, sagte er zu Bascal. Als der nicht reagierte, versuchte er es erneut: »Sieh dir mal diese Wand an. Ist das Backstein? Sieht aus wie Backstein.«
»Kann schon sein«, entgegnete Bascal, nicht spöttisch aber auch nicht gerade begeistert. Das Thema interessierte ihn einfach nicht.
Conrad wandte sich an Yinebeb Fecre. »Du studierst doch Architektur, nicht wahr Fecre?«
Fecre wedelte wieder sarkastisch mit den Händen. »O je, Architektur!«
Na gut, dann kam das Thema also nicht an. Trotzdem fand er es wichtig – zumal hier. Es gab genau zwei Fächer, in denen Conrad im letzten Jahr nicht versagt hatte: Architektur und Materieprogrammierung. Seine Besessenheit für diese beiden Gebiete ärgerte die Lehrer beinahe ebenso sehr wie die mürrische Apathie, die er den anderen Fächern entgegenbrachte. Lediglich das Fach Geschichte hatte ein wenig Interesse bei ihm wecken können, und das auch nur deshalb, weil diesmal die Lichtkriege dran gewesen waren, das erste Mal in der Geschichte, da Architektur und Materieprogrammierung zusammenfanden.
Hätte er nicht auf Mrs. Reglands Stuhl gespuckt und Mr. O’Hara als Schweineficker beschimpft, weil der ihn festgehalten hatte, hätte er vielleicht sogar noch mehr gelernt. Das Wissen, das er sich erworben hatte, faszinierte ihn jedoch: der Moment, da der W-Stein – die programmierbare Materie – Eingang in die alten Republiken gefunden hatte und die Lichtkriege ausgebrochen waren. Ohne die geringste Verzögerung, ohne jede Zurückhaltung. Welche Anarchie: Gebäude, die gierig Umgebungsenergie aufsaugten und Prozesswärme abgaben, das Auge mit Superreflektoren und Superabsorbern, mit blinkenden Lichtern, magnetischen Feldern und mit den Blitzen der kabellosen Kommunikationslaser beleidigten. Es war viel billiger, die benötigte Energie der Umgebung zu entziehen, als sie im Netz zu kaufen, deshalb warf man alle ästhetischen Bedenken sowie jede Rücksichtnahme auf das Wohlergehen und bis zu einem gewissen Maß auch die Sicherheit der Passanten über Bord. Wenn man mit einer schwarzen Oberfläche quasi jedes einzelne auftreffende Photon aufsaugte, hatte man so viel elektrischen Strom zur Verfügung, wie man wollte. Wenn man mit einem perfekten Spiegel die Wärme auf die bedauernswerten Nachbarn abstrahlte, hatte man selbst es schön kühl. War man schlau und rücksichtslos, konnte man beides gleichzeitig bewerkstelligen: jeden Schatten vertiefen und noch das kleinste bisschen Helligkeit zum eigenen Nutzen verstärken.
Dieser Schlag traf die Städte weniger schwer als die zwanzig Jahre zurückliegenden Faxkriege, doch die Wunden blieben auch dann noch sichtbar, als nach der Gründung des Königinreiches die Architekturerlasse durchgepeitscht wurden. Hier in Denver sah man auf den ersten Blick, in welcher Dekade das jeweilige Gebäude erbaut worden war. Hier stand ein alter Bau aus Stahlbeton, bei dem der W-Stein lediglich Fassade war. Dort ein Gebäude aus reinem W-Stein, das vom Druck der Elektronen in den Quantendots stabilisiert wurde. (Als Conrad zum ersten Mal davon hörte, kam ihm die ganze Idee blöd vor –was würde passieren, wenn der Strom ausfiel? –, doch bislang war es seines Wissens noch nie vorgekommen, dass eines dieser eigennützigen Gebäude in sich zusammengekracht wäre oder sich aufgelöst hätte. Offenbar waren irgendwelche Sicherungen eingebaut.) Die Mehrheit der Gebäude stammte aus der Zeit des Königinreichs: Rahmen und Böden waren aus Diamant, die Verkleidung und die Fassade aus W-Stein. Doch selbst diese Bauten waren eher unauffällig und wirkten eher so, als wären sie mehr oder minder aus natürlichen Materialien erbaut.
Wie die meisten großen Städte hatte sich auch Denver so weit zurückentwickelt, dass es einer Stadt vom Ende des einundzwanzigsten Jahrhunderts ähnelte. Stein, Metall und Silikatglas waren vorherrschend. Die Leuchttafeln sahen aus, als würden sie von Neongas, Quecksilberdampf oder elektroluminiszierenden Dioden erhellt. Als es dunkler wurde und sich die Straßenbeleuchtung einschaltete, bemerkte Conrad voller Genugtuung, dass sie Gaslampen simulierte. Hatte es im einundzwanzigsten Jahrhundert Gaslampen gegeben? Selbst wenn dem nicht so gewesen sein sollte, es sah jedenfalls klasse aus!
Während die Jungs weiter nach Westen gingen, kam hinter einem der Türme auf einmal der Vollmond in Sicht.
»A-uuuh!«, machte Peter Kolb und zeigte darauf.
Bascal drehte sich und breitete die Arme aus. »Ah, das ist mal ein Mond. Ein Julimond, um genau zu sein. Der Bockmond. Und wir, meine Freunde, sind die jungen Böcke, die in die Welt hinausziehen. Mögen die Menschen in den Mondkuppeln verwundert auf uns herabschauen. Die Nacht gehört uns.«
»Bockmond? Was soll das heißen?«, fragte jemand.
»Das steht im Flottenalmanach«, antwortete Bascal.
Feck räusperte sich. »Also, die Bezeichnung stammt von den Algonquin.«
Conrad wandte sich ihm zu. »Hä?«
»Ein nordamerikanischer Indianerstamm. Sehr alt, aber er existiert noch, weißt du. Ihr Gebiet ist fast so groß wie die Gesamtfläche der tonganischen Inseln. Und es umfasst beinahe ebenso viele Menschen.«
Jetzt waren alle Augen auf Feck gerichtet, und selbst im Laternenlicht war zu erkennen, wie er errötete.
Bascal wirkte überrascht. »Feck! Du weißt doch nie was, oder? Peter weiß was; er ist der Sohn von Laureaten. Conrad glaubt, etwas zu wissen, obwohl er nach meinem Dafürhalten ein Hurensohn ist. Aber du? Ah, warte mal, jetzt wird mir etwas klar: Du hast eine besondere Beziehung zu dem Stamm. Sag nichts! Du bist, lass mal sehen …« Eine Weile musterte er Fecks Gesicht. »Du bist ein Achtelblut.«
»Ein Viertel«, sagte Feck. »Aber kein Algonquin, sondern ein Chippewa. Das ist der Nachbarstamm. Wir sagen dazu Himbeermond.«
»Ah! Du bist ja praktisch ein Eingeborenenführer! Das hab ich ja gar nicht gewusst.«
»Ich war noch nie in Nordamerika«, sagte Feck. »Außerdem lebten hier die Kiowa oder die Lakota. Für die ist das der Pferdemond.«
»Wir werden dem Pferd schon die Sporen geben«, erwiderte Bascal vergnügt, »und den braven Bürgern von Denver eine große, dicke Himbeere verpassen. Gibt’s noch weitere Monde, die wir kennen sollten?«
Feck kratzte sich am Ohr, denn es war ihm unangenehm, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Der Fußgängerverkehr war versiegt; die Jungs waren in der Pfütze Lampenschein praktisch allein. »Äh … der Maismond? Oder vielleicht heißt es auch Popcornmond. Und dann gibt es noch den Raubvogel-, den Donner- und den Blutmond.«
»Wow. Ist ja roh. Das gefällt mir. Wir werden schreien wie die Adler und eine Spur von Donner und Blut hinter uns lassen. Und Himbeerpopcorn! Eigentlich ist das blöd. Aber jedenfalls ist die Stadt unser, und ich würde sagen, wir genehmigen uns einen Happen davon.«
Ah, der Dichterprinz. Conrad schnaubte leise.
Ho und Steve wechselten unbeeindruckt einen Blick, dann drehten sie sich um und gingen weiter Richtung Sonnenuntergang. Und wie zuvor sah Bascal sich auch diesmal wieder genötigt, ihnen zu folgen, um sich weiterhin Geltung zu verschaffen. Er drängte sich zwischen sie, stützte die Ellbogen auf ihre Schultern und grinste sie von der Seite an.
»Wisst ihr«, sagte er, »ein Denkmalschutzgebiet wie das hier basiert auf der sogenannten Dienstleistungsökonomie. Man läuft in der Gegend rum und sieht sich die Sachen in den Auslagen an, und wenn einem irgendwas gefällt, machen die Geschäfte einem eine Kopie davon oder faxen sie nach Hause. Oder man sitzt in einem Restaurant und bestellt leckere Sachen aus einer sehr beschränkten Speisekarte. Dabei gibt es ein bestimmtes Thema. Man zahlt hier für die Atmosphäre – weil hier nämlich das Aussehen, der Geruch und alles zusammenpassen.«
»Äh … ja«, brummte Ho unbehaglich. Er war sich bewusst, dass eine Erwiderung von ihm erwartet wurde, irgendein Vorschlag. Aber er war einfach nur saudumm.
Steve Grush duckte sich unter Bascals Ellbogen weg, und Ho tat es ihm nach, und dann traten die beiden Schlingel ein Stück zur Seite und musterten den Prinzen abschätzend. Offenbar ging es um einen unausgesprochenen Machtkampf. Allerdings hatten sie nicht die geringste Siegeschance; da es ihnen sowohl an Worten wie an Tatkraft mangelte, ließ Ho Bascal schließlich achselzuckend den Vortritt.
»Du weißt bestimmt, wo wir hinwollen. Sire.«
Sire! Conrad fragte sich unwillkürlich, ob dieser Trick erlernbar war, ob Bascal ihn vielleicht von seinen Lehrern hatte. Eigentlich hatte er überhaupt nichts getan – vielleicht war es ja genetisch verankert, eine Art Pheromonsignatur, die andere umso unterwürfiger werden ließ, je näher er ihnen kam. War das möglich? Wenn ja, wäre es einleuchtend, dass Ihre Majestäten ihrem Sohn jeden nur erdenklichen Vorteil einräumen würden. Aber vielleicht reichte es ja schon, einfach nur Prinz zu sein; Ho konnte ihn nicht einfach zusammenschlagen, denn dann hätten sich alle für ihn eingesetzt. Plötzlich empfand Conrad überwältigenden Stolz auf und Zuneigung zu seinem persönlichen Monarchen, und ihm kam der Gedanke, dass er so lange, wie er an Bascals Seite stand, niemals auf einen solchen Trick angewiesen sein würde. Das war schon die ganze Führerschaft, die sie brauchten. Schließlich ging es bei einem Königinreich ja eben darum, nicht wahr? Um das Bedürfnis, jemandem zu folgen und die lästige Bürde der persönlichen Verantwortung abzuwerfen, und sei es nur symbolisch. Galionsfiguren, genau: Sie tun so, als würden sie uns führen, und wir tun so, als würden wir ihnen folgen. Was sind wir doch für geschickte Heuchler.
Bascal ging einen Block weit nach links, zwischen einer Reihe von Gebäuden hindurch, die tatsächlich aus Backstein erbaut waren. (Obwohl das eigentlich unglaublich war. Konnte da nicht etwas herabfallen und jemanden erschlagen?)
»Wo wollen wir eigentlich hin?«, fragte Conrad mit vertraulich gesenkter Stimme, aber laut genug, dass die anderen Jungs es mitbekamen. Damit ihr’s nur wisst, ich unterhalte mich vertraulich mit eurem Prinzen!